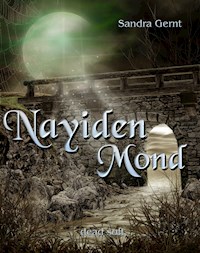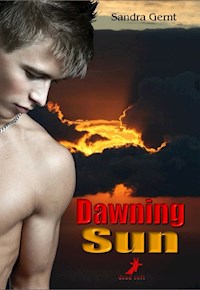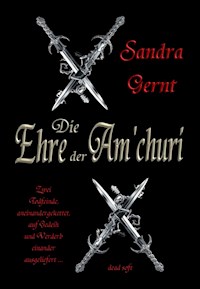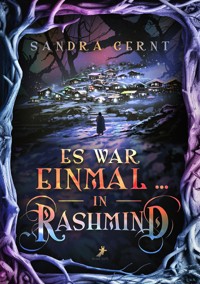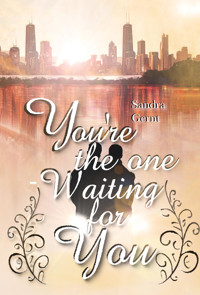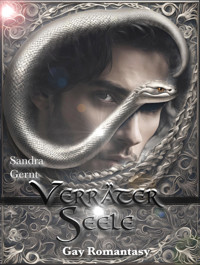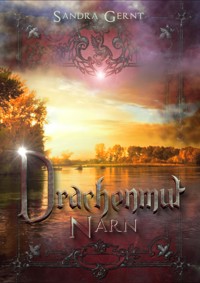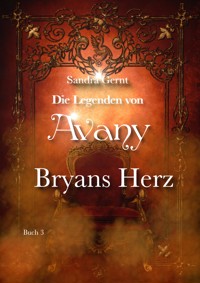4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als ein schreckliches Verbrechen verübt wird, fällt der Verdacht auf den achtzehnjährigen Kevin. Und auch wenn seine Unschuld rasch feststeht, hört sein Schulkamerad Daniel nicht auf, ihn zu verfolgen. Dann geschieht ein Unglück, und ihr Leben wird komplett durcheinandergewirbelt … Ca. 53.500 Wörter Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte ungefähr 260 Seiten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Als ein schreckliches Verbrechen verübt wird, fällt der Verdacht auf den achtzehnjährigen Kevin. Und auch wenn seine Unschuld rasch feststeht, hört sein Schulkamerad Daniel nicht auf, ihn zu verfolgen.
Dann geschieht ein Unglück, und ihr Leben wird komplett durcheinandergewirbelt …
Ca. 53.500 Wörter
Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte ungefähr 260 Seiten
Like an avalanche
- Wie eine Lawine
von
Sandra Gernt
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Epilog
Kapitel 1
„Weißt du schon das Neueste?“
„Nee.“
„Celina geht jetzt mit dem Aaron aus der 9b.“
„NEE!“
„Wenn ich’s dir doch sage!“
„Du meinst unsere Celina, ja? Zwölfte Klasse und so. Was will die mit diesem kleinen Jungen?“
„Woher soll ich das wissen?“
„Echt widerlich … Und dann noch dieser bescheuerte Name. ÄÄHRRÄNN.“
„Kann er ja auch nix für. Bescheuerte Hartz IV-Eltern halt mit Amerika-Tick.“
„Hast ja Recht. Trotzdem finde ich …“
Kevin atmete erleichtert auf, als Bettina, Sophie-Marie und Natasha außer Hörweite waren. Die drei Mädels waren in seinem Jahrgang und auch wenn sie hinsichtlich Lästereien nicht schlimmer waren als alle anderen, fühlte er sich von ihnen am stärksten bedroht. Sie waren nämlich durchaus intelligenter als quasi alle anderen Schüler. Volle Punktzahl in jeder Klausur war Mindeststandard und sie hingen bereits seit der fünften Klasse zusammen. Ein eingespieltes Team mit scharfem Blick für die Unzulänglichkeiten ihrer Mitmenschen.
Zum Glück beachteten sie ihn nicht weiter, wie üblich. Er war schließlich auch das Opfer bescheuerter Hartz IV-Eltern mit Amerika-Tick … Du meine Güte, es war ein vollkommen normaler Name, was sollte das Gehacke auf die Namensgebung eigentlich immer? Und Aaron war noch nicht einmal ein typisch englischer Name.
Wenn sie ihn wahrnehmen würden, könnten sie sein Geheimnis in zwei Wimperschlägen herausfinden, da machte er sich keine Illusionen. Seine Homosexualität stand ihm zwar nicht auf die Stirn geschrieben, er trug keine Mädchenklamotten, schminkte sich nicht, näselte nicht affektiert herum oder spreizte den kleinen Finger ab, sobald er einen Becher in die Hand nahm. Aber er las gerne und viel, spielte kein Fußball oder betrieb andere männliche Sportarten, war für seine achtzehn ziemlich schlaksig und ein bisschen klein im Vergleich zu anderen Jungs aus dem zwölften Jahrgang, er war gut in Kunst und, last but not least, er hatte keine Freundin. Er konnte sich Sophie-Maries schrilles Lachen lebhaft vorstellen, wenn ihre Busenfreundin Natasha loslegen würde:
„Wisst ihr schon das Neueste? Der Kevin – yupp, der kleine Blonde mit der Brille, der, für den die Sharona immer geschwärmt hatte – der is’ ´ne Schwuppe. Stockschwul. Ich schwör’s. Nein, er hat sich nicht geoutet, sooo blöd isser ja nu’ nich’, nee? Aber ehrlich, er malt besser als Ivana und ist gut in Deutsch und erinnert ihr euch noch an das schöne Gedicht von ihm in der 9. Klasse? Jungs können keine Gedichte, das hätte mir wirklich sofort auffallen müssen. Vor allem keine Liebesgedichte.“
Zehn Minuten später wüsste es die gesamte Schule, und dann?
Vermutlich würde die Welt nicht untergehen. Kevin war der Typ beliebter Außenseiter. Nicht mittendrin und voll dabei, er hatte keine echten Freunde, doch keiner hatte etwas gegen ihn. An seiner Schule herrschte eigentlich insgesamt ein eher tolerantes Klima – ein Gymnasium in einer kleineren Stadt, die nah an Köln gelegen war. Hier lebten größtenteils gut situierte Pendler, es gab lediglich kleinere Ecken mit Migrantenproblematik. Die Ausländer an seinem Robert Koch-Gymnasium stammten durchweg aus Familien, die mindestens in der zweiten Generation in Deutschland wohnten und zumeist wohlhabend waren. Toleranz war billig zu haben, solange die Ausländer nicht stanken, besseres Deutsch sprachen als die Deutschen und nicht mit religiösem Fanatismus auffielen.
Dementsprechend konnte sich Kevin Hoffnung machen, dass seine Sexualität auch billig toleriert würde – er benahm sich nicht tuntig, verlangte nicht aggressiv, dass seine Rechte geschützt werden mussten, und belästigte auch sonst niemanden.
Trotzdem zog er es vor, sein Outing auf irgendwann später zu verlegen. Sehr viel später. Nach dem Studium vielleicht, oder wenn er auf dem Sterbebett lag …
Schließlich war da noch Daniel Harting. So wie Tatsachen grundsätzlich von Ausnahmen bestätigt wurden, gab es Daniel, der für den rechtskonservativen Anteil zuständig war. Nicht auf die prollige Art, der Kerl klopfte keine hirnlosen Stammtischparolen der Sorte „Ausländer raus“ und „Alle Homos sind Kinderschänder!“ Nein, er war intelligent und leise, nervte seine durchweg neutral ausgerichteten Freunde nicht zu sehr mit seinen Argumenten. Wenn er loslegte, konnten oft auch die Lehrer nicht gegen gewinnen. Gegen „Natürlich bin ich dafür, Asylanten zu helfen. Aber warum soll diese Hilfe darin bestehen, sie wie unmündige Kinder in Heime zu stecken und einfach bloß durchzufüttern? Es wäre sinnvoller, sie Deutsch lernen zu lassen, ihre Traumata zu therapieren und ihnen zu helfen, sich entweder zu integrieren oder in ihre Heimat zurückzukehren und dort wieder aufzubauen, was kaputt gegangen ist“ konnte man wenig sagen. Abgesehen von „Woher soll das Geld kommen?“ und „Auf ähnliche Weise versucht die Regierung ja zu arbeiten, leider ist das nicht so einfach.“ Was unausweichlich mit einem „Dann sollte man deutlich weniger Asylanten aufnehmen und sich um die anständig kümmern, statt möglichst viele, die man nicht versorgen kann“ gekontert wurde. Ähnlich hielt Daniel es mit Schwulen und Lesben. Seine Argumente bauten darauf, dass Homosexualität Ausdruck einer seelisch-frühkindlichen Störung sein musste, da man bei eineiigen Zwillingen beobachten konnte, dass nicht immer beide homosexuell waren. Demzufolge konnte es seiner Meinung nach nicht genetisch begründet sein und gehörte als Krankheit behandelt.
Da Kevin keinen Freund hatte, gab es sowieso keinen Grund, sich outen zu wollen. Er hatte überhaupt noch nie einen Freund gehabt. Sexuell unerfahren. Komplett unbeleckt, wie Bettina es nennen würde. Auch in Sachen Verliebtheit war er ein Spätzünder. Abgesehen von ein paar Schwärmereien für unerreichbare Heteros hatte er lediglich Tagträume zu bieten – Schauspieler, Sänger, gut aussehende Unbekannte im Internet, die er gefahrlos ansabbern konnte, wenn er sich in seinem Zimmer einschloss oder unter der Dusche stand. Facebook lieferte endloses Bildmaterial für Selbstbespaßung. Aber Schmetterlinge im Bauch, wonnige Höhenflüge, rosarote Watteplüschwölkchen, das kannte er bloß aus Romanen, Filmen und den freizügigen Erzählungen seiner Mitschüler.
Er war eben ein wandelndes Klischee – peinlicher Name, von asozialen Eltern lieblos ausgesucht; schmalbrüstiger Geek mit Brille; ein Schwuler, der davon träumte, Modedesign zu studieren.
Wenn ihn jemand fragte, was er mit dem Abi anfangen wollte, sprach er von Innenarchitektur oder Eventmanager, was ihm beides ganz gut gefallen würde. Vielleicht würde er sich tatsächlich in diese Überlebensnischen drängen, denn ob er den ausreichenden Biss mitbrachte, sich in der exaltierten Modebranche durchzusetzen, wusste er beim besten Willen nicht. Kevin war nicht introvertiert, dafür jedoch eher konfliktscheu. Dass er es liebte, mit Stoffen umzugehen, dass die viel zu wenigen Textilstunden in der Unterstufe sein persönliches Schulhighlight gewesen waren, reichte wahrscheinlich nicht aus … Und hey, ein schwuler Modedesigner wäre vermutlich der totale Klischee-Overkill.
~*~
„Ey, wo warst’n schon widda?“
Kevins Mutter drückte eine Zigarette aus und wedelte mit der Hand, als könnte das den Rauchgestank mindern. Sie lag im Jogginganzug auf der Couch, der Fernseher plärrte, eine leere Tüte Chips auf dem Tisch zeigte, was ihr Mittagessen gewesen war. Eine imposante Anzahl ebenso leerer Bierflaschen zeigten, dass der vor zwei Tagen verkündete „Ich hör mit dem Saufen auf, das bringt ja alles nix!“-Willensfunke bereits wieder erloschen war. Kevin kannte das viel zu gut, um darüber enttäuscht zu sein. Er lächelte schmal und hob die schwere Tasche an, Ausbeute seines Zwischenstopps bei der Städtischen Bücherei.
„Yow, lies du man fleißig, tut dir gut, Junge“, brummte seine Mutter. Sie war sichtlich müde von dem vielen Alkohol. Glücklicherweise machte das Zeug sie sanftmütig und ihre Rückfälle kamen regelmäßig, bevor sie im Entzug aggressiv werden konnte.
Früher war sie häufig für mehrere Tage verschwunden, um mit irgendwelchen Kerlen zurückzukehren, die genau solche versoffenen Loser waren wie seine Mutter. Vor denen hatte er sich stets in Acht nehmen müssen, da sie grundsätzlich vergaß, die Typen vor dem minderjährigen Mitbewohner vorzuwarnen. Viele von denen waren gewalttätig gewesen, hatten ihn, seine Mutter oder auch sie beide verprügelt. Zwei hatten versucht ihn anzufassen, doch als er anfing zu schreien und sich zu wehren, passierte in beiden Fällen das große Wunder: Seine Mutter wurde nicht nur nüchtern genug, um zu erkennen, dass ihr Sprössling in ernsten Schwierigkeiten steckte, sie entwickelte auch ausreichend Kraft und Mut, die Bastarde rauszuschmeißen. Angela Wiedow hatte selbst genug durchgemacht – mit fünfzehn ungewollt schwanger und von ihren Eltern rausgeworfen; zwei Jahre lang bei Kevins Erzeuger und dessen Familie untergekrochen, dort mit Müh und Not entkommen und von da an alleinerziehende Mutter. Sie erzählte selten von der Gewalt, die man ihr das gesamte Leben lang angetan hatte, doch es genügte, dass Kevin ihr den Alkohol nicht übel nehmen konnte. Die versoffenen Penner, die sie anschleppte, nachdem sie ihn ohne Aufsicht und Nahrung teilweise tagelang allein gelassen hatte, o ja, die hatte er ihr sehr übel genommen. Inzwischen ging sie nicht mehr auf solche Touren. Sie behauptete, dass sie zu alt und hässlich geworden war, aber das war Unsinn – auch wenn sie eher wie fünfzig als vierunddreißig wirkte, sie könnte noch immer Kerle abschleppen. Außerdem finanzierte sie Zigaretten, Alk und Fast Food dadurch, dass sie den widerlichen Kerl an der Tankstelle gegenüber bespaßte.
Kevin wusste, dass sie seinetwegen aufgehört hatte, auf Tour zu gehen. Das Geschrei, als sie den letzten Typen rausgeworfen hatte, hörte er noch immer in seinen Albträumen:
„Du Dreckssau! Das’n Kind, du Ratte! MEIN Kind! Niemand schlägt meinen Jungen blutig! Niemand packt ihn am Schwanz oder Arsch! Er is’ dreizehn, du versoffenes Stück Scheiße! Raus hier, SOFORT!“
Sie hatte den Kerl mit allem beworfen, was sie zwischen die Finger bekam und war schließlich mit einer abgebrochenen Flasche auf ihn losgegangen. Kevin hatte währenddessen heulend am Boden gelegen. Nackt, blutend, halb wahnsinnig vor Angst und Scham.
„Tut mir so leid, Baby!“, hatte seine Mutter unzählige Male gerufen, als sie ihn von dort aufklaubte. Er hatte sich an sie geklammert, ihren Gestank nach altem Schweiß, Alkohol, Zigaretten und billigem Parfüm eingeatmet und sich sicher gefühlt. Sie mochte eine schlechte Mutter sein, unfähig, ihm Liebe zu schenken, anständiges Essen für ihn zu kochen oder sonst irgendetwas für ihn zu tun, was Kinder normalerweise brauchten. Aber sie liebte ihn zumindest mehr als sich selbst und beschützte ihn vor Männern, von denen sie sich bereitwillig hätte schlagen und benutzen lassen.
Sie hatte ihn angefleht, nicht zum Arzt zu gehen, obwohl er einige heftige Prellungen und blutige Schnittwunden davongetragen hatte – der Penner hatte einen großen Ring mit sehr scharfen Kanten getragen. Wäre er in diesem Zustand ins Krankenhaus gegangen, wäre er vom Jugendamt fortgeholt worden. Das wussten sie beide, dafür hatte es bereits zu oft hart auf der Kippe gestanden, ob er noch bei ihr wohnen durfte oder nicht. Kevin war darum zu Hause geblieben, bis seine Wunden soweit verheilt waren, dass er wieder unauffällig zur Schule gehen konnte. In dieser Nacht hatte sie ihm hunderte Male geschworen, dass sie niemals wieder einen Kerl über die Schwelle lassen würde und dieses eine Versprechen hatte sie gehalten.
Gut, sie hatte ihm auch geschworen, keinen Tropfen mehr zu trinken, die Zigaretten wegzuschmeißen, arbeiten zu gehen und den Haushalt allein zu führen, statt alles ihm zu überlassen. Das hatte sie nicht einmal einen kompletten Tag lang durchgestanden, doch das war okay für ihn. Er wusste, dass sie ihn brauchte. Seit seinem sechsten Lebensjahr wusch er die Wäsche, kaufte ein, hielt die Wohnung sauber und rettete ihr mehrmals die Woche das Leben, indem er ihr die brennenden Kippen abnahm, sobald sie im Laufe des Abends auf der Couch einzuschlafen drohte.
Vermutlich hatte er es deshalb nicht wirklich eilig, seine Zukunft zu planen – sobald er studieren ging, würde seine Mutter komplett versumpfen, das war ihm klar. Wahrscheinlich verliebte er sich aus diesem Grund auch nicht. Liebe würde ihn verändern. Ihn dazu bringen, dieses sinkende Schiff verlassen zu wollen. Und wie sollte er einem Freund beichten, dass hinter seiner gepflegten Fassade ein kaputtes Hartzer-Kind steckte? Er verdiente das Geld für seine Klamotten, die modischen Haarschnitte und jene kleinen Extras wie sein Handy selbst. Mehr als hundert Euro durfte er im Monat nicht dazuverdienen. Von jedem Euro mehr würde der Staat ihm achtzig Cent wegnehmen. Das war unfair, aber mit hundert Euro kam er einigermaßen über die Runden.
„Hör auf zu rauchen“, befahl er sanft und nahm ihr die Zigarettenschachtel aus der Hand. Er legte eine Decke über sie, öffnete das Fenster, um den Zigarettenqualm abziehen zu lassen und begann, den Müll von Boden und Tisch wegzuräumen.
„Hast ja Recht“, grummelte seine Mutter. Noch bevor er die Bier- und Schnapsflaschen in die Küche gebracht hatte, schnarchte sie schon friedlich.
Seufzend stellte Kevin die blaue Plastikschüssel bereit, falls sie sich übergeben musste. Das kam selten vor, aber sie hatte jetzt rund zwei Tage Abstinenz gehalten, da war die Gefahr größer. In dieser Schüssel hatte sie ihn als Baby gebadet und es war der einzige Gegenstand, den sie aus dem Haushalt von Kevins Erzeuger und dessen Eltern mitgenommen hatte. Warum sie an dem Ding festhielt, wusste wohl nicht einmal sie selbst und irgendwie war es makaber, dass es ihre Spuckschüssel geworden war. Andererseits spielte es keine Rolle, oder?
Kevin verzog sich in sein eigenes Reich. Eines, in dem Träume dominierten. Träume von Liebe, von einem besseren Leben, von Sex und Anerkennung. Von Freundschaft und davon, sich nicht mehr verstecken zu müssen. Schämen für alles das, was er war und was seine Realität ausmachte. In den Ecken und Schatten lauerten allerdings auch die Albträume: Hände, die ihn hart packten und schlugen, seine Kleidung zerrissen und ihn in die Knie zwangen. Die ihn an intimsten Stellen berührten und befingerten. Stimmen, die Drohungen zischten, ihn beleidigten und erniedrigten. Gestank nach Alkohol, Schweiß und Exkrementen.
Die Stimme seiner Mutter, die Versprechungen murmelte, ohne sie einhalten zu können.
Bildhafte Vorstellungen einer verbrannten Leiche auf dem Sofa, weil er es nicht schaffte, ihr die Zigaretten rechtzeitig abzunehmen.
Da waren die Gedanken an Klassenkameraden, die seine kleinen, schmutzigen Geheimnisse entdecken könnten, beinahe erholsam …
Kapitel 2
Der Tag, der seinen Untergang einläutete, begann harmlos.
Kevin hatte vor dem Unterricht noch Wäsche gewaschen und eingekauft. Dienstag hatte er immer bis 17.00 Uhr Unterricht, wenn er dann nach Hause kam, war er zu müde, um sich noch um irgendwelche Pflichten kümmern zu wollen. Gestern Abend hatte er Pellkartoffeln vorgekocht. Seine Mutter war instruiert, dass sie sich ihre Portion wegnehmen sollte, gemeinsam mit dem Forellensalat, den er fertig gekauft hatte. Das bisschen Haushaltsgeld, das sie vom Staat bekamen, ließ keine großen Sprünge zu, geschweige denn etwas wie ausgewogene, gesunde Ernährung. Frühstücksbrote kannte Kevin nur von seinen Mitschülern. Er nutzte das kostenlose Obstangebot seiner Schule, das musste reichen. Aus diesem Grund waren ihm die schulfreien Tage weniger lieb, obwohl sie ihm eine Gelegenheit zur Flucht aus der zugemieften Bude und vor all seinen Träumen bot. Der Zwang, sich ernähren zu müssen, nervte ihn ungemein, denn jeder Happen war Geld, das anschließend woanders fehlen würde. Wie oft hatte er bereits überlegt, ob er nicht doch das Rauchen anfangen sollte, denn es würde seinen Appetit hemmen. Und jedes Mal hatte er dann seine Mutter vor Augen, mit der unvermeidlichen Kippe in der Hand. Er hasste dieses Bild noch mehr als den Gestank, der dazugehörte.
Nachdem er noch die Hinterlassenschaften seiner Mutter fortgeräumt hatte, schnappte er sich den Müllbeutel und machte sich auf den Weg zur Schule. Zu seinem Pech war diese nicht weit genug entfernt, als dass man ihm ein kostenloses Monatsticket für Bus und Bahn zur Verfügung stellen würde. Die rund neunhundert Meter machten ihm zwar bloß bei Schnee und Glatteis oder Gewitter mit Hagelschauern etwas aus, doch das Ticket wäre ja auch anderweitig nützlich.
Wie üblich passierte er das Haus von Daniel Harting mit einem leicht flauen Gefühl im Bauch. Vor etwa drei Wochen waren sie in der Cafeteria zusammengestoßen, da hatte Daniel ihn offenbar das erste Mal wirklich bemerkt. Seitdem fühlte er sich von ihm beobachtet. Schon früher hatte er es vermieden, an diesem Haus vorbeizugehen, wenn sein Klassenkamerad noch nicht zur Schule losgefahren war. Daniel benutzte stets das Fahrrad und zum Glück machte er sich meist relativ früh auf den Weg. Aber erst seit dem Zusammenstoß, bei dem Daniel sich Orangensaft über den weißen Pulli geschüttet hatte – was dieser erstaunlich gelassen hingenommen hatte – war da flattrige Angst im Bauch. Kevin hatte einfach das Gefühl, zu leicht davongekommen zu sein. Natürlich war das Unsinn, wegen eines solchen dummen Unfalls würde ihn der Typ nicht zusammenschlagen. Seine Phantasie war wie meistens sein wahrer Feind. Im Herbeireden von Unglücksszenarien und nachfolgenden Albträumen war er vermutlich der ungekrönte König.
„Hey!“ Die Stimme war ihm vertraut. Der harte Klang hingegen nicht. Kevin zuckte zusammen und unwillkürlich wandte er den Kopf, um über die Schulter zurückzublicken. Daniel stand dort, keine fünf Meter von ihm entfernt. Die Arme verschränkt, sein Blick glitt taxierend über Kevins Körper. Er war groß, sicher an die 1,90 m, schlank, hatte kurzes, hellbraunes Haar. Die schwarze Winterjacke ließ ihn breiter und gefährlicher wirken, als er war.
„Warte mal, Mann. Du bist’n Homo, nicht wahr?“
Das klang so absurd, zudem stellte Daniel diese Frage mit einem entspannten Lächeln, dass Kevin bereits nickte, bevor sein Kopf den Hintersinn sowie die Gefahr erkannt hatte.
„Moment, was?“, versuchte er sich zu retten. Doch es war zu spät, wie Daniels verächtliches Schnauben bewies.
„Eigentlich weiß es jeder, es hat sich bloß nie jemand getraut, dich zu fragen.“ Daniel kam langsam auf ihn zu.
Wegwegweg!, brüllten Kevins Überlebensinstinkte. Seine Beine waren wie festgefroren, er konnte sich nicht bewegen. Lediglich seinem Gegner hilflos entgegenstarren, der sich alle Zeit der Welt ließ, breitbeinig daherkam, die Daumen in die Gürtelschnallen geschoben. Er trug fingerlose schwarze Fahrradhandschuhe. Sie würden seine Knöchel schützen, sollte er Kevin schlagen wollen.
„Irgendwie hab ich’s auch schon immer gewusst, es aber versucht zu ignorieren. Du hast so was an dir – du bist zu hübsch, verstehst du? Bis jetzt bist du ja nie weiter schlimm aufgefallen, Mann. Kein Make-up, keine Tuntenklamotten, keine komischen Frisuren, alberner Hüftschwung oder sonstige Sachen. Und selbst wenn, das wäre mir auch soweit egal gewesen. Wenn ein Kerl meint, sich lächerlich machen zu müssen – bitte sehr, gerne doch! Solange er keinem weh tut, soll’s mir am Arsch vorbeigehen.“
„Ich tue keinem weh!“, brachte Kevin nervös hervor, während er Schritt für Schritt rückwärts ging. Weglaufen wäre sinnlos, Daniel konnte sehr viel schneller rennen als er, das wusste er vom Sportunterricht. Um Hilfe brüllen? Noch hatte der Spinner ihm nichts getan. Ihn nicht einmal wirklich bedroht, auch wenn er extrem bedrohlich wirkte.
„Was ist mit dem Kurzen aus der Fünften?“ Daniel schnellte vor und packte Kevin hart am Kragen. Einen Moment später schubste er ihn gegen eine Mauer, ohne ihn loszulassen, rückte nach, hielt ihn fest umklammert.
„Wovon sprichst du, Mann?“ Schwer atmend versuchte Kevin, sich aus dem harten Griff zu befreien. Vergeblich – sein Gegner war sehr viel stärker als er, größer, breitschultriger. Sofort war da der Flashback.
Stinkender Atem. Hände überall auf seinem Körper. Reißen ihm den Schlafanzug herunter. Packen an die verbotensten denkbaren Stellen.
Panik verlieh ihm Kraft, er befreite sich, rang nach Luft wie ein Ertrinkender.
„Lass mich … Lass mich!“ Kevin würgte, ein hohes Wimmern drang aus seiner Kehle. Starrte in braune Augen, die sich erschrocken weiteten. Beinahe war er dankbar für die leichte Ohrfeige, die ihn traf und wieder ein wenig zur Besinnung brachte.
„Hör auf, wie ein Hund zu fiepen!“, zischte Daniel voller Verachtung und drängte ihn zurück gegen die Mauer.
„Wer unschuldig ist, bräuchte nicht solche Angst zu haben. Hm? Also, wie war das gestern Abend mit Achim? So ein kleiner Blonder aus der Fünften. Jemand hat sich den Kleinen geschnappt und ihn missbraucht. Ein Mann mit einer Maske.“
„Das war ich nicht!“, brachte Kevin hervor. Empörung setzte sich gegen die Panik durch. „Ich würde niemals ein Kind anpacken, nie, nie, NIE!“
Zu genau wusste er, wie furchtbar das war. Ja, er hatte Berichte darüber gelesen, dass viele Täter dieser Art selbst einst Opfer gewesen waren. Dass sie sich nach Jahren, in denen sie sich schwach und hilflos gefühlt hatten, auf diese Weise stark machen wollten. Anscheinend fehlte ihm dafür ein Gen, jedenfalls hatte er wirklich niemals auch nur für eine Zehntelsekunde darüber nachgedacht, dass er sich als Täter stärker und besser fühlen könnte.
„Leugnen ist zwecklos“, murmelte Daniel. „Der Kerl wurde als eher klein und schmal beschrieben, mit Brille, roter Jacke und schwarzen Sneakers. Genau das Zeug, das du auch immer trägst und die Beschreibung passt.“ Anklagend wies er auf Kevins Schuhe. „Achim hat wohl ausgesagt, dass sein Angreifer auf ihn jung wirkte, auf jeden Fall unter zwanzig, und eindeutig ein Deutscher war.“
„Sag mal, den Scheiß hast du dir gerade ausgedacht, um mich fertig zu machen, oder?“, flüsterte Kevin entsetzt. Daniels Blick nahm ihm jede Hoffnung. Der Kerl meinte das ernst. Wirklich todernst.
„Ich werde Beweise suchen, ob du es warst oder nicht!“, zischte er. „Und Gnade dir Gott, wenn ich welche finde!“
Mit diesen Worten ließ er ihn abrupt los, wischte sich übertrieben eifrig die Hände an der schwarzen Jeans ab, schnappte sich sein Fahrrad und verschwand.
Kevin blieb verstört zurück. Er lehnte zittrig an der Mauer, versuchte ausreichend Luft in seine Lungen zu pumpen, gegen die Faust, die seine Brust zerquetschte. Der einzige Gedanke, der vollkommen klar durch sein Bewusstsein irrte, lautete:
OH! MEIN! GOTT!
Er wollte nicht in die Schule, auf gar keinen Fall. Aber welche Chance blieb ihm?
Es dauerte endlose Minuten, bis er sich einigermaßen beruhigt hatte, sein Magen nicht mehr revoltierte – welch ein Glück, dass der leer gewesen war – und ihm nicht mehr beständig schwarz vor Augen wurde. Verflucht, diese Flashbacks würden ihn eines Tages umbringen! Kevin wischte sich die Tränen vom Gesicht und setzte mit dem Gefühl völliger Orientierungslosigkeit seinen Weg fort.
~*~
Die Stimmung in der Schule kochte. Egal wohin er kam, „die Sache mit Achim“ war das Thema des Tages. In einer kleinen Stadt wie der ihren kein Wunder, man kannte solche Vorfälle nur aus den Nachrichten, wenn es irgendwo in weiter Ferne geschah. Da Achim Schmidts Vater ein Lokalpolitiker war, aktiv in der heimischen Fußballmannschaft spielte und auch beim Karneval fleißig mitmischte, war die Familie weithin bekannt wie ein bunter Hund. Ausgerechnet den kleinen Achim hatte es also getroffen. Gestern Abend, als er von einem Freund aus nach Hause wollte, war er von seinem Fahrrad in die Büsche eines leer stehenden Grundstücks gedrängt und dort missbraucht worden. Vielleicht wäre noch schlimmeres geschehen, hätte nicht ein älterer Mann, der mit seinem Hund spazieren ging, die Hilferufe des Jungen gehört.
Eigentlich wollte Kevin dem dramatischen Gerede von Daniel keine weitere Bedeutung beimessen. Dieser Spinner wollte sich wichtig machen, sonst nichts!
Doch noch vor der großen Pause wurde klar, dass nicht bloß Daniel glaubte, Kevin könnte etwas mit der Sache zu tun haben. Die finsteren Blicke, intensives Gemurmel, das abbrach, sobald Kevin in die Richtung schaute …
Einem inneren Gefühl folgend, verzog er sich in eine ruhige Ecke und schaute auf sein Handy. Auf seinem Facebook-Account stapelten sich Anklagen, Beschimpfungen und Beleidigungen. Er hatte dutzende PNs, die ihn aufforderten, sich sofort der Polizei zu stellen, die Wahrheit käme sowieso ans Licht. Fassungslos las Kevin die unglaublichen Beschuldigungen und Drohungen:
„Für Kinderschänder gibt es keine Gnade, du wirst bluten, du Drecksau!“
„Wag dich ruhig im Dunkeln vor die Tür, wir finden dich!“
„Gott hasst dich!“
„Wie konntest du nur? Wie kann irgendjemand SO ETWAS einem Menschen antun, geschweige denn einem Kind???“
„Schwul, widerlich, pädophil.“
„Ich hab ein Messer, auf dem dein Name steht und du wirst zuschauen, wie ich deinen Schwanz schön langsam in kleine Häppchen schneide!“
Ich muss hier weg!, dachte er panisch. Er verzichtete darauf, seine anderen sozialen Online-Kontakte abzuchecken und seine privaten Emails wollte er auch nicht sehen. Man kannte ihn an dieser Schule. Rund tausendfünfhundert Schüler. Wenn die sich zusammenrotteten, bliebe von ihm nicht genug übrig, um eine Streichholzschachtel zu füllen und keiner würde sich damit aufhalten, seine Unschuldsbeteuerungen anzuhören. Er musste jetzt sofort weg, solange sich die Gewalt noch bei mehr oder weniger anonymen virtuellen Drohungen aufstaute.
Mordlustige Blicke folgten ihm. Wütendes Gezischel. Finger, die auf ihn wiesen. War das allein Daniels Werk? Hatte der die Massen aufgeschaukelt?
Verzweifelt mühte sich Kevin, nicht zu rennen. Eine Gruppe Neuntklässler verstopfte den Haupteingang. Umgehen ließe sich die nur, wenn er über den Schulhof marschierte. Dreihundert Meter durch die Massen, die sich mit jeder weiteren Minute noch mehr gegenseitig davon überzeugte, dass er der Täter sein musste.
Gütiger Gott im Himmel, hilf!
Das Stoßgebet gab ihm keinen Mut. Mit wackligen Knien und brennendem Kopf, wild pochendem Herzen und akuter Atemnot kämpfte er sich durch die Schülergruppe. Jeden Moment rechnete er mit Schlägen, mit Händen, die ihn hinterrücks griffen. Kevin kannte diese Ängste, hatte sie jahrelang durchlitten. Wann immer seine Mutter den nächsten versoffenen Loser anschleppte, war die Angst vor Schlägen nicht weit. Er kannte den Schmerz. Den Unterschied zwischen Ohrfeigen mit der flachen Hand und Fausthieben. Wusste, wie sich Gürtel, Kochlöffel und sogar Stahlrohre anfühlten. Sei es auf nackter Haut oder von Kleidung gedämpft. Viele Jahre war es her seit dem letzten Mal. Seit fünf Jahren hatte niemand mehr Hand an ihn gelegt. Trotzdem war die Angst lebendig, die Bilder in seinem Kopf nicht weniger frisch, als wäre es erst gestern geschehen. Er schlotterte mittlerweile vor Panik am ganzen Leib.
Niemand hielt ihn auf. Keine Übergriffe. Es hagelte Gelächter und dumme Sprüche, die er in seinem Zustand nicht verstand. Möglicherweise hatten die Typen hier noch nichts von der Hexenjagd mitbekommen, die mittlerweile im Gange war?
Endlich war er draußen. Kevin hielt sich nicht damit auf, vor Erleichterung durchzuatmen. Dafür war er zu sehr damit beschäftigt, nicht zu kotzen.
„Hey!“ Jemand rief ihm hinterher. Statt sich umzudrehen, zog er die Träger des Rucksacks dichter an den Körper und begann zu laufen. Wie von Hunden gehetzt rannte er durch die Straßen und blieb nicht stehen, bis er beinahe zu Hause angekommen war.
Vor der Tür stand ein Streifenwagen. Niemand saß drin und es gab keinen spezifischen Grund anzunehmen, dass die Beamten zu ihm wollten. Das hier war keineswegs die beste Gegend. Doch Kevin wusste es mit absoluter Sicherheit, dass die Polizisten nach ihm Ausschau hielten. Es wäre utopisch anzunehmen, dass niemand einen Tipp abgegeben hatte, wen man als Schuldigen ansah …
Kurz lehnte er sich an die Hauswand und atmete durch. Er wollte weglaufen. Alles hinter sich lassen. Einfach vor dem irrsinnigen Stress und Druck fliehen.
Aber wohin? Er hatte kein Geld. Auf der Straße schlafen hatte nichts mit Romantik zu tun. Seine Mutter wäre fortan allein, er ein gejagter Kinderschänder. Bilder hetzten durch sein Bewusstsein. Wilde Jagdszenen aus diversen Hollywoodstreifen. Erinnerungen an die Heerscharen verlotterter, alkoholkranker, nikotinsüchtiger, teils auch drogenabhängiger Trauergestalten, die seine Mutter nach Hause gebracht hatte. Er würde genauso enden, sollte er sein Heil in der Flucht versuchen, da machte er sich keine Illusionen. Als obdachloser Penner auf der Straße bliebe ihm die Wahl zwischen Drogenstrich und Betteln in Parks. Da könnte er sich auch gleich vor den Zug werfen, um dem Elend ein Ende zu setzen!
Noch einmal atmete er tief durch. Er war unschuldig. Diesen Achim Schmidt hatte er niemals angepackt, er wusste ja kaum, wie er aussah. Daran musste er festhalten und auf das Beste hoffen.
Kevin schleppte sich die Treppen des fünfstöckigen Mehrfamilienhauses hoch. Hier lebten in erster Linie Arbeitslose und alleinerziehende Mütter. Die Mieten waren billig, das Ambiente entsprechend. Es stank nach Kohlsuppe, Bier, Zigaretten und vollen Windeln. Hinter den meisten Türen war Geschrei von Kindern, lautstarker Streit und noch lautere Fernseher zu hören und das zu einer Uhrzeit, wo der normale Deutsche bei der Arbeit sein sollte …
Mit zittrigen Fingern schloss er die Wohnungstür auf. Er hörte die Stimme seiner Mutter aus dem Wohnzimmer, sie klang schrill und aufgeregt. Natürlich – die Beamten hatten sie mit Sicherheit aus dem Tiefschlaf gerissen. Ohne Alkohol zum Frühstück war diese Frau nicht fähig, drei Sätze geradeaus zu formulieren.
Kevin eilte zu ihr, im Vorbeigehen stach ihm alles ins Auge, was an dieser Bruchbude beschämend war – die vom Zigarettenqualm vergilbten Tapeten, der bröckelnde Putz, die langen Staubfäden in diversen Ecken, die er beim Wohnungsputz regelmäßig vergaß. Der eklige Teppich im Wohnzimmer, auf den sich schon so ziemlich sämtliche Arten von Körperflüssigkeiten ergossen hatten, von Alkohol, Kaffee und Nahrungsresten mal zu schweigen. Der Gestank in diesem Raum, die völlig verlotterte Couch, auf der seine Mutter nahezu ihr gesamtes Leben zubrachte. Auch wenn er aufgeräumt hatte, es war nicht zu übersehen, dass Alkohol und Zigaretten neben dauerhafter Fernsehberieselung ihre Hauptbeschäftigung des Tages waren. Und da war natürlich diese Frau selbst, die sich vor schätzungsweise einer Woche das letzte Mal unter die Dusche bequemt hatte, entsprechend roch und ausschaute wie ein Zombie. Allein diese Haare, die fettig und grau an ihrem Kopf hingen, dermaßen verfilzt, dass sie wie angeklebt wirkten.
Dieser Zombie schoss mit erstaunlicher Geschwindigkeit an den beiden Polizisten vorbei, sobald Kevin den Raum betrat, und verpasste ihm links und rechts harte Ohrfeigen.
„Ist das wahr? Hast du’n Kind angefasst?“, kreischte sie. Eindeutig, ihr fehlte Schlaf und Alkohol, sonst würde sie sich niemals derart aufführen.
„Ich habe niemandem etwas getan“, erwiderte Kevin ruhig. Er fühlte sich gerade ziemlich merkwürdig. Distanziert. Beinahe, als wäre sein Verstand eingefroren, um nichts mehr wahrnehmen zu müssen.
„Wenn ich rauskriegen sollte, dass du das doch warst, dann …“
„So, gute Frau, jetzt beruhigen wir uns alle erst mal wieder“, fuhr einer der Beamten dazwischen und hinderte Kevins Mutter mit einer schnellen Bewegung daran, ihm noch mehr Schläge zu verpassen. In Kevins Ohren rauschte es, anscheinend hatten sich die Hiebe gelohnt. Schmerz spürte er noch keinen, er war von innen wie außen taub. Rasch prüfte er, ob seine Brille noch heil war, die zum Glück nichts abbekommen hatte. Brillen waren teuer und ein Antrag auf Ersatz umständlich und langwierig.
„Herr Wiedow, wir hätten einige Fragen an Sie“, sagte der andere Polizist derweil höflich an ihn gewandt. Ihm war, als hätten sie ihre Namen genannt, aber irgendwie war das an seinem Bewusstsein vorbeigerauscht … Beide waren ungefähr Mitte dreißig und wirkten wie nette Typen von nebenan.