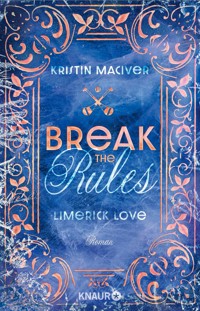
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Limerick Love
- Sprache: Deutsch
Manchmal musst du über dich selbst hinauswachsen, um deine wahre Bestimmung zu finden Die historische New Adult Sports-Romance "Break the Rules" ist der erste Band der "Limerick Love"-Dilogie: Historical Romance zum Träumen trifft auf das Aufbegehren nach Freiheit und Abenteuer im verschneiten Irland des 15. Jahrhunderts. Die rebellische Lady Vivienne FitzGerald, genannt Viv, langweilt sich tödlich auf Limerick Castle, wo sie nicht mehr tun darf, als den Tag mit Sticken und Singen zu vertrödeln. Als Viv dann auch noch erfährt, dass sie in wenigen Wochen heiraten soll – den ebenso besitzergreifenden wie hochnäsigen Sir Liam – trifft sie eine verzweifelte Entscheidung: Wenigstens einmal im Leben will sie tun, wonach ihr Herz sich sehnt! Verkleidet als Junge schließt Viv sich dem Hurling-Team an. Trotz einiger Rückschläge beim Training entdeckt sie nicht nur ihre Begabung für den leidenschaftlichen Sport. Da ist auch ein verbotenes Kribbeln in ihrem Bauch, jedes Mal, wenn sie mit dem besten Hurling-Spieler Ruairí zusammen ist. Doch Ruairí und sie kommen aus verschiedenen Welten und ihre Familien spaltet eine Vergangenheit, die alles zerstören könnte … Historical Romance mit einer ordentlichen Portion Sport, großen Emotionen und den Tropes Forbidden Love und Fake Identity Hinreißend romantisch erzählt Kristin MacIver, wie die rebellische junge Lady Viv und der leidenschaftliche, gutaussehende Hurling-Spieler Ruairí gegen ihr Schicksal aufbegehren. Lass dich von der Romance in die Eis- und Schneelandschaft des historischen Irlands entführen! »Fesselnd, gefühlvoll und mit unwiderstehlichen Ice-Hockey-Vibes! Ihr müsst diese Forbidden-Love-Romance unbedingt lesen.« Regina Meissner, Autorin Im zweiten New Adult Liebesroman der Dilogie, »Win Your Heart. Limerick Love«, muss Ruairís Schwester Sláine um ihr Glück kämpfen. Entdecke auch Kristin MacIvers historische Liebesromane in Schottland: - Der Traum der Lady Flower (Celtic Dreams 1) - Die Liebe der Lady River (Celtic Dreams 2) - Der Mut der Lady Leaf (Celtic Dreams 3)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 595
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kristin MacIver
Break the Rules
Limerick Love
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Manchmal musst du über dich selbst hinauswachsen, um deine wahre Bestimmung zu finden
Irland, 1461: Die rebellische Viv langweilt sich tödlich auf Limerick Castle, wo sie ihren Anforderungen an ihre Rolle als Lady gerecht werden muss. Als sie erfährt, dass sie den besitzergreifenden Sir Liam heiraten soll, will sie endlich das tun, wonach sie sich sehnt! Verkleidet als Junge schließt Viv sich dem Hurling-Team an. Trotz einiger Trainingsrückschläge entdeckt sie ihr Talent, und ein starkes Herzklopfen der Nähe des besten Hurling-Spieler Ruairí. Doch Ruairís und Vivs Familien spaltet ein dunkles Geheimnis, das alles zerstören könnte …
»Fesselnd, gefühlvoll und mit unwiderstehlichen Ice-Hockey-Vibes! Ihr müsst diese Forbidden-Love-Romance unbedingt lesen.« Regina Meissner, Autorin
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Hinweis auf Triggerwarnung
Widmung
Playlist
Glossar
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Epilog
Leseprobe zu
Kapitel 1
Danksagung der Autorin
Triggerwarnung
Liebe Leser*innen,
bestimmte Themen lösen bei manchen Menschen unbeabsichtigte Reaktionen aus. Deshalb findet ihr am Ende des Buches eine Triggerwarnung.
Ich wünsche euch ein schönes Leseerlebnis.
Eure Kristin
Für Luke, der mich zu dieser Geschichte inspiriert hat.
Und für alle, die kurz davor sind aufzugeben. Ihr werdet einen Weg finden!
Playlist
The Man – Taylor Swift
That’s So True – Gracie Abrams
I Can Do It With a Broken Heart – Taylor Swift
I’ll Make a Man Out of You – Donny Osmond
Colors of the Wind – Judy Kuhn
Please Please Please – Sabrina Carpenter
Set Fire to the Rain – Adele
Familiar Taste of Poison – Halestorm
The Tortured Poets Department – Taylor Swift
Astronomy – Conan Gray
Behind Blue Eyes – Limp Bizkit
Lie to Me – 5 Seconds of Summer
Irish Celebration – Macklemore & Ryan Lewis
Red – Taylor Swift
Here Without You – 3 Doors Down
Bar Is on the Floor – Alex Porat
I Am the Fire – Halestorm
Rewrite the Stars – Zac Efron / Zendaya
Unwritten – Natasha Bedingfield
I’m Still Standing – Elton John
Glossar
Hurling
Ein schnelles, körperbetontes Mannschaftsspiel mit keltischen Wurzeln. Es wurde mit Holzschlägern und einem kleinen Ball (Sliotar) gespielt und war ein wichtiger Bestandteil der irischen Kultur.
Hurley
Der hölzerne Schläger, mit dem beim Hurling der Sliotar geschlagen wurde. Er besaß eine breite, flache Schlagfläche und war meist aus Eschenholz gefertigt.
Sliotar
Der Ball beim Hurling, ähnlich einem heutigen Baseball. Aussprache: Schlihtor.
Anglo-Irish
Nachfahren der normannischen Eroberer, die im 12. Jahrhundert nach Irland kamen. Sie unterhielten oft enge Verbindungen zur englischen Krone und waren im Namen des englischen Königs die Herrscher der Stadt Limerick.
Gaelic-Irish
Die einheimische irische Bevölkerung, die nach ihren eigenen Gesetzen leben wollte und eine eigenständige Kultur pflegte. Sie standen in ständigem Konflikt mit den herrschenden Anglo-Irish.
King’s Island
Eine Insel im Fluss Shannon, auf der sich King John’s Castle, das Zentrum der anglo-irischen Herrschaft in der Stadt, und die St. Mary’s Cathedral befanden.
English Town
Der befestigte Teil von Limerick. Die wohlhabenden Anglo-Irish lebten hier.
Irish Town
Der unbefestigte Teil der Stadt jenseits des St. John’s Gate, in dem hauptsächlich die Gaelic-Irish lebten, die wirtschaftlich und sozial gegenüber den Anglo-Irish benachteiligt waren.
St. John’s Gate
Stadttor, das aus der English Town in die Irish Town führte.
Ruairí Ó Meadhra
Aussprache: Rurie Oh Mara
Sláine Ó Meadhra
Aussprache: Slawnje Oh Mara
Tadhg an Chomhaid Ó Briain
Aussprache: Teig an Chowid Oh Breen
Kapitel 1
Irland, 2. November 1461
Fünfzehn! Es dürfen auf jeder Seite des Feldes nicht mehr als fünfzehn Männer spielen!« Die Stimme der Burgwache schallt dröhnend über die schneebedeckte Wiese, die seitlich des Flusses unmittelbar an die Irish Town von Limerick angrenzt. Der Mann hat sich auf eine umgedrehte Kiste gestellt, um größer zu wirken, doch den Massen von mit Holzschlägern ausgestatteten Gaelic-Irish ist er noch immer nicht gewachsen.
Es sind an die zwanzig auf jeder Seite des Spielfelds.
Mein Herz schlägt schnell vor Aufregung, als ich die meist rothaarigen Männer mustere und noch immer nicht glauben kann, dass ich tatsächlich hier bin. Hier, außerhalb von King’s Island und der English Town von Limerick, im für mich verbotenen Teil der Stadt.
Die Gaelic-Irish tragen trotz der Kälte nur ihre Wollhosen und knielangen Leinentuniken. Sie haben die Ärmel hochgekrempelt und den weiten Stoff der Tuniken mit Gürteln an der Hüfte hochgerafft. Ihre Füße stecken in abgewetzten Lederschuhen, mehrere Männer stehen sogar barfuß im Schnee. Ein vorfreudiger, beinahe fiebriger Ausdruck liegt in ihren Augen. Ein Mann klopft sich mit dem ovalen Endstück seines Hurleys in die Hand und fixiert die gegnerische Mannschaft. Wüsste ich es nicht besser, würde ich sagen, er bereitet sich auf eine Rauferei vor. Obwohl … ist Hurling am Ende nicht genau das? Eine handfeste, als Spiel getarnte Rauferei samt Ball und Holzschlägern?
Ich trete wehmütig ein paar Schritte weiter nach vorn, bis ich unmittelbar am Spielfeldrand stehe. Ich kann es kaum erwarten, bis die Männer gleich in roher Wildheit dem faustgroßen Ball hinterherjagen. Es muss ein unbeschreibliches Gefühl von Freiheit sein, so entfesselt und ungehemmt gegen die gegnerische Mannschaft anzutreten und seinem Ehrgeiz und Kampfgeist freien Lauf zu lassen. Sich ganz auf die eigene Kraft, die eigene Schnelligkeit und Geschicklichkeit zu verlassen, umgeben von Kameraden, angefeuert von der Menge.
Nichts würde ich lieber machen.
Nichts ist unmöglicher.
»Halt! Nein, stopp, stopp.« Der Mann der Burgwache gestikuliert wild in Richtung von fünf weiteren Männern, die das Spielfeld mit ihren Hurleys betreten. »Keine weiteren Spieler! Ich sagte, keine weiteren … ah! Sir Liam!« Überraschung, gefolgt von Scham, zeichnet sich auf dem Gesicht des Mannes ab, als Sir Liam de Clare, der neue Constable von King John’s Castle und damit oberster Befehlshaber der Burgwache, auf seinem Schimmel erscheint.
Sofort nicken einige Gaelic-Irish-Männer knapp und gesellen sich an den Rand des Spielfelds. So sind auf jeder Seite nur noch etwa fünfzehn Spieler auf dem Spielfeld.
»Schwächlinge«, knurrt ein älterer, ausgemergelter Mann neben mir auf Gälisch, der Sprache der Gaelic-Irish. Sein Gesicht ist verhärmt, und er muss sich auf einen Stock stützen, um aufrecht stehen zu können. Als er unmittelbar vor meinen Füßen ausspuckt, zucke ich zusammen.
Er lacht höhnisch. »Was ist, Junge? Siehst du das anders?« Er wird lauter. »Früher, da haben wir zu hundert gespielt! Und die einzige Regel war, dass es keine Regeln gibt. Und jetzt«, er schnaubt verächtlich in Sir Liams Richtung, »jetzt kommen diese verweichlichten normannischen Adeligen von King John’s Castle und meinen, uns Regeln vorschreiben zu können, um uns zu zähmen.« Er redet sich immer mehr in Rage. »Sieg schon bei drei Toren. Keine Schlägerei?« Er hebt seinen Stock und gestikuliert in Sir Liams Richtung. »Wenn du mich fragst, sollte man denen mal gehörig die Fresse polieren.«
Ein Ellbogenstoß der Frau neben ihm, die ebenso abgezehrt wirkt, bringt den Mann zum Schweigen. »Hast du wieder gesoffen oder was?« Sie wirft ihm einen vernichtenden Blick zu. Daraufhin schweigt er.
Da ertönt eine tragende Stimme vom Spielfeld. Sie klingt so dunkel und rau wie ein Sturm in einer Winternacht. Mein Bauch zieht sich zusammen, und ein Schauer läuft meinen Rücken hinab. Mein Blick gleitet über das gefrorene Spielfeld, bis er an einem Mann mit hellbraunen Haaren hängen bleibt. Er überragt die anderen Männer um ihn herum und hat trotz seiner abgetragenen Kleidung die Ausstrahlung eines Kriegers.
Ich kann nicht wegsehen.
Niemand könnte bei so einem Mann wegsehen.
Hitze schießt in meinen Körper, und ich mustere unverhohlen das Gesicht des Mannes. Das markante Kinn. Die scharfkantigen Wangenknochen. Die sinnlich geschwungenen Lippen.
»Wir spielen mit zwei Mannschaften«, tönt die Stimme des Mannes laut und über das ganze Spielfeld hinweg. »Die Einwohner des nördlichen Teils gegen die Einwohner des südlichen Teils der Stadt.«
Sein Tonfall klingt dominant, seine Worte unanfechtbar. Und ich bin derart von dem Mann gebannt, dass ich erst nach einem Moment verstehe, dass er mit derStadt lediglich die Irish Town, den südlichen Teil von Limerick, meint. Denn im nördlichen Teil, auf King John’s Castle und in der English Town, leben nur die reicheren Anglo-Irish, und von ihnen steht hier keiner auf dem Spielfeld.
Der Mann geht in die Mitte der Wiese. Links und rechts von ihm haben sich die beiden Mannschaften bereits in zwei sich gegenüberstehende Reihen aufgestellt, die Hurleys in der Hand, den Kampfgeist im Blick, hinter ihnen jeweils in gut hundert Fuß Entfernung zwei hölzerne Pfosten, die die Tore markieren.
»Bereit?« Auf den Lippen des Mannes liegt ein unheilvolles Lächeln, und er hebt den ledernen Ball nach oben. Dann bekommt seine Miene einen spöttischen Ausdruck, als er noch einmal kurz in Richtung der Burgwache nickt. »Ihr kennt die Regeln, Männer.« Täusche ich mich, oder zwinkert er dabei? »Ihr dürft alles, nur nicht unanständig sein.«
Lachen erklingt. »Wir? Niemals!«
Der spöttische Ausdruck im Gesicht des Mannes wandelt sich zu einem stolzen Grinsen. »In diesem Fall: Lasst das Spiel beginnen!«
Mit einer kräftigen Bewegung schleudert er den Ball in die Luft. Sofort ertönt wildes Gebrüll, Schnee stiebt auf, und für einen Moment ist nichts als ein wilder Haufen aus Gliedmaßen und Hurlingschlägern zu erkennen.
Ich halte gebannt den Atem an, denn genau deshalb bin ich hier. Um einen Wettkampf zu sehen, der inmitten des kalten Winters so hitzig ist wie ein Kampf um Leben und Tod und bei dem sich doch niemand ernstlich verletzt. Zumindest hoffe ich das, als ich Zeugin werde, wie der erste Hurlingschläger den Kopf eines bereits einhändigen Spielers nur knapp verfehlt.
Die Wiese ist uneben, und in den Bodenvertiefungen ist der Regen der vergangenen Tage unter dem dieses Jahr frühen Schnee zu Eis gefroren. Es glitzert verräterisch und verleiht dem rauen Spiel eine sonderbare Eleganz. Und ein ganz neues Ausmaß an Gefahr, das mich nicht derart begeistern sollte.
Ich reibe meine Hände aneinander und trete noch einen Schritt nach vorn, um besser sehen zu können. Ich habe keine Ahnung mehr, wer zu welcher Mannschaft gehört. Doch die Spieler wissen es. Sie brüllen sich Anweisungen zu, rennen über das Spielfeld, den Ball auf ihren Hurleys balancierend.
Ich staune, wie das möglich ist. Ich könnte vermutlich nicht einmal im Stehen den Ball auf der ovalen Fläche am Ende des Schlägers balancieren. Doch bei ihnen sieht es so leicht aus, so schwerelos und selbstverständlich, als könne es gar nicht anders sein.
Gerade hat ein schwarzhaariger Mann den Ball, er ist stämmig und hat eine schiefe Nase. Ein Gegner rempelt ihn seitlich an, doch er wankt nicht einmal, rennt einfach weiter, vorbei am nächsten Gegner. Das Tor kommt immer näher, der Mann schlägt den ledernen Ball mit seinem Hurley hinüber zu einem Mitspieler. Sofort ist auch dieser umringt von zwei Männern, ihm bleibt keine andere Wahl, als den Ball von seinem Hurley auf den Fuß zu befördern und damit wieder ein Stück zurückzutreten. Das ist erlaubt, denn beim Hurling darf der Ball nicht nur mit dem Schläger geschlagen und getragen, sondern auch mit der Hand oder mit dem Fuß gefangen und gespielt werden.
Dort, wo der Ball aufkommt, sind unverzüglich zwei weitere Gegenspieler zur Stelle, ihre Schläger verhaken sich kurz, während sie um den Ball kämpfen, sie brüllen sich an, andere kommen dazu.
Der Mann der Burgwache tritt auf seiner Kiste unbehaglich von einem Fuß auf den anderen, doch der Knäuel aus Spielern und Schlägern löst sich wieder auf, und dieses Mal ist der Mann, der vorhin die Ansprache gehalten hat, im Ballbesitz. Der Mann, von dem ich meinen Blick erneut nicht abwenden kann. Der Mann, dem die Menge »Ruairí, Ruairí, Ruairí!« zuruft.
Ruairí ist besser als die anderen, das kann ich sofort erkennen. Er bewegt sich leichtfüßiger und vorausschauender. Und, verflucht, er muss nicht einmal auf den Ball schauen, wenn er ihn auf dem Schläger balanciert. So sicher ist er, dass der Ball nicht zu Boden fallen wird.
Ein Gegner stellt sich ihm in den Weg, doch Ruairí vollführt eine kraftvolle Drehung und behält den Ball. Ein triumphierendes Lächeln zeigt sich in seinem Gesicht, und während die anderen Spieler bereits um Luft ringen, wirkt er noch nicht einmal angestrengt. Er nähert sich dem gegnerischen Tor, wehrt zwei Gegner gleichzeitig ab, die sich auf ihn stürzen wollen, und schlägt den Ball zu einem Mitspieler hinüber.
Kurz bin ich enttäuscht. Denn der Mitspieler ist ein älterer Mann, und ich bin mir beinahe sicher, dass er den Ball verlieren wird. Doch er überrascht mich, legt die gleiche Lässigkeit an den Tag wie Ruairí und führt seinen nächsten Spielzug so aus, dass er gerade noch rechtzeitig mit dem Ball entkommt, während seine beiden Gegner heftig zusammenprallen.
Sie reiben sich die Köpfe, werden jedoch überrannt von Verteidigern aus ihrer eigenen Mannschaft, die auf kürzestem Weg zum Tor stürmen. Darunter ist auch der schwarzhaarige Mann mit der schiefen Nase, der mir schon vorhin aufgefallen ist. Er ist anscheinend der beste Spieler der gegnerischen Mannschaft, und viele Zuschauer rufen ihm den Namen »Darragh!« zu.
Darraghs Gesichtsausdruck ist verbissen, als er geradewegs auf Ruairí zusteuert. Und kurz habe ich den Eindruck, als würde es ihm um mehr als nur dieses Spiel gehen.
Ruairí sieht Darragh anscheinend nicht kommen. Stattdessen macht er sich bereit, den Rückpass des älteren Mannes anzunehmen, den die Menge nun mit »Cian! Los, schieß den Ball zu Ruairí!« anfeuert.
Cian gehorcht und schlägt den Ball zu Ruairí hinüber. Der Ball fliegt durch die Luft, über die Köpfe der Spieler hinweg in Richtung einer größeren Eisfläche.
Sofort setzt sich Ruairí in Bewegung. Mein Herz schlägt schneller. Bei dieser Geschwindigkeit muss ein Mann, der über das Eis rennt, stürzen. Ich halte den Atem an, ebenso wie die Zuschauer um mich herum.
Ruairí gewinnt noch einmal an Geschwindigkeit, doch da rempelt Darragh ihn derart heftig von der Seite an, dass beide auf dem Eis ins Schlittern geraten.
»Zur Hölle mit Darragh!«, brüllt einer der Spieler. »Er hatte gar keine Chance, an den Ball zu kommen, dieser vermaledeite Metzger!«
Ich zucke bei diesen heftigen Worten zusammen. Dennoch kann ich meinen Blick nicht von Ruairí lösen. Er schlittert noch immer mit beträchtlicher Geschwindigkeit nach vorn, ringt um Gleichgewicht, ohne aufzugeben. Der Ball ist ihm nur ein paar Fuß von Darragh entfernt vom Schläger gefallen, gleich wird dieser ihn erreichen.
Doch da macht Ruairí etwas Unglaubliches. Anstatt zu versuchen, sein Gleichgewicht wiederzufinden, wirft er seinen Körper der Länge nach mit ausgestrecktem Schläger auf das Eis und schlägt den Ball dadurch, einen Wimpernschlag, bevor Darragh ihn erreicht, zu Cian zurück.
Darragh flucht heftig, und Ruairí lacht laut. Ich kann nicht hören, was er zu Darragh sagt, doch dieser gerät daraufhin so aus der Fassung, dass er seinen Hurley zur Seite schleudert und mit geballten Händen auf Ruairí losgeht.
Schnell sind andere Männer zur Stelle, nicht, um die beiden auseinanderzubringen, sondern um sich der Rauferei anzuschließen. Mein Herz steht still. Doch da ertönt das Geschrei der Menge: »Tooor! Tor von Cian!«
Lauter Applaus brandet auf, und der ältere Mann reckt seinen Hurlingschläger in die Luft. Er scheint jedoch nur halb bei der Sache zu sein, blickt stattdessen mit gefurchter Stirn zu Ruairí und Darragh. Doch das Tor hat Darraghs Aufmerksamkeit zurück auf das Spiel gelenkt, denn er bellt seine Mitspieler nun an, wieder Aufstellung zu nehmen.
Dieses Mal nimmt Cian den Ball und wirft ihn zwischen die beiden Reihen der Spieler. Sofort beginnt der Kampf um den Ball auf Schnee und Eis erneut. Und wieder ist es Ruairí, der den Spielzug anführt. Der seinen Kameraden Anweisungen zuruft, der dafür sorgt, dass sie eine durchdachte Aufstellung einnehmen, der am Ende das Tor schießt.
Der Jubel ist bahnbrechend, das Hochgefühl berauschend. Ich recke meine Faust in die Luft und stimme in das Geschrei mit ein.
Von allen Seiten drängen sich nun Männer auf das Spielfeld. Und zwar genau jene, die vorhin nach dem Erscheinen von Sir Liam wegen der Begrenzung auf je fünfzehn Spieler wieder an den Seitenrand getreten sind.
Wie gern würde ich mich ihnen anschließen.
Auch von hinten drängt sich ein Mann an mir vorbei nach vorn auf das Spielfeld. Ohne genau zu wissen, was ich mache, folge ich ihm einen Schritt. Und dann noch einen.
Mein Kopf ist wie leer gefegt, ich bin wie gebannt von dem Spiel, dem Wettkampf, dem Rausch der Gefühle. Das ist das Leben. Das Abenteuer. Und damit das, was ich auf keinen Fall haben kann.
Ich bleibe stehen, mein Blick wandert noch einmal zur Burgwache. Und plötzlich habe ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Doch es kann nicht sein, dass Sir Liam mich …
Ein dumpfer Schlag trifft mich an der Schläfe. Sofort fährt ein stechender Schmerz durch meinen Kopf. Alles um mich herum scheint langsamer zu werden. Ich fasse mir an die Stelle, von der der Schmerz ausgeht, während ich wanke und vergebens nach Halt suche. Erst als ich falle, wird mir bewusst, wie schnell sich die Welt auf einmal vor meinen Augen dreht. Stimmen um mich herum werden laut, und ich muss aus irgendeinem Grund an den Geschmack von Bratäpfeln denken. So wohlig, so warm, so …
»Wach auf!«
Ein scharfer Schmerz an der Wange lässt mich blinzeln. Über mir sehe ich das Gesicht von Cian, dem älteren Spieler, der vorhin das erste Tor geschossen hat. Ich glaube, er hat mich gerade geschlagen. Aber warum sieht er mich dann so besorgt und mitfühlend an?
Ich blinzele erneut. Um mich herum höre ich noch immer Gebrüll, das Spiel muss noch in vollem Gang sein. Nur warum liege ich hier?
»Komm, fort von hier«, drängt Cian. »Die Burgwache sieht nicht gern Verletzte, und ich habe dafür gebürgt, dass es keine mehr geben wird.«
»Verletzt?« Ich ziehe die Brauen zusammen.
»Komm, Junge.« Cian zieht mich auf die Beine und beugt sich näher zu mir. »Sir Liam kommt auf uns zu. Wenn wir nicht verschwinden, gibt es Ärger.«
Doch ich kann mich nicht rühren. Ich kann nur auf das wutverzerrte Gesicht des Constable von King John’s Castle starren, der rasch herankommt.
»Nun mach schon«, drängt Cian. »Am Ende erklärt er noch das ganze Spiel für beendet. Und wir sollten schauen, dass du einen Schluck zu trinken bekommst.«
»Ich … Es geht schon«, stammle ich. Wenn ich nun auch noch davonlaufe, wird alles nur schlimmer werden.
Doch Cian lässt mir keine Wahl. Er packt mich fest, aber nicht grob, am Arm und zieht mich durch die Menge. Ich fühle mich noch zu benommen, um mich aus seinem Griff zu befreien. Die Gesichter der Menschen vor meinen Augen verschwimmen, also folge ich Cian, der mich hinter die Reihen der Zuschauer zieht. »Verflucht, Sir Liam verfolgt uns.«
»Ich rede mit ihm.«
Nur was, wenn er mich erkennt? Ein eisiger Schauer läuft meinen Rücken hinab, denn ich will mir nicht ausmalen, was dann geschehen wird.
Es ist undenkbar.
Cian bleibt stehen. Er schüttelt entschieden, aber auch eine Spur anerkennend den Kopf. »Der Ball hat dich härter getroffen, als ich angenommen habe, was?«
Sir Liam erreicht uns auf seinem Pferd, und ich senke den Blick. Cian hat recht. Sicher ist sicher. Und Sir Liam bebt vor Wut.
»Wir hatten eine Vereinbarung, Cian«, sagt er leise. Sein ruhiger Tonfall ist das Unheilvollste, was ich je bei einem anglo-irischen Lord erlebt habe. »Aber wenn du mir nicht garantieren kannst, dass ihr beim Spiel keine Kinder verletzt«, ich halte den Atem an, »werde ich andere Maßnahmen ergreifen. Verstehst du mich?«
Cian nickt, sagt dann: »Ich bitte im Namen aller um Entschuldigung.«
Sir Liams Stimme wird dunkler. »Du kannst von Glück reden, dass ich heute guter Stimmung bin. Und du«, damit kann er nur mich meinen, also muss ich den Kopf heben, »verdienst eine gehörige Tracht Prügel dafür, dass du als Unbeteiligter aufs Spielfeld rennst. Warte …«
Alles in mir verspannt sich.
Er darf mich nicht erkennen.
»Kenn ich dich, Junge?«
Ich schlucke. Meine Muskeln verkrampfen sich. Meine Verkleidung ist einwandfrei. Die verfilzte Jacke aus Schafsfell, die Mütze, der Dreck im Gesicht. Meine langen Haare, die vollständig verborgen sind.
Es ist unmöglich, dass Sir Liam mich in diesem Aufzug erkennt.
Nur … was ist, wenn ich mich irre? Wenn er mein Gesicht gut genug kennt, nachdem er mich bei unseren vergangenen Zusammentreffen stets so eindrücklich angestarrt hat, um mich jetzt zu enttarnen?
Ich wage es nicht, zu sprechen.
Ich kann nicht einmal den Kopf schütteln.
Da ertönt hinter uns wieder Gejubel, es muss ein drittes Tor gefallen sein. »Ruairí, Ruairí, Ruairí!«, singt die Menge laut, und auch Cian kann sich einen Freudenlaut nicht verkneifen.
Sir Liam wendet seinen Blick kurz den Spielern zu, ein abfälliger Ausdruck huscht über seine Miene. Und diese Abscheu trifft mich direkt ins Herz.
Am liebsten würde ich ihn von seinem hohen Ross werfen und ihm gründlich die Meinung sagen. Ihm entgegenschmettern, dass es keinen Grund gibt, die Gaelic-Irish so abwertend zu behandeln, zu unterdrücken und kleinzuhalten. Dass Irland ihr Land war, bevor es unseres wurde, und es eine Schande ist, wie die Anglo-Irish sich verhalten. Dass sie aufhören sollen, Pläne mit England zu schmieden und auf ein stärkeres Eingreifen von dessen König Edward IV. zu hoffen, und stattdessen nach Aussöhnung streben sollten.
Nach Gleichberechtigung, wie es meine Mutter immer sagte, bevor sie starb.
Ich balle die Hände zu Fäusten, doch die Angst, erkannt zu werden, hält mich klein. Und stumm, wie ich es stets sein muss.
Sir Liam blickt mich noch immer herablassend an. Gerade öffnet er den Mund, doch da eilt der Mann der Burgwache, der zuvor auf der Kiste stand, auf uns zu.
»Sir Liam, ich muss Euch dringend bitten mitzukommen.«
Den Rest verstehe ich nicht, doch der Oberkommandierende der Burgwache flucht heftig. Er wendet sich noch einmal an mich. »Ich werde gebraucht, aber wir beide sind noch nicht fertig miteinander.«
»Sir Liam«, setzt Cian an. »Der Junge hat seine Lektion gewiss gelernt. Lasst Güte walten, ich bitte Euch, Mylord.«
Doch Sir Liam antwortet darauf nicht, sondern wendet sich ab. Und da weiß ich, dass ich dringend die Flucht ergreifen muss.
Doch bevor ich davonstürmen kann, hält Cian mich am Arm fest. »Du hast mehr Mut, als dir guttut, und bist gewiss so flink und wendig, wie du aussiehst, Junge.« Er senkt die Stimme. »Komm vorbei, wenn wir das nächste Mal üben. Wir brauchen Spieler wie dich.«
Ich blinzele. Und mein Herz setzt einen Schlag lang aus. Habe ich gerade richtig gehört? »Ich … soll Hurling spielen? Mit euch? Wäre Sir Liam da nicht dagegen?«
Cian zuckt mit den Schultern. »Es wird dauern, bis du erstmals auf dem Spielfeld stehst, und dann wirst du stärker aussehen. Ich bin der Lehrmeister dieser Meute, ich weiß das aus Erfahrung. Außerdem«, Cian schlägt mir auf die Schulter, »es gibt nicht viele Burschen, die nach einem Schuss von Ruairí gegen ihren Kopf so schnell wieder auf den Beinen sind. Wir treffen uns immer samstags nach getaner Arbeit, genau hier.«
Ich blinzele wieder, noch immer ungläubig, und wende mich dem Spielfeld zu. Dort wird Ruairí gerade von seinen Mannschaftskameraden auf den Schultern getragen.
Und sein Blick … liegt auf mir. Ich spüre ihn sofort, wie eine Berührung, die meine Haut zum Glühen bringt. Da ist etwas Drängendes in seinen Augen, eine seltsame Neugier, die mich in seinen Bann zieht. Wir kennen uns nicht, und trotzdem kann ich nicht wegschauen. Sein Blick zwingt mich, ihm standzuhalten, an diesem Moment festzuhalten.
Ein verwegenes Lächeln spielt um seine Lippen. So als würde er mich herausfordern, es zu erwidern. Mir wird gleichzeitig heiß und kalt. Und als seine Lippen eine stumme Entschuldigung formen, weiß ich, dass ich wiederkommen muss.
Ich habe keine andere Wahl.
Kapitel 2
Ihr habt mir beinahe keine andere Wahl gelassen, Mylady! Wärt Ihr noch länger verschwunden geblieben, hätte ich Euren Vater benachrichtigen müssen. Wo wart Ihr nur so lange? Und ausgerechnet heute!«
Meine Kammerjungfer Martha fächelt sich hektisch Luft zu, und auf ihrem Hals zeichnen sich rote Flecken ab. Draußen tobt der Wind wie ein hungriges Tier, krallt sich an den Mauern von King John’s Castle auf der Königsinsel fest und heult so fürchterlich, als wolle er durch die mit Lederhäuten bespannten Fensterrahmen ins Innere dringen. Ich trete derweil vollständig aus dem geheimen Fluchtgang, der von meinem Gemach aus der Burg zu einem verfallenen Schuppen mit Brennholz an der Außenseite der Burgmauer führt und mich wieder zurück ins Innere der Festung bringt.
Noch ehe ich den Wandteppich vor die geheime Tür zurückgehängt habe, versinkt Martha in einen Knicks und senkt den Blick. »Entschuldigt, Mylady. Ich hätte nicht derart mit Euch sprechen dürfen. Es muss die Sorge sein, die mich mein Benehmen hat vergessen lassen.«
»Martha.« Ich nehme meine Mütze vom Kopf und lege sie auf dem Bett ab. Eine fast greifbare Stille breitet sich im Gemach aus, und nur das Knistern der Holzscheite im Kamin ist zu hören, während ich das Lederband löse und mir meine langen blonden Haare in Wellen bis zur Hüfte hinabfallen.
Mein Blick schweift durch das sorgsam hergerichtete Zimmer. Die dunkelblauen Vorhänge meiner Schlafstatt sind mittlerweile ordentlich zurückgezogen, das Fell auf dem Boden liegt ohne eine einzige Falte. Die brennenden Kerzen auf dem Kamin, die dem Raum einen Hauch von Wärme verleihen, stehen in exakt gleichem Abstand zueinander.
Nur ich, mit meinem rußverschmierten Gesicht und meiner abgenutzten Männerkleidung, wirke fehl am Platz. Heute noch mehr als sonst, weil Martha versucht hat, sich mit ihrem Ordnungswahn von der Sorge um mich abzulenken.
Ich kann es ihr nicht verdenken. Sie war von Anfang an dagegen, dass ich den Ausflug in die Irish Town wage. Doch ich habe es keinen Tag länger in dem goldenen Käfig ausgehalten, in den mein Vater, Lord Gerald FitzGerald, der Herr dieser Burg, mich seit Jahren sperrt. Vor allem nicht, seitdem er mir letzte Woche auch noch untersagt hat, dem Empfang des irischen Clanführers Tadhg an Chomhaid Ó Briain beizuwohnen. Dabei sind Gäste die einzige Abwechslung in meinem Leben. Und ich hätte den mächtigen Mann, der die Ländereien nördlich von Limerick kontrolliert und den meine Mutter einst sehr geschätzt hat, nur allzu gern einmal wiedergesehen.
Ich blicke zurück zu meiner Kammerjungfer. Sie verharrt noch immer in ihrem Knicks, den Kopf mit dem bereits graubraunen Haar gebeugt.
»Martha.« Ich gehe auf sie zu. Obwohl Martha mit ihren vierzig Jahren doppelt so alt ist wie ich, weiß ich, dass in ihrem Herzen ein ähnliches Feuer brennt wie in meinem. Sie versucht es zu bändigen, weil sie mir nicht zu nahe treten will. Sie versucht, sich entsprechend ihres Standes zu verhalten. Doch ich sehe an ihren in den Kleiderstoff gekrallten Fingern, dass sie mir am liebsten gehörig die Meinung sagen würde.
Und vermutlich habe ich das auch verdient. Denn ich war lange fort. Vielleicht zu lange.
Ich fasse Martha sanft am Arm ihres braunen Wollkleids und ziehe sie wieder in den Stand. »Wie viele Jahre stehst du nun schon in meinen Diensten?«
»Seit dem Tag Eurer Geburt, Mylady.«
»Und habe ich dir in all den Jahren je den Eindruck vermittelt, dass du nicht offen mit mir sprechen kannst?«
Ich sehe Martha prüfend an, doch sie hält den Blick nach wie vor gesenkt. »Kaum, Mylady.«
Kaum. Dieses eine Wort schneidet wie ein Messer in mein Herz. Kaum ist nicht nie. Und ich weiß sofort, worauf Martha anspielt. Auf die Monate nach dem Tod meiner Mutter. Die Monate, in denen ich Martha jedes Mal von mir gestoßen habe, sobald sie versucht hat, mich zu trösten oder aufzuheitern. Ich war erst acht. Trotzdem schäme ich mich dafür, dass ich Martha damals so entschieden in ihre Position als Bedienstete verwiesen habe, obwohl sie als Schwester des Aldermanns Thomas Fanning – dem ehemaligen Bürgermeister von Limerick – durchaus einen anderen Umgang verdient hätte.
Doch ich glaubte damals, es würde Martha nichts ausmachen, dass meine Mutter, Lady Isabella, urplötzlich und ohne jede Vorwarnung im Schlaf verstorben war. Dabei hatte Martha ihren Schmerz nur entschieden hinter gespielter Gleichmut versteckt. War vor mir stark gewesen und hatte nachts allein um meine Mutter getrauert.
Eine Schwere legt sich auf meine Brust bei dieser Erinnerung, die jede Lebendigkeit in mir erstickt. Doch das will ich nicht zulassen. Nicht heute, wo mich bereits gestern an Allerheiligen, als wir der Toten gedacht haben, die Erinnerung an den Verlust meiner Mutter tief betrübt hat.
Also straffe ich die Schultern und lenke meine Aufmerksamkeit auf das Knistern der Holzscheite im Kamin und das Heulen des Winds, das vor meinem Fenster zunehmend lauter wird.
»Es tut mir leid, dass ich dir heute Sorgen bereitet habe. Und wenn du mich dafür rügen willst, habe ich das verdient.«
Martha hebt den Blick, doch noch versucht sie, Haltung zu bewahren. »Euch zu rügen, obliegt allein Eurem Vater, Mylady. Oder dem Kaplan, wenn Ihr Eure Sünden beichtet.«
Ich verdrehe die Augen. Zum Glück habe ich die Beichte bereits vor Tagen anlässlich Allerheiligen hinter mich gebracht, wodurch die nächste Beichte erst kurz vor Weihnachten fällig wird. »Heute war der letzte Tag des großen Jahrmarkts, Martha. Eine bessere Gelegenheit, um mich unbemerkt unter die Menschen zu mischen, hätte sich mir bis zum nächsten Jahr nicht mehr geboten.«
Martha erwidert darauf nichts. Sie weiß, dass ich recht habe. Dass es heute, als noch unzählige fremde Händler aus dem gesamten Umland von Limerick in der Stadt waren, leichter für mich war, unerkannt zu bleiben. Dennoch entschuldigt das den Kummer nicht, den ich ihr anscheinend bereitet habe.
Wie schaffe ich es nur, dass Martha ihre Zurückhaltung mir gegenüber aufgibt? Ich brauche keine Kammerjungfer. Ich brauche eine Vertraute. »Bitte, Martha. Du kannst offen mit mir sprechen. Das ist gewissermaßen ein Befehl.«
Martha blickt mich stumm an, und ich sehe den Kampf, den sie innerlich mit sich ausficht, auf ihrem Gesicht. Die Wut und die Sorge, die sich gegen alle Konventionen Luft verschaffen und ausgesprochen werden wollen.
»Also gut«, platzt es schließlich aus ihr heraus. »Lady Vivienne FitzGerald, wie könnt Ihr es wagen, mir solche Sorgen zu bereiten? Habt Ihr eine Ahnung, wie lange Ihr fort wart? Es ist mittlerweile fast Nacht! Euer Vater würde Euch das Hinterteil versohlen, wenn er nur die leiseste Ahnung davon hätte, wo Ihr Euch heute herumgetrieben habt. Und das als unverheiratete Frau! Und Eure Mutter …«
Martha schnauft und presst die Augenlider zusammen.
»Und meine Mutter?«
Martha öffnet die Lider wieder. Anstatt Wut schimmert in ihren Augen nun Melancholie. »Eure Mutter wäre vermutlich zu allem Übel auch noch stolz auf Euch, Gott hab ihre Seele gnädig.«
Ich schlinge die Arme um meinen Oberkörper und lächle wehmütig. Irgendwie habe ich vor Marthas Worten bereits geahnt, dass meine Mutter mein Verhalten nicht nur verwerflich finden würde. Vermutlich ist das auch der Grund, warum Martha mich nicht an meinen Vater verraten hat, sondern mir stattdessen von dem irischen Stalljungen ihres Bruders meine Verkleidung besorgt hat.
»Ihr solltet nicht lächeln, wenn man Euch rügt.« Martha schüttelt den Kopf. »Das wird Euch eines Tages noch in Schwierigkeiten bringen.«
Ich ergreife Marthas Hände. »Ich fürchte, es gibt eine unendlich lange Liste an Dingen, die mich in Schwierigkeiten bringen werden. Aber ich freue mich nun einmal über jeden Gefühlsausbruch einer Frau.«
Martha schüttelt abermals den Kopf, und auf einmal wirkt sie erschöpft. »Ich hätte nichts sagen sollen. Verzeiht mir. Es war nicht angebracht.«
Ich verdrehe die Augen. Wie ich sie verachte, diese einschränkenden Regeln und Konventionen. Diese Festlegungen, was man zu mir sagen darf und was nicht. Und was ich sagen darf und was nicht.
Wo bleibt da die Freiheit, die nur als leise Ahnung in meinem Inneren schlummert? Aber dennoch wie eine Glut ist, die niemals erlischt.
Jede Frau sollte zeigen dürfen, was sie fühlt. Aber uns Frauen ist das nicht gestattet. Wir Frauen müssen immer Haltung bewahren, ganz gleich ob als Lady oder als Kammerjungfer. Ganz anders als die Gaelic-Irish beim Hurlingspiel. Und ganz anders als vorhin, als ich mich als Junge verkleidet habe.
Ich blicke an mir hinab, auf die verfilzte Jacke aus Schafsfell, die abgetragene Lederhose, die schlammbespritzten Stiefel. Meine Schwester Adeline würde in Ohnmacht fallen, würde sie mich in diesem Aufzug sehen. Und doch ist er mir viel lieber und weit kostbarer als jedes goldene Seidenkleid.
»Euch muss kalt sein«, sagt Martha nun, die meinem Blick gefolgt ist. »Eure Stiefel sind durchnässt.«
Doch ich spüre die Kälte kaum. Stattdessen wird mir immer wärmer, wenn ich daran denke, wo mich diese Stiefel vorhin hingetragen haben. Wo sie mich wieder hintragen könnten. Zum Hurlingfeld. Wo ich mit den Gaelic-Irish über den Schnee wirbeln könnte, einen Hurley in der Hand, wie Cian es vorgeschlagen hat …
»Oje«, stöhnt Martha. »Ihr habt wieder diesen Blick.«
»Den Traumblick?« So hat Martha ihn früher genannt, wenn ich mir wieder einmal etwas Unerreichbares in den Kopf gesetzt hatte. Und auch jetzt warnt mich mein Verstand davor, mich nicht schon auf dem Hurlingfeld zu sehen, mich nicht in etwas hineinzusteigern, das sogar mir selbst unmöglich erscheint. Dennoch drängen sich Bilder in meinen Kopf. Bilder, wie auch ich einmal von der Wildheit koste, die das Leben zu bieten hat. Wie ich nicht durch Stärke, sondern durch meine Geschicklichkeit und Schnelligkeit, in der ich mich seit Jahren heimlich übe, im Spiel besteche. Wie ich Teil der Mannschaft bin und der Männer, die sich im Wettkampf miteinander messen, wenn sie gegeneinander anstürmen und um den Ball kämpfen, als hinge ihr Leben davon ab. Ich dürfte brüllen und Kampfgeist zeigen, Niederlagen erleben, aber auch den unendlich süßen Geschmack des Sieges.
Und Ruairí … Sein Blick flammt in meinen Erinnerungen auf. Ruairí wäre Teil von meiner Mannschaft. Und vielleicht würde er mich dann öfter so ansehen, wie er mich am Ende des Spiels angesehen hat. Mit vor Stolz glühenden Augen ob des Sieges, ein selbstsicheres Lächeln im markanten Gesicht. Ein wohliger Schauer läuft über meine Haut. Ruairí wirkte vorhin beinahe wie ein König. Wie der mächtigste Mann der Welt.
Und vielleicht war er das im Moment des Sieges auch.
Denn er hat nicht nur gewonnen, er hat gleichzeitig auch Macht über sich selbst besessen.
Ist es da nicht lustig, dass die Leute vor mir den Kopf neigen anstatt vor ihm?
Ein bitterer Geschmack breitet sich auf meiner Zunge aus und holt mich zurück in die Gegenwart. Ich presse die Lippen fest zusammen.
Und Martha fragt: »Kann ich Euch nun beim Umkleiden helfen, Lady Vivienne?«
Meine Verwandlung von einem irischen Wanderarbeiter hin zu Lady Vivienne FitzGerald geht schweigend vonstatten. Die Stille im Raum lastet schwer auf mir, und das Kerzenlicht flackert so sehr, als wäre es vom Aufruhr meiner Gedanken beeinflusst. Erst schält mich Martha aus der verfilzten Jacke aus Schafsfell, dann aus dem kratzigen Leinenhemd. Behutsam löst sie das Tuch, das ich mir fest um meine ohnehin flachen Brüste gebunden habe, um sie gänzlich verschwinden zu lassen.
Es war unangenehm, mit der Schnürung um meine Brust zu atmen, doch als der Druck nun verschwindet, fühle ich mich noch eingeengter. Denn die Körperteile freizulegen, die mich als Frau ausweisen, bedeutet, dem Grund für meine Unfreiheit ins Auge zu blicken. Und das halte ich heute nicht aus.
Nachdem Martha das Tuch ordentlich gefaltet auf den Tisch neben meinem Bett gelegt hat, hilft sie mir aus den abgenutzten Stiefeln, der wollenen Hose und den Strümpfen. Als ich nackt vor ihr stehe, taucht sie einen Schwamm in eine Schüssel mit Wasser und beginnt, mir den Dreck von der Haut zu schrubben.
»Fühlt sich das gut an?«, fragt sie.
Ich nicke. Denn dass sich das kalte Wasser auf meiner Haut anfühlt wie tausend kleine Nadeln, die den letzten Rest der Freiheit von meinem Körper waschen, will ich ihr nicht verraten.
»Danke«, sage ich, nachdem Martha mich gereinigt hat. »Du kannst mir unmittelbar mein Nachtgewand reichen, ich möchte heute früh schlafen gehen.«
Sofort reißt Martha die Augen auf. »Und … das Fest, Mylady?«
Ich ziehe die Augenbrauen zusammen. »Wovon sprichst du?«
Martha schüttelt unmerklich den Kopf. »Sir Liams Ernennung zum Constable wurde wegen des unerwarteten Besuchs des Ó Briain noch nicht gebührend gewürdigt. Hat Euch Euer Vater nicht davon erzählt?«
Doch, das hat er. Erst letzte Woche, als er mir verboten hat, an ebendiesem Besuch teilzunehmen, aus Gründen, die er mir wiederum nicht erklärt hat. Ich war darüber derart enttäuscht, dass ich das Fest für Sir Liam anscheinend vergessen habe, zumal mir bis jetzt unklar war, ob meine Anwesenheit dabei überhaupt erwünscht ist.
Martha holt ein seidenes Unterkleid und hilft mir hinein. »Sir Liam hat darauf bestanden, dass es nur ein kleines Fest im Kreis der engsten Vertrauten Eures Vaters wird.«
Ich atme scharf ein, denn ein kleines Fest ist am heutigen Tag für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn Sir Liam mich in so kurzer Zeit noch ein zweites Mal aus nächster Nähe sieht, dieses Mal ohne Ruß im Gesicht, wird er mich am Ende noch erkennen. Und das will ich nicht erleben. Nicht nur, weil ich als unverheiratete Lady keinesfalls allein die Burg hätte verlassen dürfen, wie Martha vorhin treffend gesagt hat. Sondern weil ich zudem noch in die Irish Town gegangen bin …
Mein Vater würde mich dafür vor allen Anwesenden mit seinem Gürtel züchtigen. Dabei kann ich seinen Hass auf die Gaelic-Irish am wenigsten verstehen. Hat er früher an der Seite meiner Mutter doch beinahe wohlwollend über sie gesprochen.
»Ich denke nicht, dass meine Anwesenheit heute Abend vonnöten ist«, bescheide ich mit zittriger Stimme. »Sagt mein Vater nicht stets: ›Was hat eine Frau schon in einer Runde voller Männer beizutragen? Vor allem, wenn es um Strategie und Politik geht?‹«
In Marthas Gesicht finde ich stumme Zustimmung. Dennoch sagt sie: »Euer Vater hat mir aufgetragen, Euch in Euer prächtigstes Gewand zu kleiden.«
»Zur Verschönerung des Raums?« Mein Lachen klingt hohl. Ich erinnere mich nur allzu gut an das letzte dieser Abendessen, zu Ehren der Ernennung des neuen Bürgermeisters. Abgesehen vom Wetter und dem Rehbraten war meine Meinung zu nichts anderem willkommen gewesen. Und gerade heute, nachdem ich das Gefühl von Freiheit beim Hurlingspiel gekostet habe, will ich nicht wie eine taubstumme Gefangene an der Tafel meines Vaters sitzen und mich von den anwesenden Männern begaffen lassen wie einen Leckerbissen.
Martha geht zurück zu meiner silberbeschlagenen Kleidertruhe und bringt mir ein hellblaues Überkleid aus feinstem Stoff mit silbernen Verzierungen am Ausschnitt.
Ich lege die Hand auf meine Stirn. »Ich fühle mich krank. Gewiss wird mein Vater Verständnis dafür haben, dass ich mich ausruhen muss.«
Doch Martha schüttelt bedauernd den Kopf. Und auf einmal erkenne ich Sorge in ihrem Blick, und mein Bauch zieht sich zusammen.
»Was ist, Martha?«
Sie sieht zu Boden, dann zurück zu mir. Schließlich seufzt sie schwer, geht noch einmal zu meiner Kleidertruhe und kehrt kurz darauf mit einem geöffneten, mit Schnitzereien verzierten Kästchen zurück. In dessen Mitte, auf dunklem Samt, prangt eine silberne Kette mit einem tränenförmigen Saphir.
»Euer Vater hat Euch für heute Abend die Kette Eurer Urgroßmutter bringen lassen«, sagt Martha leise.
Augenblicklich wird mir eiskalt, und die Kehle schnürt sich mir zu.
»Die Kette meiner Urgroßmutter?«
Martha nickt.
Und da zerbricht etwas in mir.
Denn es gibt nur einen Anlass, zu dem die Frauen meiner Familie diese Kette tragen.
Am Tag ihrer Verlobung.
Nur wer soll überhaupt mein Ehemann werden?
Kapitel 3
Ich muss mich beeilen. Ich muss mit meinem Vater sprechen. Denn wenn er erst einmal inmitten der anderen hochrangigen Adeligen an der großen Tafel in der Empfangshalle sitzt – und, Gott bewahre, mein angedachter Ehemann bereits unter diesen weilt –, kann ich meinen Unmut nicht mehr äußern. Oder wohl eher meinen glühenden Zorn.
Wie kann mein Vater es wagen, mir die Verlobungskette bringen zu lassen, ohne auch nur ein einziges Mal zuvor mit mir über meine Verlobung gesprochen zu haben? Ich balle die Hände zu Fäusten. Dabei brennt die silberne Kette mit dem blauen Saphir wie ein glühendes Eisen auf meiner Haut.
Ich fühle mich wie ein Rind, das gebrandmarkt werden soll. In dessen Haut eingebrannt wird, wem es gehört. Als beständige Erinnerung daran, dass ich nicht über mich selbst verfüge. Dass ich der Entscheidungsgewalt anderer ausgeliefert bin.
Ich hasse es, jemandem ausgeliefert zu sein.
Meine Finger wandern zu der Kette, während ich durch die steinernen Gänge von King John’s Castle haste, vorbei an Treppenaufgängen, Fackelhaltern und Bildern von Ahnen, und die besorgten Blicke der Bediensteten auf mich ziehe. Sie können mit Sicherheit nicht verstehen, warum ich mich derart undamenhaft fortbewege. Eine Lady hat schließlich anmutig zu schreiten. Aber ich will in diesem Moment am liebsten rennen. Mir die Kette vom Hals reißen und sie meinem Vater direkt vor die Füße schleudern.
»Vivienne!« Der schrille Ruf meiner Schwester irgendwo hinter mir lässt mich abrupt innehalten. Sie klingt, als ob sie Schmerzen hätte, und auch wenn Adeline und ich uns meist nicht allzu gut verstehen, zieht sich mein Bauch zusammen bei der Vorstellung, dass ihr etwas geschehen ist. Ist sie gestürzt? Braucht sie meine Hilfe?
Ich wirbele herum und haste zurück, bis ich den Treppenaufgang erreiche, den ich gerade erst passiert habe. Doch meine Schwester liegt nicht etwa mit verdrehtem Knöchel auf den Stufen. Stattdessen steht sie mit gestrafften Schultern und anmutig wie eine Königin auf der Treppe, gehüllt in ein burgunderrotes Kleid mit weiten Ärmeln und Pelzbesatz, eine hohe, spitz zulaufende Haube auf dem Kopf, die ihr kastanienbraunes Haar vollständig bedeckt. Ihre spitze Nase ist gerümpft, und ihre schmalen Lippen sind fest aufeinandergepresst. Auf ihre Wangen, auf die sie immer etwas zu viel Gesichtsweiß aufträgt, um ihre Sommersprossen zu verbergen, hat sich Röte gelegt.
»Vivienne«, wiederholt Adeline und schüttelt kaum merklich den Kopf. »Was denkst du dir dabei, derart durch die Gänge zu hasten? Du blamierst uns vor allen.«
Ich verenge die Augenlider. Und sehe, wie Adelines Freundin Joan, die seitlich hinter meiner Schwester steht, beschämt den Blick senkt. So als wäre es ihr unangenehm, dass meine Schwester mich zurückzitiert hat, um mich von der Treppe herab zu belehren. Meine drei Jahre jüngere Schwester wohlgemerkt.
Mir brennt die Bemerkung auf der Zunge, dass hysterisch zu schreien ebenfalls nicht damenhaft ist, aber da ich diese Meinung leider – oder eher zum Glück – nicht teile, schüttele ich nur den Kopf. »Wenn du unnötigerweise nach mir rufst, werde ich darauf eines Tages nicht mehr reagieren, wenn du mich wirklich brauchst.«
»Ha«, schnaubt Adeline und hebt das Kinn noch ein Stück höher. »Als ob du mich retten könntest, wenn ich wirklich in Gefahr wäre. Dafür braucht es die starken Arme eines Mannes. Nicht wahr, Joan?«
Joan fährt mit den Fingernägeln über ihren Handrücken. »Lasst uns nicht streiten. Nicht heute.«
Lady Joan de Clare ist die Schwester von Sir Liam. Mit ihren dunklen, fast schwarzen Haaren und der bleichen Haut sieht sie an den meisten Tagen kränklich aus. Aber heute wirkt sie leichenblass. Und müde. Unendlich müde.
Nimmt sie ebenfalls nicht gern am Fest zu Ehren ihres Bruders teil? Oder weiß sie etwas, das ich bisher nur ahne? Etwa, mit wem ich verlobt werden soll? Dabei wusste nicht einmal Martha die Antwort auf diese Frage mit Gewissheit, und sie hat ihre Ohren und Augen überall auf der Burg.
Adeline schnalzt mit der Zunge. »Ich streite doch nicht. Ich mache mir Sorgen um Vivienne. Was wird Vater sagen, wenn sie derart in den Speisesaal gestürmt kommt? Und erst ihr zukünftiger Ehemann?«
»Du weißt davon?« Mir bleibt der Mund offen stehen. Kurz tanzen schwarze Punkte vor meinen Augen, und ich lenke meine Aufmerksamkeit auf das Gemälde meines achtzigjährigen Onkels James FitzGerald, dem sechsten Earl of Desmond, der mich mit entschlossener Miene anstarrt. Also stimmt es. Mein Vater will mich heute tatsächlich verloben. Und anscheinend hat er Adeline von seinen Plänen erzählt. Adeline, nicht mir, obwohl ich diejenige bin, die er verheiraten will.
Das kann nur eins bedeuten. Mein Vater ist sich sicher, dass ich mit der Wahl meines Ehemanns nicht glücklich sein werde.
»Wen? Wen soll ich heiraten?«
Adeline lächelt süffisant und macht einen Schritt auf der Treppe nach unten. Ihr Kleid legt sich dabei derart elegant um ihren Körper, als wäre es ein Teil von ihm.
»Das kann ich dir nicht sagen.«
»Komm schon.« Ich habe keine Lust mehr, zu meiner Schwester nach oben zu starren, und erklimme die Stufen, bis ich neben ihr stehe. Wenn sie meine Ahnung bezüglich meines zukünftigen Ehemanns bestätigen kann, soll sie es tun. »Wen soll ich heiraten?«
Adeline atmet aus, und irgendwie schafft sie es, dass selbst das tadelnd klingt. »Ungeduld und übermäßige Beharrlichkeit ziemen sich ebenfalls nicht für eine Lady.«
Ich packe Adeline an beiden Schultern. Sie atmet so scharf ein, als hätte ich sie die Treppe hinabgestoßen »Ich habe keine Lust mehr auf deine Spielchen, Adeline. Ich habe keine Ahnung, warum du dich mir gegenüber meist boshaft verhältst oder was ich dir getan habe. Aber wenn du weißt, was Vater vorhat, bitte ich dich inständig, es mir zu sagen. Wir sind Schwestern. Wir sollten zusammenhalten.«
Adelines Augenlider verengen sich zu Schlitzen. »Erzähl du mir nichts von Zusammenhalt. Du bist doch diejenige, die immer eine Ausrede findet, um mich beim Sticken, beim Singen oder bei unseren Lehrstunden mit dem Kaplan allein zu lassen. Du lässt mich im Stich. Wo warst du heute zum Beispiel? Ich habe nach dir gesucht, aber ich konnte dich nirgends finden.«
Ich schließe die Augen. Adelines Vorwurf ist berechtigt. Und ich hätte ihr auch gern gesagt, wo ich gewesen bin. Nur hätte Adeline das nicht gutgeheißen. Und wenn meine Schwester etwas, das ich tue, nicht gutheißt, hat sie die leidige Angewohnheit, es meinem Vater zu petzen.
»Joan?« Ich wende mich an Adelines Freundin.
Doch die schüttelt nur erschöpft den Kopf. »Vergib mir, Vivienne. Aber es ist nicht an mir, dir zu sagen, was Adeline und ich versehentlich belauscht haben.«
Ich seufze. Beide wissen, was mich heute Abend erwartet, doch keine sagt es mir. Beide lassen mich lieber ins offene Messer laufen. Dabei hätte ich das wissen müssen. Adeline ist gehässig, wenn sie beleidigt ist. Und Joan einfach zu gut erzogen.
Ich dagegen habe kostbare Zeit verloren.
Ohne ein weiteres Wort drehe ich mich auf dem Absatz um und haste mit noch längeren Schritten als zuvor in Richtung des Gemachs meines Vaters. Nachdem meine Mutter gestorben ist, hat er ihrem gemeinsamen Schlafzimmer im Nordturm, wo auch Adeline und ich unsere Kemenaten haben, den Rücken gekehrt und sein Gemach ans andere Ende der Burg verlegen lassen. So als ob er möglichst viel Abstand zwischen sich und die Familie bringen wollte, die wir einst waren.
Ich spüre eine Träne über meine Wange rinnen. Wie anders doch alles war, solange meine Mutter noch lebte. Sie hätte niemals zugelassen, dass Adeline und ich uns entzweien. Und von einer bevorstehenden Verlobung hätte sie mir berichtet, sobald sie davon erfahren hätte. Mehr noch, vermutlich hätte sie derart auf meinen Vater eingewirkt, dass er mich sogar gefragt hätte, wen ich heiraten möchte.
Denn es verhält sich ja nicht so, dass ich nicht heiraten will. Nur soll es ein guter Mann sein. Ein Mann, der meine Wünsche und Träume respektiert. Der mich nicht von oben herab behandelt, sondern ernst nimmt. Der zwar nicht immer einer Meinung mit mir ist, sich die meine aber zumindest anhört. Und der mir nicht verbietet, mich frei in Limerick zu bewegen. In der English Town, in der wir Anglo-Irish verkehren, und in der Irish Town, in die ich mich heute verkleidet geschlichen habe. In der ich – so Gott will – vielleicht sogar in Zukunft Hurling spielen kann.
Kein Mann wird das erlauben, höre ich da Adelines Stimme in meinem Kopf. Und wie kommst du überhaupt zu so vermessenen, ja lächerlichen Vorstellungen?Du kannst froh sein, wenn dein Mann dich nicht schlägt. Wenn er kein Säufer und nicht grob zu dir bei der Erfüllung deiner ehelichen Pflichten ist.
Die Übelkeit in mir wächst mit jedem Schritt, denn es stimmt. Was ich mir von einem Mann wünsche, ist nicht üblich. Und vielleicht auch zu viel verlangt. Aber ich habe es bei meinen Eltern gesehen. Früher, als mein Vater und meine Mutter ein Herz und eine Seele waren. Wie füreinander geschaffen. Das ist, wonach ich suche. Das ist, wofür ich kämpfen werde.
»Vater?« Ich klopfe an die Tür zu seinem Gemach und bete inständig, dass er noch dort ist, weil ihm sein Kammerdiener gerade in sein Wams hilft oder ihm seinen festlichen Gürtel umlegt.
Er wird nicht erfreut über die Störung sein. Aber ich muss dennoch mit ihm sprechen, bevor alle sich im Speisesaal versammelt haben.
»Vater! Vater, bitte!«
Doch es bleibt still hinter der eisenbeschlagenen Tür. Und mein Herz wird leise.
Vielleicht täuschst du dich, und er hat es dir nur nicht gesagt, weil es eine freudige Überraschung wird, flüstert mir eine Stimme in meinem Inneren zu. Weil er zur Feier von Sir Liam einen edlen Mann eingeladen hat, den du noch nicht kennst.
Nur kenne ich Sir Liam. Und wenn er eines nicht leiden kann, dann, dass ihm jemand die Aufmerksamkeit stiehlt. Das weiß mein Vater auch. Er würde auch kein Fest für den neuen Constable und damit den zweitmächtigsten Mann von King John’s Castle ausrichten, um ihn dann auf diesem zu brüskieren.
Und das lässt lediglich einen Schluss zu: Mein Vater will mich mit Sir Liam verloben. Dem Mann, der meine Verkleidung als Junge beim heutigen Hurlingspiel fast durchschaut hätte. Der sie nachträglich noch durchschauen könnte. Der Pflicht und Fügsamkeit über alles schätzt.
Gnade mir Gott.
»Vivienne, du hast uns warten lassen!«
Die Stimme meines Vaters ist schneidend, als ich die große Halle betrete. Als Letzte, wie ich zu meinem Entsetzen bemerke, denn alle Plätze bis auf den meinen sind um die Tafel herum bereits belegt.
Mein Vater, der an der Stirnseite der Tafel sitzt, hat die Arme vor der Brust gekreuzt und die buschigen Augenbrauen zusammengezogen. Die anderen Männer um ihn herum wirken ähnlich erzürnt. Verflucht. Ich hätte nicht so lange vor seiner Kammer stehen und mich fragen sollen, ob ich meine Teilnahme am Fest nicht doch verweigern kann.
Ich senke meinen Blick und murmele knicksend eine Entschuldigung. Als ich ihn wieder hebe, ist der Gesichtsausdruck der meisten Männer milder. Nichts beruhigt sie mehr als eine Frau, die sich fügt.
Mit unterdrückter Wut mustere ich die Anwesenden an der Tafel. Auf ihrer linken Längsseite erkenne ich die höchstrangigen Würdenträger der English Town: den Bürgermeister Simon Power sowie die sechs Aldermänner – jene ehemaligen Bürgermeister von Limerick, die gegenwärtig zu den einflussreichsten Männern des Stadtrats zählen und zu denen auch Marthas Bruder Thomas Fanning gehört. Zwei weitere Mitglieder des Stadtrats sind ebenfalls anwesend sowie die beiden Sheriffs, die im Namen des Bürgermeisters die Stadtwache anführen.
Auf der anderen Seite der Tafel sitzen dagegen die höchstrangigen Adeligen der Burg: der Deputy Constable Sir Edmund Roche und der Ritter Sir Nicholas White, der Burgpförtner Sir David Nash, der Gewehrte Geoffrey Purcell, der schon bald zum Ritter geschlagen werden soll, der Schreiber meines Vaters und unser Kaplan. Der ehrwürdige Bischof von Limerick – William Creagh – fehlt dagegen, was mich kurz erleichtert, da ich ihn und seine unterwürfige Art nicht leiden kann.
Dafür sind meine Schwester und Lady Joan anwesend sowie ihre jeweiligen Kammerjungfern, die sich ebenfalls wie die Kammerdiener der Männer im Hintergrund halten. Aus den Augenwinkeln erkenne ich Martha unter ihnen, doch mein Blick weilt nicht lange auf ihr, denn es gibt noch einen weiteren Mann im Raum.
Jenen, den ich bisher bewusst vermieden habe anzusehen.
Sir Liam de Clare.
Sir Liam sitzt unmittelbar neben meinem Vater, seine Lippen sind fest zusammengepresst und nahezu blutleer. Er hält meinem Blick wortlos stand, mustert mich seinerseits eingängig. Von meinem Gesicht bis zu den Spitzen meiner seidenen Schuhe hinab und wieder zurück.
Mir wird heiß, jedoch nicht auf angenehme Art. Und als Sir Liam schließlich geräuschvoll seinen Stuhl zurückschiebt und aufsteht, will ich am liebsten einen Schritt zurückweichen.
Hat er mich erkannt? Oder ist er einfach nur wütend, weil ich zu spät zu seinem Fest komme?
Mein Bauch zieht sich zusammen, als Sir Liam auf mich zukommt. Er ist hochgewachsen, mindestens einen Kopf größer als ich und aufgrund seiner langjährigen Kampferfahrung gut gebaut. Ich schätze ihn auf Anfang dreißig. Seine dunkelbraunen Haare sind ordentlich zurückgelegt, und seine Augen schimmern fast so grau wie ein Eisenschwert. Mit dem dunklen Wams, das er trägt, und dem Dolch, der selbst beim Essen an seinem prachtvollen Gürtel steckt, ist er eine stattliche Erscheinung. Doch in diesem Moment wirkt er vor allem bedrohlich auf mich.
Ich ziehe die Schultern unmerklich nach oben.
Sir Liams Schritte werden langsamer, und er hebt eine Augenbraue, bevor er stehen bleibt, nur knapp vor mir. Mir kommt es so vor, als könnte er unmittelbar ins Innerste meiner Seele blicken.
Ich verstecke meine Hände hinter meinem Rücken aus Angst, dass sich unter meinen Nägeln noch ein letzter Rest Dreck befinden könnte. Er registriert die Bewegung wortlos.
Dann, nach einer schieren Ewigkeit, bietet er mir seinen Arm an.
Ich zögere. Ich kann nicht erkennen, ob Sir Liam mit mir spielt. Hat er das Gesicht des irischen Jungen mit dem von Lady Vivienne bereits abgeglichen und in Übereinstimmung gebracht? Als neuer Oberbefehlshaber der Burgwache muss er in jedem Fall ein äußerst aufmerksamer Mann sein. Andererseits rechnet er gewiss niemals damit, mich verkleidet als Junge in der Irish Town anzutreffen.
Ich schlucke und versuche mit tiefen Atemzügen, meinen Herzschlag zu beruhigen.
»Lady Vivienne.« Sir Liams Tonfall ist der Inbegriff beherrschter Gefasstheit. »Wollt Ihr uns noch länger warten lassen oder gestattet Ihr mir, Euch zu Tisch zu führen?«
»Entschuldigt, Mylord.« Verflucht, meine Stimme sollte nicht derart brüchig klingen. »Es war nicht meine Absicht, Euch und die anderen Gäste warten zu lassen.«
Sir Liam sieht mich prüfend an, dann wird sein Gesichtsausdruck etwas weicher.
Er nickt knapp. »Eure Schwester hat uns bereits berichtet, dass Ihr aufgeregt seid. Das müsst Ihr nicht sein.« Er neigt den Kopf zu mir. »Was auch immer Ihr an Schlimmem befürchten mögt, wird nicht eintreten.«
Ich atme scharf ein, meine Finger zittern leicht. Er hat mich also nicht erkannt. Stattdessen hat er mir mitgeteilt, dass er mir für mein Zuspätkommen vergibt und möchte, dass ich mich in seiner Gegenwart wohlfühle.
»Nun kommt.« Sir Liam zieht mich bestimmt, aber nicht grob mit sich an den Tisch. Noch immer verwirrt, angespannt und überfordert, wütend auf meinen Vater und zugleich ein wenig neugierig, lasse ich Sir Liam meinen Stuhl zurückziehen und nehme dann neben ihm Platz.
»Du hast Glück, dass sie den Braten noch nicht gebracht haben«, zischt Adeline auf meiner anderen Seite, während sich Sir Liam setzt.
Der Kopf meines Vaters ruckt sofort in Adelines Richtung, und in seinem Blick steht die eindeutige Warnung, mein Zuspätkommen nicht noch einmal zur Sprache zu bringen. Sofort senkt Adeline die Lider und verstummt. Joan, die auf der anderen Seite von Adeline sitzt, hat ihren Blick erst gar nicht erhoben.
»Hübsch siehst du aus, Tochter«, sagt mein Vater laut. In seiner Stimme schwingt eindeutig Stolz.
Ich dagegen spüre erneut Wut in mir aufkommen. Schämt er sich denn gar nicht, mich auf diese Art anzupreisen? Noch dazu, wo doch er mir genaue Anweisung erteilen ließ, was ich zu tragen habe?
Kurz huscht ein Ausdruck von Schuld über sein Gesicht, als sein Blick die Kette um meinen Hals streift. Doch bevor er seinen Worten etwas hinzufügen kann, wendet sich Sir Liam mit einem ehrlichen Lächeln um die Lippen an mich. »In der Tat, Mylady. Wenn Ihr mir gestattet, das zu sagen: Euer Anblick ist bezaubernd.«
»Danke, Mylord«, bringe ich hervor, noch verwirrter als zuvor. Ich kann den Mann vor mir einfach nicht mit dem Mann in Einklang bringen, der mir als irischem Jungen verkleidet heute Mittag noch eine gehörige Tracht Prügel angedroht hat. Hier, am Tisch, benimmt sich Sir Liam tadellos, ja nahezu galant. Kein Wunder, dass mein Vater ihn im Namen meines Onkels – dem Earl of Desmond – zum Constable dieser Burg ernannt hat.
Faktisch steht diese Macht meinem Vater zwar nicht zu, denn King John’s Castle gehört offiziell dem englischen König. Doch England war in den letzten Jahren zu sehr mit dem Erbfolgekrieg zwischen den Häusern York und Lancaster beschäftigt, als dass der englische König seine Ansprüche in Irland außerhalb von Dublin hätte durchsetzen können. Folglich wurde mein Onkel, ein Lehnsmann des Königs, immer unabhängiger in seinen Entscheidungen und übertrug einen Teil seiner Macht auf meinen Vater, der seitdem die Stimme und der Arm meines Onkels auf King John’s Castle ist, solange dieser auf Askeaton Castle südlich von Limerick weilt.
Die beiden Männer sind sehr unterschiedlich, da mein Onkel sich weit stärker an die gälische Kultur angepasst hat als mein Vater. Andererseits hat mein Onkel sein Leben auch nicht auf einer Burg verbracht, die unmittelbar an eine englische Royal Borough grenzt – eine Stadt, die dank des englischen Königs besondere Rechte und Freiheiten besitzt und ein Außenposten englischer Kultur ist. Dennoch hat sich mein Onkel kaum in die Belange der English Town von Limerick eingemischt und erst recht nicht, seitdem er vor Monaten schwer erkrankt ist.
Ob er überhaupt weiß, dass mein Vater meine Hochzeit plant?
Ich würde ihm diese Frage gern stellen, doch in diesem Augenblick wird die Tür zum Empfangsraum erneut geöffnet, und die Bediensteten tragen das Mahl auf.
Allein beim Anblick der auf großen Holzbrettern angerichteten Speisen läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Es gibt gebratenes Wildschwein, Reh und Lamm, auf offener Flamme gerösteten Fisch mit einer Kräuterkruste aus Honig, Körbe mit frischem Brot, Schalen mit herzhaftem Eintopf aus Bohnen, Kohl und Lauch und sogar frische Früchte.
Dabei war ich bis gerade eben noch kein bisschen hungrig.
Der Duft, den das Essen verströmt, ist betörend, und alle am Tisch fallen über die Speisen her wie hungrige Tiere. Dabei ist hier in der English Town niemand ausgehungert. Anders als in der Irish Town, in der ich heute einige ausgemergelte Gestalten gesehen habe.
Ich nehme ein paar Bissen zu mir, doch das Gefühl von Schuld ist plötzlich übermächtig. Wie kann ich hier sitzen und in Hülle und Fülle speisen, während auf der anderen Seite des Flusses die Menschen schimmliges Brot essen und zum Teil sogar dem Hungertod nahe sind?
»Mundet Euch das Reh nicht, Lady Vivienne?« Die Stimme von Sir Liam klingt ehrlich besorgt. »Hier.« Er schneidet ein Stück des Lamms ab, das er sich gerade erst auf den Teller gelegt hat. »Kostet hiervon. Es ist vorzüglich.«
Bevor ich ihn daran hindern kann, hält Sir Liam mir sein Essmesser hin. Sein Blick ist auf meinen Mund gerichtet.
»Nein danke«, bringe ich hervor. »Mir ist gerade nicht nach Lamm.«
»Vivienne«, zischt mein Vater warnend. »Sir Liam bietet dir sein Essen an. Iss.«
Ich würde am liebsten widersprechen, doch das zuckende Augenlid meines Vaters lässt mich davon absehen.
»Verzeiht«, murmele ich stattdessen, beuge den Oberkörper nach vorn und ziehe mit den Lippen vorsichtig das Stück Fleisch von Sir Liams Essmesser. Dabei entgeht mir nicht, wie genau er jede meiner Bewegungen beobachtet.
Hitze steigt mir in die Wangen, ohne dass ich weiß, warum. Fühle ich mich peinlich berührt? Oder einfach nur vorgeführt?
Ich fächle mir Luft zu. »Ich fürchte, mir ist heute nicht wohl. Ich … Ich glaube, es ist besser, wenn ich mich zurückziehe und mich hinlege.«
Mein Vater setzt seinen Krug mit Ale schwunghaft ab. So schwunghaft, dass er krachend auf die hölzerne Tischplatte trifft. Augenblicklich verstummen die Gespräche am Tisch, und die Gesichter aller Gäste wenden sich zu meinem Vater.
Erwartungsvoll. Gespannt.
Mein Vater räuspert sich. Dann schiebt er seinen Stuhl zurück und steht auf. Sein bereits ergrautes Haar fällt ihm in die Stirn und bedeckt die wulstige Narbe, die er sich einst in einem Kampf zugezogen hat. Er überkreuzt die Arme erst vor seinem Bauch, dann breitet er die Arme wieder aus.
»Wir alle haben uns heute Abend hier versammelt, um Sir Liam de Clare zu ehren. Sein Vater war bis zu seinem Tod ein mutiger und entschlossener Mann, der dieser Burg über viele Jahre als Constable gedient hat. Er war loyal, ein treuer Ratgeber und stand mir stets unerschütterlich zur Seite. Sein Sohn – unser geschätzter Sir Liam – hat nun gelobt, es ihm gleichzutun.«





























