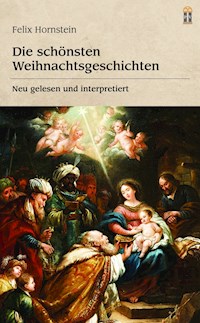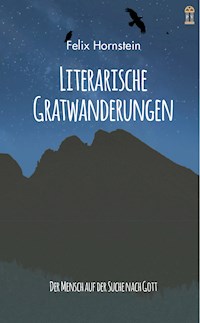
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Patrimonium
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Mit einem Vorwort von Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz Was haben Otfried Preußlers »Krabat«, die Sage von Orpheus und Eurydike und Julian Barnes‘ »A History of the World in 10 ½ Chapters« gemein? Jugendliteratur, griechische Mythologie und eine unkonventionelle Geschichte der Menschheit in Geschichten – zwischen ihnen, aber auch Homers »Odyssee« und der Legende des heiligen Christophorus, die Felix Hornstein zur Grundlage seiner Interpretationen macht, scheint kein Zusammenhang zu bestehen – oder doch? Allen lassen sich aus christlich-katholischer Perspektive wertvolle Einsichten abgewinnen. Felix Hornstein stellt in diesem Zusammenhang nicht nur Bezüge zur Bibel her, sondern auch zur Gottesfrage und er sucht Spuren Gottes in bekannten Werken der Weltliteratur. So wird nicht nur die Parallele zwischen Moses‘ Auszug aus Ägypten und der »Odyssee« deutlich, Hornstein eröffnet auf einer literarischen Gratwanderung vor dem Hintergrund seines persönlichen Glaubens eine völlig neue Perspektive auf die vorgestellten Texte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Ähnliche
Felix Hornstein
Literarische Gratwanderungen
Felix Hornstein
Literarische
Gratwanderungen
Der Mensch auf der Suche nach Gott
Patrimonium-Verlag 2020
Impressum
1. Auflage 2020
© 2020 Patrimonium-Verlag
In der Verlagsgruppe Mainz
Alle Rechte vorbehalten
Printed in GermanyErschienen in der Edition »Patrimonium Poeticum«
Patrimonium-Verlag
Verlagsgruppe Mainz
Süsterfeldstraße 83
52072 Aachen
www.patrimonium-verlag.de
Gestaltung, Druck und Vertrieb
Druck & Verlagshaus Mainz
Süsterfeldstraße 83
52072 Aachen
www.verlag-mainz.de
Umschlag:
Gestaltung Dietrich Betcher
Druckbuch:
ISBN-10: 3-86417-136-9
ISBN-13: 978-3-86417-136-9
E-Book:
ISBN-10: 3-86417-151-2
ISBN-13: 978-3-86417-151-2
Utrique uxori,
et vivae et defunctae
Geleitwort
Wie wohl tut es, Texte zu lesen, in denen die Sprache stimmt. Und dann erstaunlich und tief erfrischend: in denen auch das Denken stimmt. Obwohl dieser Zusammenhang in Wirklichkeit natürlich klar ist. Denn Worte gebären ja Welten, und wer in solchen Welten wandert, dem erweist sich die Wahrheit des Gesagten überraschend und doch wieder selbstverständlich, altbekannt und heute morgen neu.
Text heißt eigentlich Gewebe. Es gibt Texte, die aus der Kunst des Zusammenwebens vielfältiger Fäden bestehen. Und das Gewebe zerfasert nicht, es wird dicht und bunt und lockt immer tiefer in das Verschlungene hinein.
Das geschieht hier: Was für eine Spanne zwischen einem Kinderbuch über Fisch und Frosch bis zu Orpheus und Eurydike und ihrem vergeblichen Gang aus dem Totenreich! Oder von Krabat und Christophorus, der das Weltenkind trägt, über Julian Barnes’ merkwürdige Satire auf Himmel und Hölle bis zu Odysseus und Kalypso und dem bekannten Elefanten, um den sich die Religionen sinnlos streiten… Aber der kenntnisreiche Blick des Autors leuchtet in die Tiefe des bunt Gehäuften und verwebt Neuzeit, Postmoderne und Antike in ihrer vielfach berührenden Lebendigkeit. So steht Hölderlin mühelos neben Augustinus, dieser neben Sappho, aber auch neben der Volkssage vom Schwarzen Müller; Ovid neben Reiner Kunze und C. S. Lewis. Es macht Freude, sich ins Getümmel der Bilder und Zitate zu werfen, sich ins Netz der Bezüge zu verstricken und wieder hellsichtig herausgeführt zu werden. In allen Überschreibungen taucht zugleich die Gestalt des Menschensohnes auf, des Gottes, der lebte und starb und auferstand – unerschöpflich für alles Verstehen. Es ist Kunst, diese Geschichten so ineinander zu blenden und darin das Leben in seinem Rhythmus von Freude und Trauer pulsieren zu lassen, zwischen »Nichts und Fülle«.
Nicht oft geschieht ein so großer Dienst an der heutigen Kultur, ihr solche Perlen ihres eigenen Könnens, ihrer Herkunft, ihrer Spannweite zu zeigen. Europa ist müde geworden, auch an sich selbst. Hier strömt Wasser aus dem verhärteten Felsen. Und wie immer geschieht darin »das Beschenktwerden durch eine Huld, das Aufblühen eines Neuen, das beglückende Geraten eines Vollkommenen, das freie Sich-Öffnen des Herzens« (Romano Guardini).
Solche Deutungen machen das Leben wieder zu dem, was es immer war: zum göttlichen Entwurf.
Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
Erlangen, 4. Februar 2020
Vorwort
»Jeder von uns steht auf des Messers Schneide zwischen dem Nichts und der Fülle des göttlichen Lebens.«
Edith Stein
»The proof of the pudding is in the eating«: Philosophen und andere Denker sind berühmt dafür, Gedankengebäude zu errichten. Die Frage, die sich dabei stellt, ist nur, ob man darin auch wohnen kann: Ist das Dach dicht, tragen die Balken, wird geheizt? Sicher ist wohl nur, dass man auch für Gedankengebäude mitunter recht hohe Mieten zahlen muss.
Doch Scherz beiseite: Ihre wirkliche Gefahr besteht darin, nur Vorspiegelung von Wirklichkeit zu sein, falsche Abstraktion, Wahnidee, in die sich einer verrennt. Und diese Gefahr kommt aus der Vernunft selbst. Denn diese neigt, ihrer eigenen Logik folgend, dazu, die Dinge zu scharf weiterzudenken. Wie das Skalpell des Chirurgen schneidet sie oft zu viel weg, wie ein Bulldozer schlägt sie zerstörerische Schneisen durch feingliedrige und zerklüftete Landschaften. Doch manche Dinge, die »eigentlich« klar sind, sind es nicht mehr, wenn man beginnt, sie in die Wirklichkeit umzusetzen. Nicht weil die Wirklichkeit nicht logisch wäre, es geht auf der Welt schon mit rechten Dingen zu, sondern weil sie corpus mixtum ist, Knäuel von Wirklichkeiten, Konglomerat, mehr noch Brekzie. Der Verstand tut sich schwer damit, die Dinge in ihrer ungeheuren Verwicklung zu begreifen. Er ist zu eindimensional und zu abstrakt. Und so führt gerade die logische Konsequenz manchmal in den Abgrund.
»The proof of the pudding is in the eating«: Der Beweis für die Richtigkeit der Theorie ist die Anwendung, der Beweis für die Wahrheit der Philosophie ist das Leben. So ist die Schwäche der Literatur zugleich ihre Stärke: Sie erzählt vom Leben, schöpft direkt aus ihm. Gute Literatur ist immer verdautes, durchdachtes, mit aller Aufmerksamkeit wahrgenommenes und durchdrungenes Leben.
Wenn man nun mit Hilfe der Literatur Philosophie und Theologie treibt oder umgekehrt, wenn man Literatur aus dem Blickwinkel der Philosophie, Theologie und Geschichte betrachtett, »erdet« man die Gedankengebäude. Man überprüft ihre Wirklichkeitstauglichkeit, sieht, ob sie vor dem Leben bestehen können.
Nie kommt man auf diese Weise zur Geradheit eines »reinen« philosophischen Diskurses, immer aber zu festen Gestalten, Ursituationen, Beispielen und wahren Bildern. Die Anwendung der Philosophie und Theologie auf die freilich nur in der guten Literatur gespiegelte Wirklichkeit beweist die Wahrheit der Gedanken. Und sie verhilft zu ungeahnten Einsichten und Durchblicken, die anders schwer zu gewinnen sind.
Soviel zu »literarisch«. Warum aber Gratwanderungen? – Weil jeder weiß, wer Gott ist, ob er´s glaubt oder nicht, weil jeder aber auch den großen Abyssus kennt, den Abgrund, das schwarze Loch des Nichts. Leben heißt balancieren, auf schmalem Grat zwischen diesen beiden Welten seine Schritte setzen. Und dieser Weg will bestanden sein.
So gehen wir auf dem Grat, wie ein Seiltänzer, immer nur den nächsten Tritt vor Augen und unter uns den Abgrund. Wir gehen aber auch auf den Grat zu, auf eine Wand, hinter der sich ein neues Land auftut – oder nicht? Wir leben im Diesseits und wissen nicht, was jenseits unserer Welt ist, wir tragen nur die unsterbliche Hoffnung in unseren Herzen und das Wissen, dass es hinter jedem verschlossenen Tor noch immer weiterging. Alles oder nichts.
Ich habe in diesem Buch eine Reihe von Aufsätzen zu höchst unterschiedlichen Werken der Literatur versammelt, die alle von unserer Wirklichkeit ausgehen, von der Situation, in der wir uns in dieser Welt befinden. Diese Texte sind ihrerseits bereits stark verdichtet, immer aber zeigen sie, was Leben heißt, diese Unmöglichkeit, die Wirklichkeit ist. Oder sagen wir besser: was Schöpfung heißt. Denn kein Leben erklärt sich aus sich selbst, alles verweist auf einen geheimnisvollen, schrecklichen und furchtbaren, doch zugleich herrlichen, heiligen und unendlich guten Ursprung, auf den »Geber der Gabe«.
Felix Hornstein
Tegernsee, am vierten Advent 2019
Krabat von Otfried Preußler
Einleitung
Ist ein Jugendbuch ein behandlungswürdiger Gegenstand? Man kann sich fragen, wie man auf einen derartigen Gegenstand kommt. Ob es nicht größere Literatur gebe.
Wenn ich ein umfangreiches, kompliziertes und »dunkles« Werk für Erwachsene vorlege, kann die Fülle der ausgebreiteten Gedanken über strukturelle Schwächen hinwegtäuschen. Wenn ich es schaffe, mit einem einzigen Strich eine ganze Landschaft vor dem geistigen Auge erstehen zu lassen, dann muss ich als Maler ganz genau wissen, wie ich diesen Strich ziehe. Da gibt es nicht, wie bei mancher barocken Figur, eine Menge Stoff, die Fehler in der Orthopädie kaschieren kann. – So ist die Kunst, Jugendliteratur zu schreiben, die Kunst der Reduktion. Jugendbücher sind schwerer zu schreiben als Bücher für Erwachsene. Hier muss alles stimmen. Kinder- und Jugendbücher muss man deshalb nicht anders schreiben als Bücher für Erwachsene, sondern besser!1
Freilich: Meistens ist das nicht der Fall. Darum gibt es ja auch nur so wenig gute Jugendliteratur. Otfried Preußler aber ist mit seinem Krabat ein wahres Meisterwerk gelungen, das durch die Gedrängtheit der Aussagen, die gleichzeitige Leichtigkeit und Schlichtheit, die Einfachheit in Form und Sprache bei gleichzeitiger Tiefe alle Ansprüche an ein großes Kunstwerk erfüllt. Hier entsteht ein ganzer geistiger Kosmos vor unseren Augen. Preußlers Krabat ist nicht weniger als eine Deutung unserer ganzen Welt.
Ich weiß übrigens nicht, wieweit sich Preußler dessen bewusst war. Wenn man nachliest, was er zur Entstehung des Krabat selbst geschrieben hat,2 kann man den Eindruck bekommen, er habe gar nicht gewusst, welch weiten Horizont sein Werk eröffnet. Aber vielleicht hat er sich hier nur ein bisschen versteckt.
Vorausschicken muss ich ein paar einführende Bemerkungen: »Krabat« geht auf eine alte Sage zurück, die aus der Lausitz stammt, jener Landschaft zwischen Schlesien und Sachsen, die uns zum größten Teil noch geblieben ist und in der es noch die letzten Reste der slawischen Bevölkerung gibt, die das Gebiet zwischen Elbe und Oder einst besiedelte. Die Sage vom Zauberer Krabat ist in der Lausitz allenthalben bekannt. Es gibt auch interessante literarische Fassungen des Stoffes, v.a. von dem 1916 geborenen sorbischen Autor Jurij Brĕzan.3 Und ich habe mir bei der geistigen Suche nach ähnlich ausgeprägten Sagengestalten gedacht, dass auch Goethe statt einem Faust einen Krabat hätte schreiben können: Denn der Krabat, der uns in den »Volksbüchern« entgegentritt, ist in seiner Suche nach Wissen und Macht eine in vielerlei Hinsicht faustische Gestalt, wenn auch eine, die gegen den Teufel kämpft. Krabat ist zugleich auch ein Robin Hood, den man freilich nicht mit Pfeil und Bogen gegen den Sheriff von Nottingham kämpfen sieht, sondern mit geheimnisvollen Zauberkräften gegen die Mächtigen und Reichen seiner Zeit. Preußler hat die alten Sagen in einer bemerkenswerten Weise umgeschrieben und mit viel Kolorit versehen: Er hat sich in die Welt der Mühlen eingearbeitet und er hat sie in der Zeit des Nordischen Krieges angesiedelt, im ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts, genauer etwa zwischen 1706 und 1710.4
Ich kann den Inhalt des Buches hier leider keineswegs erschöpfend wiedergeben. Deshalb stelle ich an den Anfang nur einen so knapp wie möglich gehaltenen Überblick, zur Orientierung für diejenigen, die die Erzählung noch nicht kennen, zur Auffrischung für die, die das Buch schon gelesen haben. Im Übrigen kann ich jedermann nur raten, das Buch selbst zu lesen.
Der Inhalt
Krabat, unterwegs als einer von drei heiligen Königen, hört im Traum eine Stimme: »Komm nach Schwarzkollm in die Mühle, es wird nicht zu deinem Schaden sein.«5Er macht sich auf den Weg und findet schließlich die Mühle im Koselbruch: »Da lag sie vor ihm, in den Schnee geduckt, dunkel, bedrohlich, ein mächtiges, böses Tier, das auf Beute lauert.«6
Er verdingt sich als Lehrbub. Das Leben ist hart, nur dem dummen Juro, der sich um die Küche kümmert und von allen wie der letzte Dreck behandelt wird, geht es noch schlechter. Immerhin hat er einen Freund, den Altgesellen Tonda, der sich seiner annimmt. Sehr bald muss Krabat die Erfahrung machen, dass es auf dieser Mühle nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber für einen Waisenknaben gibt es keinen Grund zur Flucht, solange es noch Winter ist.
Die Mühle ist vollkommen von der Außenwelt abgeschottet und doch wird auf ihr Tag für Tag gearbeitet, auch an den Sonntagen. Aber niemand erklärt ihm, warum das so ist.
Eines Nachts wacht er aus einem Traum auf. Er blickt aus dem Fenster und sieht wie dort ein Planwagen steht, von schwarzen Rössern gezogen, er sieht einen Mann auf dem Kutschbock sitzen, mit hochgezogenem Mantelkragen und den Hut in die Stirn gezogen »nachtschwarz auch er«7. Eine Hahnenfeder steckt an seinem Hut – gleich einer Flamme taucht sie den Vorplatz in flackerndes Licht. Die Knappen aber tragen schwere Säcke zum Toten Gang und bringen sie zurück, als das Gut vermahlen ist.
Wieder erklärt ihm niemand, was das zu bedeuten hat.
Am Karfreitag erfährt Krabat, dass er auf einer Schwarzen Schule gelandet ist. Er erhält ab sofort jeden Freitagabend einen nach didaktischen Maßstäben veralteten, aber sehr effektiven Unterricht in der Kunst zu zaubern. Und er merkt, dass ihm die Mühle damit auch etwas anbietet, das sich zu lernen lohnt.
Die Osternacht müssen die Knappen paarweise unter freiem Himmel verbringen, um »sich das Mal zu holen«8. In dieser Nacht hat der Meister keine Gewalt über sie und es kommt zu einer Begegnung mit der Außenwelt. Zusammen mit Tonda, der Krabat in dieser Nacht erzählt, wie der Meister seine Freundin Worschula in den Tod getrieben hat, begegnen sie den Mädchen aus dem Dorf, die das Osterwasser holen und sie hören die Stimme der Vorsängerin, der Kantorka, die ein altes Osterlied singt.
Wieder zu Hause, werden die Knappen dem Meister neu verpflichtet und dürfen bald darauf endlich feiern.
Das Jahr vergeht im Alltag, der nur gelegentlich von lustigen Begebenheiten unterbrochen wird.
Im Herbst entdeckt Krabat den Wüsten Plan, eine abgelegene und ungeschmückte Gräberstätte im Moor. Tonda schenkt ihm »als Andenken« sein Messer, das die wunderbare Eigenschaft hat, eine dunkle Farbe anzunehmen, wenn seinem Besitzer Gefahr droht.
Als der erste Schnee fällt, werden die Mühlknappen äußerst reizbar. Weihnachten fällt komplett aus und auch am Silvesterabend geht man wie immer zu Bett. Doch kurz vor Mitternacht wachen alle auf, um gleich danach einen entsetzlichen Schrei zu hören: Tonda fehlt. Er ist tot, er »hat sich den Hals gebrochen«.9
Am nächsten Tag beerdigt man ihn in aller Hast, ohne »Pastor und Kreuz« und ohne überhaupt noch von ihm zu sprechen. In bedrückter Stimmung verbringen die Knappen die nächsten Tage untätig, bis der Meister die Knappen eines Abends wieder zur Arbeit ruft und ein neuer Lehrbub da ist: Witko. »Die Mühle, sie mahlt wieder«10, und das Leben geht seinen Gang.
Die Trauer um Tonda wird durch einen Traum bewältigt, in dem dieser Krabat im Koselbruch erscheint, »am anderen Ufer« und ihm bedeutet, auf der Welt zu bleiben und sich an den Burschen zu halten, dem er als nächstes begegnet. Als Michal und Juro Krabat gleichzeitig wecken, hält sich dieser an Michal, der in vielem Tonda gleicht.
Das Jahr vergeht ähnlich dem ersten. Nur in der Osternacht wendet Krabat die Kunst an, aus seinem Leib herauszugehen, um die Kantorka zu sehen. Er verliebt sich in das Mädchen, hält das aber geheim. Im September des Jahres feiert der Meister mit den Knappen den Radhub und am Jahresende muss wieder einer dran glauben. Diesmal ist es Michal, der durch seine Gerechtigkeit mit dem Meister in Konflikt gekommen ist.
Michals Vetter Merten lässt sich von niemandem die Trauer verbieten. Er geht in die innere Emigration und versucht schließlich zu fliehen, was ihm aber nicht gelingt – auf dieser Mühle nicht gelingen kann. Krabat erlebt die Mühle als Gefängnis ohne Ausgang und den Meister in all seiner Grausamkeit. Und er beschließt, gegen ihn zu kämpfen.
Die dritte Osternacht verbringt er mit dem ebenso liebenswürdigen wie lustigen neuen Lehrbuben Lobosch und er kann es so einrichten, dass er auf dem Rückweg die Kantorka trifft. Sie kennt ihn, denn sie hat von ihm geträumt, und so hält sie zu ihm.
Aber jetzt kommt eine schwierige Zeit für Krabat. Denn auch dem Meister kann jetzt nicht mehr entgehen, dass Krabat verliebt ist. Er versucht es mit Strenge und schließlich mit Güte, ihn dazu zu bewegen, etwas zu erzählen. Er gibt ihm schließlich sogar, als seinem besten Schüler – Krabat lernt in der Schwarzen Schule, was er kann, um gegen den Meister bestehen zu können – für die Sonntage freien Ausgang.
Krabat ahnt die Falle, aber er kann sie nur mit der Hilfe Juros umgehen. Dieser von Allen verachtete Trottel erweist sich als der gescheiteste Knappe auf der ganzen Mühle. Er spielt ein Versteckspiel, das es ihm erlaubt, die Arcana der Macht kennenzulernen: Er kann sogar lesen, er weiß, wie man sich vor dem Meister verborgen halten kann und wie man seine Macht brechen kann: Man braucht dazu ein Mädchen, das einen in der Silvesternacht freibittet.
Aber das ist nicht so leicht, wie man meinen möchte: Das Mädchen muss nur den Burschen, den es liebt, unter den anderen herausfinden. Aber wie geht das, wenn der Meister den Burschen befiehlt, sich in Raben zu verwandeln und den Schnabel unter den linken Flügel zu stecken? Ab sofort trainieren die beiden Freunde in jeder Nacht, wenn der Meister über Land gefahren ist, sich seinem Willen zu widersetzen. Krabat wird bei der Probe einfach den Schnabel unter den rechten Flügel stecken! Aber das ist das Schwierigste, was es gibt, und oft meint Krabat, er werde es nie schaffen.
Es wird Kirchweih, bis Krabat die Kantorka treffen kann, um sie zu fragen, ob sie bereit ist, ihn herauszubitten. Sie sagt zu und mithilfe eines Ringes von Haar, den sie ihm abschneidet, kann Krabat seine Kräfte verdoppeln. Jetzt gewinnt er jeden Probekampf gegen Juro.
So geht es auf das Ende zu: Der Meister merkt, dass er an Krabat nicht herankommt und er beginnt, sich zu fürchten. Wenige Tage vor Jahresende bietet er ihm die Mühle an. Als Krabat ablehnt, zeigt er ihm die Krallen. Doch Krabat besteht die Versuchung und am Silvestertag kommt die Kantorka, wie abgemacht, auf die Mühle, um Krabat frei zu bitten.
Deutung
I. Die Welt der Mühle
Mit einer ungeheuerlichen Schlussszene, auf die ich noch zu sprechen komme, geht der Krabat zu Ende. Der Schleier wird nicht gelüftet. Der Vorhang fällt. Schnee hüllt alles gnädig ein.
Auch das ist Absicht – wie mir scheint: Das Leben bleibt rätselhaft, es gibt keinen Durch- oder Überblick. Wir finden keine Weltformel, stehen immer wie der »Ochs am Berg«. Aber wir wissen zu unterscheiden zwischen Gut und Böse, wir wissen zu unterscheiden Wahrheit und Lüge, Liebe und Selbstsucht. Krabat weiß, was er getan hat, er weiß, dass er es tun musste – so sehr es vielleicht sogar auch ihm leid tun mochte um die Kunst zu zaubern.
Preußlers Krabat ist wie eine Prinzregententorte, die man in verschiedenen Schichten lesen kann: Als Abenteuergeschichte, als Beschreibung einer Diktatur, als Bericht über die Versuchung des Menschen durch die Zauberkraft (also als Parabel für die moderne Welt der Technik), als Liebesgeschichte, als religiöse Weltdeutung. Ich will jetzt einige von diesen Schichten anschneiden, sozusagen Aufschlüsse im geologischen Sinne gewinnen und vielleicht auch die Aufmerksamkeit in bisher noch nicht bedachte Richtungen lenken.
Zunächst einmal: Dieses Buch ist starker Tobak, alles andere als ein harmloses Büchlein zur Unterhaltung von Kindern. Eigentlich ein Erwachsenenstoff, den Preußler hier für etwas jüngere Semester aufbereitet hat. Und wenn man an die grausamen Todesszenen denkt – andere Grausamkeiten bleiben angedeutet – so ist das alles andere als Kuschelpädagogik. Aber gerade das ist die besondere Stärke dieses Buches: Es beschönigt nichts, redet die Dinge nicht – verfälschend – schön. Krabat ist aber ein Buch, das Mut macht: Du kannst es schaffen, du wirst es schaffen, du musst es schaffen – aber mach dir nichts vor, es ist schwer! Doch es lohnt sich – trotz allem!
Worum geht es? Die Mühle ist, wie man sieht, eine grausame, eine verkehrte Welt, eine Welt unter der Knute eines unbarmherzigen Herrschers. Dennoch ist diese Welt nicht nur schlecht. Sie ist z.T. auch recht angenehm, ja sogar ganz gemütlich. Denn sie hat ihre feste Ordnung, sie läuft berechenbar – die Mühle, »sie mahlt wieder«11 –, es gibt auf ihr ein illustres, recht nettes Völkchen von Gesellen. Vor allem aber ist die Mühle warm, es gibt, sehr wichtig, immer reichlich zu essen, die Arbeit tut normalerweise nicht weh, am Abend sitzen die Gesellen einträchtig bei ihrem Zeitvertreib herum: Man hört nur zu ganz bestimmten Anlässen davon, dass sie streiten und man hört auch nie davon, dass einer sich verletzt oder krank wird oder dass sonst ein Unglück passiert. Und manchmal wird auch zünftig und ausgelassen gefeiert. Nächtliches Ausrücken und ähnliche Dinge sind zwar vergleichsweise unangenehm, aber auch das kommt nicht allzu oft vor und es lässt sich überstehen. Also alles in allem ist die Mühle zwar keine Luxusherberge, aber für einen Bettlergesellen, der nicht weiß, wie er seinen Bauch vollkriegen soll und der frierend über die Landstraßen zieht, doch eine Bleibe, in der sich´s aushalten lässt. Und so denkt Krabat in den ersten Monaten ja auch, obwohl er da noch richtig hart ran muss. Und da weiß er noch gar nichts vom Besten, was es auf der Mühle gibt, von der Macht zu zaubern.
Man könnte jetzt meinen, ich sei verrückt, nach alledem, was auf der Mühle geschehen ist, aber dieser Punkt scheint mir doch für die Gesamtdeutung wichtig zu sein: Die Mühle ist ein Ort, an dem sich´s immerhin – auch – leben lässt!
Die Mühle ist ein Mikrokosmos, eine kleine Welt für sich. Nicht ohne Kontakt nach außen und dennoch eine Größe für sich. Es sind genau zwölf Knappen, die auf ihr Dienst tun, keiner weniger und keiner mehr. Und wenn die Zahl nicht voll ist, mahlt die Mühle nicht – oder, wie in den Neumondnächten zwischen Neujahr und Ostern, der Meister muss einspringen und den fehlenden zwölften Gesellen ersetzen. Zwölf ist die Zahl der Monate des Jahres und damit nach alter Bedeutung einer Welt. Sie ist aber auch die Zahl Israels und der Kirche: Zwölf Söhne hat Jakob und diese werden zu den Stammvätern der zwölf Stämme. Jesus, so heißt es ganz schlicht in der Bibel, »machte Zwölf« (Mk 3,14, vgl. Lk 6,13) und diese Zwölf »sind« dann auch die Kirche, weshalb sich diese Zahl an den Salbstellen, den Apostelkreuzen und oft auch an anderen Stellen im Kirchengebäude wiederfindet.
Nun ist die Mühle ganz und gar keine Kirche und alles andere als ein heiliger Ort. Sie ist viel eher die Umkehrung des Heiligen, sein Zerrspiegel und Gegenbild. Nimmt man die Zaubermacht und den Willen, der hinter ihr steckt, dazu, findet sich dahinter der Versuch der Aufspreizung des Endlichen zum Absoluten. Das aber ist das Signum des Teufels. Die endliche Macht, die absolut werden will, das Endliche, das alles sein will. Und das sich absolute Macht, Verfügung über die Welt, Sicherheit und Unabhängigkeit erhofft. Und doch nie erringen kann.
Nach zwei Jahren – so lange hat er gebraucht – ist auch Krabat klar, welches Spiel auf der Mühle gespielt wird: Der Meister hat einen Pakt mit dem Herrn Gevatter, wie er ihn nennt. Er hat einen Chef, der ihm die Mühle gegeben hat. Dafür ist er ihm gewisse Dienste schuldig – wir haben von den Neumondnächten gehört –, v.a. aber bezahlt er für die Macht, die ihm die Herrschaft über die Mühle gibt, mit Blut. Jedes Jahr in der Silvesternacht muss einer der zwölf Knappen dran glauben – oder der Müller selber ist dran.
Wer ist der Herr Gevatter? Der Teufel, wird man sagen. Wir kennen das Motiv des Teufelspaktes ja. Aus dem Volksbuch von Dr. Faustus und dem, was Goethe daraus gemacht hat oder ganz explizit mit den zwölf Knappen aus Selma Lagerlöfs Roman Gösta Berlings Saga. Auch der Urkrabat oder der Krabat, der uns in den Dichtungen von Jurij Brĕzan begegnet, ist eine faustische Gestalt: Er will das absolute Wissen erringen und verdingt sich dafür in der Mühle. Er wird aber betrogen und versucht nun seinerseits den Betrüger zu betrügen – in einem verzweifelten Kampf, in dem Krabat, der immer der gute Zauberer bleibt, schließlich gewinnt.12 Da ist der Müller der Teufel.
In Preußlers Krabat trägt der Herr Gevatter ganz eindeutig teuflische Züge: Einmal hört Krabat die Stimme des Fremden: »Es war eine Stimme wie glühende Kohlen und klirrender Frost in einem. Er spürte, wie es ihm eiskalt den Rücken hinablief, während er gleichzeitig das Gefühl hatte, mitten in einem lichterloh brennenden Feuer zu stehen.«13
Dennoch kann man nicht einfach von einer Gleichsetzung des Herrn Gevatters mit dem Teufel ausgehen. Seine Gestalt ist teuflisch, aber sie bleibt unbestimmt. Ihre Dunkelheit und Unbestimmtheit selber – gerade für den jugendlichen Leser etwas sehr Nachdrückliches, Rätselhaftes – ist Teil seines Wesens: Es geht um die verneinende, zersetzende, durcheinanderbringende Macht. Diese ist nicht klar. Ihr Wesen ist Lüge und Betrug. Mit dieser Macht des Bösen, die uns bedrängt und deren wir uns zu erwehren haben, steht der Meister in Kontakt. Und das genügt.
Wie geht es nun weiter? Die Mühle, habe ich gesagt, ist auch ein angenehmer, ja gemütlicher Ort. Und sie bietet die Möglichkeit zu lernen. Man kann auch den Geschmack an der Macht lernen. Bei einer seiner Ausfahrten lädt der Meister Krabat dazu ein, mitzukommen an die große Welt des Dresdner Hofes und sich im Zentrum der Macht umzuschauen. Auf der Rückkehr fragt ihn der Meister: »Woran denkst du?«– »Ich denke darüber nach«, sagte Krabat, »wie weit man es bringen kann mit der Schwarzen Kunst – und dass sie ein Mittel ist, das einem selbst über Fürsten und Könige Macht verleiht.«14
Man kann also den gleichen Weg einschlagen wie der Meister. Man muss aber, wenn man diese Macht will, bereit sein, einen Preis zu zahlen. Einen sehr hohen Preis. Diesen hohen Preis nennt man gewöhnlich die Seele. »Was nützte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne«, sagt Jesus, »aber Schaden litte an seiner Seele?« (Mt 16,26) Und Sokrates wurde nicht müde zu sagen, der Mensch solle sich mehr als um alles andere darum kümmern, dass seine Seele schön sei.15 Diese Seele muss man verkaufen.
Der Meister weiß um diesen Preis. Einmal zeigt er es, und zwar beim beiläufig erwähnten Fest des Radhubs, als er ausnahmsweise einmal mit den Gesellen zusammen feiert. Bei dieser Gelegenheit lernen wir den Meister anders kennen als sonst: »Der Meister war redselig und bei bester Laune. Er lobte Staschko und dessen Gehilfen für ihre Arbeit und hatte sogar für den dummen Juro ein gutes Wort übrig: daß der Braten vortrefflich sei und der Wein ein Labsal. Er sang mit den Burschen, er spaßte mit ihnen, er forderte sie zum Trinken auf und trank selber am meisten. ›Lustig!‹ rief er, ›nur lustig, Burschen! Der Neid könnte einen zwacken, wenn man euch sieht – ihr wißt nicht, wie gut ihr´s habt!‹ ›Wir?‹ fragte Andrusch, sich an den Kopf fassend. ›Hört ihr das, Brüder und Mitgesellen – der Meister beneidet uns!‹ ›Weil ihr jung seid.‹ Der Meister war ernst geworden.«16 Er wird an diesem Abend von seiner Jugend erzählen. Er wird diese Erzählung schließlich abbrechen, um ein anderes Mal fortzufahren. Und er wird sich so hemmungslos besaufen, dass es den Burschen vor ihm graut. Finster bleibt er auf seinem Stuhl sitzen. Die Knappen lassen ihn dort einfach zurück, bis er sich irgendwann in der Nacht ins Haus zurückschleicht.17
Der Meister weiß, dass er, trotz all seiner Macht, sein Leben verlieren wird. Seine Macht ist ihm nur geliehen und eines Tages wird er sie zurückgeben müssen. Dann wird er aber nichts in der Hand haben, was seinem Leben einen Wert geben könnte, dann wird er nackt sein und darum graut ihm angesichts seines Alters.
Wir wissen doch, was das Gericht Gottes heißt, ganz unabhängig davon, ob wir an ihn glauben oder nicht: Dastehen im Licht, wo keiner gut ausschaut. Gesehen werden. Etwas getan haben oder nicht getan haben. Jemand sein oder eben nicht sein. »Simon, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizenkörner sieben darf«, sagt Jesus (Lk 22,31). Die Wahrheit über unser Leben, die wir nicht verstecken können.
Wir Menschen können gar nicht so leben, als ob es keinen Unterschied machen würde, wie einer gelebt hat. Als ob das nichts zählen würde. Wir können uns als freie Wesen vor der Verantwortung für unsere Taten nicht drücken. Und wir sind, auch als Sünder, nicht alle gleich. Es ist nicht so, dass es keinen Unterschied machen würde, ob jemand als Verbrecher gelebt hat oder als Heiliger. Wovor uns auch keine modernistische Theologie rettet.
Der Meister geht den Weg der Macht und der Selbstsucht und des Erfolgs. Und da er diesen Weg einmal betreten hat, kehrt er auch nicht um. Lichte Momente, in denen er zeigt, dass er in seinem Inneren sehr wohl weiß, auf dem falschen Weg zu sein, ändern nichts an seinem Verhalten. Wir werden es bald sehen.
Ist der Meister in all seiner Macht glücklich? In den Augen der Knappen ist er es. Er hat die Macht, er schikaniert die anderen, er kann tun, was er will, während die anderen oft genug das saure Brot der Knechtschaft essen müssen. Aber wir sehen zu deutlich die Angst hinter dem Gesicht, das häufig »so weiß war, wie mit Kalk bestrichen«,18 wie es in einer von Preußlers nachdrücklichsten Formulierungen heißt. Der Meister hat sich für den Weg der Macht und der Selbstsucht und des Wohllebens entschieden. Was ihm fehlt und fehlen muss – ist die Liebe.
Wer liebt, dem geht es nicht mehr vorrangig um sich selbst – »ἡ ἀγάπη … οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς« (»he agápe … ou zeteî tà heautês«), heißt es bei Paulus im Hohelied der Liebe in 1 Kor 13,5: »Die Liebe sucht nicht das Ihrige.« Ihr Wesen ist es, den anderen zu lieben, die Freude darin zu finden, dass man sich selbst vergisst und den anderen liebt. Zuerst und zuletzt den liebt, der, wie Platon sagt, »allen seligen Ernstes wert ist19, den liebt, der unter allen Umständen liebenswert ist, der so ist, dass sich um seinetwillen alles andere lohnt. Weshalb die Gottesliebe Grund und Folge jeder Liebe ist. Und dass man in einer Teilnahme der göttlichen Liebesbewegung zum Schwachen und Armen dieses mitliebt, in schenkender Liebe. Soweit das uns Menschen, uns bedürftigen und schwachen Wesen, eben möglich ist.
Wer liebt, dem geht es nicht mehr vorrangig um sich selbst. Er macht sich selbst nicht zum Mittelpunkt der Welt. Seine vorrangige Frage ist nicht: Was habe ich davon, was bringt das mir? sondern: Wozu bin ich da? Was ist so wertvoll, so über jede Fraglichkeit erhaben, dass es sich um dessentwillen zu leben lohnt? »Das Leben des Menschen ist nichts wert, der nichts hat, was mehr wert ist als sein Leben«, so hat das der Philosoph Jörg Splett auf den Punkt gebracht.20 Und Petrus Canisius hat in seiner berühmten Katechismusfrage vor 450 Jahren das gleiche getan: »Wozu sind wir auf Erden?« »Um Gott zu ehren, ihn zu lieben, ihm zu dienen und dadurch selig zu werden.«21 Gott allein ist zu leben wert. Und wenn ich das weiß und ihn liebe, dann wird auch mein Leben gesund. Aber ich darf natürlich nicht Gott lieben, um gesund zu werden. Denn wer so denkt, der liebt nicht.
Die Welt der Mühle ist keinesfalls nur schlecht. Aber sie ist eine Welt, die auf dem Verbrechen gebaut ist und die deshalb nicht sein darf. Die Liebe aber sagt: »Es ist gut, dass es dich gibt!« So läuft das Buch auf einen Konflikt zwischen Liebe und Macht hinaus.
Der Konflikt beginnt just in der Osternacht, als Krabat zum ersten Mal die Stimme der Kantorka hört: Da spürt er einen Schmerz an einer Stelle, von der er vorher noch gar nicht wusste, dass es sie überhaupt gab. Er kennt das Mädchen noch gar nicht, macht sich selbst noch gar nicht klar, was mit ihm geschehen ist: Aber sein Herz gehört schon der Kantorka.
Wir wollen über der Liebe zu diesem Mädchen freilich die andere Liebe, die zum toten – und an seiner Liebe gestorbenen – Freund Tonda nicht vergessen. Ohne diese Liebe wäre Krabat in der Mühle nicht der, der er ist. Und vielleicht würde er noch nicht einmal die Kantorka lieben. Denn Tonda hatte ihm in der ersten Osternacht von seiner Liebe zu Worschula erzählt und ihn auf den Klang der Glocken aufmerksam gemacht. Er hat ihm die Ohren geöffnet – Höre, das heißt auf aramäisch: Ephata!22 – und wie der Glaube vom Hören kommt (Röm 10,17), so auch die Liebe zur Kantorka. Wir erfahren nie ihren »richtigen« Namen, aber sie ist die Vorsängerin, die damals, in der unheilig-heiligen Nacht gesungen hat.
Was Tonda nicht gelang, den Meister und die dem Teufel gehörende Welt der Mühle durch die Liebe zu überwinden, Krabat wird es gelingen.
Es musste freilich noch etwas anderes hinzukommen. Denn allein hätte er es nicht schaffen können, so gescheit er auch war. Der Verstand allein, heißt das, bezwingt die Welt nicht. Er denkt zu gerade. In Umberto Ecos Roman Der Name der Rose ist die analytische Vernunft diejenige Kraft, die alles aufschlüsselt, die jedes Geheimnis durchdringt – aber immer im Danach, sie ist die Kraft, die immer einen Schritt zu spät ist und die dadurch zuletzt die ganze Welt in Flammen aufgehen lässt.
Der Verstand ist der Abgefeimtheit des Gegners nicht gewachsen. Er ist zu naiv, fällt auf Tricks herein, weil er – logischerweise – ausrechenbar ist.
Die Welt wird überwunden durch Liebe und durch Klugheit. »Seid klug wie die Schlangen und sanft wie die Tauben« (Mt 10,16). Und es bedarf des Helfers. Was allein nicht geht, geht gemeinsam. Allerdings auch dann nur durch die Bereitschaft zum Opfer. Ohne Verzicht und Opfer kann die Welt nicht überwunden werden. »Siehe, ich habe die Welt besiegt«, ruft Christus, der Gekreuzigte.
II. Lebensordnungen
»Jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden, und ein Haus ums andere stürzt ein. Wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann Bestand haben?«
Lk 11,17f.
Das Leben auf der Mühle ist bestimmt und geregelt von festen Ordnungen und Bräuchen. Die machen dieses Leben, wenn man vorher ein obdachloser Straßenbub war, erträglich. Man mag das als Lohn für den Gehorsam sehen, als Opium für das Volk oder was auch immer. Oder einfach als Ausdruck der Tatsache, dass auch die Gegenordnung eine Ordnung sein muss und auf Ordnung angewiesen ist.
So haben diese Bräuche auch eine beeindruckende Seite. Es ist mitunter schön zu sehen, wie sie das Leben zusammenhalten, wie sie bei allem, was nicht stimmt, einen festen Rahmen bilden, der Halt bietet. Der frühere bayerische Kultusminister Hans Maier hat in einem Büchlein erzählt, wie er als Kind im Breisgau erlebt hat, wie bei all dem Chaos des Zusammenbruchs von 1945 die kirchlichen Lebensordnungen, die liturgischen Feste dem chaotischen Leben der Menschen eine Stütze boten. Sie gingen mit der größten Selbstverständlichkeit weiter, während draußen alle Selbstverständlichkeiten verlorengingen.
Ein schönes Beispiel für die Mühlenordnung ist die Schlichtung eines Streites unter den Knappen: Als Lyschko Michal beim Meister verpfeift und dieser ihn daraufhin in der Schwarzen Kammer misshandelt, wollen es ihm die Knappen mit gleicher Münze heimzahlen. Michal verhindert das durch sein Dazwischentreten. Aber der Verstoß gegen den Zusammenhalt der Gruppe muss geahndet werden. Die Lyschko auferlegte Strafe besteht nun darin, dass er nicht mehr mit den anderen Burschen aus einer gemeinsamen Schüssel essen darf, »weil du von niemandem verlangen kannst, daß er mit einem Haderlumpen aus einer Schüssel ißt.«23 Was für eine Strafe! Für uns wäre eher das Gegenteil eine Strafe! Aber in der alten Ordnung hat man das anders empfunden. Die Menschen lebten enger miteinander. Bei den Reformen der bayerischen Armee in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde der Brauch abgeschafft, dass die Soldaten je zu dritt in einem Bett schliefen, jetzt teilten sie es sich nur noch zu zweit! Das gemeinsame Essen aus einer Schüssel habe ich selber noch vor wenigen Jahren bei einer Bauernfamilie erlebt.
An Ostern freilich, auch das gehört zur Ordnung, musste aller Streit vorbei sein.
So lebt auch die Mühle von ihrer festen Ordnung: Zwölf Knappen müssen es sein, sonst mahlt die Mühle nicht. Nach Zunftgebrauch werden die Lehrbuben freigesprochen. Jeden Tag wird zur festgesetzten Zeit gearbeitet. Die Zeit wird nach dem Kirchenkalender gerechnet; so fällt der erste Schnee z.B. einmal um die Andreasnacht. Nur an Neumondnächten – und wirklich nur an diesen – kommt der Herr Gevatter vorgefahren. Jeden Freitag findet die schwarze Schule statt. Ostern und freilich auch Neujahr finden nach einer ganz festen Regel statt. Und geregelt ist schließlich auch noch, wie ein Knappe freigebeten werden kann.
Als sich der Meister über die Mühlenordnung hinwegsetzt und die Knappen zwingt, statt tagsüber nachts zu arbeiten, wo es ihnen schwerfällt – da greift sogar der Herr Gevatter ein: »Lass das bleiben«, sagt er zum Meister, als der den völlig erschöpften Witko mit der Peitsche züchtigt.24 Auch die Gewalt darf nicht überdehnt werden, das weiß sie, sonst kann sie nicht bestehen.
Freilich ist die Ordnung der Mühle auf weite Strecken eine Gegenordnung: Da wären zu nennen das gefeierte Gegenostern, der Schwur mit der linken statt mit der rechten Hand; der Freitagabend, der dem Sonntag korrespondiert, freilich auch der weitgehende Verzicht auf die Ordnung der Feste, die das Leben wieder ins Lot bringen: Die Mühle auf dem Koselbruch arbeitet Tag und Nacht; es gibt keinen Sonntag und keine Feiertage, nicht einmal Weihnachten. Der Müller hält sich aber auch nicht an die ordentliche Regelung der Beziehung zur Außenwelt, besonders zu den anderen Mühlen: Beim Radhub werden die Anderen nicht eingeladen und als Pumphutt »wie es Zunftgebrauch ist, ein Quartier erheischt«25, weist er ihm die Tür – was ihm dann schlecht bekommt. So sind aufs Ganze gesehen dann doch fehlende Ordnungen, nicht Ordnungen das Zeichen der Diktatur.
III. Diktatur
Denn die Mühle ist eine handfeste Diktatur. Schon als er sie zum ersten Mal sieht, merkt Krabat, was los ist. Wie ein sprungbereites Raubtier duckt sich die Mühle unter dem Schnee. Und die Herrschaft des Meisters ist gemildert durch Ordnung, sonst aber eine gnadenlose Tyrannis. Wie sie funktioniert, ist gleichwohl beachtenswert.
Der Meister braucht eigentlich nicht viel zu tun: die Mühle läuft auch ohne ihn. Doch wehe dem, der gegen ihre Regel verstößt. Was auf der Mühle geschieht, bestimmt der Meister und sonst kein anderer. Nicht einmal gestorben wird ohne seine Erlaubnis.
Als unumschränkter Herr ist der Meister nicht auf seine Untertanen angewiesen. Seine Tyrannei ist eine altmodische, vorrevolutionäre, vorindustrielle oder, besser, vormassenmediale. Sie ist nicht auf die noch so manipulierte Zustimmung der Beherrschten angewiesen. Was diese denken, ist ihr egal, solange die Substanz der Herrschaft nicht angegriffen wird. »Räsoniert, aber gehorcht!« – das würde hierher ganz gut passen. Der Meister hat es deshalb auch nicht nötig, sich seinen Untertanen zu zeigen oder ihnen etwas vorzuspielen. Er taucht nur gelegentlich auf, dann oft sehr plötzlich, wie ein überraschendes Gewitter.