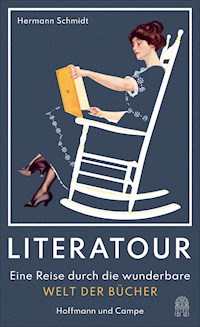
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Wenn es mir schlecht geht, gehe ich nicht in die Apotheke, sondern zu meinem Buchhändler.« Philippe Dijan Hermann Schmidt hat sein Leben lang gelesen, aus Neugier, Leidenschaft und Abenteuerlust. In diesem Buch versammelt er Autorinnen und Autoren mit ihren Lebensgeschichten und ihren schönsten und aufregendsten Büchern: von Heinrich Heine und Wilhelm Busch über Franz Kafka und Erich Kästner hin zu Georges Simenon, Patricia Highsmith, Walter Kempowski, Isabell Allende und Gerhard Henschel. »Literatour« ist eine einzigartige Reise durch eine Welt voll unerhörter Begebenheiten und unvergesslicher Figuren, Gedanken und Geschichten. Ein unverzichtbares Werk für alle, die selbst gerne lesen oder andere dazu einladen wollen. Ein einzigartiger Leseverführer und ein besonderes Geschenk für alle, die mehr über die besten und schönsten Bücher und ihre Autorinnen und Autoren wissen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Hermann Schmidt
Literatour
Eine Reise durch die wunderbare Welt der Bücher
Hoffmann und Campe
In dankbarer Erinnerung an meine Gladenbacher Lehrer
Dieter Blume und Dr. Berthold Leinweber
Hermann Schmidt
Vorwort
Der vorliegende Band stellt eine persönliche Auswahl bedeutender Autoren des 19., 20. und 21. Jahrhunderts vor, die nicht nur durch ihr literarisches Schaffen auf sich aufmerksam gemacht haben, sondern zumeist auch ein außergewöhnliches Leben führten: unangepasst wie Else Lasker-Schüler, aufrührerisch wie Georg Büchner, mal eigenbrötlerisch wie Walter Kempowski, mal haltlos wie Hans Fallada, einige alkoholabhängig wie Joseph Roth, Dylan Thomas, Patricia Highsmith und Peter Kurzeck, oder starke Raucher wie Wilhelm Busch oder Heinrich Böll, einige von der steten Suche nach Liebe getrieben wie Georges Simenon, Patricia Highsmith, Bertolt Brecht, manche vergleichsweise »normal«, viele verkannt, geschmäht und verfolgt, immer aber von der Passion des Schreibens getrieben.
Von allen vorgestellten Autorinnen und Autoren und deren von mir ausgewählten Büchern und Werken geht eine einzigartige, unverwechselbare Faszination aus, die mein Leben als Leser in jungen Jahren geprägt hat und die bis heute anhält. Niemand, der sich auf die abenteuerliche Reise durch die Welt der Bücher begibt, wird sich deren Zauber entziehen können.
Begonnen hat meine »Reise« mit Grimms Märchen, den Märchen von Hans Christian Andersen, Ludwig Bechstein, Wilhelm Hauff und mit den Bildergeschichten von Wilhelm Busch.
Gedichte und Novellen von Theodor Storm, Verse von Annette von Droste-Hülshoff, Theodor Fontane, Rainer Maria Rilke und Erich Kästner, Kurzgeschichten von Ernest Hemingway, Heinrich Böll und Siegfried Lenz, die ich durch meine Deutschlehrer Dieter Blume und Dr. Berthold Leinweber kennenlernte, führten dazu, dass ich mich für die Lebensgeschichte dieser Autoren zu interessieren begann. Seit Mitte der siebziger Jahre des alten Jahrhunderts habe ich regelmäßig Reisen zu den Lebensstationen meiner Lieblingsautoren und den Schauplätzen ihrer Werke unternommen. So bin ich in das Falladasche »Haus am See« in Carwitz gelangt, besuchte immer wieder einmal die bezaubernde »Stormstadt« Husum, begab mich auf die Spuren von Franz Kafka in Prag, reiste nach Laugharne in Wales, wo Dylan Thomas zeitweilig lebte und schrieb. Eine weitere Reise führte mich nach Salinas und Monterey in Kalifornien, wo John Steinbeck lebte – um nur einige Orte meiner langen Reise durch die literarische Welt zu nennen.
Über allem könnte der Titel eines Songs von John Lennon und Paul McCartney stehen: »Magical Mystery Tour«. Ich möchte Sie gerne mitnehmen auf eine Reise durch die wunderbare Welt der Bücher und der Menschen, die sie geschrieben haben.
Die Kurzbiographien meiner Lieblingsautorinnen und -autoren werden ergänzt durch kommentierte Textauszüge, Buchtipps und Hinweise zu Gedenkstätten.
Herrn Rainer Wieland, dem Lektor dieses Buches, danke ich für seine akribische Durchsicht des Manuskriptes und die zahlreichen Anregungen, die er mir für die »Literatour« mit auf den Weg gegeben hat. Frau Sophia Jungmann und dem Team von Hoffmann und Campe danke ich für Rat und Tat bei der Fertigstellung des Buches.
Hermann Schmidt, im Juni 2022
ILESEVERFÜHRER
1Wilhelm Busch. Der ewige Junggeselle
*15.4.1832 Wiedensahl
†9.1.1908 Mechtshausen
Als ich ein kleiner Junge war, las ich jeden Abend vor dem Beten und Einschlafen in meinem Bett, während draußen auf der Straße ab und zu ein Auto vorbeifuhr und das Dorf bereits schlief. Im Frühjahr und Sommer las ich, solange es hell war, im Herbst und Winter, nach Einbruch der Dunkelheit, mit der Taschenlampe unter der Decke.
Die bekanntesten Märchen der Brüder Grimm, die von Hans Christian Andersen und Wilhelm Hauff hatte mir und meinem Freund, dem Nachbarsjungen Giso, dessen Oma Anna erzählt, während wir in der Küche saßen und dazu rohe Kartoffeln aßen, die sie schälte und in einen großen Topf mit kaltem Wasser warf.
Bald danach bekam ich eine Märchensammlung geschenkt. Nun konnte ich meine Lieblingsmärchen selbst lesen: »Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen«, »Der fliegende Koffer«, »Hans im Glück«, »Der kleine Muck«, das waren meine Lieblingsmärchen.
In meinem Zimmer stand ein kleines Bücherregal, in dem sich die Bücher meiner Eltern und meines Großvaters befanden, darunter: Vom U-Boot bis zur Kanzel von Martin Niemöller, Rilkes Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, Goethes Die Leiden des jungen Werthers, Eichendorffs Taugenichts, die Romane von Theodor Plievier, eine Sammlung deutscher Balladen – und natürlich die Bibel. Keines dieser Bücher aus dem Regal las ich. Mit einer Ausnahme, und das war das Große Wilhelm Busch Buch, damals neben Dr. Oetkers Backbuch und einem Gesundheitslexikon zum Pflichtbestandteil eines jeden deutschen Durchschnittshaushalts gehörend.
Mit Wilhelm Busch begann meine jahrzehntelange, bis heute anhaltende Reise durch das Abenteuerland der Literatur. Natürlich kannte ich bereits die Bildgeschichte Max und Moritz. Mit meiner Mutter und meinen beiden Schwestern hatte ich sogar die Verfilmung im Union-Theater in der nahen Kreisstadt Biedenkopf gesehen: der erste Film meines Lebens. Danach träumte ich davon, eine Holzbrücke, die über den Dorfbach führte, anzusägen, um anschließend beobachten zu können, wie der dicke Dorfdiener, der mit einer Glocke durch den Ort ging und die neuesten Bekanntmachungen des Bürgermeisters verlas, in den Bach plumpste. Und ich stellte mir vor, wie ich einem ungeliebten Onkel eine Tüte mit Maikäfern ins Federbett legte.
Im Großen Wilhelm Busch Buch entdeckte ich schließlich mit der Tobias Knopp-Trilogie die Welt der Erwachsenen. Immer wieder las ich die Verse, sodass ich bald einige davon auswendig aufsagen konnte. Noch heute kann ich mich über die Zeilen des großen Volksdichters ausschütten vor Lachen: Rotwein ist für alte Knaben / Eine von den besten Gaben. Oder: »Heißa!!« – rufet Sauerbrot – / »Heißa! meine Frau ist tot!!«[1]
Im weiteren Verlauf meines Lebens habe ich die Bildgeschichten und Gedichte Wilhelm Buschs immer wieder gelesen. Als Erwachsener fuhr ich in die Bilderbuch-Dörfer Wiedensahl, Ebergötzen und Mechtshausen, die Lebensstationen des Dichters, um die Schauplätze seiner Helden und ihrer Geschichten wiederzufinden. Jeder Weg hat sich gelohnt.
Geboren wurde Wilhelm Busch am 15. April 1832 als erstes von sieben Kindern in Wiedensahl, wo die Eltern einen Krämerladen betrieben. Das Dorf liegt bei Stadthagen, unweit des Steinhuder Meeres, und gehörte damals zum Königreich Hannover. Vater Busch war sehr auf Bildung bedacht. Die Söhne erhielten eine umfassende schulische Ausbildung und ergriffen zum Teil akademische Berufe: Einer wurde Mathematiklehrer, ein anderer promovierte in Philosophie. Der älteste Sohn der Familie, Wilhelm, sollte Maschinenbauer werden.
Als Wilhelm neun Jahre alt war, wurde er zum Bruder seiner Mutter, dem Pastor Georg Kleine, nach Ebergötzen bei Göttingen in Obhut gegeben. Das Zuhause in Wiedensahl war für die große Familie zu eng geworden. Nach Wilhelm wurden später auch die anderen Geschwister der Erziehung des Pastors anvertraut. Erst drei Jahre nach seinem Abschied von der Familie sah Wilhelm seine Eltern wieder. Das Fernsein von den Eltern war eine schwere Bürde für den kleinen Jungen, der ein besonders enges Verhältnis zu seiner Mutter hatte.
Die Erziehung durch den Onkel sollte indessen entscheidend für den weiteren Lebensweg Wilhelm Buschs sein. Busch ging in Ebergötzen nicht in die Dorfschule, er erhielt durch seinen Onkel Einzelunterricht, bis er im Alter von fünfzehn Jahren an die Polytechnische Schule in Hannover wechselte. Dort entpuppte sich Wilhelm als Musterschüler.
In Ebergötzen räumte der Onkel seinem Neffen viele Freiheiten ein, nachdem er erkannt hatte, dass Wilhelm ein außergewöhnlich begabter Junge war. Mit dem Müllersohn Erich Bachmann entwickelte sich eine enge Freundschaft. Gemeinsam streiften die Jungen im Dorf und in der Natur umher, fingen Forellen, spielten Streiche, und sie zeichneten zusammen. Erich Bachmann übernahm später die Mühle des Vaters. Er war und blieb für ein ganzes Leben der beste Freund Wilhelm Buschs.
1847 gab Wilhelm Busch das Berufsziel Maschinenbauer auf und beschloss, ein Studium der Malerei aufzunehmen. Er verließ die Oberschule in Hannover und besuchte fortan die Kunstakademie in Düsseldorf. Dort wurde er allerdings auch nicht recht glücklich. Deshalb wechselte er zur Königlichen Akademie der Künste in Antwerpen. Nach einem weiteren Jahr kehrte er nach Wiedensahl zurück. Wilhelm Busch war jetzt zwanzig Jahre alt, und seine künstlerische Zukunft, die der Vater eher kritisch gesehen und nur unwillig finanziert hatte, war ungewiss.
Dem Ruf eines Düsseldorfer Studienkollegen folgend, brach Wilhelm Busch nach München auf, in die Stadt, die in jenen Jahren den Ruf einer Kunstmetropole hatte. Dort wurde Busch in den Künstlerverein Jung-München aufgenommen. Gemeinsam mit Freunden lebte er ein sorgloses Leben, konnte sich zunächst jedoch nicht als Künstler etablieren. Bei einem der allabendlichen Wirtshausbesuche in München lernte er den Verleger der Fliegenden Blätter und Münchener Bilderbogen, Caspar Braun, kennen, der Busch anbot, für ihn zu arbeiten. Damit konnte sich Busch für einige Zeit finanziell über Wasser halten und regelmäßig seinem Durst frönen. In einer Männerrunde zog man an den Wochenenden aus der Stadt hinaus in die umliegenden Biergärten an den oberbayerischen Seen und beim Kloster Andechs. Inzwischen rauchte Busch von morgens bis abends, immerzu selbst gedrehte Zigaretten. Täglich kam er auf vierzig bis fünfzig Zigaretten französischen Tabaks.
Wilhelm Busch war zwar häufiger einmal verliebt, doch geheiratet hat er nie. Als er beim Vater der siebzehnjährigen Anna Richter um die Hand des Mädchens anhielt, wurde sein Antrag abgelehnt, da er keine zuverlässige berufliche Perspektive zu bieten hatte. Seine späteren Darstellungen ehelichen Lebens sind dann auch allesamt von satirischem Humor geprägt, etwa die einzigartig-wunderbare Darstellung des Schicksals von Tobias Knopp.
Von 1867 an war Busch häufiger Gast der Frankfurter Bankiersfamilie Keßler, bei der sein Bruder Otto als Hauslehrer angestellt war. Wilhelm Busch fühlte sich zur Ehefrau des Bankiers hingezogen, die Mutter mehrerer Kinder war. Die Bankiersgattin sammelte Gemälde und glaubte in Wilhelm Busch einen großen Maler entdeckt zu haben. Johanna Keßler wusste um Wilhelms Zuneigung für sie. Ob sie es duldete, dass sich mehr als platonische Gefühle einstellten, ist literaturgeschichtlich nicht belegt. Jedenfalls bezog Busch eine Wohnung in der Nähe des Keßler-Hauses und lebte vier Jahre in Frankfurt am Main.
Daneben pflegte Busch eine enge Freundschaft mit der Holländerin Maria Anderson, die ihm gestand, ihn »platonisch« zu lieben. Ein Foto zeigt Maria Anderson als hagere Frau mit zotteligen Haaren und harten Zügen. Es verwundert nicht, dass die Holländerin kein sonderliches Begehren des in sich selbst ruhenden Dichters auslöste.
Die 1872 erschienene Bildgeschichte Die fromme Helene, in der Wilhelm Busch die religiöse Heuchelei auf die Schippe nahm, fand die Anerkennung zahlreicher Kritiker. Inzwischen hatte Wilhelm Busch einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Seine Bildgeschichten waren in ganz Deutschland verbreitet und außerordentlich populär.
Nachdem Busch Frankfurt am Main verlassen hatte, ging er wieder zurück nach Wiedensahl. Dort zog er zunächst ins Haus seines Bruders Adolf und dessen Ehefrau Johanna ein. Als es zu Unstimmigkeiten kam, wechselte er ins Wiedensahler Pfarrhaus von Schwager Hermann Nöldeke. Der Wiedensahler Pastor war mit seiner Schwester Fanny verheiratet. Und als der Schwager starb, zog Busch mit Schwester Fanny ins Pfarrwitwenhaus. »Bei meiner Schwester habe ich es nun auch gut«, schrieb er einmal an Marie Anderson.
1898 wurde der Neffe Otto Nöldeke als Pfarrer in das an den östlichen Ausläufern des Harzes gelegene Dorf Mechtshausen berufen. Mutter Fanny und sein berühmter Onkel folgten ihm dorthin. Das Malen hatte Wilhelm Busch bereits zwei Jahre vorher aufgegeben. Gegen eine Abfindung von 50000 Mark hatte er sämtliche Rechte an seinen Veröffentlichungen an den Verlag Bassermann abgetreten.
In Mechtshausen wussten nur wenige Menschen, welch berühmter Zeitgenosse dort an den Abenden spazieren ging. An seinem siebzigsten Geburtstag flüchtete Wilhelm Busch von dort, um dem Trubel der Feierlichkeiten aus dem Wege zu gehen. In seiner Abwesenheit trafen Tausende von Glückwünschen und Geschenken ein. Der Verlag, der Max und Moritz erstveröffentlicht hatte, überwies 20000 Mark, die Busch an Krankenhäuser in Hannover weitergab.
Wilhelm Busch, einer der größten Humoristen deutscher Sprache, starb am 9. Januar 1908 im Alter von 76 Jahren an einer plötzlichen Herzschwäche. Gut getrunken und viel geraucht hat der gute Mann bis zu seinem letzten Atemzug.
Buschs anhaltender Ruhm gründet auf seinen Bildgeschichten, allen voran Max und Moritz, Fips, der Affe und der Vers-Trilogie Tobias Knopp – sie sind die Vorläufer der Comics. Seit mehreren Jahrzehnten werden einzelne Bildgeschichten Wilhelm Buschs von Pädagogen, Eltern, Erziehern und Literaturinteressierten zunehmend kritisch beleuchtet. Dabei wird auf gewalttätige Szenen und Grausamkeiten verwiesen, wenn zum Beispiel die »bösen Buben« Max und Moritz ins Mühlwerk geraten, fein geschrotet als Körner enden und vom Federvieh gefressen werden. Auch in Tobias Knopp, Hans Huckebein oder in der Frommen Helene und in anderen Bildergeschichten Buschs lassen sich vergleichbare Geschehnisse entdecken, die zu dem Fazit der Kritiker führen, derartige Texte aus pädagogischen Erwägungen Kindern vorenthalten zu müssen. Ähnliches müsste übrigens, nebenbei erwähnt, dann auch für unzählige Märchen der Brüder Grimm gelten.
Bei der Lektüre der entsprechenden Bildgeschichten Buschs wie auch beim Lesen der Märchen habe ich diese Abschnitte als Kind nicht weiter reflektiert und auch nicht bewusst als Bedrohung wahrgenommen. Dass »böses Tun« Strafen nach sich zieht, war in der Praxis der Erziehung des 19. und 20. Jahrhunderts üblich. Die grotesk übertriebenen Strafen, die Wilhelm Busch in Wort und Bild setzt, waren mir dennoch deutlich, ohne dass ich dabei Schaden genommen oder Ängste entwickelt hätte. Und vermutlich ging es den meisten Kindern ebenso.
Ein weiterer Vorwurf in der Rezeption des Werkes von Wilhelm Busch bezieht sich auf den ihm unterstellten Antisemitismus. Mehrfach lassen sich Stellen in Bildgeschichten und Briefen finden, die geeignet sind, dies zu belegen, wenn er etwa in der Frommen Helene schreibt: Und der Jud mit krummer Ferse / Krummer Nas’ und krummer Hos’ / Schlängelt sich zur hohen Börse / Tiefverderbt und seelenlos …[2] Auch an anderer Stelle (etwa in Plisch und Plum) lassen sich vergleichbare Textpassagen finden. Allerdings sollten diese in ihren zeitlichen Kontext gestellt werden. Die fromme Helene erschien im Jahr 1872, Plisch und Plum zehn Jahre später. Gehässigkeiten, Verunglimpfungen und Vorurteile über jüdische Mitbürger waren in jener Zeit in Deutschland und anderen europäischen Ländern leider weitverbreitet. Wilhelm Busch folgte in den inkriminierten Texten dem Zeitgeist jener Jahre. Vor dem Hintergrund des Holocaust, der Jahrzehnte später als das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit in die Weltgeschichte eingegangen ist, bekommen die entsprechenden Verse eine Dimension, die zum Zeitpunkt ihrer Niederschrift nicht absehbar war. Das entschuldigt nichts. Die Textstellen sind eindeutig antisemitisch. Spott und Häme über Juden dürfen in Buschs Werken nicht übersehen werden. Ob man Busch aber deshalb per se als Judenhasser oder Wegbereiter des Nationalsozialismus bezeichnen darf, bleibt weiterhin umstritten.
Unbestritten gilt: Wilhelm Busch ist derjenige Autor des 19. Jahrhunderts, der wie kein anderer das deutsche Spießbürgertum der Gründerjahre karikiert hat. Seine Werke haben einen volksliedhaften Ton. Unzählige seiner Verse sind zu geflügelten Worten geworden, die bis heute im deutschen Sprachgebrauch erhalten geblieben sind.
Im Jahr 2018 erschien das Buch Laubengänge von Gerhard Henschel und Gerhard Kromschröder, das eine Wanderung der beiden Autoren von Wiedensahl nach Ebergötzen in Wort und Bild wiedergibt: ein Wiedereintauchen in die Welt des Dichters, der mich in meiner Kindheit zum Lesen verführt hat.
Tobias Knopp
Balduin Bählamm
Maler Klecksel
Die fromme Helene
Max und Moritz
Nach Max und Moritz ist das Versepos Tobias Knopp das bekannteste Werk Wilhelm Buschs. Die drei Teile Abenteuer eines Junggesellen, Herr und Frau Knopp und Julchen entstanden in den 1870er Jahren. Ich las den Knopp zum ersten Mal im Alter von dreizehn oder vierzehn Jahren. Auf der unentwegten Suche des Junggesellen nach einer Liebsten muss er manche Enttäuschung hinnehmen, beispielhaft steht dafür die Episode mit seiner »alten Flamme« Adele:
Transpirierend und beklommen, / Ist er vor die Tür gekommen, / Oh, sein Herz, es klopft so sehr, / Doch am Ende klopft auch er. / »Himmel«, ruft sie, »welches Glück!!« / Knopp sein Schweiß, der tritt zurück. / »Komm, geliebter Herzensschatz, / Nimm auf der Berschäre Platz! / Nur an dich bei Tag und Nacht, / Süßer Freund, hab ich gedacht. / Unaussprechlich inniglich, / Freund und Engel, lieb ich dich!«[3]
Das ist dem lieben Knopp dann doch zu viel, aber Rettung naht:
Knopp, aus Mangel an Gefühl, / Fühlt sich wieder äußerst schwül; / Doch in dieser Angstsekunde / Nahen sich zwei fremde Hunde. / »Hülfe! Hülfe!« – ruft Adele – / »Hilf, Geliebter, meiner Seele!!!« / Knopp hat keinen Sinn dafür. / Er entfernt sich durch dieTür. – / Schnell verläßt er diesen Ort / Und begibt sich weiter fort.[4]
Doch schon bald wendet sich alles zum Guten. Knopp gründet eine Familie, und nahtlos schließen sich in Herr und Frau Knopp und Julchen kuriose Szenen einer Ehe und Begebenheiten an, die Busch in formvollendeten Versen so witzig zu erzählen weiß, dass sie bis heute zum Schönsten gehören, was die deutsche Lyrik zu bieten hat.
Gudrun Schury: Ich wollt, ich wär ein Eskimo. Wilhelm Busch: Die Biographie. Aufbau Verlag, Berlin 2007.
Gert Ueding: Wilhelm Busch. Das 19. Jahrhundert en miniature. Insel Verlag, Frankfurt am Main, Leipzig 2007.
Joseph Kraus: Wilhelm Busch. Rowohlt Bildmonographie, 17. Auflage, Reinbek 2007.
Frank E. Pietzcker: Wilhelm Busch. Auf der Suche nach Heimat. Klotz Verlag, Eschborn 2011.
Museum Wilhelm Busch, Deutsches Museum für Karikatur- und Zeichenkunst, Georgengarten 1, 30167 Hannover
Wilhelm Busch Geburtshaus, Hauptstr. 68, 31719 Wiedensahl
Museum im Alten Pfarrhaus, Hauptstr. 83, 31719 Wiedensahl
Museum Wilhelm-Busch-Mühle, Mühlgasse 8, 37136 Ebergötzen
Wilhelm-Busch-Haus, Mechtshausen, Pastor-Nöldeke-Weg 7, 38723 Seesen-Mechtshausen
2Theodor Storm. Der Husumer
*14.9.1817 Husum
†4.7.1888 Hademarschen
Die Werke Theodor Storms waren in den Nachkriegsjahren Bestandteil der schulischen Bildungspläne aller Bundesländer. An Theodor Storm und dessen populärsten Werken kam kein deutscher Schüler vorbei. Die Novelle Der Schimmelreiter steht bis heute auf der Empfehlungsliste literarischer Texte im Deutschunterricht. Sowohl meine Söhne Kai und Henning als auch mein Enkel Bjarne lasen in der Schule den Schimmelreiter – zugegebenermaßen jedoch, je nach deren Alter, mit abnehmender Begeisterung. Enkel Bjarne erklärte mir, von mir nach seinen Eindrücken zum Schimmelreiter befragt: »Da reitet einer Tag und Nacht auf dem Deich hin und her.«
In der Freiherr-vom-Stein-Schule in Gladenbach lasen wir zuerst Pole Poppenspäler, und zu Weihnachten 1962 schenkten mir meine Eltern die Gesammelten Werke von Theodor Storm mit Gemälden von Adolph Menzel. In der zehnten Klasse lasen wir dann endlich den Schimmelreiter, neben Hans und Heinz Kirch die für mich eindrucksvollste Novelle Storms. Genauso faszinierten mich die Gedichte Theodor Storms, von denen wir einige (»Die Stadt«, »Abseits«, »Meeresstrand« (Ans Haff nun fliegt die Möwe …) in der Schule auswendig lernten. Für mich, aufgewachsen in der kleinen, überschaubaren Welt Oberhessens, geriet der Dichter Theodor Storm zu einem Tor zu einer anderen Welt. Der äußerste Norden Deutschlands, Schleswig-Holstein und somit auch Nordfriesland und seine Inseln und Halligen, wurden zu meinem Sehnsuchtsort.
Die Beschäftigung mit Theodor Storm und dessen dichterischem Schaffen hat mich nie mehr losgelassen. Husum, »die graue Stadt am Meer«, habe ich immer wieder besucht, und auch andere Plätze und Orte, an denen Storm gelebt hat: Heiligenstadt und Hademarschen, den Schimmelreiter-Krug in Sterdebüll, in dem die Rahmenerzählung der Schimmelreiter-Novelle ihren Anfang nimmt. Ich war viele Jahre lang Mitglied der Theodor-Storm-Gesellschaft, und immer wieder lese ich einzelne seiner Gedichte und Novellen und in den Briefen, die er seiner Frau, literarischen Weggefährten und Verlegern geschrieben hat.
Geboren wurde Hans Theodor Woldsen Storm am 14. September 1817 in Husum, das damals zu Dänemark gehörte. Sein Vater Johann Casimir Storm und dessen Vorfahren stammten aus Westermühlen, einem kleinen Ort südwestlich von Rendsburg gelegen, ganz in der Nähe des heutigen Nord-Ostsee-Kanals. Er war Rechtsanwalt von Beruf. Storms Mutter Lucie, geborene Woldsen, wuchs in einer der reichsten Husumer Familien auf.
Im Alter von vier Jahren wurde Theodor eingeschult, mit neun Jahren wechselte er zur Husumer Gelehrtenschule. Zur Abrundung seiner Schulausbildung besuchte er anschließend für zwei Jahre das Lübecker Katharineum. Im April 1837 nahm er das Studium der Rechtswissenschaft an der Kieler Universität auf. 1842 trat er in die Anwaltskanzlei seines Vaters ein, und ein Jahr später eröffnete er eine eigene Praxis in Husum.
Parallel zu seiner beruflichen Tätigkeit begann er Gedichte, Spukgeschichten und Märchen zu schreiben, die in Sammlungen veröffentlicht wurden. Im Jahr 1848 verfasste er die Gedichte »Oktoberlied« und »Abseits«, ein Jahr später die erste Fassung der Novelle Immensee und das Märchen Der kleine Häwelmann. 1852 erschien sein erster Gedichtband in einem Kieler Verlag.
Im Zuge des deutsch-dänischen Konfliktes engagierte sich Storm gegen die dänische Herrschaft. Daraufhin wurde seine Bestallung als Anwalt vom dänischen König aufgehoben. Storm bemühte sich in der Folge um eine Anstellung als Anwalt bei der preußischen Regierung in Berlin. Im Oktober 1853 wurde er zum preußischen Gerichtsassessor ernannt und zog von Husum nach Potsdam.
In Berlin traf er sich im Verein Tunnel über der Spree mit anderen Künstlern, zu denen auch Theodor Fontane und der Maler Adolph Menzel gehörten. Seinen Zeitgenossen erschien der mittelgroße, leicht gebeugt gehende Mann aus Nordfriesland schon aufgrund seiner Kleidung außergewöhnlich. Storm trug bevorzugt bequeme Hosen und Jacken aus Leinen, die nicht maßgeschneidert waren. Die literarischen Wegbegleiter im Tunnel machten sich lustig über ihn. Storm störte das nicht. Er pflegte und genoss sein Image als norddeutscher Außenseiter.
1856 wurde er zum Kreisrichter in Heiligenstadt (Eichsfeld) berufen. Und nach Beendigung des Deutsch-Dänischen Krieges im Jahr 1864 durfte Storm wieder nach Husum zurückkehren. Er übernahm dort das Amt des Landvogts von Husum-Land.
In all den Jahren ging Storm seiner literarischen Arbeit weiter nach und schrieb Gedichte und Novellen, die in literarischen Zeitschriften und in Buchform veröffentlicht wurden. 1868 erschien im Braunschweiger Verlag Westermann eine erste Gesamtausgabe in sechs Bänden. Im gleichen Jahr wurde Storm preußischer Amtsrichter und später Oberamtsrichter und Amtsgerichtsrat.
Neben seiner beruflichen und dichterischen Tätigkeit, neben seiner Begeisterung für die Natur und seinem Interesse für Musik und der Leitung verschiedener Gesangschöre widmete sich Theodor Storm einer weiteren Leidenschaft: den Frauen. Früh schon hatte er eine starke Neigung zum anderen Geschlecht entwickelt. Im Alter von zwölf Jahren küsste er heimlich die Freundin seiner Schwester, Emma Kühl, mit der er sich acht Jahre später verlobte und anschließend gleich wieder entlobte. Als junger Student verliebte er sich in die sechzehnjährige Bertha von Buchan. Er schrieb für sie Liebesgedichte und machte ihr einen Heiratsantrag, der von dem streng christlichen erzogenen Mädchen jedoch abgelehnt wurde.
Kurz darauf, 1844, verlobte er sich mit seiner acht Jahre jüngeren Cousine Constanze Esmarch aus Bad Segeberg und heiratete sie zwei Jahre später. Seiner Frau hatte Storm, wie in jenen Zeiten üblich, die Rolle der Hüterin des Hauses und der Familie zugedacht. Zugleich versuchte er, Constanze als gleichwertige Partnerin für Gespräche über sein schriftstellerisches und berufliches Arbeiten fortzubilden. In Anlehnung an das alttestamentarische »Hohelied Salomos« verfasste er ein überschwängliches Liebesgedicht: Deine Lenden stehen gleich aneinander wie zwei Spangen von des Meisters Hand, deine Brüste sind wie zwei junge Rehzwillinge, die unter Rosen weiden … Wie schön und lieblich bist du Liebe in Wollüsten! Wende deine Augen von mir, denn sie machen mich brünstig. Deine Gestalt gleicht dem Palmbaum und deine Brüste den Weintrauben …[5]
Doch schon bald, noch vor der Geburt des ersten Sohnes Hans, wurde er seiner Frau untreu. Er hatte sich in die siebzehnjährige Dorothea (Doris) Jensen verliebt, die in dem von ihm geleiteten Chor mitwirkte. Dennoch hielt die Ehe dieser andauernden Belastung stand. Sieben Kinder brachte Constanze ins Leben: Hans (1848), Ernst (1851), Karl (1853), Lisbeth (1855), Lucie (1860), Elsabe (1863), Gertrud (1865).
Nach der Geburt des siebten Kindes starb Constanze. Der nun achtundvierzigjährige Theodor Storm trug schwer am Tod seiner Frau, aber nicht allzu lange. Bei der Taufe seiner Tochter Gertrud traf er Dorothea Jensen wieder. Freunden berichtete er, dass es »nichts Verblühteres gebe als eine verblühte Blondine«, doch nach Ablauf des Trauerjahres heiratete er »Frau Do«. Wohl auch deshalb, weil er Unterstützung im Haushalt der Familie mit sieben Kindern benötigte. 1868 kam die gemeinsame Tochter Friederike zur Welt.
Zusammen ertrug das Paar den Alkoholismus des ältesten Sohnes Hans und die Krankheit des jüngsten Sohnes Karl, der sich in seiner Leipziger Studienzeit die Syphilis zugezogen hatte. Dorothea Storm begleitete ihren Mann als Kritikerin seiner literarischen Werke und war eine pedantische Hausfrau, die Eindruck auf die zahlreich erscheinenden Gäste im Hause Storm machte. Dass Theodor Storm auch im hohen Alter noch ein Auge für die Verlockungen des weiblichen Geschlechtes hatte, ist in den sorgfältig recherchierten Veröffentlichungen des Literaturwissenschaftlers Karl Ernst Laage hinreichend belegt.
Nach seiner Pensionierung im Jahre 1880 ließ Storm sich in Hanerau-Hademarschen, zwischen den Städten Rendsburg, Itzehoe und Heide gelegen, seinen Alterswohnsitz errichten. Hier schuf er die Novelle, die ihn posthum berühmt machte, den Schimmelreiter. Nur wenige Monate nach dessen Vollendung starb Theodor Storm am 4. Juli 1888 in Hademarschen an Magenkrebs. Drei Tage nach seinem Tod wurde er in Husum, seiner Geburtsstadt, die unauslöschlich mit seinem Namen verbunden ist, begraben.
Das Leben und Schaffen Storms ist untrennbar mit seiner nordfriesischen Heimat verknüpft, und dennoch erzielte der Dichter eine Wirkung, die weit über die Grenzen Deutschlands hinausgeht. Der Schimmelreiter, Pole Poppenspäler, Bötjer Basch und Hans und Heinz Kirch gehören zur Weltliteratur. Bis heute zählt Theodor Storm zu den meistgelesenen Schriftstellern deutscher Sprache im Ausland (insbesondere in Japan, in den USA und in Belgien). Seine volksliedhaften Natur- und Liebesgedichte machen ihn neben Goethe, Schiller, Heine und Fontane zu einem der wichtigsten Lyriker deutscher Sprache.
Der Schimmelreiter
Hans und Heinz Kirch
Die Stadt (Gedicht)
Oktoberlied (Gedicht)
Meeresstrand (Gedicht)
Die Novelle Der Schimmelreiter fußt auf einer alten Sage, die in Nordfriesland die Runde machte. Als weitere Quelle benutzte Theodor Storm die Geschichte Der gespenstige Reiter. Ein Reiseabenteuer, die im Jahr 1838 erschienen war. Im Sommer 1886 begann Storm mit den Arbeiten am Schimmelreiter, im Februar 1888 beendete er sie. Im Mai des gleichen Jahres erschien sie zunächst in der Zeitschrift Deutsche Rundschau und danach in Buchform.
Der Schimmelreiter ist die letzte vollendete literarische Arbeit Storms. Sie gehört zu den wichtigsten Werken des deutschen Realismus. Die Hauptfiguren der Novelle – der Deichgraf Hauke Haien und dessen Ehefrau Elke – und auch die anderen Akteure im Kampf der Menschen gegen die Naturgewalt des Meeres sind glaubwürdig und anschaulich dargestellt. Der Schimmel, den Hauke Haien kauft, symbolisiert das nahende Unheil und wird mit einem Pferdegerippe auf der nahen Jevershallig in Verbindung gebracht, das dem Volksglauben nach in Mondnächten zu sehen ist.
Die Schilderung der Sturmnacht, die den alten Deich brechen lässt und für den Deichgrafen und seine Familie zum Schicksal wird, gehört zu den Höhepunkten der Erzählkunst deutscher Dichtung im 19. Jahrhundert. Storms Stärke als Erzähler liegt in seiner prägnanten, nie ausufernden Sprache, mit der er die handelnden Figuren des Geschehens vor dem Hintergrund von Marschen, Himmel und Meer in Szene setzt:
Der Deichgraf Hauke Haien jagte auf seinem Schimmel dem Deiche zu. Der schmale Weg war grundlos, denn die Tage vorher war unermeßlicher Regen gefallen, aber der nasse saugende Klei schien gleichwohl die Hufen des Tieres nicht zu halten, es war, als hätte es festen Sommerboden unter sich. Wie eine wilde Jagd trieben die Wolken am Himmel; unten lag die weite Marsch wie eine unerkennbare, von unruhigen Schatten erfüllte Wüste; von dem Wasser hinter dem Deiche, immer ungeheurer, kam ein dumpfes Tosen, als müsse es alles andere verschlingen.[6]
Der Schimmelreiter ist bis heute Pflichtlektüre im Deutschunterricht an weiterführenden Schulen und wurde dreimal – 1934, 1978 und 1984 – verfilmt.
Karl Ernst Laage: Theodor Storm. Eine Biographie. Verlag Boyens & Co, 8. Auflage, Husum 2007.
Jochen Missfeldt: Du graue Stadt am Meer. Der Dichter Theodor Storm in seinem Jahrhundert. C. Hanser Verlag, München 2013.
Theodor-Storm-Haus, Wasserreihe 31, 25813 Husum mit Theodor-Storm-Archiv
Geburtshaus Theodor Storm, Husum
Gedenkstein Theodor Storm, Husum
Schimmelreiterkrug, Sterdebüll 67, 28856 Sterdebüll (früher Gasthof, jetzt Wohnhaus)
Literaturhaus Theodor Storm, Am Berge 2, 37308 Heilbad Heiligenstadt
Gedenkstein Theodor Storm Hanerau-Hademarschen
Denkmal Theodor Storm Heiligenstadt
3Ludwig Thoma. Der doppelte Ludwig
*21.1.1867 Oberammergau
†26.8.1921 Rottach-Egern
Meinen Deutschlehrern Dieter Blume und Dr. Berthold Leinweber verdanke ich mein frühes Interesse für Literatur und die deutsche Literaturgeschichte. Es begann mit Kurzgeschichten von Wolfgang Borchert, Wolfdietrich Schnurre und Heinrich Böll, die wir in der Schule lasen, mit Hörspielen, die wir aus literarischen Texten selbst fertigten, und mit gemeinsamem Lesen von Texten im Unterricht. Deutschstunden waren neben Sport die Highlights meiner gesamten Schulzeit.
Immer am letzten Schultag vor Beginn der großen Ferien las uns Dieter Blume etwas in seiner unnachahmlich lebendigen Art vor. Dazu gehörten auch die Lausbubengeschichten von Ludwig Thoma. Darin fanden wir Schüler uns wieder. Einzelne der von Ludwig Thoma erzählten Episoden sind so herzerfrischend witzig, dass ich sie bis heute immer wieder nachlese.
Erst im Erwachsenenalter erstand ich antiquarisch eine Ausgabe von Jozef Filsers Briefwexel, ein Bravourstück bayerischen Humors über das gottgesegnete Bayernland und die dort agierenden Kommunalpolitiker, durchaus übertragbar auf nachfolgende Zeiten. Als Redakteur des Simplicissimus war Ludwig Thoma ein ungeheuer witziger und geistreicher Schilderer bayerischer Lebensart und ein streitlustiger Kritiker Preußens.
Die Widersprüche und Brüche im Leben des Menschen Ludwig Thoma blieben mir lange verborgen, bis sie seit den 1990er Jahren in den Feuilletons diskutiert wurden. Meine Sympathie für einige seiner literarischen Figuren und die entsprechenden Werke blieb davon unberührt, obgleich der letzte Abschnitt des Lebens von Ludwig Thoma auch bei mir einen faden Beigeschmack hinterlässt.
Ludwig Thoma wurde am 21. Januar 1867 als Sohn des Oberförsters Max Thoma und dessen Frau Katharina, geborene Pfeiffer, in Oberammergau geboren. Die Thomas hatten sieben Kinder, Ludwig war das fünfte Kind der Familie. Weil das Forsthaus in der Vorderriß weit abgelegen, in einem Nebental der Isar, nahe der Landesgrenze zu Tirol, lag, brachte die Mutter Ludwig im bayerischen Passionsspielort Oberammergau zur Welt.
Die Kindheitsidylle im abgeschiedenen Forsthaus, mit zahlreichen Tieren und den am Tal gelegenen Wäldern war für Ludwig Thoma nur von kurzer Dauer. 1873 zog die Familie Thoma nach Forstenried bei München. Im Jahr darauf – der kleine Ludwig war da gerade sieben Jahre alt – starb der Vater an einem Herzinfarkt. Die häufig kranke Mutter musste nun allein für ihre sieben Kinder aufkommen. Die Witwenpension in Höhe von 100 Mark reichte hinten und vorne nicht. Schließlich übernahm ein Beamter die Vormundschaft für ihre Kinder. Der wurde nicht Herr über den eigenwilligen Ludwig, der zwar als besonders begabt galt, aber alles andere im Kopf hatte als Schule, Disziplin und Fleiß. Umso talentierter zeigte sich der Junge im Aushecken von Streichen. Die Lehrer an der Lateinschule in Landstuhl in der Pfalz, die Ludwig besuchte, bescheinigten ihrem ungezogenen Schüler: »In seinem Charakter liegt etwas Durchtriebenes. Bei Tadel und Strafe zeigt er eine für seine Jahre ungewöhnliche Kälte und hartnäckige, trotzige Unempfindlichkeit.«
Je autoritärer seine Erzieher und Lehrer mit ihm umgingen, umso mehr wehrte sich Ludwig Thoma durch neue, oft boshafte Streiche. In der Familie, bei seiner Mutter und den älteren Geschwistern, galt er als Versager, der nur seinem Vergnügen nachjagte. Die hatten alle Hände voll zu tun: Die Mutter hatte den Gasthof Zur Kampenwand in Prien am Chiemsee gepachtet und führte ihn zusammen mit ihren Töchtern. Später übernahm sie die Gaststätte Post in Traunstein.
Mehrfach wechselte Ludwig die Internatsschulen: Von Neuburg an der Donau ging es nach Burghausen, München und Landshut. In Landshut machte Ludwig 1886 Abitur. Der Direktor des Gymnasiums hatte den Schüler Thoma für die übliche Abiturabschlussrede vorgesehen, doch als der Auserwählte am Rednerpult stand, brachte er kein Wort heraus.
Danach begann Ludwig ein Studium der Forstwissenschaft an der Forstakademie in Aschaffenburg am Main. Schon bald erkannte er, dass dies für ihn nicht der Weg in eine gedeihliche Zukunft sein konnte. Zwei Semester hielt er aus, dann wechselte er nach München, um Jura zu studieren. In Erlangen schloss er sein Studium mit dem Examen ab. Die mündliche Doktorprüfung bestand er mit »Ausreichend«. Seine schriftliche Arbeit zur Dissertation wurde von der Universität Erlangen nie angenommen. Ob Ludwig Thoma den Doktortitel, den er fortan für sich in Anspruch nahm, zu Recht führte, ist umstritten.
Anschließend nahm er eine Tätigkeit als Rechtspraktikant am Amtsgericht Traunstein auf. Erfüllung fand er darin nicht, auch nicht nach einem Wechsel zu einem Münchener Rechtsanwaltsbüro. In diese Zeit fielen seine ersten schriftstellerischen Versuche.
Im Juni 1894 starb Ludwigs Mutter. Im Herbst des gleichen Jahres ließ er sich als Advokat in Dachau nieder. Erste Erzählungen von ihm wurden in der Augsburger Abendzeitung veröffentlicht. Es folgte eine Sammlung Dachauer Bauerngeschichten unter dem Titel Agricola in Buchform.
In München lernte Thoma den jungen Verleger Albert Langen kennen, der die satirische Wochenzeitung Simplicissimus gegründet hatte. Unter dem Pseudonym Peter Schlemihl veröffentlichte Thoma dort satirische Gedichte. 1899 verkaufte er seine Anwaltspraxis in Dachau und wurde ab März 1900 Redakteur des Simplicissimus. Seine politischen Satiren und Gedichte hatten ihn zu einem für Albert Langen unentbehrlichen Mitarbeiter gemacht. Die Auflage stieg, der Simpl wurde nun Woche für Woche von 80000 Leserinnen und Lesern verschlungen.
1901 wurde Thomas Theaterstück Die Medaille im Residenztheater in München uraufgeführt. Ein Jahr später folgte mit der Komödie Die Lokalbahn ein erster großer Erfolg. Damit war der Dichter seine Geldsorgen vorerst los. Zusammen mit seinem Freund Ignaz Taschner unternahm er eine Fahrradtour nach Florenz, wenig später reiste er nach Südfrankreich, Nordafrika und Sizilien.
Zurück in München, begann er mit der Arbeit an den Lausbubengeschichten, die 1905 als Buch herauskamen. Im Jahr darauf erschien sein erster großer Roman Andreas Vöst. Als Thoma ihn vollendet hatte, gab es ein großes Fest in seiner Münchener Wohnung. Dabei lernte er die fünfundzwanzigjährige Tänzerin Marietta Schulz, geborene di Rigardo, kennen, die von den Philippinen stammte. Schon rein äußerlich war Marietta in allem das Gegenteil dessen, was Ludwig Thoma verkörperte. Sie verbrachte ihre Zeit mit Skifahren, Segeln und Tennis. Marietta ließ sich von ihrem Mann scheiden und heiratete noch im gleichen Jahr Ludwig Thoma. Gegen Zahlung einer fünfstelligen Summe hatte Mariettas Mann die Schuld für das Scheitern der Ehe auf sich genommen.
Die Ehe mit Marietta, von Thoma stets »Marion« genannt, hielt nicht lange. Beide Partner hatten sich in der Ehe einer gewissen gegenseitigen Freizügigkeit versichert, die Thoma allerdings vor allem für sich selbst in Anspruch zu nehmen gedachte. Als Marietta eine Affäre begann, bedeutete dies den Anfang vom Ende seiner Liebe zu ihr. Im August 1910 wurde das Paar geschieden.
Zur gleichen Zeit schrieb Ludwig Thoma den Bauernroman Der Wittiber (bayerisch für »Witwer«), der die seinerzeitigen moralischen Vorstellungen der bäuerlichen Welt seiner Heimat widerspiegelt und Einblicke in die Gefühlswelt des Autors gewährt.
Gemeinsam mit Albert Langen, Hermann Hesse und Theodor Heuss, dem späteren Bundespräsidenten, gründete Thoma 1906 die Zeitschrift März, die sich zu einer der erfolgreichsten Zeitschriften im deutschen Kaiserreich entwickelte. Für Hermann Hesse sollte sie der Auftakt zu seinem literarischen Erfolg sein. Im selben Jahr musste Ludwig Thoma wegen eines Spottgedichts im Simplicissimus, in dem er angeblich führende Vertreter von Sittlichkeitsvereinen beleidigte, eine sechswöchige Haftstrafe im Münchener Gefängnis Stadelheim antreten. Die nutzte er, um an seinem neuen Theaterstück Moral zu arbeiten. Mit dem großen Erfolg des Stückes Moral und den nachfolgend erscheinenden Filserbriefen erreichte Thoma endgültig den Status finanzieller Unabhängigkeit. 1908 bezog er ein großes Haus »Auf der Tuften« in Rottach am Tegernsee. Zudem pachtete er die Jagd in Dachau und die Tegernseer Gemeindejagd.
Seine literarische Produktion setzte sich auch während des 1914 begonnenen Krieges ungebrochen fort. Ludwig Thoma wandelte sich vom entschiedenen Kriegsgegner zum Kriegsbefürworter. Vehement trat er für den Erhalt des Deutschen Reiches ein, was zu Auseinandersetzungen in der Redaktion des Simplicissimus führte. Im März 1915 wurde Ludwig Thoma als Sanitäter einer Transporteinheit rekrutiert, die sich in den Einsatz nach Belgien begab. Ein paar Monate später wurde ihm das Eiserne Kreuz verliehen. Kurz darauf schied er wegen einer Ruhrerkrankung als felddienstuntauglich aus dem Militärdienst aus.
Nach Beendigung des Krieges wandte sich Thoma einer früheren Freundin, Maidi Feist-Belmont, inzwischen verheiratete von Liebermann, zu. Am Tegernsee machte das Gerücht die Runde, dass es in ihrer Ehe nicht zum Besten stehe. Thoma bemühte sich um sie, aber Frau von Liebermann beantwortete seine Briefe nicht. Doch Ludwig Thoma kämpfte um Maidi und forderte ihren Ehemann auf, seine Frau freizugeben – falls erforderlich, im Rahmen einer finanziellen Regelung, wie er es ja bereits erfolgreich bei seiner ersten Eheschließung praktiziert hatte. Bis zu seinem Tod sollte Thoma um Maidi werben, stets vergeblich.
Politisch war Thoma nach dem verlorenen Krieg endgültig im reaktionären Lager gelandet. Er wurde Autor des rechtsorientierten Miesbacher Anzeigers, einem Sammelbecken von Nationalisten und späteren Unterstützern und Mitläufern des Naziregimes. Ludwig Thoma verfasste anonym 167 Artikel, die vorwiegend gegen sozialdemokratische Positionen Stellung nahmen. In politischen und journalistischen Kreisen begann die Suche danach, wer hinter dem Anonymus steckte. Alsbald wurde Ludwig Thoma als Verfasser ausgemacht, doch Thoma leugnete hartnäckig. Sogar gegenüber Maidi von Liebermann.
Am 26. August 1921 verstarb Ludwig Thoma an einem Magenleiden in seinem Haus »Auf der Tuften« in Rottach. Den größten Teil seines Vermögens vermachte er Maidi von Liebermann, die das Haus am Tegernsee als Pension weiterführte.
Viele Literaturkritiker sehen in Ludwig Thoma heute allenfalls den Schöpfer humorvoller Jugenderinnerungen, die in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts mehrfach auf alberne Weise verfilmt wurden. Der langjährige Mitarbeiter der Süddeutschen Zeitung, Martin A. Klaus, hat im Jahr 2016 ein von der Literarturkritik viel beachtetes Werk über Thoma geschrieben, in dem er dessen Beziehungen zu Frauen, seine politischen Ansichten und seinen Antisemitismus kritisch beleuchtet.
Man mag zu Ludwig Thoma stehen, wie man will: Seine Lausbubengeschichten haben ganze Kindergenerationen und viele Erwachsene im 20. Jahrhundert entzückt und zum Lachen gebracht. Seine Filserbriefe sind – jeder für sich – Glanzstücke politischer Satire, die bis heute ihresgleichen suchen und von einer Beobachtungsgabe und einem Humor zeugen, die den bayerischen Schriftsteller über die literarisch tätigen Satiriker seiner Zeit hinausheben.
Lausbubengeschichten
Jozef Filsers Briefwexel
Der Münchner im Himmel
Altaich
Erinnerungen
Die Lausbubengeschichten erschienen erstmals im Jahr 1905 und tragen den Untertitel Aus meiner Jugendzeit. In einer späteren Ausgabe wurden sie von Olaf Gulbransson illustriert. Neben dem Münchner im Himmel sind die Lausbubengeschichten das bekannteste und erfolgreichste Werk Ludwig Thomas.
Mein Lieblingskapitel trägt die Überschrift »Besserung«. Darin geht es um die Bus- und Zugfahrt zweier missratener Schüler, die gerade ihr Zeugnis bekommen haben. In reichlich angetrunkenem Zustand machen es sich die beiden im Rauchercoupé bequem:
Wie der Zug gegangen ist, hat der Fritz eine Zigarre angezündet und den Rauch auf die Decke geblasen, und ich habe es auch so gemacht. Eine Frau ist neben mir gewesen, die ist weggerückt und hat mich angeschaut, und in der anderen Abteilung sind die Leute aufgestanden und haben herübergeschaut. Wir haben uns furchtbar gefreut, dass sie alle so erstaunt sind, und der Fritz hat recht laut gesagt, er muss sich von dieser Zigarre fünf Kisten bestellen, weil sie so gut ist …
Bei der nächsten Station haben wir uns Bier gekauft, und wir haben es schnell ausgetrunken. Dann haben wir die Gläser zum Fenster hinausgeschmissen, ob wir vielleicht einen Bahnwärter treffen … Wir sind weitergefahren, und bei der nächsten Station haben wir uns wieder ein Bier gekauft. Wie ich es ausgetrunken habe, ist mir ganz schwindlig geworden und es hat sich alles zu drehen angefangen. Ich habe den Kopf zum Fenster hinausgehalten, ob es mir nicht besser wird. Aber es ist mir nicht besser geworden, und ich habe mich stark zusammengenommen, weil ich glaubte, die Leute meinen sonst, ich kann das Rauchen nicht vertragen.
Es hat nichts mehr geholfen, und da habe ich geschwind meinen Hut genommen. Die Frau ist aufgesprungen und hat geschrien, und alle sind aufgestanden, und der Lehrer sagte: »Da haben wir es.« Und der große Mann in der anderen Abteilung: »Das sind die Burschen, aus denen man die Anarchisten macht.«[7]
Ludwig Thoma: Erinnerungen (Autobiographie). dtv, München 1983.
Fritz Heinle: Ludwig Thoma. Rowohlt Bildmonographie, aktualisierte Ausgabe, Reinbek 1985 (zuerst 1963).
Martin A. Klaus: Ludwig Thoma. Ein erdichtetes Leben. dtv, München 2016.
Ludwig-Thoma-Haus, Auf der Tuften, 83864 Tegernsee
Ludwig-Thoma-Haus, Augsburger Str. 23, 85221 Dachau
Geburtshaus Ludwig Thoma, Dorfstr. 20, 82487 Oberammergau
4Annette von Droste-Hülshoff. Die adelige Westfälin vom Bodensee
*10.1.1797 Havixbeck
†24.5.1848 Meersburg
Die Schullektüre Die Judenbuche empfand ich nach wenigen Seiten als dröge, und einige meiner Mitschüler auch. Ich kaufte mir ein dünnes Bändchen mit Materialien zum Text – waren es Königs Erläuterungen? – und konnte somit im Unterricht erfolgreich verbergen, dass ich die Erzählung der adeligen Dichterin gar nicht gelesen hatte.
In der gewonnenen Zeit hörte ich lieber Platten der Beatles, der Kinks und der Rolling Stones. Und um die Novellendichterin nicht völlig aus den Augen zu verlieren, widmete ich mich stattdessen einigen Balladen der Droste. »Der Knabe im Moor« jagte mir Schauer über den Rücken, das war eine Story ganz nach meinem Geschmack.
Der Kapitän steht an der Spiere, das Fernrohr in gebräunter Hand … So beginnt die Ballade »Die Vergeltung«, ein handwerkliches Meisterstück deutscher Dichtkunst, von gleichem Rang wie »Der Knabe im Moor«, »Der Fundator« und »Am Turme«. Hätte »die Droste« nur diese Gedichte geschrieben und sonst gar nichts, so würde sie dennoch Eingang in den Olymp der deutschen Dichtung finden. Die Judenbuche aber habe ich bis heute nicht gelesen – ein Versäumnis, das es zu bereinigen gilt. Es ist die einzige vollendete Novelle der Dichterin.
»Die Droste« wurde am 10. Januar 1797 auf der Wasserburg Hülshoff bei Münster in Westfalen geboren. Ihr vollständiger Name lautet Anna Elisabeth Francisca Adolphina Wilhelmina Ludovica Freiin von Droste zu Hülshoff.
Sie wuchs auf Burg Hülshoff mit drei Geschwistern auf. Biographen schildern sie als lebhaftes, sensibles Kind, das sich gern in der Natur aufhielt und gelegentlichen Stimmungsschwankungen unterlag, in denen sie sich gern auf sich selbst zurückzog. Andererseits hatte sie Freude am gemeinsamen Musizieren und Komödie-Spielen. Seit ihrer frühen Kindheit kränkelte sie und litt unter häufigen Kopfschmerzen sowie an einer Sehschwäche. Früh begann sie, sich mit der Musik und dem Schreiben zu beschäftigen. In ihrer Jugend lernte sie den Märchendichter Wilhelm Grimm kennen, der ihr gegenüber skeptisch blieb. »Es ist schade, dass sie etwas Vordringliches und Unangenehmes in ihrem Wesen hat«, schrieb er an seinen Bruder Jacob Grimm, »es war nicht gut mit ihr fertig zu werden.« Diese Einschätzung gründete auf dem Selbstbewusstsein der jungen Frau, mit dem sie sich kritisch und meinungsstark in den Gesprächen der etablierten Dichter zu Wort meldete. Die von Männern dominierte Welt der literarischen Kreise jener Zeit nahm die Einlassungen der jungen, ambitionierten Frau als geduldete Randerscheinung ihrer Gespräche wahr. Oft wurden ihre Diskussionsbeiträge mehr belächelt denn als Bereicherung empfunden. Ein anderer Zeitzeuge, der Kaufmann Fritz Beneke, beschrieb die junge Dichterin anlässlich eines Besuches in Bökendorf gar als »eitel, eigensinnig und gebieterisch«.
Bei einem der kontinuierlich stattfindenden Treffen des Bökendorfer Kreises, einer Gruppe literatur- und kulturinteressierter Adeliger und Vertretern des gehobenen Bürgertums auf Schloss Bökerhof, lernte die dreiundzwanzigjährige, nur einen Meter fünfzig große Annette den Kasseler Juristen und Schriftsteller Heinrich Straube kennen, der sich in sie verliebte. Inwieweit Annette von Droste-Hülshoff die Gefühle ihres wenig attraktiv aussehenden Freundes erwiderte, ist bis heute literaturgeschichtlich nicht geklärt.
Der zum Freundeskreis gehörende Ministersohn und Literat August von Arnswaldt spann nun gemeinsam mit Straube und anderen Angehörigen des Kreises eine Intrige, um die Ernsthaftigkeit und Treue der Droste auf die Probe zu stellen: Er gab vor, sich in Annette verliebt zu haben, und Annette ging darauf ein – in welcher Form auch immer. An dieser Intrige zerbrachen die Beziehungen Annettes zu beiden Freunden. Annette von Droste-Hülshoff fühlte sich gedemütigt und zog sich aus dem Kreis zurück.
Zu den Ereignissen hat sich die Dichterin brieflich geäußert: Ich glaube, ich war in Arnswaldt verliebt, und in Straube nicht so recht, aber das erste ist vergangen … Arnswaldt muss mich von Anfang an gehasst haben, denn er hat mich behandelt wie eine Hülse, die man nur auf alle Art drücken und brechen darf, um zum Kern zu gelangen.[8] Bis heute wird aus diesem nachhaltigen Einschnitt im Leben der Dichterin ihre bis zum Lebensende andauernde Ehe- und Kinderlosigkeit hergeleitet.
Annette widmete sich weiter ihrem dichterischen Schaffen, komponierte Musikstücke und unternahm Reisen ins Rheinland zu Verwandten. Nach dem Tod ihres Vaters zog sie 1826 mit ihrer ältesten Schwester Jenny in das Rüschhaus zu Münster, dem Witwensitz ihrer Mutter. Die ohnehin innige Beziehung zu Jenny vertiefte sich. Auch die Heirat ihrer Schwester tat dem keinen Abbruch. 1834 zog Jenny mit ihrem Ehemann Freiherr von Laßberg auf die Burg Meersburg am Bodensee. Bei den zahlreichen längeren Besuchen und Aufenthalten von Annette entstanden die wichtigsten Werke der Dichterin.
1838 erschienen die ersten Gedichte der Annette von Droste-Hülshoff in einem Band des Münsteraner Aschendorff Verlages. Die Veröffentlichung fand kein großes Aufsehen, es wurden nur wenige Exemplare verkauft. Aufregend fand die literarische Öffentlichkeit allenfalls den Umstand, dass eine Frau Gedichte veröffentlichte.
Als Annette einundvierzig Jahre alt war, begann eine Freundschaft zu dem vierundzwanzigjährigen Levin Schücking, dem Sohn ihrer Freundin Katharina Busch. Schon als Schüler hatte er sich gelegentlich im Kreis der Familie Droste-Hülshoff eingefunden. Schücking war ein gut aussehender junger Mann, der eine große Anziehungskraft auf Frauen ausübte. Annette von Droste-Hülshoff wurde eine enge Vertraute für ihn, sie ging in einer fürsorglichen, ja fast mütterlichen Rolle für ihn auf. Er vermittelte ihr ein Gefühl von wiederkehrender Jugend, das ihr, trotz gesundheitlicher Labilität, die Kraft für neue kreative Phasen gab. Sie begann mit der Arbeit an der Novelle Die Judenbuche.
Auf Vermittlung von Annette übernahm Levin Schücking die Aufgabe eines Bibliothekars auf Schloss Meersburg, in dem seine Freundin, die er in Briefen mit »Mütterchen« und zunächst mit »Sie« anschrieb, ein kleines Zimmer bewohnte. Um dem Geschwätz der Öffentlichkeit zu entgehen, musste die Beziehung verschleiert werden. Dennoch sah man sich täglich. Ganz offensichtlich sah die Dichterin in Levin Schücking nicht nur den jungen Mann, den sie mütterlich und Rat gebend umsorgen durfte. Sie sehnte sich nach der Erfüllung ihrer Liebe und nach körperlicher Nähe. In ihren Briefen himmelte sie ihn regelrecht an: Mein liebes, liebstes Herz, schrieb sie, ich kann Dir gar nicht sagen, wie lieb ich Dich habe.[9] Doch ihrer Sehnsucht nach Mehr konnte und wollte Schücking nicht entsprechen. Droste liebte Schücking, für Schücking war die Droste eine beste Freundin, eine Art Mutterersatz.
Im Frühjahr 1842 verließ Levin Schücking Meersburg und trat eine Stelle als Prinzenerzieher in der Nähe von Salzburg an. Alsbald heiratete er die Tochter eines hessischen Generals, Luise von Gall, der er vor der Verlobung noch nie persönlich begegnet war. Kennengelernt hatte Schücking seine spätere Ehefrau durch deren Veröffentlichungen in einer Zeitung des Cotta Verlages. Daraus folgte eine Kontaktaufnahme per Brief. Den ihm vertrauten Dichter Ferdinand von Freiligrath bat er, der Droste nichts davon zu erzählen. In einem gemeinsamen Brief, den Levin Schücking und seine Braut Luise an Annette sandten, stellten sie sich schließlich als Paar vor.
Die Droste fiel auf sich selbst zurück. Sie litt unter der Trennung von Levin und war eifersüchtig, ohne sich dies anmerken zu lassen. Nachdem sie sich ein kleines Häuschen in den Rebhängen oberhalb der Burg gekauft hatte, weilte das Ehepaar Schücking für gut drei Wochen auf der Meersburg. So sah Levin seine alte Freundin zum ersten Mal nach der Trennung wieder. Und dann nie mehr. Annette von Droste-Hülshoff kehrte, von Krankheit gezeichnet, nach Münster zurück.
Levin Schücking kritisierte nun in seinem schriftstellerischen Werk die Privilegien des Adels, sehr zum Missfallen seiner Freundin, die sich jetzt auch dem Verdacht ausgesetzt sah, intime Informationen aus ihren Kreisen an ihren jahrelangen engen Freund weitergegeben zu haben.
In den letzten Sommertagen des Jahres 1846 zog Droste-Hülshoff noch einmal um, zunächst vom Rüschenhaus ins Schloss Hülshoff. Ihr Arzt empfahl ihr, den Winter nicht im Münsterland zu verbringen. Ende September traf sie nach einer beschwerlichen Reise in Meersburg ein. Kurz nach der Märzrevolution in Deutschland starb Annette von Droste-Hülshoff am 24. Mai 1848 auf Schloss Meersburg. Zwei Tage später wurde sie auf dem dortigen Friedhof beerdigt.
Levin Schücking setzte sich auch nach ihrem Tod für die Dichterin ein. Er besorgte die Ausgabe Sämtlicher Werke von Annette Droste-Hülshoff, die 1878/79 im Cotta Verlag erschien.
Balladen und Gedichte
O schaurig ist’s über’s Moor zu gehn, / Wenn es wimmelt vom Heiderauche / Sich wie Phantome die Dünste drehn / Und die Ranke häkelt am Strauche, / Unter jedem Tritte ein Quellchen springt, / Wenn aus der Spalte es zischt und singt, / O schaurig ist’s übers Moor zu gehen, / Wenn das Röhricht knistert im Hauche.[10]
Wer, der diese Zeilen gelesen hat, könnte sie je vergessen? Die adelige Dichterin war eine Meisterin der deutschen Sprache, wie kaum eine zuvor und kaum eine danach. Ihre Verse lassen unvergessliche Bilder entstehen. Das Gedicht vom Knaben im Moor erzählt eine Geschichte, die man heutzutage in einem Film nicht plastischer darstellen könnte. Alles passt. Jede Zeile, jeder Reim stimmt punktgenau. Das setzt nicht nur Eingebung und Phantasie voraus, sondern auch überragendes handwerkliches Geschick in der Bearbeitung und Verfeinerung eines Textes.
Die Ballade schildert einen Jungen, der nachts durch das Moor geht und von Ängsten gepeinigt wird, die ihn immer rascher vorantreiben. Die Gefahr, der er durch die Beschaffenheit des Moorbodens ausgesetzt ist, geht einher mit Bildern von bedrohlichen Phantasiegestalten aus ihm bekannten Sagen und Erzählungen seiner Umgebung.
Fest hält die Fibel das zitternde Kind / Und rennt, als ob man es jage; / Hohl über die Fläche sauset der Wind – / Was raschelt drüben am Hage? / Das ist der gespenstische Gräberknecht, / Der dem Meister die besten Torfe verzecht; / Hu, hu, es bricht wie ein irres Rind! / Hinducket das Knäblein zage. // Vom Ufer starret Gestumpf hervor, / Unheimlich nicket die Föhre, / Durch Riesenhalme wie Speere; / Und wie es rieselt und knittert darin! / Das ist die unselige Spinnerin, / Das ist die gebannte Spinnlenor’, / Die den Haspel dreht im Geröhre.[11]
Von Strophe zu Strophe steigt die Spannung. Bis zu dem Punkt, an dem der Knabe wohlbehalten am anderen Ende des Moores angelangt ist.
Da mählich gründet der Boden sich, / Und drüben, neben der Weide, / Die Lampe flimmert so heimatlich, / Der Knabe steht an der Scheide. / Tief atmet er auf, zum Moor zurück / Noch immer wirft er den scheuen Blick: / Ja, im Geröhre war’s fürchterlich, / O schaurig war’s in der Heide.[12]
»Der Knabe im Moor« wurde am 16. Februar 1842 im Morgenblatt für gebildete Leser, das vom Cotta Verlag herausgegeben wurde, veröffentlicht. Dort erschien im gleichen Jahr auch die Novelle Die Judenbuche. Die Droste gehört zu den wenigen Dichterinnen von Weltrang, die sich der deutschen Sprache bedienten. Das gilt uneingeschränkt, auch wenn sie und ihre Werke für viele heutzutage fast in Vergessenheit geraten sind.
Barbara Beuys : Blamieren mag ich mich nicht. Das Leben der Annette von Droste-Hülshoff. C. Hanser Verlag, München 1999.
Herbert Kraft: Annette von Droste-Hülshoff. Rowohlt Bildmonographie, 5., neu bearbeitete Auflage, Reinbek 1998.
Droste-Hülshoff-Museum, Herrenhaus der Villa Schonebeck, Burg Hülshoff, Schonebeck 6, 48329 Havixbeck
Museum Haus Rüschenhaus, Am Rüschenhaus 81, 48161 Münster-Nienberge
Fürstenhäusle Meersburg, Stettener Str. 11, 88709 Meersburg
5Heinrich Heine. Ein deutscher Dichter für die ganze Welt
*13.12.1797 Düsseldorf
†17.2.1856 Paris
Mein Großvater verehrte Heinrich Heine wie keinen anderen deutschen Dichter, vielleicht weil er überzeugter Sozialdemokrat war und er ebenfalls den Vornamen Heinrich trug. Die »Loreley« konnte er auswendig aufsagen und in entsprechender Stimmung auch in klangvollem Tenor vorsingen, während er sich dabei selbst am Klavier begleitete. Sein Lieblingsgedicht von Heinrich Heine war »Die schlesischen Weber«. Gerne zitierte er die Zeile Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht, aus Heines Wintermärchen: Etwa wenn der von ihm geschmähte Bundeskanzler Adenauer im Radio wieder einmal gegen die Sozialdemokraten und Gewerkschaften wetterte oder die »Ritterkreuzträger-Partei« FDP, wie er sie zu nennen pflegte, sich anschickte, gegen den von ihm verehrten Kurt Schumacher oder gegen Erich Ollenhauer zu Felde zu ziehen.
Heinrich Heine gehört neben Goethe und Schiller zu den größten Dichtern deutscher Sprache. Seine Werke haben Weltgeltung und sind zeitlos geblieben. Kein anderer deutscher Lyriker hat derart volksliedhafte Verse geschrieben, die so klar und einfach die Gefühlswelt alles Menschlichen beschreiben wie er.
Geboren wurde Heinrich Heine im Dezember 1797 in Düsseldorf am Rhein. Der genaue Geburtstag ist unklar, neuere Forschungen gehen vom 13. Dezember aus. Zu den Irritationen trug Heinrich Heine höchstselbst bei, weil er sein Geburtsdatum kurzerhand auf die Jahrhundertwende verlegte, wohl um als eine der ersten Geistesgrößen des 19. Jahrhunderts in die Kulturgeschichte einzugehen. Dessen hätte es nicht bedurft, das schaffte er auch so.
Seine Eltern waren der Textilkaufmann Samson Heine aus Hannover und dessen Ehefrau Betty, geborene van Geldern, aus Düsseldorf. Sie gehörten der jüdischen Gemeinde der Stadt an. Ihr ältester Sohn bekam den Namen Harry Heine. Erst als dieser zum Protestantismus konvertierte, nahm er den Namen Heinrich an. Zum Zeitpunkt der Geburt Heines gehörte Düsseldorf zum französischen Kaiserreich. Nach der Niederlage Napoleons bei der Völkerschlacht zu Leipzig 1813 besetzten französische Truppen die Stadt. Zwei Jahre später wurde das Rheinland auf Beschluss des Wiener Kongresses gemeinsam mit Westfalen ein Teil von Preußen.
Nach dem Besuch der Vorschule und der Volksschule besuchte Harry Heine für fünf Jahre das Düsseldorfer Lyzeum und wechselte danach auf die Höhere Handelsschule. Nach verschiedenen Praktika in Banken und in einer Kolonialwarenhandlung absolvierte er eine zweijährige Lehre in einem Hamburger Bankhaus, an dem sein Onkel Salomon Heine beteiligt war. Salomon Heine hatte den Ruf, der reichste Mann von Hamburg zu sein. In seinem vornehmen Haus im heutigen Stadtteil Ottensen (damals zu Altona und damit zu Dänemark gehörend) verkehrte alles, was in Wirtschaft, Politik und Kunst Rang und Namen hatte. Neben zwei Söhnen hatte Salomon auch vier Töchter, in die sich der junge Heine der Reihe nach verliebte, obgleich sie doch seine Cousinen waren. Seine von den Millionärstöchtern mehr oder weniger unerwiderten Gefühle goss Harry Heine in romantische Verse.
Die Geschäfte des Vaters in Düsseldorf gingen derweil immer schlechter. Als letzte Rettung war die Gründung einer Zweigniederlassung in Hamburg unter dem Firmennamen seines Sohnes »Harry Heine et Comp.« gedacht. Hier sollten die in Düsseldorf nicht verkauften Waren angeboten werden. Die erforderliche Kapitaleinlage besorgte Onkel Salomon. Doch kurze Zeit nach der Gründung der Hamburger Filiale war Samson Heine bankrott. Die Verbindlichkeiten gegenüber Banken und Salomon Heine beliefen sich auf rund 90000 Taler.
1819 kehrte Heine in sein Elternhaus nach Düsseldorf zurück. Onkel Salomon unterstützte die Familie seines Bruders und stellte für die Ausbildung der Kinder Geld zur Verfügung. Harry Heine nahm in Bonn ein Jurastudium auf. Nach zwei Semestern wechselte er an die Universität Göttingen. Dort hielt es ihn aber nicht lange. Wegen einer Duellforderung nach einer von ihm geäußerten Beleidigung erhielt er einen einjährigen Universitätsverweis. Auch die Burschenschaft, der er beigetreten war, musste er verlassen, da er ein »Vergehen gegen die Keuschheit« begangen haben soll. Ort der unkeuschen Tat: die »Knallhütte« – nomen est omen –, ein Bordell in der Ortschaft Bovenden, nördlich von Göttingen.
Heine wechselte zur Königlichen Universität Berlin. Hier trat er zum ersten Mal als Buchautor hervor. 1822 erschien in der Maurer’schen Buchhandlung ein Band mit seinen Gedichten und ein Jahr später mit Intermezzo ein weiteres Werk im Verlag Dümmler. Erhöhte Aufmerksamkeit erreichte Heine mit der Veröffentlichung seiner Briefe aus Berlin in der Zeitung Rheinisch-Westfälischer Anzeiger. Die ironisch-kritischen Berichte aus der preußischen Hauptstadt bedeuteten den Beginn seiner journalistischen Arbeiten.
Es schlossen sich Aufenthalte bei den nach Lüneburg umgezogenen Eltern und Reisen nach Westpolen, Cuxhaven und in den Harz an, bevor Harry Heine sein Studium – nun wieder in Göttingen – abschloss. Er legte sein juristisches Examen ab und wurde 1825 zum Dr. juris promoviert. Im gleichen Jahr konvertierte er in Heiligenstadt, eigentlich einer katholischen »Hochburg«, und ließ sich dort protestantisch auf den Namen Christian Johann Heinrich Heine taufen.
Dann zog Heine nach Hamburg, wo der Verleger Julius Campe 1826Die Harzreise als ersten Teil der Reisebilder veröffentlichte. Mit den Reisebildern, die sukzessive bei Hoffmann und Campe erschienen, gelang Heine der schriftstellerische Durchbruch. Gleichzeitig begannen seine Auseinandersetzungen mit den deutschen Zensurbehörden. Verleger Campe unterstützte seinen Autor tatkräftig in dessen Kampf gegen die Zensur. Um der üblichen Vorzensur der Behörde aus dem Weg zu gehen, wurde der zweite Band der Reisebilder zu einem 360 Seiten starken Sammelband zusammengefasst, sodass sich Heine später zu einem Loblied auf seinen Verleger veranlasst sah, das er im Wintermärchen niederschrieb:
Der Campe ist wirklich ein großer Mann, / ist aller Verleger Blüte. / Ein anderer Verleger hätte mich / vielleicht verhungern lassen, / der aber gibt mir zu trinken sogar; / werde ihn niemals verlassen. / Ich danke dem Schöpfer in der Höh, / der diesen Saft der Reben / erschuf und zum Verleger mir / den Julius Campe gegeben![13]
Der junge Autor und sein Verleger waren einander auf freundschaftliche und oft ironische Weise verbunden. Heine schrieb an Campe: Ich weiß … dass ihr Herz mir liebend zugetan ist, aber der Weg von Ihrem Herzen bis zu Ihrer Tasche ist sehr weit …[14] Trotz zahlreicher Auseinandersetzungen, in der es meist um Honorarfragen ging, fanden Autor und Verleger immer wieder zusammen. Campe schrieb über seine Zusammenarbeit mit Heine, »es sei, wie es sich in einer guten literarischen Ehe geziemt, wo man lieben, aber auch schmollen und grollen darf, damit wieder Platz für die Liebe gewonnen wird …«.
Heine fasste den Plan, eine vollständige Sammlung seiner bisherigen Gedichte verlegen zu lassen. Obwohl er auf ein Vorabhonorar verzichten wollte, tat sich Campe mit diesem Projekt schwer. Wohl nur aufgrund des Erfolges der Reisebilder wurde Das Buch der Lieder im Jahr 1827 gedruckt. Es brauchte zehn Jahre, bis es zu einem Erfolg wurde, der nur mit Goethes Werther vergleichbar war. Nun musste es ständig nachgedruckt werden. Das Buch der Lieder erschien bis zu Heines Tod in dreizehn und bis zum Ablauf des Verlagsrechtes bei Hoffmann und Campe in fünfzig Auflagen.
Noch im Jahr des Erscheinens des Buchs der Lieder übernahm Heine für ein hohes Jahresgehalt den Posten eines Redakteurs bei der Monatszeitschrift Neue Allgemeine Politische Annalen in München, die Johann Friedrich Cotta herausgab. Eine Bewerbung um die Stelle eines Honorarprofessors an der Universität München wurde vom bayerischen König Ludwig I. abgelehnt. Vor allem deshalb, weil Heines Wirken als Kritiker der herrschenden Klasse und Verhältnisse offenkundig und ein Mann seiner Überzeugungen für die Obrigkeit alles andere als willkommen war.
Umso mehr galt es jetzt für Heine, sich auf seine schriftstellerische und journalistische Arbeit als eigentlichen Broterwerb zu konzentrieren. Seine zahlreichen Reisen wurden zum schier unerschöpflichen Quell seiner literarischen Veröffentlichungen, in denen sich die spöttische Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen zunehmend verschärfte.
Im Jahr 1831 wurden seine Werke vom preußischen Ministerium des Innern verboten. Heinrich Heine ging ins französische Exil nach Paris. Dort begann er eine Korrespondententätigkeit für Cottas Allgemeine Zeitung. Neben Bekanntschaften zu Frauen aus den Salons des Pariser Lebens wie Betty Rothschild, George Sand und Elisa Rachel hielt sich Heine bevorzugt im Milieu der einfacheren Damen auf der Straße und in den Prostituiertenvierteln der französischen Hauptstadt auf. 1834





























