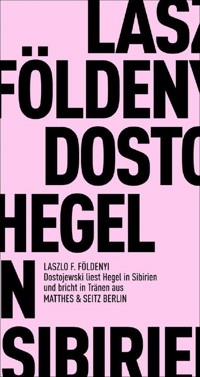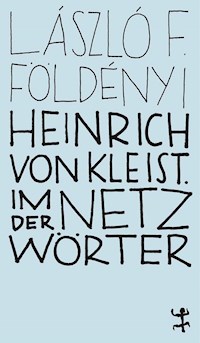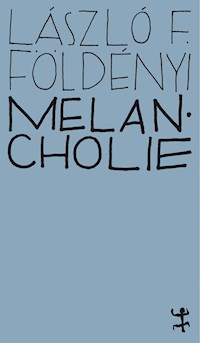Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit diesem Lob der Melancholie kehrt László F. Földényi nach 40 Jahren zu seinem Lebensthema zurück und nähert sich ein weiteres Mal jener unzeitgemäßen Stimmung. In einem feinen Gewebe von Essays durchstreift er Malerei, Kino und Literatur und entlockt ihnen die Erfahrung einer Sehnsucht, die in ihrer Zartheit alles mit sich zu reißen vermag. Dabei begegnet uns die Melancholie in all ihrem betörenden kulturellen Reichtum als verunsichernder dunkler Schatten des sonst so strahlenden, vergnügungssüchtigen Diesseits - ohne jedoch den versöhnenden Glauben an ein Jenseits anzubieten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
László F. Földényi
Lob der Melancholie
Rätselhafte Botschaften
Aus dem Ungarischenvon Akos Doma
O reiner Mond, …
Du aber bist nicht sterblich
Und wirst kaum Acht auf meine Klage geben.
Doch du, einsame, ew’ge Wandlerin,
Gedankenvolle, du vielleicht verstehst,
Was dieses Erdenleben,
Dies unser Leiden soll und unser Bangen,
Was unser Tod bedeute, dieses letzte
Erblassen unsrer Wangen,
Dies von der Erde Schwinden und Entschweben
Aus jedem Kreise, der uns traut umfangen.
[…]
Wenn ich die Herde treibe sacht voran
Und seh’ die Stern’ erglänzen dicht und dichter,
Frag’ ich mich in Gedanken:
Wozu so viele Lichter?
Was soll das weite Luftmeer, jener tiefe
Endlose Aether? Was bedeutet diese
Gewalt’ge Einsamkeit? Und ich, was bin ich?
So grübl’ ich bei mir selbst; und für dies Haus,
So grenzenlos und herrlich,
Für seine zahllos wimmelnden Bewohner,
Dann für so vieles Mühn, so vieles Regen
Der Wesen all’, die Erd’ und Himmel faßt,
Umkreisend ohne Rast,
Um doch zum Ausgang stets zurückzukehren,
Vermag ich weder Grund
Noch Zweck zu ahnen. Aber dir gewiß,
Göttliche Jungfrau, ist dies Alles kund.
Giacomo Leopardi, »Nachtgesang eines wandernden Hirten in Asien« (Aus dem Italienischen von Paul Heyse)
Inzwischen war es wirklich Nacht; das Licht war verschwunden und hatte einer unnatürlichen Dunkelheit Platz gemacht. Kilometerweit ringsum gab es keine künstliche Lichtquelle, und der Mond war noch nicht aufgegangen. Blieben die Sterne. Die herrlichen Sterne der Jugend, die man später kaum noch betrachtet, während sie weiterhin funkeln mit ihrem körnigen, unruhigen Licht, selbst in der größten Stille. Ihr beharrliches Flackern [war] wie eine Sprache. Und hinzu gesellte sich unversehens die brudergleiche Sprache des Grillenkonzerts, nah und unendlich weit. Die beiden Sprachen schienen ohne Unterbrechung nur das eine, doch Unerschöpfliche sagen zu wollen: allzu leicht wäre es, wenn wir dächten, es spräche von Traurigkeit und Tod; es war viel mehr: es war reines Wissen, ein ungeheuer bedeutungsvoller Gedanke, doch gegenstandslos.
Pier Paolo Pasolini, Petrolio, S. 92
Inhalt
Der Anfang. Auf dem Rücken liegend
Einführung
Melancolía
Jenseits von Wissen und Gefühl
In Mythen gefangen
Der melancholische Embryo
Rätselhafte Steinblöcke
IDürer besucht Giorgione in seinem Atelier und wird beim Anblick des Gewitters von tiefer Melancholie befallen
IIEt in Arcadia ego. Ein wohlbehauenes, quadratisches Grab
IIIDürers Polyeder: ein rätselhafter Steinblock, der sogar fortfliegen könnte
IVStanley Kubrick behaut und poliert Dürers Polyeder weiter
VExkurs: In den Tod hineingeboren werden oder gerade durch den Tod geboren werden, wie es Stanley Kubricks Helden geschah. Hans-Peter Feldmanns Serie 100 Jahre
VIDie nahende Dunkelheit
Eine Kapelle. Peter Zumthor denkt Dürers Polyeder und Kubricks Monolith im Raum weiter
IDie Bruder-Klaus-Feldkapelle
IIWenn der Raum zum Erlebnis wird
IIIEin Bauwerk, das sich der Erlösung genauso widersetzt wie deren Fehlen
IVExkurs: Ein Möbelstück
Die Melancholie von Anselm Kiefer
IDas Sichtbare und das Unsichtbare
IIDie melancholische Ordnung der Engel
IIIHypatia
Die Grenzen des Körpers
IUnter dem Tätowierapparat
IIWem gehört der Körper, wenn nicht dem, der in ihm wohnt?
Francis Bacon
IFrancis Bacons Atelier: Der Brandherd des Geistes
IIAls entstünde die Persönlichkeit vor unseren Augen: Die Portraits von Francis Bacon
Abgesang auf das Kino
IAbgesang auf das Kino
IIAbgesang auf den Film
IIIBeuys, Viola und die anderen
IVDie Taten und Leiden des Lichtes
VRichters Glasfenster
Die kosmische Stille. Giovanni Segantini malt die Schlitten ziehende Bäuerin im Engadin
Michael H. Parkinson nimmt Gestalt an, betritt die Literatur und steigt mithilfe W. G. Sebalds auf dieer-Straßenbahn um
INorwich, Sommer
IIDie 56er-Straßenbahn
Das Ende. Zwei Augenpaare
Anmerkungen
Literatur
Abbildungsverzeichnis
Der Anfang
Auf dem Rücken liegend
Ich hatte gar nicht bemerkt, dass ich müde geworden war. Aber mein Körper erinnerte mich daran. Ich ging in den Garten, suchte einen sonnigen Fleck im Gras, überlegte, wann die rasch sinkende Nachmittagssonne von der nächsten Baumkrone verdeckt würde. Ich breitete eine Decke aus, legte mich mit den Füßen zur Sonne gewandt hin.
Die Müdigkeit ließ mich jedoch nicht zur Ruhe kommen. Mal legte ich die Hände hierhin, mal dorthin; faltete sie unter meinem Kopf, verschränkte sie auf meinem Bauch, dann legte ich die linke neben meinem Rumpf auf die Erde und schob die rechte unter meinen Nacken. Sekunden später legte ich meine auf dem Boden liegende Hand auf meinen Bauch. Dann legte ich beide auf die Erde. Das kam mir am bequemsten vor. Meine Finger und Muskeln führten indessen ihr eigenes Leben; auch sie verlangten nach Bequemlichkeit und so drehten sich meine Arme ein wenig nach außen. Meine Muskeln entspannten sich. Doch jetzt versagten meine Gelenke, Fingerknochen und Handgelenke den Gehorsam. Selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich diese winzigsten, fast unmerklichen Zuckungen nicht beeinflussen können. Zuletzt kamen meine Arme allmählich von selbst zur Ruhe. Ebenso erging es meinen Beinen.
Mein im Gras liegender, ermüdeter Körper hatte sich unabhängig von mir seine passendste Stellung gesucht. Lange hatte er gezögert. Erst als er sich restlos, bis in die kleinsten Glieder, die feinsten und verborgensten Hautoberflächen, von mir, der ich mich für seinen Eigentümer hielt, ja unerschütterlich überzeugt davon war, dass dieser Körper so sehr eins mit mir sei, dass er ohne mich gar nicht existieren könne, befreit hatte, war er zur Ruhe gekommen. Während ich im immer kraftloser werdenden Sonnenschein reglos dalag, konzentrierten sich alle meine Gedanken auf die Hoffnung, dass die Sonne die schattenwerfenden Baumkronen möglichst spät erreichte. Doch je näher sie ihnen kam, desto mehr wurde meine Hoffnung von einer infolge des Wartens in mir aufkeimenden, prickelnden Ungeduld erfüllt. Bis schließlich, wenn das Zusammentreffen der Blätter und Sonnenstrahlen unausweichlich sein würde – und weniger das Auge als vielmehr die Hautoberfläche zu spüren begänne, wie ein Ast sich in die Sonnenkugel schob –, das Prickeln überhandnähme und ich mehr noch als den ungetrübten Sonnenschein die paar Augenblicke des von Schatten durchsetzten Lichtes zu genießen begänne. Vielleicht nicht einmal mehr das, sondern nur noch die nicht weiter zu steigernde Erwartung, die meinen Körper einem maßlosen, der Befriedigung ähnelnden Zittern auslieferte, bevor er im kurz darauf heranschleichenden, endgültigen Schatten zu sich käme und wieder der meine würde. Und ich, meines Körpers unerwartet wieder Herr geworden, erschaudern würde, mich zusammenzöge, zu regen begänne und bald darauf erhöbe.
Aber noch schien die Sonne, verließ mich mein Körper Regung für Regung. Hätte man mich gefragt, hätte ich nicht mehr sagen können, wie ich meine Hände, meine Füße, meinen Kopf hielt und auch nicht, in welcher Stellung sie zueinander lagen. Dass ein Körper da sein musste, wusste ich natürlich. Zu diesem Wissen gesellte sich jedoch keinerlei Gewissheit.
Mein Körper ruhte. Um das tun zu können, hatte er sich meiner entledigt. Ich hatte versucht, selbst die bequemste Stellung zu finden; aber ich muss wohl so müde gewesen sein, dass all die gewollten Bewegungen, die sonst natürlich gewesen wären, sich als erschöpfend erwiesen. Ich hatte die Bewegungen gesucht; aber nichts ist ermüdender als gesuchte Natürlichkeit. Die gewählte Stellung der Arme oder Beine wird schon durch die schiere Tatsache des Wählens immer schwerer, bis schließlich auch das einfache Liegen zu einer unerträglichen Kraftprobe werden kann.
Ich ruhte, aber wider meines Selbst. Meine Gliedmaßen schienen sich nun in die Erde zu schmiegen. Mein Bauch senkte sich; ineinander geschoben sackten mein Magen, meine Leber, meine Gedärme, aber auch meine Nieren ein, und die Wölbung der Magenwand folgte ihnen. Mein Körper verwandelte sich. Er begann sich von mir zu entfernen. Nur die Erde hinderte meine inneren Organe daran, aus mir herauszustürzen. Zu meinem Rückgrat hatte ich nicht mehr Bezug als zu einem Ast. Und statt als neutraler Untergrund unbemerkt zu bleiben, diente mir die Erde jetzt als Stütze. Ich spürte, dass ich mit meinem ganzen Gewicht auf ihr lastete und mich damit auch von mir selbst loszulösen versuchte.
Während ich dalag und durch das unwillkürliche Zurückhalten meines Atems mein Ich und das Gefühl des Gleichgewichts zwischen ihm und meinem Körper, der aus ihm entweichen wollte, zu bewahren suchte, geriet ich geradezu außer mir. Ich sah mich auf der ein wenig verschlissenen, an den Rändern zerfransten Decke liegen, im Gras, unter dem jungen Aprikosenbaum, unweit des Haselnussstrauchs, wo immer wieder Scharen winzigster Insekten und Käfer sich auf den Weg machten, um den am Boden liegenden menschlichen Körper zu umfliegen, zu erkunden und dann wieder zu verlassen; ich sah, wie mein Kopf leicht zur Seite knickte, meine Arme sich neben meinem Rumpf ins Gras schmiegten und meine Füße sich sanft nach außen drehten; und während ich meine Sohlen beobachtete, die an den Knochen etwas verfärbte, aber noch nicht verhärtete, allerdings auch nicht mehr als lebendig zu bezeichnende Hautoberfläche, die mir bis dahin unbekannte Ordnung der Runzeln, Falten und Linien betrachtete, beobachtete ich nun nicht mehr mich selbst, sondern einen fremden Körper, jenen unvergesslichen, noch heute in mir lebenden Körper, den ich einst als Kind erblickt hatte, als ich auf dem Weg zum Sportplatz durch ein Fenster im Erdgeschoss eines der Klinikgebäude gespäht hatte. Damals hatte ich die erste Leiche meines Lebens erblickt, nackt, die Sohlen zu mir zeigend. Wortlos ließ ich meine Freunde vorausgehen, ich konnte mich von dem Anblick nicht lösen. Ich weiß nicht, was mich mehr in seinen Bann geschlagen hatte: die Nacktheit des Körpers oder sein Ausgeliefertsein. Ob es sich um einen Mann oder um eine Frau gehandelt hat, weiß ich nicht mehr; aber ich weiß noch, wie die Haut, die Sohle, die Knie ausgesehen haben, was für Falten der Körper warf, wie die Hände gefaltet waren, erinnere mich noch an die gelblich-weiße, verhärtete Haut an den Zehen, habe noch den mit weißer Ölfarbe angemalten, abgegriffenen Metallrand der Rollbahre, das gemusterte Wachsleintuch unter dem Körper vor mir, erinnere mich auch, wie sich der Körper und das Leinen berührten. Seltsamerweise prägte sich mir die Erinnerung nicht nur als Anblick, sondern auch als Geschmack und Geruch ein. Ich beobachtete die Leiche durch ein Glasfenster und hätte somit keinen Geruch wahrnehmen dürfen. Und doch begann mich ein solcher zu verfolgen, und als ich kurz darauf, bereits auf dem Sportplatz, bei einer abrupten Bewegung roch, dass dieser seltsame Geruch aus meiner Handfläche strömte, konnte ich meinen Schrecken und mein Entsetzen nur mit größter Selbstbeherrschung vor den anderen verheimlichen. Ich zog mich zurück, um mir mehrmals die Hände zu waschen; einmal rieb ich sie mir nicht mit Seife, sondern mit Erde ein. Doch der Geruch kehrte jedes Mal zurück, ja steigerte sich, sogar am nächsten Tag roch ich ihn noch. Es war nicht der Geruch der Leiche, sondern der des Todes. Niemand außer mir würde ihn riechen können, und doch schreckte ich davor zurück, jemanden zu bitten, an meiner Handfläche zu schnuppern, nachzuprüfen, ob der Duft tatsächlich zu riechen sei. Der Anblick der Leiche und meine schamlose Neugierde erfüllten mich mit einem Gefühl von Schande. Ich war der Einzige, der diesen Geruch verströmte. Durch ihn wurde alles sinnlich wahrnehmbar, was beim Anblick des toten Körpers in mir zu strudeln begonnen hatte. Es war der Geruch des vom Tod berührten kindlichen Körpers. Er entströmte der Seele, aus einer solchen Tiefe, dass er auch den Körper durchtränkte.
Und ich erinnere mich auch, dass ich an jenem Abend, nachdem ich mich hingelegt und irgendeiner unwiderstehlichen Verlockung folgend, widerwillig zwar, aber doch immer wieder an meiner Handfläche geschnuppert hatte, mich nicht mehr traute, mich flach auf den Rücken zu legen. Ich fürchtete mich vor der Körperstellung des Toten am Vormittag, fürchtete mich vor der Körperlage, die mich an ihn erinnerte, am meisten aber vor den in einem ähnlichen Winkel nach außen gedrehten Füßen. Ich begann mich im Dunkeln hin und her zu bewegen, zappelte so lange, bis ich am Ende doch genauso dalag wie der Tote. Und dabei schnupperte ich immer wieder an meiner Handfläche. Nur in Momenten erotischer Erregung kam ich später diesem Zustand wieder nah, den ich damals im Dunkeln empfunden habe. Sowohl die Nacktheit des erwachsenen Körpers, den ich unverhüllt beobachten konnte, als auch die Regungslosigkeit des toten Körpers, vor dem ich mich nicht benehmen musste, hielten mich in ihrem Bann. Mir entströmte der Geruch seines Todes; auch mein Körper unter der Decke gehorchte seinem Körper. Später dachte ich, dass ich mich, indem ich den Tod übte, auf die Wonne vorbereitete; dann wich diese Vorstellung dem Verdacht, dass es vielleicht gerade umgekehrt sei: dass gerade Letztere die Vorbereitung sei.
Und diesen Toten erkannte ich wieder, während ich meinen im Gras liegenden Körper beobachtete, und in seiner Körperstellung das Kind, das der Tote in seinen Bann geschlagen hatte. Ich sah, dass mein Fuß die gleiche Stellung hatte wie der Körper auf der Rollbahre; sah, dass die Farbe unserer Sohlen, unserer Fußnägel, aber auch die Haut, die die Nägel umgab, gleich war; sah, dass mich mein eingesunkener Bauch genauso ausgeliefert machte wie ihn, sah auch, dass ich jetzt nicht in der Lage wäre aufzustehen. Und ich sah, dass ich ein Körper war. Nichts als ein Körper. Ein Körper, der eigentlich niemandem gehören will, der auch meiner nicht bedarf. Nur ich seiner; ich bin es, der das Verhältnis zu ihm um jeden Preis aufrechterhalten will; der ihn wie sein Eigentum behandelt und hilflos wird, wenn er sieht, dass er sein eigenes Leben führt. Eifersüchtig beobachte ich sein Altern, seinen Verfall oder auch nur seine Veränderungen.
Allmählich verließ mich der im Gras liegende, müde Körper. Welche Bewegung ich auch ausführen mochte, stets bedurfte es eines Kraftaufwands. Diese Kraft kann sich immer nur gegen einen Widerstand manifestieren. Als müsse ich etwas ständig aufrechterhalten; mit jeder meiner Bewegungen negiere ich das Absinken, die Erdschwere. Nicht umsonst spricht man vom geflügelten Geist; er strebt nach oben und will den Körper mit sich reißen. Das Leben ist aufwärts gerichtet. Ein Dasein mit gestutzten Flügeln bedeutet das Scheitern des Lebens. Hilflosigkeit macht sich breit, beschwert uns mit Ermattung, Niedergeschlagenheit, Müdigkeit. In solchen Momenten streckt man sich aus, sinkt nieder, legt sich hin. Lässt seinen Körper ausschließlich das sein, was er ist: ein Körper.
Im Gras liegend, innerlich auf der Flucht vor den nahenden Schatten, sank in mir alles nach unten. Ich drückte auf die Erde, als wollte ich aus mir selbst herausstürzen. Mit der Erde eins werden; jener Erde, die alle abwärts stürzenden Körper zum Halten bringt. Mein Körper gehorchte der Schwerkraft, der Gravitation, die ihn abwärts zog. In die Erde, obwohl sie der Tod des Körpers ist; in eine Tiefe, deren letzte Grenze noch nie jemand gesehen hat, die tiefer als das tiefste Grab ist; von der wir nur eine vage Ahnung haben und keinerlei Erfahrung besitzen. Diese unendliche Tiefe zog meinen Körper an. Auch die grasbedeckte Erde war ein Hindernis für ihn; wäre er in der Lage dazu gewesen, hätte er sie durchbrochen. Diese Tiefe ist die Versuchung eines jeden müden Körpers; sie lockt ihn, sobald die Seele nicht mehr Herr ihrer selbst ist; sie ruft mich, wenn ich schläfrig, müde werde. Aber ihre Stimme kommt von innen, wie auch der Geruch des Todes in meiner Kindheit meinem Inneren entströmt war.
Wir ahnen, wohin die Gravitation zieht. Wir ahnen auch, dass unser Planet einen Mittelpunkt haben muss. Der ist aber genauso unbegreiflich wie ein geometrischer Punkt. Sollte es wirklich einen Mittelpunkt geben, der keine Gravitation kennt? Eine Grenze, im Vergleich zu der alles außerhalb ist? Je entschlossener wir versuchen, diesen Punkt, dem alles entgegenstrebt, im Netz unserer Gedanken einzufangen, desto klarer wird uns, dass wir ihn vergeblich suchen: Wir sind immer außerhalb seiner. Und sobald er uns eingesaugt hat, sind wir nicht mehr in der Lage, ihn zu suchen: Dann sind wir identisch mit ihm. Indem er sich der Anziehungskraft des bodenlosen Abgrunds überlässt, hört der Körper zu stürzen auf. Er selbst wird zum Abgrund. Er ist der Schwerkraft ausgeliefert, aber die kann ihre Macht nur durch ihn selbst spürbar machen. Der ermüdete Körper wird genauso schwer wie die Erde und will wieder eins werden mit dem, dem er entnommen wurde. Er ähnelt einem einsamen Himmelskörper; einem Kometen, der das Weltall aus eigenem Antrieb durchpflügt, bis er von einem anderen Himmelskörper eingesaugt wird. Dann erlischt er. Zu Erde zerbröckelt, zu Staub zerfallen nähert er sich dem geheimnisvollen Punkt, der ihn seit seiner Geburt an sich zieht; jenem Aufflackern, das jenseits alles Denkbaren ist, über allem Seienden steht, das einem in vereinzelten, außergewöhnlichen, halb traumhaften Augenblicken aber doch selbstverständlicher als alles andere erscheint.
Der Körper ist ein bodenloser Abgrund. Ein müder Körper, ein schlafender Körper, ein liebender Körper, ein kranker Körper, ein toter Körper. Stürzen möchte er ohne Aussicht darauf, irgendwo anzukommen. Die Leiche – die erste –, die ich in meiner Kindheit sah, hatte sich so natürlich an die Bahre geschmiegt, als wäre diese ihre endgültige Bestimmung. Sie war wie ein Planet, den keine Kraft mehr von seiner exakt festgelegten und geheimnisvollen Bahn ablenken kann. Nichts kann den Menschen stärker in seinen Bann ziehen als die Erfüllung. Auch ich war nicht in der Lage, mich vom damaligen Anblick zu befreien. Ich spürte an jenem Abend vage, dass ich das Geheimnis des vollkommen in sich geschlossenen, an einen glatt gewetzten Kieselstein am Meeresstrand erinnernden Körpers nur dadurch würde lösen können, dass ich ihm ähnlich würde. Nur der Tod würde den Zauber des Todes brechen können.
Erst beim Eintritt in die unauflösliche Dunkelheit, die im Fleisch, den Eingeweiden, den Adern, den Gedärmen, den Organen herrscht, kann man seinem Selbst gleich werden, spürte ich an jenem sonnigen Nachmittag, als ich mir des Netzes bewusst wurde, das mein Wesen gefangen hielt, zwischen dessen Knoten sich meine augenblickliche Müdigkeit, der Anblick der Leiche aus meiner Kindheit, die unwiderstehliche Erdschwere befanden. Reglos lag ich da, genoss die Wärme der Sonne und überließ mich wonnig der Anziehungskraft der Erde. Die überirdische Tiefe zog meinen Körper an. Von meinem Kopf bis zu meinen Sohlen spannte sich der Bogen, der die untere Dunkelheit und das obere Licht zusammenhielt. Ich beobachtete, wie sich die Sonne dem gelegentlich erzitternden Laub des Aprikosenbaums näherte. So erwartete ich den Schatten.
Einführung
Melancolía
Vor einigen Jahren verbrachte ich Ostern in Spanien und fuhr mit dem Autobus von Madrid nach Guadalupe. Mein eigentliches Ziel war Cádiz gewesen; aber als sich am Busbahnhof herausstellte, dass der einzige Linienbus an dem Tag kurz zuvor abgefahren war, kaufte ich kurzentschlossen eine Karte nach Guadalupe. Bald ließen wir die Stadt hinter uns und fuhren südwärts, immer tiefer ins spanische Hinterland hinein. Ich sah Landschaften, wie ich sie noch nie zuvor erblickt hatte. Die Erde war rot, durchsetzt von kleineren und größeren Felsen, stellenweise weckte sie den Eindruck einer Steinwüste. Man hatte zuweilen das Gefühl, als klänge gerade irgendeine geologische Katastrophe ab. Als hätte ein unbekannter Wille die Erde absichtlich gemartert. Etwas zutiefst Fremdes lag in dieser Landschaft, vor allem im Vergleich zu anderen, zivilisierteren Gegenden Europas. Mir war, als wäre ich ungebetenerweise irgendwo eingedrungen und säße nun in der Falle.
Der Bus war überfüllt. Vor mir saß eine Mutter mit ihren drei Kindern; ihre Haut war dunkel wie von Nordafrikanern, ihre Gesichtszüge waren jedoch europäisch. Ein Mann nahm eine halbe Wassermelone aus einer Kartonschachtel, schnitt eine Scheibe ab und aß sie schlürfend. Der Saft floss in die Schachtel zurück. Ich versuchte dahinterzukommen, wo er sich die Hände abwischte, konnte es aber nicht erkennen. Die Augen einer jungen Frau glänzten wie Edelsteine. Sie sprangen förmlich aus ihrem Gesicht hervor. Gewiss war sie eine Andalusierin; in ihrem Gesicht vermischten sich maurische, jüdische und iberische Züge – das las ich jedenfalls in sie hinein. Sie war noch jung, aber bereits sichtlich gealtert. Ich musste mich überwinden, dass ich sie nicht fortwährend beobachtete. Weiter vorne, einige Sitzreihen hinter dem Fahrer, spielte eine ältere Frau auf einer Gitarre und sang dazu. Mehrere Reisende stimmten in ihr Lied ein. Die Musik spielte, und im Refrain des Liedes erklang immer wieder das Wort »melancolía«.
Unverhofft bekam für mich ein Wort, das ich damals bereits seit vielen Jahren so gründlich aus meinem Bewusstsein gelöscht hatte, als handelte es sich um ein Tabu, einen neuen Sinn. Ich saß in einem Bus, der immer weiter südwärts fuhr, die Landschaft wurde immer wilder, die Menschen wirkten gar nicht mehr wie Europäer. Umso mehr empfand ich sie als Schicksalsgenossen. Ich entfernte mich von der Zivilisation, bewegte mich in der geschichtlichen wie geologischen Zeit rückwärts. Und doch fühlte ich mich immer heimischer. Als wäre auch ich nur ein Augenblick, eine flüchtige Sekunde der Geologie, der kosmischen Zeit – oder besser Zeitlosigkeit – gewesen. Und dadurch begann das, was ich in wacheren Augenblicken als mein Ich bezeichne, seine Konturen zu verlieren. Als wäre ich ein Bruchstück, das aber nicht aus etwas herausgebrochen wurde, sondern genau so, als Bruchstück ganz und endgültig war. Kristallklar erkannte ich, dass es auch eine Perspektive gab, aus der betrachtet es gleichgültig war, ob ich existierte oder nicht, denn wenn ja, war das Universum auf diese Weise vollkommen, und wenn nicht, dann eben auf jene. Meine Existenz fügte dem ohnehin vollkommenen Universum nichts hinzu; und noch weniger würde ihr Fehlen zu bemerken sein. Mich selbst als völlig gleichgültig zu erfahren und dennoch weder Schmerz noch Bitterkeit, höchstens ein Staunen zu empfinden, ja, das ist die Melancholie. Das war sie jedenfalls für mich, dort im Bus nach Guadalupe, in jenen bis heute unvergessenen Augenblicken, während die Musik spielte und ich jene iberische Frau betrachtete.
Jenseits von Wissen und Gefühl
Lob der Melancholie. Viel habe ich darüber nachgedacht und noch mehr zum Thema gelesen. Aber während ich über die Melancholie sinnierte und an diesem Buch arbeitete, versuchte ich allen Fragen aus dem Weg zu gehen, woran ich denn gerade schrieb. Denn auf diese Frage folgte in der Regel eine zweite: Und was ist die Melancholie? Worauf ich nichts zu erwidern wusste, lieber zu ausweichenden Antworten Zuflucht nahm. Obwohl ich seit Jahrzehnten darüber nachdenke und auch früher schon darüber geschrieben habe. Aber es ist, als verhüllte der Begriff der Melancholie die Melancholie selbst. Die Worte machen das, worüber sie sprechen sollen, zunichte. Je naheliegender die Antwort zu sein scheint, desto stärker ist das Mangelgefühl, das sie begleitet. Denn immer neue Kriterien drängen sich in den Vordergrund und verhindern, dass sich die Aufmerksamkeit auf einen einzigen Fokus richtet.
Als der englische Wissenschaftler Robert Burton zu Beginn des siebzehnten Jahrhunderts über die Melancholie schrieb, untersuchte er von der Mathematik und der Pflanzen- beziehungsweise Tierkunde über die Astrologie, Theologie und mittelalterliche Philosophie bis hin zur Liebe, zur antiken Literatur, aber auch zum Aberglauben ausnahmslos alles, um am Ende überall, in allem auf Melancholie zu stoßen. Sein umfangreiches, über tausend Seiten langes Werk Die Anatomie der Melancholie ist das längste, das je zu dem Thema geschrieben wurde. Wer es aber zu lesen beginnt, wird immer ratloser. Und am Ende angekommen wird er nicht sagen können, was die Melancholie sei, ja, sollte er früher angenommen haben, dass er es wüsste, wird ihm auch dieses Wissen abgegangen sein. Und doch wird er zu ahnen beginnen, was die Melancholie ist. Nur ist diese Ahnung nicht mit Wissen gleichzusetzen. Wissen richtet sich stets auf etwas. Eine Ahnung erlaubt einem nicht, eine solche Distanz zu wahren. Beim Wissen überhole ich gleichsam den Gegenstand; bei der Ahnung hingegen überholt er mich. Ich werde ihm ausgeliefert. Burtons Werk bietet dafür ein schönes Beispiel: Während der Lektüre verliere ich allmählich mein vorheriges Wissen über die Melancholie und tappe unbemerkt in ihre Falle.
Es gibt viele Arten von Gefühl, Glück und Verzweiflung, Furcht und Angst, Hoffnung und Niedergeschlagenheit und so weiter. Alle lassen sie sich mehr oder weniger treffend umschreiben. Fällt jedoch das Wort Melancholie, horchen für einen Moment alle auf – auch diejenigen, die die anderen Gefühle sonst überhört hätten. Denn der Melancholie wohnt ein Mehrwert inne. Worin er besteht, lässt sich schwer sagen; aber gerade dieser Mehrwert bewirkt, dass sich die Melancholie überall bemerkbar machen kann. Nicht nur in der Niedergeschlagenheit, sondern auch in der Hochstimmung; nicht nur im Kummer oder in der Langeweile, sondern auch in der Freude oder der Ekstase. In der Lethargie ebenso wie in der konzentrierten Aufmerksamkeit.
»Ja selbst im Tempel aller hohen Wonnen (Delight)
Besitzt Melancholie Altar und Stätte«,
heißt es in John Keats’ Gedicht »Ode auf die Melancholie«. Sie kann sich also in den gegensätzlichsten Gefühlen bemerkbar machen. Was den Verdacht weckt, dass sie mehr als nur ein Gefühl ist.
Jenseits des Wissens, aber auch jenseits des Gefühls. Kein Wunder also, dass die Melancholie, seitdem sie in der europäischen Kultur aufgetaucht ist, stets argwöhnisch beäugt wurde. Für die Griechen waren Melancholiker die hervorragendsten, aber auch gefährdetsten aller Menschen. Im Mittelalter bezeichnete man die Melancholie als das Kissen des Teufels und hielt Melancholiker für Taugenichtse, warf ihnen in schwerwiegenden Fällen sogar Gottesleugnung vor. Als Melancholiker bezeichnete man aber auch die Eiferer unter den Gläubigen, die nichts anderes taten, als in ihren Zellen zu beten. Und auch Geisteskranke und gewöhnliche Irre wurden zu Melancholikern abgestempelt. In der Renaissance galten die meisten herausragenden Künstler als Melancholiker; die Melancholie war aber auch für ihr Unglück verantwortlich, darin lag auch die Ursache ihrer Verzweiflung und der immer häufiger werdenden Selbstmorde. Später, zur Zeit der Verbürgerlichung, galten Faulheit und Langeweile als Kennzeichen der Melancholie, da sie sich den immer stärker werdenden Zwängen der Gesellschaft widersetzen wollten. Aus ähnlichen Gründen wurde seit dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts auch die Genialität zu einem Kennzeichen der Melancholie, ging doch auch sie mit Unberechenbarkeit einher, der fehlenden Fähigkeit und Bereitschaft, sich an Vorschriften zu halten, sich einzugliedern.
Melancholie heißt wörtlich schwarze Galle. Und die schwarze Farbe lenkt das Augenmerk auf die Dunkelheit, auf die Tatsache, dass wo auch immer die Melancholie auftauchen und was auch immer man davon halten mag, in ihr stets der dunkle Schatten der jeweiligen Welt zum Vorschein kommt. Es gibt etwas, das man aus dem Tagesbewusstsein verdrängen muss, denn ließe man ihm Raum, störte es den gewohnten Lauf der Dinge. So war es in der Antike und im Mittelalter, so war es in der Renaissance und auch später. Besonders stark ist der Argwohn gegenüber der dunklen Melancholie aber seit dem Jahrhundert des Lichtes, der Aufklärung – denn ist die Melancholie jenseits des Wissens, untergräbt sie das Wissen der jeweiligen Zeit folglich auch. Oder wirft zumindest den Schatten des Zweifels darauf. Der Melancholiker misstraut endgültigen Erklärungen, folglich werfen ihm Nicht-Melancholiker vor, den Verstand zu missachten, es an notwendiger und vernünftiger Einsicht fehlen zu lassen. Und so unternimmt unsere Zivilisation seit nunmehr über zwei Jahrhunderten alles, um die Melancholie irgendwie im Zaum zu halten oder ihr jegliche Gültigkeit abzusprechen.
Seit der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts wurde sie europaweit angegriffen, der Begriff selbst wurde auf eine seiner Begleiterscheinungen reduziert, auf die Depression. Früher hatte die Depression als eine Unterart der Melancholie gegolten; seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts kehrte sich das um, und die Melancholie wurde zu einer Unterart der Depression. In seinem Tagebuch verwendet Kierkegaard beide Begriffe noch synonym und ist der Ansicht, dass die sogenannte »mentale Depression« eng mit der Genialität verbunden sei. Natürlich leugnet er nicht, dass die Melancholie auch eine Last sei und mit der »mentalen Instabilität«1 zusammenhänge. Allerdings ist die Depression für ihn weniger eine seelisch-körperliche Krankheit als vielmehr ein zivilisatorischer Zustand: »Daß unser Zeitalter ein Zeitalter mentaler Depression ist, steht außer Frage […] Ja, gerade die Depression ist eine Folge jener Rastlosigkeit und Gärung, die letztlich zu hefigen Blähungen führen wird.«2
Depression sei der dunkle Schatten der für die moderne Zivilisation typischen, ständigen Rastlosigkeit, nicht zu beschwichtigenden Erregtheit. Es ist verständlich, dass die Zivilisation ihre latente Depression auf die Melancholiker abwälzte, auf jene also, die am endlosen Gehetztsein nicht teilhaben wollten und wollen. Krank sei nicht die Zivilisation, lautet die landläufige Meinung, sondern gerade derjenige, der diese Zivilisation für krank hält. So ersetzte man die Melancholie mit ihrem stets weit gefassten Seinsverständnis durch die relativ leicht definierbare Depression und versucht bis heute, sie auf medikamentös behandelbare Symptome zu reduzieren. Der deutsche Psychiater Emil Kraepelin eliminierte den Begriff »Melancholie« 1896 endgültig aus seiner Systematik und verwendete stattdessen das Wort »Depression«3. Und einige Jahre später, 1904, schlug der aus der Schweiz stammende amerikanische Psychiater Adolf Meyer auf einer Sitzung der New York Neurological Society vor, den Ausdruck »Melancholie« nicht mehr zu verwenden, da dieser »Wissen über etwas suggeriert, das wir nicht haben, und das von verschiedenen Autoren unterschiedlich verwendet wird. Würden wir für den ganzen Bereich statt Melancholie den Ausdruck Depression verwenden, wäre von vornherein das gemeint, was in der Alltagssprache der Ausdruck Melancholie bezeichnet«4.
Sogar Freud, der sich der Melancholie wohlgesonnen näherte und an dem Begriff festhielt, engte ihre Bedeutung ein. In seiner 1917 entstandenen Studie Trauer und Melancholie sah er den entscheidenden Unterschied zwischen beiden darin, dass die Ursache der Trauer bekannt, die der Melancholie hingegen unbekannt sei. »So würde uns nahe gelegt, die Melancholie irgendwie auf einen dem Bewußtsein entzogenen Objektverlust zu beziehen, zum Unterschied von der Trauer, bei welcher nichts an dem Verluste unbewußt ist«5. Freud erklärte das damit, dass für den traurigen Menschen nur die Welt, für den Melancholiker hingegen auch das Ich verloren sei. Diese Unterscheidung ist jedoch höchst problematisch. Freud beschrieb die Trauer als ein durch und durch natürliches Phänomen, als einen Zustand, der, da er eine gut definierbare Ursache hat, erklärbar, begründbar ist, sich also ins Gewebe der Welt einfügt. Und somit ein normales Phänomen ist – sie lässt das Leben nicht stocken, sondern verhilft ihm sogar zu einem störungsfreien Lauf. Für die Melancholie gilt das alles nicht: Laut Freud zeichnet sie sich durch das Fehlen eines Objekts aus, und da in solchen Fällen auch das Ich verletzt wird, kann man in ihr sogar eine Zwillingsschwester der Angst erblicken. Ein Melancholiker kann einen Verlust nicht verarbeiten, nicht zur Einsicht gebracht werden. Rationale Argumente prallen an ihm ab, und das führt letztlich dazu, dass das rationale Gewebe der Welt einen Riss bekommt. Darum ist sie für Freud ein abnormer Zustand, dem nur durch therapeutische Behandlung abzuhelfen ist. »Bei der Trauer ist die Welt arm und leer geworden, bei der Melancholie ist es das Ich selbst«6, schreibt er. Damit vollzog Freud eine starre und künstliche Trennung, die ihn daran hinderte, das tiefe und weite Seinsverständnis, das man der Melancholie zwei Jahrtausende lang nicht abgesprochen hatte, zu entfalten. Freud untersuchte den Zustand des Melancholikers als Ich-Zustand, dem die Welt neutral gegenüberstand. Darin blieb er ein Gefangener der ausschließlich naturwissenschaftlichen, mechanistischen Medizin. Die Welt ist ein lebloser Gegenstand, der dem Menschen erlaubt (oder eben nicht erlaubt), an ihm seine Wünsche zu befriedigen. Bei seiner Deutung der Melancholie stellte Freud das Ich und die gegenständliche Welt einander starr gegenüber: Alles spielt sich im Ich ab, die im Vergleich zum Ich äußere Welt zieht sich in eine neutrale Teilnahmslosigkeit zurück. Dadurch büßte die Melancholie jedoch jene Tiefe und zweifellos positive Bedeutung ein, die sie in der Geschichte der europäischen Kultur über zwei Jahrtausende lang innehatte. Aus seiner Perspektive nachvollziehbar, sah Freud nur eine Krankheit in ihr, einen Zustand der Verletztheit also, und assoziierte sie mit den Psychosen beziehungsweise Neurosen.
In Mythen gefangen
Aber auch der über hundert Jahre anhaltende Triumphzug der Depression konnte die Melancholie nicht obsolet werden lassen. Sie hält sich beharrlich, und schon das mahnt uns, dass sie etwas ist, das sich von den Wurzeln unserer Kultur nährt. Sich von ihr zu befreien ist genauso unmöglich wie von manchen anderen Begriffen – etwa dem Wort »Gott«, und mag Gott auch gestorben sein, oder dem Begriff »Größe«, und mag seit nunmehr zwei Jahrhunderten das Mittelmaß auch das Ideal sein, oder »Metaphysik«, und mag die ganze Zivilisation auch vereint an ihrer gewaltsamen Verdrängung arbeiten. Wie diesen Begriffen wohnt auch der Melancholie etwas Beunruhigendes inne – heute genauso wie zur Zeit der Griechen, im Mittelalter oder auch in der dem Tod so innig verbundenen, barocken Melancholie. Denn die Melancholie stellt die jeweilige Kultur in einer Lichtbrechung dar, von der die meisten Menschen aus dem berechtigten Grund des Selbstschutzes nichts wissen wollen. Die Melancholie erinnert uns an die Unzuverlässigkeit der Gefühle, aber auch an die Vergeblichkeit des sogenannten letzten Wissens. Daran, dass die Welt, und mögen wir sie noch so souverän einrichten, auf wackligen und zerbrechlichen Säulen ruht. Dass wir, und mögen wir alles noch so lückenlos absichern und die Welt noch so heimelig gestalten, eine Heimat nur inmitten der Heimatlosigkeit einrichten können. Dass sich hinter dem Optimismus, und mag er auch zur verbindlichen Weltreligion geworden sein (ob als Glaube an Gott oder die Allmacht der Technik oder politische Lösungen oder endloses Wirtschaftswachstum), viele Fragen auftürmen, die genauso wenig befriedigend beantwortet werden können wie die Frage, was Melancholie denn sei.
Jede Epoche verstand unter Melancholie etwas anderes. Jede hatte ihre eigene Melancholie mit ihrem eigenen, unverwechselbaren Antlitz, die mit der Melancholie der vorhergehenden und darauffolgenden Epochen nicht zu verwechseln war. Deshalb können wir von einer mittelalterlichen, einer barocken, einer neuzeitlichen, einer antiken Melancholie sprechen; jede von ihnen war der unverwechselbare Schatten ihrer jeweiligen Epoche. Und doch gibt es hinter den unterschiedlichen Bedeutungen einen gemeinsamen Nenner, einen gemeinsamen Zug: die Tatsache, dass die Melancholiker, unabhängig davon in welcher Zeit sie gelebt haben, die jeweilige Weltordnung nie für endgültig halten konnten. Besonders auffällig ist das heute, an der Schwelle zum dritten Jahrtausend. Die gegenwärtige Zivilisation ließ nicht nur den geografischen Entdeckern keine weißen Flecken auf der Landkarte übrig, sondern akzeptiert auch in anderen Bereichen des Lebens nichts Unlösbares mehr. Sie glaubt felsenfest, dass man früher oder später in der Lage sein wird, für alles eine Erklärung zu finden und alles zu lösen, auch die Verlängerung des Lebens oder die Unsterblichkeit des Bewusstseins. Alles ist nur eine Frage der nötigen Kenntnisse und Eignung. Diesen universellen Glauben teilt der Melancholiker nicht. Mag seine Galle noch so schwarz sein, er bleibt ein Hüter der weißen Flecken. Er ist gerade für das empfänglich, was unlösbar und unerklärlich ist, was sich rationalen Weltdeutungen widersetzt. Für ihn ist das Unbekannte nicht etwas, das mit den nötigen Kenntnissen früher oder später erkannt werden kann, sondern das innerste Zentrum der menschlichen Existenz und des menschlichen Denkens.
Die Melancholie in unseren Tagen: ein Aufbegehren gegen die allgemeinen, gesellschaftlich-zivilisatorischen Erwartungen. Und nichts ist einfacher, als den Aufbegehrenden Schwermut, Traurigkeit oder Missmut vorzuwerfen. Obwohl der Melancholiker sich nicht infolge von Missmut weigert, am universellen Glücksreigen teilzunehmen. Melancholie ist vor allem keine Trübsal, kein Missmut, sondern eine innere Kraft, die einem ermöglicht, das Augenmerk auf etwas anderes zu richten, das, was frühere Zivilisationen das »Wesen« nannten, anderswo zu finden und alles, was scheinbar selbstverständlich und offenkundig ist, stets zu hinterfragen. Melancholie bedeutet eine Offenheit für die Metaphysik in einer Welt, die jeglicher Metaphysik den Kampf angesagt hat, die sie für etwas Anachronistisches, eine aus der Vergangenheit übriggebliebene Skurrilität hält. Der Melancholiker spricht auch dann vom Wesen, wenn er nicht an Gott glaubt, redet auch als areligiöser Gläubiger von der Essenz – und weicht damit vom herrschenden, öffentlichen Denken ab, das an Gott auch nicht glaubt (nur an Feiertagen den Anschein dessen erwecken will), mit Gott aber auch das Wesen aus seinem Blickfeld verbannt hat. Die große Sünde des modernen Melancholikers besteht darin, dass er erkennt, wie wenig natürlich und selbstverständlich alles das, was die ganze Zivilisation dafür hält, in Wahrheit ist. Dass ihm bewusst ist, dass die Zerstörung der Mythen mit der Erschaffung neuer Mythen bezahlt wird.
Im Katalog der von André Breton und Marcel Duchamp organisierten Ausstellung Le surréalisme en 1947 heißt es in einem »Die Abwesenheit des Mythos« betitelten Text von Georges Bataille: »Die entschiedene Abwesenheit des Glaubens ist der unerschütterliche Glaube«7. In diesem Gedanken hallt gleichsam eine Überlegung Adornos und Horkheimers von einigen Jahren zuvor wider, wonach auch die Aufklärung selbst, während sie alles als Mythos entlarvte, zu einem riesigen, unumgänglichen Mythos wurde. Der Verzicht auf den Mythos, genauer die Eliminierung des Mythos war eines der großen Ziele der Aufklärung. Doch während sie die Welt ihrer sogenannten metaphysischen Dimensionen beraubte, stülpte sie ihr paradoxerweise eine neue Metaphysik über – aus dem einfachen Grund, dass der Mensch ohne Metaphysik nicht existieren kann. Sein Leben verdankt er einem Bruch, einem Riss – dem Sturz aus dem Nichtsein ins Sein –, und ein ähnlicher Bruch, ein ähnlicher Riss – der Sturz aus dem Sein in eine andere Seinsform, die er mangels besseren Ausdrucks als Nichtsein bezeichnen muss – setzt ihm wieder ein Ende. In diesem Unbekannten, das dem Leben vorausgeht und folgt, liegen die Wurzeln der Empfänglichkeit für die Metaphysik. Man muss dazu kein Philosoph sein; diese Empfänglichkeit wohnt jedem Menschen inne, um in bestimmten Situationen aufzuflackern und sich in ein alles hinwegfegendes Erlebnis zu verwandeln. Schon infolge seines Wissens um die Vergänglichkeit ist der Mensch von Geburt an zum Heimweh nach der Metaphysik verdammt. »Die Wiege schaukelt über einem Abgrund«, schreibt im ersten Satz seiner Memoiren Vladimir Nabokov, »und der platte Menschenverstand sagt uns, daß unser Leben nur ein kurzer Lichtspalt zwischen zwei Ewigkeiten des Dunkels ist«8.
In dieser Empfänglichkeit für den Abgrund wurzelt die Melancholie. Sie macht es dem Menschen möglich, etwas, wovon ihn die ganze Zivilisation zu überzeugen versucht, nicht als selbstverständlich zu akzeptieren. »Nacht ist auch eine Sonne, und die Abwesenheit des Mythos ist auch ein Mythos: der kälteste, der reinste, der einzig wahre«9, schreibt Bataille in seiner obigen Studie. Diesen kalten Mythos spürt an der Schwelle zum dritten Jahrtausend der Melancholiker von heute um sich, zugleich weiß er aber auch, dass das menschliche Leben ohne Mythos nicht vorstellbar ist. Gerade wegen unserer Ratlosigkeit angesichts des Unbekannten, das dem Leben vorausgeht und folgt, müssten wir uns wie Baron Münchhausen an den eigenen Haaren hochziehen, um einen Blick aus dem werfen zu können, worin wir uns befinden. Aber auch dieser Vergleich hinkt noch, denn wir müssten nicht nur über den Überblick verfügen, sondern müssten gleichzeitig auch in dem bleiben, worauf wir blicken. Wir müssten gleichzeitig draußen und drinnen sein, was genauso unmöglich ist wie das Sehen im 360-Grad-Winkel. So etwas taucht höchstens als Sehnsucht auf, als ein ideales Ziel, das man sich immer wieder setzt, ohne es jemals erreichen zu können. Der Mensch bedarf eines Gottes, auf den er diese Fähigkeit übertragen kann – eines allsehenden, allmächtigen Gottes, der prinzipiell zu allem fähig ist, wonach sich der Mensch nur sehnen kann.
Das Mangelgefühl infolge der Unerreichbarkeit der Ganzheit schafft die Notwendigkeit des Mythos. Und der Melancholiker findet sich in einer Zwickmühle wieder: Er weiß, dass er inmitten von Mythen lebt, die ihm den Ausblick auf das, was jenseits des gewaltigen, von den Mythen gebildeten Gewölbes liegt, verstellen, weiß aber auch, dass er sich, solange er lebt, von diesen Mythen nicht wird befreien können. Mensch sein heißt, in Mythen gefangen zu leben. In diesem Eingeschlossensein kann man bestenfalls die Sehnsucht hegen, einen Blick auf das zu werfen, was Hölderlin im Gedicht Brod und Wein »das Offene« nennt und was nach Rilke nur Säuglinge sehen können, bevor sie von den Erwachsenen umgestülpt werden, oder Tiere, die kein Wissen über den Tod haben. Dem Melancholiker bietet aber auch dieser Glaube an das Offene keinen Trost. Er wird auch darin einen Mythos erblicken, den der Mensch erfunden hat, um sich damit zu trösten. Und so lebt der Melancholiker in einer vielfachen Zwangslage: Er geht zwar davon aus, dass jenseits der Mythen etwas existiert, das man vielleicht als unverhülltes oder reines Sein bezeichnen könnte; da aber niemand zu Lebzeiten in der Lage ist, es zu erlangen, bleibt es für ihn auch fraglich, ob es das wirklich gibt – ob ein Jenseits, ein Unverhülltes, ein Sehen von Angesicht zu Angesicht wirklich existiert.
Der melancholische Embryo
In der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts schrieb der Arzt Sir Thomas Browne, einer der melancholischsten Denker aller Zeiten, einen Dialog, den zwei Embryos im Mutterleib führen. Leider blieb die Schrift nicht erhalten, und es ist nicht einmal sicher, dass Browne sie überhaupt zu Papier gebracht hat. Er erwähnt sie nur einmal, in seinem Werk Hydriotaphia – Urnenbestattung aus dem Jahr 1658: »Ein Dialog zwischen zwei ungeborenen Kindern im Mutterschoß über die Welt, die sie draußen erwartet, gäbe so ein treffendes Bild von unserer Unwissenheit über das zukünftige Leben nach dem Tode ab; ich glaube wirklich, wir reden hier, als wären wir in Platons Höhle und sind nichts als bloße Embryo-Philosophen«10. Sind wir mit unserem reifen, aufgeklärten Verstand aber noch Embryo-Philosophen, könnte man umgekehrt auch den echten Embryo als eine Art Philosoph bezeichnen. Denn könnten wir ihn irgendwie nach seiner Sicht der Welt befragen, würde er Widerspruch nicht duldend feststellen: Die Welt sei dunkel, warm, weich, flüssig, an Ernährung gäbe es keinen Mangel und er selbst hätte nichts zu tun, als in diesem Fluidum zu plantschen. Und er hätte recht; denn wie sollte er von etwas anderem wissen? Doch dann wird er geboren, und aus dem Embryo wird ein Mensch, der sich über seine einstige Beschränktheit wundert und über seine frühere kampfeslustige Selbstsicherheit amüsiert. Obwohl er sich, so Browne, vom einstigen Embryo kaum unterscheidet, ist er nun doch genauso selbstsicher, wie es früher jener gewesen ist. Wie jener verkündet er, Widerspruch nicht duldend, dass die Welt wahrlich alles andere als warm, dunkel, weich und flüssig sei, dass sie vielmehr so sei, wie sie uns jetzt erscheine: fest, dem Gesetz der Gravitation unterworfen; dass die Sonne scheine, der Himmel blau sei, sich dann bewölke, die Jahreszeiten wechselten, ringsum viele Gegenstände und Lebewesen und Menschen seien, die sich zu Gesellschaften organisierten, dass um uns herum das unendliche Universum oder auch Multiversum sei, hinter uns der Urknall und vor uns das … ja, was? Dass wir geboren würden, stürben, entstünden und vergingen wie alles andere auch. Und an dieser Stelle fährt Sir Thomas Browne dazwischen und fragt angesichts dieser Selbstgewissheit, ob der geborene Mensch nicht genauso vorschnell urteilte wie einst der Embryo? Wer weiß, ob es nicht eine nächste, neuere Lebensform gibt, von der wir auf unsere jetzige, diesseitige Existenz genauso zurückblicken werden, wie wir das früher taten, als wir uns an unser embryonales Dasein erinnerten? Man weiß es nicht. Dieses Nicht-Wissen ist eine der nie versiegenden Quellen der Melancholie.
Joan Carlile, Sir Thomas Browne, 1641–1650.
Auch Samuel Beckett sinnierte oft über das embryonale Dasein. Nach eigenem Bekunden hatte er klare Erinnerungen an das, was er im Mutterleib erlebt hatte, ja er konnte sich sogar erinnern, dass er einmal, als seine Mutter an einem Mittagessen teilnahm, deutlich die Stimmen und Gespräche der Gäste hören konnte. Die weiche, dunkle Wärme erfüllte ihn nicht mit Wohlbehagen, sondern im Gegenteil mit Schrecken und Angst. Noch kurz vor seinem Tod erinnerte er sich, dass für ihn der Mutterleib eine Falle gewesen sei, ein Gefängnis, aus dem er sich nicht habe befreien können, in dem er geweint habe, dass man ihn herauslassen möge, aber niemand ihn gehört habe, und dass das Dasein ihm Schmerzen bereitet habe, er aber nichts dagegen habe unternehmen können. Auf Martin Esslins Frage, was ihn zum Schreiben bewöge, erwiderte er: »Das einzige, dem ich mich verpflichtet fühle, ist dieser arme eingeschlossene Embryo […] Das ist die furchtbarste Situation, die man sich denken kann, denn man weiß, dass man sich in einer elenden Lage befindet, weiß aber nicht, ob es irgend etwas jenseits dieses Elends gibt oder irgendeine Möglichkeit, diesem Elend zu entkommen«11. Beckett hatte das Gefühl, dass es ihm auch nach seiner Geburt nie gelungen sei, sich aus diesem embryonalen Dasein emporzuschwingen; ihm war, als befände er sich nach wie vor in einem Gefängnis, aus dem er, solange er lebte, nicht entlassen würde. Deshalb konnte er sagen, dass der einstige Embryo nach wie vor in ihm lebte, nur eben ermordet. Ihn habe er mit seinen Schriften zum Leben erwecken wollen.
Als Archetyp für Beckett oder Sir Thomas Browne diente natürlich Platons Höhlengleichnis. Wir leben in einer Höhle eingeschlossen, behaupten sie alle, und obwohl es auch außerhalb dieser Höhle ein Leben gibt, ja das echte und wirkliche Leben angeblich nur dort ist, werden wir nie in der Lage sein, es zu erkennen, da wir uns der Höhlenöffnung nicht zuwenden und ins Licht hinaussehen können. Wie der Embryo im Mutterleib halten auch wir unser Dasein in der Höhle für das einzig wirkliche. Damit schuf Platon einen Archetyp für die europäische Kultur. Vermutlich hatte es aber auch vorher schon Muster gegeben, an denen er sich gedanklich orientierte, wie auch nach ihm welche entstanden, etwa die christliche Mythologie, die ebenfalls von einer weiter gefassten Seinsform ausgeht als derjenigen, die wir gegenwärtig kennen. Die Reihe ist endlos, denn es geht um Denkmuster, die mit dem menschlichen Dasein untrennbar verbunden sind. Der Mensch ist deshalb Mensch, weil er in der Lage ist, sein Dasein als geschlossen und begrenzt zu empfinden, weil er eine Ahnung davon hat, dass sein Dasein bruchstückhaft ist, und zwar im mehrfachen Sinn des Wortes: Er wird bei seiner Geburt aus etwas herausgebrochen und bei seinem Tod wieder aus etwas herausgebrochen. Und deshalb erscheint ihm auch die Welt ringsum wie ein Haufen Bruchstücke, die sich niemals zu einem beruhigenden und akzeptablen Ganzen werden zusammensetzen lassen.