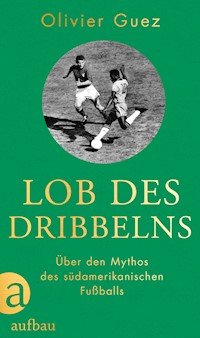
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Olivier Guez war schon als Kind vernarrt in Fußball, hat in der Jugendliga gespielt und später als Journalist darüber berichtet. Sein Buch ist eine Hymne an den südamerikanischen Fußball und eine Erkundung der Kunst des Dribbelns: Die ersten schwarzen Spieler begannen mit dem Dribbling, um den Kontakt mit den weißen Verteidigern zu vermeiden und nicht auf dem Rasen und nach Spielende verprügelt zu werden. Es entwickelte sich an Stränden, mit einem Sockenknäuel oder einem kleinen Gummiball. Es ist eine Hüftbewegung, ähnlich der der Samba-Tänzer und Capoeira-Ringer, spielerisch, akrobatisch und das Markenzeichen der größten Solisten von Leonidas, Pelé bis zu Diego Maradona. Olivier Guez beschreibt den Fußball, diese absurde und verzehrende Leidenschaft, die Milliarden von Männern und Frauen auf der ganzen Welt teilen, wie niemand sonst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
An einem Sommerabend im Jahr 1982 besuchte Olivier Guez sein erstes Fußballspiel. Er ist keine 10 Jahre alt: Schwindel, Nervenkitzel. Von diesem Spektakel erholt er sich nie wirklich. Er spielt begeistert in der Jugendliga und stellt später auf seinen Reportagereisen fest, dass dieser Sport der Spiegel der Nationen ist. Auf einem Fußballplatz zeichnet sich die Identität Frankreichs ab, die Rassenfrage in Brasilien, die Moderne Argentiniens, Katars planetarische Ambitionen oder die Exzesse des Kapitalismus unter der Ägide der FIFA. Fußball, diese absurde und verschlingende Leidenschaft, vereint die Welt in Zeiten wie diesen umso mehr. Olivier Guez erzählt in seinem Buch, was das Dribbeln über die Kultur und Gesellschaft in Brasilien und Argentinien verrät, von seinen Legenden und Seiltänzern, die den Fußball in einen Tanz verwandelt haben.
Über Olivier Guez
Olivier Guez, 1974 in Straßburg geboren, ist Autor und Journalist. Er arbeitete unter anderem für Le Monde, die New York Times und die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Für das Drehbuch von "Der Staat gegen Fritz Bauer" erhielt er den Deutschen Filmpreis. Sein Roman "Das Verschwinden des Josef Mengele" (Aufbau, 2018) wurde zum internationalen Bestseller. Sein Debüt, „Koskas und die Wirren der Liebe“ ist inzwischen auch auf Deutsch erschienen (Aufbau, 2020). Guez lebt in Rom.
Nicola Denis wurde mit einer Arbeit zur Übersetzungsgeschichte promoviert. Sie übersetzte u. a. Werke von Alexandre Dumas, Honoré de Balzac, Éric Vuillard, Olivier Guez, Santiago Amigorena und Anne Dufourmantelle. Nicola Denis lebt seit vielen Jahren mit ihrer Familie in Frankreich.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Olivier Guez
Lob des Dribbelns
Über den Mythos des südamerikanischen Fußballs
Aus dem Französischen von Nicola Denis
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Einleitung — Kurzpässe, immer wieder
LOB DES DRIBBELNS — Brasilien 2013–2014
Eine Beerdigung
Die Freude des Volks
Erinnerungen
Margarita …
Reispuder
Revolution(en)
O malandro
Der Lehrmeister
Brachflächen
Street Art
Adel verpflichtet
Das goldene Zeitalter
Masse und Macht
Batucada
IM LAND DES KOSMISCHEN DRACHENS — Argentinien 2019–2020
Die Ankunft
Die Engländer schießen zuerst
Nueva Argentina
Mythologien
El pibe
Die Maschine
Perón
Das Debakel
Antifútbol
Café Saint Moritz
El pibe de oro
Borges
Victor Hugo
D10S
Clubwesen
Der Sohn Gottes
Auf dem Weg zum Flughafen
Und jetzt
Anhang
Anmerkungen
Bibliographie
Diskographie
Mein Dank geht an
Impressum
Wer sind die besten Dribbler der Welt, und wer die besten Torjäger? Die Brasilianer. Ihr Fußball ist demnach reinste Poesie: Er kreist ausschließlich um Dribblings und Tore.
Pier Paolo Pasolini
Die leichten Füße gehören vielleicht selbst zum Begriffe Gott ...
Friedrich Nietzsche
You know in football, people are mad. Football makes people mad.
Sepp Blatter, ehemaliger Präsident der FIFA
Einleitung
Kurzpässe, immer wieder
Ich hatte eine glänzende, eine außergewöhnliche Karriere als Fußballer vor mir. An einem Nachmittag Ende Juni 1986 bat der Coach meine Mutter nach dem Training der Jugendliga des AS Menora zu sich. Winzig, die Hände in die Hüfte gestemmt, unterhielt sich Maxime Elkaïm im Schatten der Reservebank mit Sylvie Guez im beigefarbenen Kostüm, während Gigi Wolff, Carsenti und ich in der untergehenden Sonne Elfmeter gegen Schuschanowic übten, den glücklosen Torwart des Vereins. Am Vortag hatte Maxime Elkaïm beim Spiel Argentinien gegen England eine Erleuchtung gehabt: Er hatte an mich gedacht.
»Er ist also so gut wie Maradona, wirklich?«, stammelte sie verstört, was eher selten der Fall war.
Trotz der späten Uhrzeit und des Musikunterrichts am darauffolgenden Morgen hatten auch wir das Viertelfinale der Weltmeisterschaft geschaut. Und wie Elkaïm und die ganze Welt war meine Mutter, die sich eigentlich nicht für Fußball interessierte, hin und weg von den beiden Toren des argentinischen Genies: Das erste hatte er vor den Augen des Schiedsrichters mit der Hand ins Tor geschmettert, das zweite nach einem atemberaubenden Slalom durch die Reihen der englischen Verteidiger, an denen er vorbeifegte wie an Torstangen.
Maradona, Maradona.
»Mit Verlaub, gnädige Frau, wir wollen ja nicht übertreiben«, sagte der Trainer. »Aber Ihr Sohn hat ein bisschen was von Jorge Valdano.«
Braune Locken, große Füße, eine imposante Statur – Maxime Elkaïm hatte ein Auge dafür: Ich war ein Doppelgänger des goleador von Real Madrid, der es an die Spitze des Weltfußballs schaffen würde. Seit zwei Spielzeiten machte unsere Jugendliga, deren Kapitän ich war, Elsass und Lothringen unsicher. Trotz Schuschanowic (der Vater Serbe, die Mutter [jüdische] Marokkanerin) war das Wunderteam des AS Menora unschlagbar, eine Maschine, spielfreudig, technisch versiert und einfach hinreißend. Die Mittelfeldspieler Bopp, Wagner und Schaub hießen »Pac-Mans«, weil sie jeden Ball abfingen. Hinten sorgten El Chino Teicher, Sebbanowski, Carlito Mimoun und der große Sy für eine sichere Abwehr. Auf den Flügeln verweigerte sich Gigi Wolff zwar Kopfballduellen, schlug dafür aber ausgezeichnete Flanken – er konnte beim Fahrradfahren übrigens mit einem Tischtennisball jonglieren. Links rannte Carsenti unermüdlich hin und her und war trotz seiner Trikofalbrille ein beherzter Luftkämpfer. Er versorgte mich mit Pässen, mich, das Bison, den Kanonier, zwischen 1984 und 1986 dreifacher Torschützenkönig bei den Jugendspielen von Elsass-Lothringen: El Guez!
»In meiner vierzigjährigen Fußballkarriere habe ich in ganz Nordafrika und Frankreich noch keinen so begabten Jungen erlebt«, sagte Maxime Elkaïm. »Madame, Ihr Sohn hat Gold, Diamanten, Platin oder sonst was an den Füßen. Er sollte ins Ausbildungszentrum eines Profiklubs.«
Am nächsten Tag besprach sich der Familienrat am runden Wohnzimmertisch, und mein Vater war zu meinem großen Erstaunen einverstanden mit meinem Transfer zum RC Strasbourg. Ich vollführte einen Dreifachsalto in der Küche, zerbrach bei der Landung zwei Teller und rannte ohne Abendessen in mein Zimmer, um meinen Azteca in die Arme zu schließen. Mit der Ablösesumme leistete sich der AS Menora einen heimtückischen (italienischen) Stürmer namens Merlino und organisierte zur Feier meines Abschieds einen Grillabend. Schuschanowic weinte, und Carsenti knutschte im Keller des Vereinshauses mit Johanna, Elkaïms einziger Tochter; Sebbanowski und Carlito Mimoun gaben sich zum ersten Mal die Kante.
Da wir die gleiche Frisur hatten (einen hellbraunen Pony), nahm mich der Mittelstürmer von Racing unter seine Fittiche. Peter Reichert verbesserte mein Stellungsspiel und mein Timing; er brachte mir Deutsch bei. Auch beim Vereinspräsidenten, dem Designer Daniel Hechter, hatte ich ein Stein im Brett. Am Ende der Spielzeit schenkte er mir einen Kommunionanzug, den er selbst entworfen hatte: eine kurze Hose und weiße Kniestrümpfe, einen dunkelblauen Blazer mit der aufgedruckten 9 und eine königsblaue Fliege. Sobald mein Auftritt beendet war, konnte ich nicht umhin, auf dem Vorplatz der Synagoge mit den im Bus angekarrten Deppen und von den Vereins-Majoretten angefeuert – 1, 2, 3, Menora hip hop, Menora olé ola –, zu kicken. Obwohl El Chino Teicher, der gut, aber ungeschickt war, ein Glasfenster zertrümmerte, strahlte Daniel Hechter über das ganze Gesicht: Als er mich wie einen Innenverteidiger im Stil der Fünfziger dribbeln sah, beschloss er, Racing künftig mit knielangen Hosen spielen zu lassen. Der ästhetische Urknall des Fußballs, die Rückkehr der Bermudashorts, ist also – leider – mir zu verdanken (und Daniel Hechter, so fair will ich sein). Sämtliche Ausstatter – Adidas, Puma, Nike – folgten unserem Beispiel.
Von Spielzeit zu Spielzeit wurde ich immer besser. Seit seiner Wiedereingliederung in Frankreich hatte das Elsass noch keine Supernova meines Kalibers hervorgebracht. Als ich mit sechzehn bei der ersten Mannschaft anklopfte, verkaufte Racing gerade Youri Djorkaeff an den AS Monaco. Die Gebrüder Panini schickten Henri Cartier-Bresson vorbei, damit er für das Album der kommenden Spielzeit mein Porträt schießen konnte. Mein Ruhm war über den Kamm der Vogesen und die Gipfel des Schwarzwaldes hinausgewachsen: Der PSG und Bayern München wollten mich. Erneut wurde ein Familienrat anberaumt. Man bestellte Maxime Elkaïm und Peter Reichert, meine Wohltäter, ein. Meine Mutter holte die Ausziehplatten für den runden Tisch, mein Vater schnitt eine ungarische Salami auf und entkorkte seine beste Spätlese. Im Hause Guez ließ man sich nicht lumpen. Doch Elkaïm und Reichert futterten die iranischen Pistazien, ohne sich einigen zu können. Wir ließen das Los bestimmen, mein Schicksal kippte, meine Schwestern vollführten Freudentänze: Drei Tage später war ich auf dem Weg nach Bayern, auf der Rückbank von Franz Beckenbauers Luxus-Mercedes.
Ach ja … wenn! Wenn nur ein Bruchteil dieses Märchens wahr wäre. Ich war kein zweiter Valdano, das stimmt alles nicht, abgesehen davon, dass Schuschanowic wirklich ein schlechter Torhüter, aber kein schlechter Flügelstürmer war, dass Elkaïm O‑Beine hatte und Djorkaeff in dem betreffenden Jahr tatsächlich nach Monaco transferiert wurde (allerdings aus anderen Gründen). Und – dass ich absolut fußballbesessen war, ein Aficionado, ein Fanatiker, ein bedingungsloser Fan. Ich, der komische Vogel, spielte Fußball, las ein bisschen und spielte wieder Fußball, jeden Tag, in der Schule, im Park, im Verein, auf der Straße, selbst bei Schnee (mit einem orangefarbenen Ball, dem absoluten Muss) und im abschüssigen Innenhof des Familienschlosses (was mir zwei gebrochene Arme bescherte – dabei regnete es noch nicht einmal). Das dumpfe Geräusch des Balls. Die Freude, ihn zu zähmen und zu streicheln, ihm ab und zu einen festen Fußtritt zu versetzen, ihn durch Gigi Wolffs X‑Beine zu kicken, und dann, nach einer Serie von Dribblings, der Jubel über den Treffer: die Arme nach oben gereckt wie meine Idole, an einem Strand in Marokko oder in Venetien, und die spektakulären, raubkatzenartigen Paraden im Swimmingpool, wenn mein Vater mir einen Elfmeter zuschoss.
Mehrere Spielzeiten lang verwandelte der Kleine das Familienwohnzimmer in einen Strafraum. Er füllte zwei, manchmal drei Panini-Alben pro Jahr – französische Meisterschaft, deutsche Meisterschaft (in der Innenstadt hatte er einen Kiosk ausfindig gemacht, wo es auch Bundesligabilder gab), internationale Wettbewerbe –, und er aß unter den missbilligenden Blicken des Oberkellners im Hotel Caravelle (Lido di Jesolo, Sommer 1984) von Kopf bis Fuß als Küken von Inter Mailand verkleidet zu Abend (oder von Atalanta Bergamo, denn auf dem schwarz-blau gestreiften Trikot gab es weder ein Abzeichen noch Sponsorennamen), die Strümpfe bis zu den Knien hochgezogen (aber ohne Schienbeinschützer). Er graste die Märkte nach Trikots ehemaliger Meister ab (Mönchengladbach, Ajax, Saint-Étienne) und zählte ab dem 1. Januar 1990 in einem Indiana-Jones-Kalender die Tage, ein echter Countdown, bis zur Weltmeisterschaft in Italien. Der Knirps las L’Equipe, France Football, But, Onze und Mondial. Er spielte Tischfußball und Subbuteo, ein in den Siebzigern sehr beliebtes Tischspiel aus England. Auf dem Esszimmertisch seiner Großeltern breitete er einen grünen Filzteppich aus und schnippte mit dem Zeigefinger kleine, auf einem rundlichen Sockel befestigte Figuren mit halblangen Haaren an, damit sie den taubeneigroßen Ball ins gegnerische Tor kickten. Bei der Fée des jouets besorgte er sich seine Mannschaften, elf Männchen in den grün-weißen Vereinsfarben von Celtic Glasgow (Europameister 1967), elf orangefarbene Figuren der legendären Holländer um Johann Cruyff oder aber blutrote Liverpooler – das Ganze in olivfarbenen Schachteln, so verlockend wie Schokoladetafeln, die ihm die Ladeninhaberin, eine alte Dame, von der anderen Seite des Ärmelkanals mitbrachte. Für das extrem langsame und technisch ziemlich anspruchsvolle Subbuteo interessierte sich sonst allerdings niemand, nicht einmal Gigi Wolff oder Schuschanowic.
Ende der achtziger Jahre entdeckte das Kind das moderne Leben. Es bekam einen Computer geschenkt und kaufte sich ein Videospiel namens Kick Off – den ehrwürdigen Vorgänger von FIFA und anderen Fußballspielen, ein wahrer Segen. Der heutige Schriftsteller verdankt seine Kurzsichtigkeit den roten und blauen Pixeln, die er auf einem phosphoreszierenden Spielfeld mit seinem Joystick fortbewegte. Woche für Woche bestritten andere Deppen mit ihm diverse Zimmerturniere. Er klügelte komplizierte Tabellen aus, organisierte eine Auslosung im Beisein eines Gerichtsvollziehers (seine Schwester Crapula ging diesem ehrenwerten Beruf nach), und Carsenti traf auf Merlino, El Chino Teicher auf Sebbanowski, und Carlito Mimoun spielte gegen Bopp, den größten Herausforderer des Zwergs, Bopp, der ruppige Innenverteidiger des AS Menora, der sein Irlandtrikot gar nicht mehr auszog, seitdem er am 14. Juli 1989 in Dublin ein Mädchen geküsst hatte – eine Revolution. Dennoch gewann der Zwerg haushoch, und Bopp, das durchtriebene Genie, rächte sich in Mathe. Die Natur und die Vorsehung hatten es gut mit den beiden gemeint und sie mit unterschiedlichen Begabungen ausgestattet. Die Deppen rasierten sich und fuhren Mofa. Sie hörten Renaud, glaubten an Mitterrand und tanzten mit den Mädchen aus dem Viertel schmachtende Tangos auf dem Speicher bei Gigi Wolff, während der Knirps bei Kick Off glänzte und Raymond Barre unterstützte. Alleingänge und brasilianisches Dribbling, Ballkontrolle, Kurzpässe, Dreieckspiel, Bewegungen, Raute, das Straßburger Tiki-Taka: Er verrenkte kunstvoll sein Handgelenk, und die Geschwindigkeit seines Zeigefingers, die Geschicklichkeit und Kraft seines Daumens, wenn er den Knopf des Joysticks drückte, machten ihn unbesiegbar, ein echter Champion: Im Frühjahr 1990 wurde er zur Coupe de France von Kick Off in Paris eingeladen, 53 Tage vor dem Anpfiff der italienischen WM. Seine Eltern verboten ihm die Teilnahme. Also organisierte er seine eigenen Matchs. Am Tag vor den Ferien rief er seine Freunde an und versammelte sie, egal, wie das Wetter war, zum Kicken im Stadion am Flussufer.
Der Fußballfan ist ein abergläubisches, launisches und irrationales Wesen. Er vergeudet seine Zeit damit, langweilige Sendungen und Begegnungen zu verfolgen, Männer und manchmal Frauen hinter dem Ball herrennen zu sehen und hirnrissige Informationen zusammenzutragen. Er gibt horrende Summen für Tickets und Abos aus (Programmpakete, Zeitschriften, Tageszeitungen), für Sticker, Trikots, Reisen und Wetten, (manchmal) für Bücher und (vor allem) für Videospiele. Er füttert sein Gedächtnis mit ausgefallenen Statistiken, Transfersummen und Vertragslaufzeiten, mit Daten, Geburtsorten, Größe und Gewicht der Spieler, mit der Erfolgsbilanz der einen und den Auswahlverfahren der anderen. Er wird sich nie mehr davon befreien können. Die Hypermnesie des Fußballfans hat etwas Manisches, weil sie sich (oft) nur auf das runde Leder bezieht. Alle zwei Jahre ist er von Mitte Juni bis Mitte Juli gänzlich unansprechbar: cerrado por mundial, signalisiert der uruguayische Schriftsteller Eduardo Galeano – abwesend wegen Fußballweltmeisterschaft, Europameisterschaft oder Copa America in den schlimmsten Fällen (so in meinem). Er lebt woanders, in rund fünfzehn europäischen und südamerikanischen Städten, ist stets auf der Lauer, will nichts verpassen von den Ergebnissen, Transfers und Pleiten der Gegner. An den Spieltagen unterzieht er sich unsinnigen Ritualen, trägt als Talisman einen Jaguarslip oder fleht seine Frau an, ihren blasslila Spitzen‑BH vom Tag ihres Kennenlernens anzuziehen, steckt sich ein 50‑Cent-Stück in den rechten Schuh und ist trotzdem vor jedem Spiel völlig von der Rolle. Das Gefühl der Leere, das sich nach Ende der Spielzeit und einem wichtigen Wettbewerb einstellt, stürzt ihn in einen Zustand tiefer Schwermut.
Der Fußballfan ist ein nostalgisches Wesen, davon zeugen die ersten (und folgenden) Seiten dieses Buchs. Der Fußball erinnert ihn an seine Kindheit, an die Schulhofspiele mit einem Tennisball – wie die Kinder in den Favelas, redet er sich heute ein –, an die Matchs auf dem Handballfeld aus Beton in den Unterrichtspausen am Gymnasium. Er appelliert an die Unschuld seiner ersten Jahre, als er noch abgöttisch seine Idole verehrte (Michel Platini, Zico, Dominique Rocheteau, die Torhüter Dominique Dropsy und Dino Zoff, immer wieder Maradona bei der WM 1982 in Spanien) und die Reinheit der Götter des Stadions noch nicht in den Schmutz zog oder anzweifelte. Der Aficionado erinnert sich an den Schock seiner ersten Weltmeisterschaft, die für immer die schönste seines Lebens bleiben sollte. Einen Monat lang wandte er den Blick nicht vom Familienfernseher, hypnotisiert von den geschmückten Stadien und Rasenflächen, von dem Ball mit seiner magnetischen Anziehungskraft und den ständig um ihn kreisenden Diskussionen der Medien, von jenem Ball, um den die Nationen stritten, als wäre er der kostbarste Diamant der Welt. Ein Schwindelgefühl, ein köstliches Schaudern: Er war unheilbar von seiner neuen Entdeckung befallen, das Virus war ihm für alle Ewigkeit eingeimpft. Er dachte an die Hymnen, an die weltweite Nervosität, an die unerträglich spannenden, nach dem K.-o.-System ausgetragenen Spiele, wenn seine Großmutter vor dem Elfmeterschießen aus dem Wohnzimmer floh, und an die fassungslosen Gesichter beim Schlusspfiff, wenn seine Favoriten ausscheiden mussten. Er war Patriot, aber wenn er sich aus purer Liebe zum schönen Spiel mit anderen identifizierte, war er ein Fußball-Kosmopolit – und auch das hatte seinen Reiz. Dann kam der Junge in den Stimmbruch. Im Fußballuniversum klingen ihm plötzlich Orte in den Ohren, von denen er noch nie gehört hat, und er träumt von neuen, fernen und abenteuerlichen Horizonten, von märchenhaften Himmeln. Zum ersten Mal spürt er die Vielfalt der Welt und ihre Herausforderungen. Er ahnt, dass er einer Gemeinschaft angehört, die über seinen Clan, sein Dorf und sein Land hinausgeht. Er ist ein Fußballfan geworden, und wo immer er hinkommt, begegnet er einem Seelenverwandten: einem Taxifahrer in Buenos Aires, einem Arzt in Neapel, einem Banker in London, der dieselbe Sprache spricht – das universelle Esperanto des Fußballs.
Von Fußball bekommt man Fernweh. Nach dieser ersten Weltmeisterschaft in Spanien träumte ich mich nach Lateinamerika (in Zicos Brasilien, in Maradonas Argentinien oder in Cubillas Peru, später auch in Francescholis Uruguay), und ich entdeckte Europa. Täglich spitzte ich im Morgengrauen die Ohren nach den knirschenden Reifen, ein Geräusch, das gedämpfter klang, wenn die Gehwege verschneit waren: Der Karren des Zeitungshändlers bildete den Auftakt zu meinem Morgengebet. Den »Atlas« in der Hand, sezierte ich unter der Bettdecke die Tabellen mit den Vorrundenspielen der Europapokale. Malmö FF, IFK Göteborg, Brondby IF – ich hatte ein unerklärliches Faible für skandinavische Mannschaften und osteuropäische Clubs, deren Namen – all die hinter dem mysteriösen Eisernen Vorhang verstreuten Dynamo-, Lokomotiv- und Torpedovereine – an Spielzeugmarken erinnerten. Die knochentrockenen, nahezu unleserlichen Tabellen der Sechzehntelfinale faszinierten mich. Ich bekam Lust, die Stadien und Städte des Kontinents zu erkunden. Jahre später sollte ich, ebenfalls über den Fußball, England entdecken, ein ländliches, proletarisches England, das ausländischen Studenten ansonsten verschlossen blieb. Mit der Mannschaft der University of Sussex, in der ich als Libero spielte, machten wir den Südwesten in einem alten Autobus unsicher. Ich brauchte drei Monate, um das Cockney zu verstehen, dass Ian, Tom und Konsorten auf dem Spielfeld brüllten. Sie tranken und grätschten wie die Bekloppten – daneben waren die Deppen wahre Unschuldsengel. Vor den Spielen schmetterte Steve, ein aus Leicester stammender Mittelfeldspieler mit schwarzen langen Haaren, in der Umkleidekabine Hits von Elastica, The Stone Roses und Primal Scream. Die Studentinnen (Zöpfe, Minirock, hohe Stiefel) bevorzugten die Rugbyspieler, lächelten uns nachts in den Nischen des Basements, einem dubiosen Club in Brighton, aber trotzdem zu. Der Rinderwahnsinn lauerte überall: Bei Sonnenaufgang aßen wir vor Fett triefende Burger am Pier. Die Spielzeit 1994/95 war von Besäufnissen, Schlägereien und einem grotesken Sieg im Sussex-Cup gegen eine Mannschaft aus Taxifahrern geprägt – ein grandioses Erlebnis.
Der Fußballfan denkt an seinen Vater zurück, als dieser noch jung, stark und beeindruckend war. Meiner nahm mich damals ins Stadion mit, so sein Terminkalender als Gynäkologe es ihm erlaubte. Das Spiel hatte oft schon begonnen, wenn wir unsere Tickets am Schalter 13 des Meinau-Stadions abholten. Die erste Begegnung, im August 1982, Straßburg gegen Auxerre, war ein langweiliges und dennoch unvergessliches Spiel. Ich entdeckte das Fußballstadion. Während ich auf die Zuschauertribüne kletterte, drückte ich die väterliche Hand. Ich kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: die grafischen Formen der Anlage, das satte Grün des von den abgezirkelten, milchigen Seitenlinien gerahmten Rasens, die Kinoscheinwerfer und die blau gesprenkelten Tribünen – ein Theater der Träume, das wie in Charlie und die Schokoladenfabrik





























