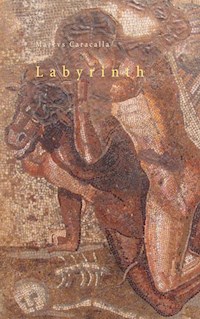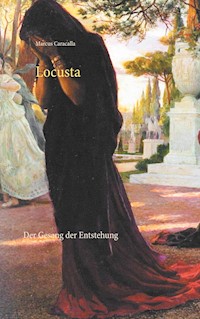
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman verfolgt den Werdegang von Locusta, der berühmtesten Giftmischerin aller Zeiten. Geboren als gallische Sklavin im Norden des römischen Imperiums findet sie sich bald verstrickt in die Intrigen und Machtkämpfe des jungen Kaiserreichs. Tiberius, Caligula, Seian, Messalina und Claudius nutzen ihre tödlichen Künste, bis sie ihnen selbst zum Opfer fallen. Locusta steht dem um sie wirbelndem Chaos von Meuchelmord und Verrat als stiller Pol gegenüber, unfähig aus der passiven Rolle des Werkzeugs herauszutreten und gefangen in einer inneren Welt, in der die Grenzen von Traum und Wirklichkeit verschwimmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Alba
Seian
Stellarius
Lepidu
Caligula
Polyphem
Britannicus
Alba
Ihre Mutter hieß Alba. So nannten sie die Legionäre, die Offiziere, das Gesinde, die Bauern und Jäger der Gegend. Alba. Weiße. Weil ihr Haar weiß, ihre Haut, ihre Zähne. Alba. Die Römer hatten ihr diesen Namen gegeben, nachdem sie ihren Mann gepfählt und sie vergewaltigt hatten. Alba. Weiße. Vergewaltigte. Sklavin. Das war vor vielen Jahren geschehen. Vor vielen Jahren war sie geworden, was sie nun war. Die Weiße. Das war, als der große Mann der Römer, Cäsar, seine Truppen über die Weltendberge führte, um Tod und Verderben unter die Stämme des Landes zu säen. Als die Sonne hinter den goldenen Schwingen des Adlers verschwand und der Wolf den Tag zu beherrschen begann.
Vor vielen Jahren war geworden, was sie nun war.
Alba sagte: „Sie nennen uns nach Eigenschaften, die uns von anderen unterscheiden. Mein weißes Haar, meine Zähne. Wir sind Dinge, lebendige Dinge für sie. Sie benennen uns nach unserem Aussehen oder Können. Wir gehören ihnen. Unser Leib. Unsere Seele. Sie erobern, um zu fressen. Sie fressen uns. Das ist, was sie tun. Die Götter bedienen sich ihrer, um uns zu strafen. Adler und Wölfe in Menschengestalt sind sie. Und was sie erobern, benennen sie mit den Augen.“
Alba war nicht bitter. Es war kein Zorn in ihr. Sie hasste die Adler und Wölfe nicht. Wie hätte sie sie hassen können? Sie waren nur Erfüllungsgehilfen der Zeitlosen. Alle Menschen waren Erfüllungsgehilfen der Zeitlosen. Das war ihr Glaube. Was sich in dieser Welt ereignete, hatte nichts mit dem Wollen und Sehnen der Sterblichen zu tun. Es war nur vager Abglanz der Ereignisse in Anderwelt. Eine Spiegelung. Anderwelt war die wirkliche Welt, die Welt der Unsterblichen, der Ort, an dem die Dinge waren wie sie schienen. Ihre Welt, Niederwelt, war nur Nebel und Dunst. Ein Trugbild. Ein Platz im Schatten.
„Wir sind Geschöpfe aus Lehm, unsere Seele ist Zwielicht, unsere Gedanken sind die Träume schlafender Riesen, unser Treiben kindliches Nachspielen ihrer Taten“, sagte Alba, ihre Mutter. Sie lächelte. Sie streichelte ihr über das Haar. Ihr Haar war tief schwarz und nicht weiß.
Einer der Legionäre, die Alba und den anderen Frauen ihres Stammes beigewohnt hatten, war ihr Vater. Wer genau es war, wusste man nicht. Vermutlich war der Mann schon lange tot. Alba sagte, er wäre tot. Sie sagte, es spiele keine Rolle. Sie sagte: „Du sollst nicht fragen.“ Und leise fügte sie hinzu: „Du bist ein Kind von Wolf und Adler, Locusta.“
*
„Die Zeitlosen spielen ihr Spiel mit uns. Manche sind uns Menschen wohlgesonnen. Andere hassen uns. Die Riesen und Trolle und Geister hassen uns. Die Hohen lieben uns. Die Hohen formten uns als ihr Abbild. Wir sind ihre Kinder; ihnen in allem ähnlich, wenn auch unvollkommen, unfertig. Woltan, dessen Weib ihm keine Söhne gebären wollte, weil sie ihr Herz insgeheim der Sonne geschenkt, goss Lehm in eine Form, um sich selbst einen Erben zu schaffen. Diese stellte er zum Härten in ein gewaltiges Feuer aus dem Atem des Drachen Gerundel. Woltans Frau sah, was ihr Mann tat. Sie wurde eifersüchtig. Und besorgt. Ihr Schoß würde nicht ewig versiegelt bleiben. Sie würde einen Sohn gebären. Nicht dem Woltan, ihrem Gemahl, sondern der Sonne, der sie ihr Herz geschenkt. Ein rotes Kind. Der Erstgeborene der Götter und Begründer eines neuen Geschlechts würde er sein. Sie sann, er würde Riesen und Götter und Geister vereinen. König einer neuen Welt werden, die Anderwelt, Niederwelt und den Schlund verschmolz. Sie hoffte, die Frucht ihres Leibes würde Frieden stiften, wo Krieg und Zwietracht herrschte. Sie rechnete, das vorbedeudete Ende aller Dinge, Weltenbrand, könne verhindert werden.
Woltans Geschöpf durfte also nicht leben, durfte nicht der Erstgeborene der Götter sein, Erbe der bleiernen Krone.
Sie sandte den Riesen Grimir, einen Sklaven ihres Liebhabers. Dieser brachte seinem Herrn vom Wein der Harfnar. Das ist, was die Römer Ambrosia nennen. Er sprach viele freundliche Worte zu ihm. Woltan nahm den Trunk, weil die Hitze des Feuers ihn durstig gemacht. Er wurde betrunken. Er schlief ein. Daraufhin holte Grimir mit bloßen Händen die Form aus dem Feuer. Und er zerbrach sie. Der Lehm war noch nicht ganz gehärtet. Langsam begann der Klumpen in sich zusammenzusinken. Sich zu entformen. Grimir hatte sich indes bei seinem Verbrechen die Hände schwer verbrannt. Er heulte vor Schmerz und Kummer. Davon wurde Woltan wach. Er sah, was seinem Kind angetan worden war. Schnell fasste er den Lehm und hauchte ihm Leben ein. Er nannte seinen Sohn Wisser. Der sich Neigende. Der Erstgeborene der Götter, Erbe der bleiernen Krone. Wisser glich Woltan in allem, doch war er unfertig, unvollkommen. Langsam zerfiel sein Leib, da er nie ganz ausgehärtet war.“
Alba nahm Locustas Hände in die ihren.
„So kommt es, dass wir Menschen im Alter wie zerfließendes Wachs werden. Unser Leib beugt sich und unsere Haut legt sich in Falten. Unser Haar ergraut und unsere Kräfte schwinden“, erklärte sie. Gedankenvoll zeichnete sie mit ihrer Fingerspitze die Linien auf Locustas Hand nach.
„Doch Woltan wollte seinen Sohn nicht ohne Hilfe lassen. Er versammelte den Rat der Götter in seiner Halle in Anderwelt zu einem großen Festessen zu Ehren der Geburt seines Sohnes. Es war ein trauriges Fest. Das Kind war schwach und sehr gering. Jeder der Zeitlosen brachte als Gabe ein Mittel, das Krankheit vertreibt, Stärke gibt und das Leben verlängert. Es waren Kräuter und Moose und die Flüssigkeiten und Gewebe, die wir aus Tieren nehmen. Alles Lebendige und manches Tote. Und sie säten diese Mittel in Niederwelt aus, dort, wo man sie gut finden konnte. Auf das Wisser Hilfe hätte und sein Leben sich verlängern würde. Doch die Riesen und Trolle und die Wesen, die den Schlund bevölkern, die Geister und Maren, hassten Wisser. Und angestachelt von Grimirs Gejammer sannen sie auf Unheil. Sie säten ihrerseits Mittel aus in Niederwelt, die jenen der Götter im Aussehen sehr ähnlich. Doch diese brachten Krankheit und Siechtum und Verderben.“
Alba hielt plötzlich inne. Ließ Locustas Hand los. Sie sah sich um, als wäre sie aus einem Traum erwacht. Sie befanden sich viele Meilen abseits des Lagers in einem tiefen, düsteren Wald. Die Luft schmeckte würzig und bitter. Die Herbstsonne brach sich im Gewirr bunter Blätter und verschwendete ihre Kraft, kühles Moos und feuchten Schlamm zu wärmen. Der Schrei eines fernen Adlers, das nahe Geraschel von Dachs und Hase und Maus. Alba fiel vor einem roten Stein auf die Knie. An dessen Sockel wuchs, bräunlich und glockenförmig und unscheinbar ein Pilz. Vorsichtig zupfte sie ihn ab und roch daran.
Sie lächelte.
„Hier, nimm.“
Locusta nahm. Roch nun selbst daran. Ein herber, vager Duft, unbestimmbar und unbedeutend wie sie fand. Interessanter schien die gekräuselte Musterung des Pilzes. Sie erinnerte an die Windungen einer Ohrmuschel.
„Was ist das?“ fragte sie.
„Beldins Ohr“, erwiderte Alba. Und sie erzählte von Beldin, einem Mann, dem Zufall und Tücke einen weiblichen Waldgeist in die Hand gespielt. „Die einzige Möglichkeit, diese schlüpfrigen Wesen in Gefangenschaft zu halten, ist, sie mit menschlichem Haar zu binden. Beldin hatte lange krause Locken. Aus denen vermochte sich der Waldgeist nicht zu befreien. Sie bat Beldin, sein Haar zu scheren. Beldin aber weigerte sich. Der Geist bot Beldin Lösegeld an. Reichtümer aus dem Schlund. Grabbeigaben sagenhafter Helden, Trinkhörner, Klingen, Helme, Pelze. Doch Beldin lehnte ab. Stattdessen verlangte er, dass der Geist ihm die Geheimnisse des Schlunds enthülle. Sie stimmte nach einigem Hin und Her zu. Und begann die Rätsel von Feuer, Wasser, Luft und Lehm in sein Ohr zu flüstern. Die Gesetze von Leben und Tod. Die Gedichte der grauen Stunden. Die Ordnungen der Geister, die Riten der Trolle, die Sagen der Riesen. Das Wissen des Schlundes ist für die Sterblichen unerträglich. Sie zerbrechen daran. Beldin zerbrach daran. Er verlor den Verstand. Sein Inneres zerbrach. Sein Herz wurde schwermütig. Er begriff, er war zerfallender Lehm. Gezählt die Tage im Schatten und die Stunden im Schatten. Etwas Unvollkommenes, Vorläufiges. Eine Missgeburt. Abscheulichkeit. Endlich ertrug er die Lehren nicht mehr. Er riss sich die Ohren aus und schleuderte sie von sich.“
Alba hielt den sonderbar geformten Pilz vor sich. Ihre Augen, grau und kalt, verfingen sich in Locustas staunendem Blick.
„Gerieben und gekocht, vermengt mit Belladonna und gesüßt mit Ygdras Tränen, bewirkt die Essenz aus Beldins Ohr, dass man das Echo der Geisterstimme in seinen Träumen hört. Aber Vorsicht! Zuviel davon kostet den Verstand und führt zu Raserei.“
*
„Kräuter, Pilze, Moose, zu Staub zermahlene Steine, die Borke lebender und toter Bäume, ihre Blätter, rot und gelb, gefallen bei Vollmond, oder von einem Ostwind geerntet, Knospen, Blütenstaub, Harz, Nektar, Wurzeln und was darunter, schwarze, feuchte Erde, Moder, Schimmel. Die Gliedmaßen von Insekten. Die Gliedmaßen warmblütiger Tiere. Das Äußere: Haut, Zahn, Klaue, Huf, Horn, Auge und Haar. Das Innere: Gedärm, Herz, Niere, Leber, Lunge, Magen. Das Geschlecht, das männliche, das weibliche, die Kammern des Werdens. Hüte dich vor Rezepturen mit Fledermauskot, Schnurrhaaren schwarzer Katzen, der Nase eines Hundes oder Wolfes, der Menschenfleisch gekostet, Blut von der Klinge eines Sohnes, der seinen Vater erstach, der ersten Menstruation einer Rothaarigen, der Nachgeburt einer Blinden und dergleichen. Das Wirksame ist vom Schädlichen zu scheiden. Bedenke die Quelle.
Blut ist nicht Blut.
Alles, was ist und sein kann, kann dir dienen. Weil eingebettet in die Materie von Niederwelt. Eingefasst in das Gewebe dieser Welt ist alles verbunden, alles aufeinander bezogen. Ein Funke von Gerundels Feuer überall dort, wo Wärme ist. Woltans Atem, wo Wesen sich aus eigener Kraft rühren. Grimirs Wehklagen hallt wider aus den Kehlen einsamer Wölfe.
Es kommt auf die Zusammensetzung an. Die kunstvolle Kombination verschiedener Substanzen erzeugt ein Konglomerat, dessen Potenz die seiner Bestandteile übersteigt. Es ist wie wenn ein Mann und eine Frau zusammenliegen und aus ihrer Liebe entsteht das Dritte, das Kind, das vordem nicht gewesen.
Das Wissen um die rechten Rezepturen – die drei Wege des Lernens. Der erste ist die Überlieferung. Das Erprobte, aufgeschrieben oder von Mund zu Ohr über die Generationen fortgetragen. Es ist Niederwelts Weise zu lernen, grob, beschränkt, mit Fehlern behaftet, doch nichtsdestotrotz nützlich, handfest. Der Weg des Menschen ist mühsam und stetig. Die zweite Weise lehren uns die Zeitlosen. Es ist Anderwelts Weg. Eingeätzt in die Materie der Wirklichkeit finden sich die Buchstaben der Götter. Ihre Spuren, Hinweise. Ihre Weisheit eingesenkt in den Stoff von Niederwelt. Lerne ihre Sprache zu sprechen, Locusta, ihre Worte zu vernehmen, ihre Spuren zu lesen. Lies aus Kraut und Sternenlauf, höre auf den Ruf der Eule und das Rauschen des Bachs. Gedichte aus Wind und Brandung. Ein Beispiel, Kind: Eine Liebende, deren Liebe unerwidert; eine Frau, deren Schoss trocken und deren Herz einsam. Der Mann, dem sie anhängt, verschmäht sie. Sie heult und jammert. Irgendwann aber, nach Jahren, wird sie müde. Und still. Ihr Haar wird grau. Sie beginnt zu träumen. Im Traum kommt die Riesenfrau Aside zu ihr. Spricht. Doch die Frau versteht die Riesin nicht. Nacht um Nacht derselbe Traum. Langsam beginnt die Frau die Worte Asides zu enträtseln. Es ist eine Rezeptur: Warmer Sommerhonig vermengt mit dem Urin eines Säugling und dem Saft eines überreifen Rothäubchens, das Gemenge, unter die Achseln gestrichen, befeuchtet den Schoss der Frau und macht den Mann begehrlich. Dieses Wissen wurde kundgegeben meiner Mutter in einem Traum. So bin ich geworden, Locusta.“
Alba lächelte. Sie streckte ihr Gesicht der Sonne entgegen, schloss die Augen. Ihr weißes Haar gleißte so sehr, dass Locusta sich abwenden musste.
„Der dritte Weg?“ fragte sie schließlich.
„Ja, der dritte Weg. Schlunds Weg. Ein dunkler Pfad.“
„Sag es mir“, bat Locusta.
Alba zögerte. Sie sah die Tochter an. Lange sah sie die Tochter an, nachdenklich und ein wenig traurig. „Dein Haar ist schwarz, Kind. Geschöpf von Adler und Wolf bist du.“
„Der dritte Weg!“
„Das Opfer des Fleisches. Das Experimentieren an Lebendigem. Der Tod als Mittel zum Leben. Das Leben als Mittel des Todes. Die Abwandelung bestehender Rezepturen im Hinblick auf erwünschte Wirkungen. Das Auffinden des Unerwünschten dabei. Und dessen Nutzbarmachung. Gifte, lähmend, tötend, schnell und langsam, klebrig, an den Spitzen von Pfeilen, auf Klingen, sengende Wunden schlagend, Infekte gebärend, Tropfen, die Wahnsinn entfache, Ausschläge, Schlaflosigkeit, die Auflösung der Organe, die Desintegration von Wisser.“
„Es muss nicht sein. Aus dem Opfer kann Gutes kommen. Einer kann um Willen der Vielen geschlachtet werden“, wandte Locusta ein.
„Es ist nie so. Es ist ein Trug. Ein übler Weg führt notwendig zu einem schlechten Ende.“
Albas senkte das Haupt, seufzte. „Dein Haar ist sehr schwarz, Kind.“
*
Rufe hallten wider in ihrem Traum. Drangen ein in absonderliche Szenen, die ein dunkles Begehren Nacht um Nacht in ihr zeugte. Die lippenlose Fratze eines Lemuren, der ihr vordem Geheimnisse zugeflüstert, in Worten, die sie verstand und nicht verstand, schrie sie nun urverwandt an. Schrie laut und wild. Rieb sein Geschlecht dabei und lachte. Dann ein unartikulierter Laut, langgezogen und sehr hoch. Es war kein Zorn, wie sie zuerst vermutete, noch Lust, sondern Agonie. Der Geist litt. Er streckte die Finger nach ihr aus. Sie glichen kleinen Ästchen mit hellgrünen Blättern. Eine flehende, bittende Geste. „Hilf mir“, sprach die Kreatur nun mit einer anderen, einer ihr bekannten Stimme. Eine Frauenstimme. Albas Stimme. Der Geist fasste sie an der Schulter und begann sie heftig zu schütteln.
„So hilf mir doch, dummes Ding!“
*
Locusta schreckte auf. Albas Züge waren gespannt, ihre grauen Augen weit geöffnet. Ein Hauch von Rot lag auf den fahlen Wangen.
„Koch Wasser!“ befahl sie und wandte sich ab. Wandte sich einem blutüberströmten Leib zu, der, umringt von zwei Legionären und einem alten Sklaven, auf dem breiten Tisch lag. Und langgezogene, schrille Laute ausstieß. Wie der Lemur in ihren Traum.
Die Legionäre beeilten sich, die Lederriemen durchzuschneiden, die den Panzer ihres Kameraden hielten. Sie fluchten dabei. Das Blut ließ die Klingen ihrer Kurzschwerter abgleiten. Der greise Sklave stand unschlüssig am Fußende des Tisches und murmelte etwas vor sich hin. Seine Hände ruhten auf den Stiefelspitzen des Verwundeten.
„Wasser, Locusta!“ schalt Alba. Sie hatte begonnen, mit einem weißen Tuch Blut und Schmutz vom Gesicht und Hals des Mannes zu reinigen.
Locusta sprang auf. Sie fasste eine Schale, die auf dem Boden neben der Feuerstelle stand, schüttete die Körner aus, die sich darin befanden, und rannte aus dem Haus. Nebel, undurchdringlich und feucht, empfing sie. Verschlang sie. Schemenhaft erkannte sie Soldaten, Sklaven, Händler, Handwerker. Das Lager war in Aufruhr. Gedämpfte Stimmen und Rufe. Manche nah, andere fern. Sie sprachen die tausend Sprachen des Römerreichs. Sie hörte Septimus, ein einäugiger Veteran, der ihr einmal eine Flöte geschnitzt hatte; Jaeel, die dicke Frau eines judäischen Bernsteinhändlers, der die meiste Zeit des Jahres bei den Stämmen jenseits des Flusses zubrachte; Polykleides, ein thebanischer Schmied, der ihr von den schönen, weißen Göttern seiner Heimat erzählt.
Sie rannte über den gefrorenen Boden. Sie war barfuß. Nur ein grobes Leinenkleid bedeckte ihre kindliche Nacktheit. Sie fror. Sie zitterte. Vor Angst. Vor Kälte. Sie füllte die Schale mit Wasser aus dem Brunnen. Dünnes Eis schwamm auf der Oberfläche und zerbrach. Sie balancierte das Gefäß zurück ins Haus. Wich den Schemen aus, die aus dem Nebel schossen, um ihren Weg zu kreuzen. Sie sah Waffen und Blut und hörte das Bellen der Offiziere und das Klirren der Rüstungen. Sie war geschickt, schnell. Lange, dünne Ärmchen und Beinchen, große Augen. Ihr Haupt war wie das aller Kinder im Lager geschoren, was ihre riesigen fast schwarzen Augen umso mehr hervortreten ließ und ihrem Gesicht etwas insektenhaftes verlieh. Locusta, Heuschreckchen, so nannte man sie deshalb. Auch Alba nannte sie so. Obwohl sie ihr einmal einen anderen Namen gegeben. Das war lange her. Der andere Name war alt geworden. War verhungert. Verdurstet. Verloren. Er war vergessen. Locusta hatte ihn vergessen und Alba wohl auch.
Das Stöhnen des Soldaten war leiser geworden, schwächer. Er röchelte nur noch. Kleine Bläschen aus Speichel und Blut blühte wie Mohn auf seinen Lippen. Locusta hatte Lust, sie zerplatzen zu lassen. Und die Lippen zu küssen. Sie schüttete das Wasser in den schweren Kessel, der über der Feuerstelle hing. Der Sklave hatte bereits Zweige in die schwelende Glut der vergangenen Nacht geworfen. Kleine Flammen beleckten das schwarze Metall.
Alba nahm von verschiedenen Kräuterbündeln, die an schweren Balken hingen. Und zerrieb ihre Ernte in einem tönernen Mörser. Ein starker Duft breitete sich aus, der den erstickenden Gestank des qualmenden Feuers und den beißenden Geruch von Schweiß und Blut überdeckte. Sie gab das feuchte Pulver in das Wasser. Dann fügte sie andere Essenzen hinzu, die sie länglichen Behältern aus ausgehöhlten Knochen entnahm. Sie tränkte ein frisches Tuch in der kochenden Flüssigkeit und wusch die Wunde auf dem Bauch des Mannes aus. Er stöhnte auf als ein sengender Schmerz seine Qualen erneuerte.
„Öffnet ihm den Mund“, befahl Alba. Einer der Legionäre hielt den Kopf des Verwundeten, während der andere das Kinn mit roher Gewalt herunter drückte. Alba tröpfelte ihm eine durchsichtige Substanz ein.
„Trink“, sagte sie. Der Mann wehrte sich zuerst, gurgelte, versuchte den Kopf aus dem Griff seines Kameraden zu lösen. Dann klarte sein Blick plötzlich. Fixierte die weiße Frau. Er begriff, man wollte ihm helfen. Er gab seinen Widerstand auf und schluckte gehorsam. Kurze Zeit später schlief er ein. Alba reinigte erneut den klaffenden Spalt unterhalb seines Nabels. Darauf schmierte sie eine weißliche Paste in die Wunde und verband sie mit einem in Öl und Wein getränkten, sauberen Tuch.
„Wird er leben?“ fragte der Legionär, der den Kopf des Verwundeten gehalten. Schweiß stand auf seiner Stirn, Tränen in den Augen.
Alba lächelte.
*
Der Mann, dem Alba das Leben gerettet, war der Centurio Marius Getius. Marius stammte aus niederem italischem Adel. Seine Familie war verarmt. Landbesitzer aus der Gegend um Padua. Ein paar Weinberge, Äcker, Olivenhaine. Eine verfallene Villa. Zwei Dutzend magere Sklaven, mageres Vieh, magere Schweine. Marius Vater hielt auf Pferde. Er hatte ihrer nur drei, doch diese waren von bester Art. Sie waren sein ganzer Stolz. Dem Sohn hatte er den Hengst Ares geschenkt als jener den Legionen beitrat, um der Familie als Offizier Ruhm zu erwerben. Was sonst gab es im kargen, kaum zivilisierten Norden auch zu gewinnen? Ruhm also. Genug Ruhm, um gut zu heiraten. Um Geld zu heiraten. Um nach Rom zu heiraten, in die Stadt, die Kleine groß und Große klein zu machen vermochte. Der Vater träumte von einer Beamtenkarriere seines Sohnes. Eine Quästur vielleicht. Vielleicht sogar ein Prätoriat, wenn es den Göttern gefiel. So träumte der Vater des Marius als er ihm mit blutendem Herzen die Zügel des Hengstes Ares in die Hand legte. Ein schwarzes, sehr schönes Tier, das als Fohlen zu ihm gekommen. Um den Preis eines Weinberges. Dem Vater standen beim Abschied Tränen in den Augen. Sein Herz war schwer. Sorge gärte auf dem Grund seiner bäurischen Seele. Um den Hengst, nicht um den Sohn. Nicht um Marius. Der auszog, Ruhm zu erwerben, dort, wo es ihn in Hülle und Fülle gab, Ruhm, Ruhm und nichts als Ruhm. Im Norden. In Gallien. Nahe der Grenze zum freien Germanien. Wo Überfälle und Scharmützel an der Tagesordnung. Wo reichlich Blut vergossen wurde, das den Ruhm der Waffen tränkte.
Der Hengst, der als Fohlen um den Preis eines Weinbergs zu Marius Vater gekommen, war gefallen. Sein Blut tränkte den Boden. Ein Speer hatte erst den Hals des Tieres und dann Marius Panzer durchdrungen. Vier Zoll tief war er ins Eingeweide gefahren. Die Verletzung hätte zum Tode führen sollen. Doch Marius lebte. Der schöne Hengst verfaulte an den Gestaden der Ister. Der Mann, der ihn getötet, ebenso. Vierzehn Legionäre. Ein Ochse. Ein Dutzend Barbaren. Ein halbes Dutzend Weiber. Ein paar Hunde. Die Ister trank ihr Blut. Ruhm blühte unter bleichenden Rippenbögen.
Marius genas von seiner tödlichen Verwundung. Es war ein Wunder. Man konnte es nicht begreifen. Man begriff nicht, wie der Hengst Ares sterben, der Offizier Marius aber mit zerfleischtem Eingeweide leben konnte.
Marius nahm Alba in sein kleines, aus dicken Stämmen gefügtes Offiziershaus. Als Pflegerin zunächst. Über Wochen und Monate umsorgte sie ihn mit schweigsamem Gleichmut. Dann aber nahm er sie als Geliebte. Und lebte mit ihr wie mit einer Ehefrau. Schließlich kaufte er sie dem Legaten ab, dem sie gehörte. Der Legat lebte nicht im Lager an der Grenze. Er liebte nicht den Ruhm. Er liebte nicht Scharmützel und Überfälle. Er wohnte in einer Stadt mit Badehaus und Theater tief im Landesinneren. Der Legat besaß ein Haus vor dem weiße Säulen standen, die man aus Griechenland hatte kommen lassen. Er war überaus fett. Ein großer Mann in jeder Hinsicht. Der Legat wusste nichts von seinem Eigentum an Alba. Die Zahl seiner Sklaven war unermesslich. Er ließ sie nach herausstechenden Eigenschaften nennen: Schreiber, Langbart, Dreifinger, Fötzchen. Alba, die Weiße – der Name sagte ihm nichts. Er wog, es mochte sich um eine Greisin handeln. Der Preis, den er dem Centurio vorschlug, war überaus maßvoll. Ebenso die Konditionen der Zahlung und der Zins. Zu zahlen später, in einem Jahr oder zwei, mit einem Fünftel oben auf. Man sei doch unter Freunden. Er bat Marius zu bleiben und zu erzählen. Er ließ ihm dünnen Wein bringen. Dunkles Brot und kaltes Fleisch. Er selbst griff reichlich zu. Er lachte als der junge Offizier die Umstände seiner Verletzung beschrieb. Er hielt sich den feisten Bauch vor Lachen. Warum er lachte, wusste er nicht. Der Centurio bedeutete mit rotem Kopf, er war nun ohne Reittier. Er bat um eine Leihgabe. Er versprach Kompensation. Der Legat hatte Mitleid mit dem jungen Helden. Er war kein Unmensch. Er klopfte Marius auf die Schulter. Er lachte. Seine Backen waren überaus fleischig und schlecht rasiert. Er schenkte dem Mann ein Pferd. Eine klapprige Mähre grau-weißer Farbe. Sie würde gut zu dieser Alba passen, fand er. Er lachte, als er es sich vorstellte. Er trank. Plötzlich bekam er brünstige Gedanken. Er dachte an Fötzchen und Dreifinger. Er rief seinen Schreiber. Er hieß ihn eilig einen Schuldschein über den Kaufpreis der Sklavin Alba auszustellen. Marius unterzeichnete.
*
Marius war schweigsam, zurückgenommen, arm an Worten. Sprach also nicht viel. Nicht zu ihr, nicht zu Alba, nicht zu den Männern unter seinem Kommando. Locusta erinnerte sich seiner als eine Person, die anwesend war, ohne ihre Anwesenheit je bemerkbar zu machen. Jemand, der am Rande steht, im Schatten. Ein Wartender. Ein Beobachter. Ein unbeteiligter Zuschauer. Dabei hatte er eine angenehme und geübte Stimme. Wenn er sich ihrer bediente, sprach er langsam, betont, überaus deutlich, ohne Akzent. Sein Vater hatte Wert darauf gelegt, dass sein einziger Sohn sich eine tadellose Sprechweise angewöhnte. Der Dialekt des Landes sollte nicht an ihm haften. Es war genug, dass die Armut an ihm haftete. Man sollte ihn in Rom nicht beim ersten Wort als Provinzialen erkennen. Als Bauern.
Marius lächelte, wenn er seines Vaters gedachte. Er zeigte Locusta seine Finger. Rötliche Striemen leuchteten darauf. Nie geheilte Narben. Er erklärte, mit diesen Händen habe er Sprechen gelernt. Eine Rute sei sein Lehrmeister gewesen.
Marius hatte keine Geschwister. Seine Mutter war schon lange in der Unterwelt. Er besaß keine Erinnerung an sie, wohl aber an ihr Grab. Ein kleines Gebäude aus verwitterten Quadern an einer Gräberstraße vor Padua. Er bedeutete Locusta, dass man in der Nacht das Flüstern der Toten dort hören könne.
„Einmal hoffe ich auch dort zu sein. In der Nische über meiner Mutter. Um mit ihr zu flüstern“, sagte er. Und sein Blick wurde leer und traurig und weit. Locusta begriff, dass er nicht zu ihr gesprochen hatte, sondern zu sich selbst, und dass sie nur zufällig Zeugin dieser Worte geworden. Teilhaberin seines dunklen Traums. Und sie ahnte, dass in diesen akzentfreien, wohl betonten Worten ein Geheimnis lag, düster und kühl wie das Innere jenes Familiengrabes an der Straße vor Padua. Und sie wog, einmal selbst dort hinzugehen, um das Flüstern der Toten zu hören.
*
Im folgenden Sommer verließen sie das Lager. Marius ging zurück in die Heimat. Musste gehen. Die Wunde in seinem Bauch machte ihm zu schaffen. Er konnte nicht mehr reiten. Er schlief schlecht. Er taugte nicht mehr zum Soldaten. Bedurfte stattdessen der umfassenden Pflege durch Alba.
Sie reisten auf einem offenen Wagen. Alba und Locusta blieben meist im hinteren Teil, während Marius neben dem Fuhrmann saß. Man sprach nicht viel. Das Rattern der riesenhaften Räder übertönte die Gedanken. Sie gelangten in eine Stadt, die Massalia hieß. Eine große Stadt aus Stein. Gewaltige Mauern. Häuser, die eine Vielzahl von Menschen in sich enthielten. Zwei, drei, vier Stockwerke hoch. Himmelhoch. Treppen, düster und eng und gewunden, führten hinauf und hinab. Führten in Kammern und Flure, die Menschen ohne Zahl enthielten. Lachende und essenden und weinende und gesunde und kranke. So viele Menschen. Locusta wähnte, die Häuser mussten den Gräbern ähneln, die Marius ihr beschrieben. Quader und Nischen. Darin Menschen aufbewahrt. Flüsternde Menschen. Gräber also. Denn Stein konnte nur Totes enthalten – so sann sie, die nur Lehm und Holz kannte. Stein war kalt und hart. Das Gegenteil alles Lebendigen. Die Römer lebten also in Gräbern. Es war kein Urteil in dieser Feststellung. Die Römer bauten Gräber, um darin zu leben. Vielleicht lebten sie auch nicht. Vielleicht waren sie tot, diese Römer, und wussten es nur nicht. Bewegten sich, obwohl sie ruhen sollten. Flüsterten. Es mochte sein. Der Tod war nichts Unumkehrbares. Er glich einem Schlaf. Ein beliebiger Zustand, der leicht gestört werden konnte. Eidechsen starben im Winter, nur um vom ersten Strahl der Frühlingssonne wiedererweckt zu werden. Sie selbst hatte es beobachtet. Viele Male. Ihr Verdacht, Leben und Tod seien in Massalia unnatürlich vermengt, erhärtete sich beim Anblick der Menschen, die dort waren. Prachtvolle Gewänder trugen sie, Roben und Tuniken, weiß und bunt. Gekleidet wie Leichen schritten die Bewohner der steinernen Stadt im Schatten ihrer Gräberhäuser einher. Die Frauen hatte weißliche Haut und rote Lippen. Ihre weißen Hälse starrten von Gold und Silber. Ihre Finger waren schwer von Edelsteinen. Sie rochen stark. Süß und betäubend. Vielleicht, um den Leichengestank zu überdecken, dachte Locusta. Sie teilte ihre Beobachtungen der Mutter mit. Auch Alba war weiß. Ihre Haut war weiß, ihr Haar, ihre Fingernägel. Alles weiß. Leichenhaft blass. Alba schwieg. Sie lächelte. Sie drückte Locustas Hand. Ihre Hand fühlte sich kühl und trocken an. Locusta fröstelte.
*
Sie blieben nur wenige Tage in der Stadt Massalia. In einem der steinernen Häuser waren ihnen zwei Zimmer zugewiesen worden. Ein großes bogenförmiges Fenster sah auf einen geschäftigen Platz. In dessen Mitte goss eine weiße Göttin unentwegt Wasser aus einer Amphore in ein Becken, das nie voll werden wollte. Unersättlich wie jene, die es erbaut. Aus mit buntem Tuch überdeckten Ständen boten Händler ihre Waren feil. Locusta verbrachte viel Zeit an diesem Fenster. Lange Stunden. Studierte das Treiben der sonderbaren Wesen, die sich wie Ameisen unter ihren Blicken tummelten. Suchte sie zu zählen, sie zu unterscheiden. War in ihrem Tun beharrlich, fast fanatisch. Reglos. Über lange Stunden. Auge, nicht Hand, nicht Fuß. Nur Auge. Locusta war Auge. Marius sprach zu ihr. Alba sprach zu ihr. Sie nickte. Sie antwortete auf eine Frage. Sie vergaß sogleich den Inhalt von Frage und Antwort. Eine dürre, alte Frau brachte ihnen essen. Sie ging stark gebeugt. Locusta studierte die eingefallenen, blassen Wangen der Frau. Dunkle Ringe unter den Augen. Schlechte Zähne. Roch nach Urin. Locusta dachte: tot. Dachte: Leichnam. Sie griff die Hand der Frau. Verwundert ließ sie es geschehen. Öffnete die Finger. Besah Schwielen und Linien. Las Krankheit und Kummer.
„Tot“, urteilte sie.
Die Frau entzog ihr die Hand. Sie war verwirrt und aufgebracht. Sie schalt Locusta. Kopfschüttelnd ging sie. Locusta aber wandte sich wieder dem unbegreiflichen Treiben unter dem großen, bogenförmigen Fenster zu.
*
Sie kannte Marius Nacktheit. Und sie kannte die Nacktheit ihrer Mutter. Sie kannte die Nacktheit vieler Menschen und vieler Alter. Sie hatte beobachtet die Weiber, wenn sie sich wuschen. Oder die Männer, wenn sie in den Fluss stiegen oder sich mit Eimern übergossen. Heimlich hatte sie auch Legionäre und Sklavinnen beobachtet, die einander Blicke zugeworfen und Worte ausgetauscht. Ihnen aufgelauert in ihren Verstecken. Hinter Bäumen und Büschen. Auf einer Lichtung. Oder in modrigen Quartieren und zugigen Baracken. Es war eine gute Nacktheit, fand Locusta, die Nacktheit der Liebenden. Warm und lachend. Die Nacktheit der Kranken und Verwundeten war ihr dagegen widerwärtig. Kaltes und riechendes Fleisch. Entformt auf sonderbare Weise. Nutzlos. Zerbrochen. Ekelhaft anzufassen. Die schönste Nacktheit war die der Neugeborenen. Eine rosige und weiche Nacktheit voller Verheißung. Die Nacktheit des Fleisches war ihr also bekannt, ja vertraut. Wenn sie an einen Menschen dachte, so dachte sie an ihn als jemand, der in den Fluss stieg oder auf Albas Tisch lag.
Hier, in Massalia, gab es keine Nacktheit. Die Leiber waren allzeit unter Stoffen verborgen. Lagen von Stoffen. Die Römer schämten sich ihrer Nacktheit. Sie schien es. Schämten sich ihrer Haut. Dort, wo die Haut unter den Stofflagen sichtbar wurde, bemalten sie sie. Die Frauen benutzten Puder. Geriebene Kreide. Die Kreide schmeckte süßlich. Sie band Feuchtigkeit, ohne sich je ganz in ihr aufzulösen. Man konnte sie zur Herstellung von Pasten benutzen. Und zum Verfärben derselben. Kreide und ungelöschter Kalk waren außer im Geschmack voneinander nicht zu unterscheiden. Dem Auge gleich. Doch von unterschiedlicher Wirkung. Kalk fraß Fleisch, während Kreide es nur weißte. Kalk verätzte die Haut. Verbrannte ohne Flamme und Hitze. Beging man den Fehler, die betroffenen Stellen mit Wasser abzuwaschen, verschlimmerte sich die Verätzung. Der Kalk verschmolz mit dem Fleisch, grub tiefe Furchen hinein. Eine Lauge, deren Hunger unstillbar. In Gallien hatte man Kalk auf die Leichen von Menschen und Tieren gestreut, wenn kein Feuerholz zur Stelle, sie zu verbrennen. Oder man machte eine Schlemme, mit der man die Wände der Ställe bewarf. Die Sklaven, die man zu diesem Dienst abgestellt, trugen Tücher über ihren Köpfen. Lange Roben. Ihre Hände waren in Stofffetzen gewickelt. Auch sie verbargen ihr Fleisch. Wie die Römer. Wenn auch aus anderem Grund. Viele, die in den Kalkminen arbeiteten, wurden blind. Der Kalkstaub verätzte ihre Augen. Sie spuckten Blut. Der Kalkstaub verätzte ihre Lungen. Sie röchelten unentwegt. Sie erinnerte sich, dass einmal eine Frau einen Säugling in einen Bottich voll frischer Schlemme geworfen hatte. Es war nicht ihr Kind. Man wusste nicht, warum sie das Kind einer anderen töten wollte. Die Haut des kleinen Wesens verschrumpelte. Wurde wie die eines Greises. Wurde rot und eitrig. Öffnete sich. Man konnte das gräuliche Fett sehen. Dann die Knochen. Binnen Stunden war das Kind tot. Es war ein Junge gewesen. Locusta erinnerte sich an das winzige Geschlecht, das nurmehr zur roten Masse geronnen. Sie erinnerte sich nicht an die schrillen Schreie des Sterbenden. An das verzweifelte Heulen der Mutter. An das Gejammer der Mörderin, die man mit Stöcken prügelte. An all das erinnerte sie sich nicht mehr. Nur an das Geschlecht des Kindes erinnerte sie sich sehr genau.
*
Locusta beobachtete die Wellen. Das Schiff schaukelte auf ihnen. Sie schaukelten auf dem Schiff. Es versank nicht. Es schwebte auf dem Wasser. Das Wasser war tief und dunkel und sehr weit. Sie stellte sich vor, wie dort unten ein vielarmiges Ungeheuer auf sie lauerte. Awensil. Schlammkriecher. Augen, schwarz und voller Hass, starrten sie argwöhnisch an.
„Warum versinken wir nicht?“ fragte sie Alba, die neben ihr stand, den Blick auf die Küste gerichtet, die langsam an ihnen vorüberzog.
„Holz enthält einen Anteil Luft. Luft und Wasser stoßen sich ab“, antwortete sie mechanisch. Ihre Gedanken waren weit entfernt. Sie wanderten an der Küste entlang.
Locusta wusste natürlich, dass Holz Luft enthielt und dass der Äther dem Feuchten feindlich entgegenstand. Darum bekam man unter Wasser keine Luft. Sie wusste auch vom Feuer, das im Holz hauste und vom großen Anteil an Lehm, aus dem Baum und Strauch wuchsen. Holz war Lehm mit Lufteinschlüssen, gehärtet vom Schein der Sonne, die den Anteil am Feuer ergab. Weswegen Holz leicht zu verbrennen. Hitze ließ das Feuer aus dem Holz entweichen, der Lehm zerfiel zur Asche, die heiße Luft sonderte sich in Gestalt von Rauch ab. Sie wusste all diese Dinge. Sie wusste auch, warum Holz auf dem Wasser schwamm. Sie hatte nicht gefragt, um zu erfahren, was sie bereits wusste. Sie hatte gefragt, um Alba zum Sprechen zu bewegen. Ihr Schweigen bedrückte sie. Und mehr als ihr Schweigen, ihr Blick, der sich im Ungefähren der Küstenlinie verlor. Sie fürchtete dieses Schweigen der Mutter und sie fürchtete den fernen Blick. Sie wollte, dass Alba mit ihr sprach.
„Es gibt viele Siedlungen hier. Keine Stunde, wo nicht ein Nest rotgeziegelter Dächer erscheint“, stellte Locusta fest, um das Gespräch im Gange zu halten.
Alba wandte sich ihr zu. Ihr Blick war ohne Ausdruck. Sie sah Locusta wie eine Fremde an. Abwesend streichelte sie die Wangen der Tochter.
„Ich vermisse meine Heimat“, meinte sie.
Heimat. Noch nie zuvor hatte Locusta dieses Wort aus dem Mund Albas vernommen. Heimat. Alba bediente sich des lateinischen Ausdrucks: Patria. Land der Väter. Locusta hatte keinen Vater. Die Legion war ihr Vater. Wölfe und Adler waren ihre Väter. Kein Mann. Keine einzelne Person. Eine Idee. Sie begriff nicht, was Heimat bedeutete. Land der Väter. Sie begriff nicht die Tränen, die sich an Albas Kinn sammelten.
„Wir gehören Marius“, stellte Locusta fest. Marius war ein Centurio. Ein Mann, der unter den Schwingen des Aquilla lebte. Wolfsmann. Und sie waren sein Eigentum. Locusta fand eine beruhigende Logik in ihrer Feststellung. Sie schloss: „Wo er ist, ist unsere Heimat.“
„Aber ja“, erwiderte Alba. Sie lächelte gequält. „Ja, Marius ist gut zu uns. Er liebt mich. Ich liebe ihn. Es wird gut werden. Wie töricht von mir, zu weinen, wo ich nichts als Freude und Erleichterung empfinden müsste.“
Locusta gedachte der Nacktheit ihrer Mutter und der Nacktheit der vielen anderen Leiber, die sie gesehen. Diese Nacktheit war rätselhaft. Sie band und schuf Neues aus jenen, die sie band. Sie dachte an ihre eigene Nacktheit unter dem Stoff und sie dachte an Marius. Alba hatte sich abgewendet. Locusta trottete an den Bug. Sie beobachtete die Wellen, die sich an Holz und Metall brachen. Schäumende Gischt. Dumpfes Grollen. Sie spürte den argwöhnischen Blick Awensils auf sich, der aus der Tiefe zu ihr herauf sah.
*
Marius Vater hieß Quintus Cornelius Geta. Er war hochgeschossen, dürr, mit langem, wohl rasiertem Gesicht. Seine Stimme war laut, geschwängert vom Dialekt des Landes. Er roch nach Wein und Schweiß und Arbeit und Kummer. Nie fand man ihn lachend. Sein Herz schlug im Schatten gescheiterter Träume und vertaner Möglichkeiten.
Er reichte dem Sohn den Arm.
„Es ist gut, dass du lebst“, stellte er nüchtern fest. Sein Blick war hart, voller Argwohn und Bitternis. „Und dass ist die Sklavin, von der du mir schriebst?“ Er musterte Alba abschätzig.
„Sie hat mir das Leben gerettet“, erwiderte Marius.
Quintus rieb sich die Nase. Sein harter, bitterer Blick wanderte von Alba zu Locusta, die hinter ihrer Mutter stand.
„Und die?“
„Meine Tochter“, erklärte Alba in Latein.
Quintus sah überrascht auf.
„Du sprichst Latein? Gut. Dann verstehst du, wenn man dir befiehlt. Was ist mit der Kleinen?“
„Auch sie spricht Latein“, sagte Alba.
„Aha. Und was kann sie sonst, außer Latein zu sprechen? Ich füttere keine nutzlosen Bälger durch.“
„Sie hilft mir“, erklärte Alba ruhig.
„So? Bei was hilft sie? Komm, Kind, ich will dich ansehen“, verlangte Quintus.
Alba trat zur Seite. Mit sanfter Gewalt schob sie ihre Tochter vor. „Geh“, flüsterte sie.
Locusta ging. Ihre nackten Füße wirbelten ein wenig Staub auf. Sie stierte den Mann an, den Vater des Marius.
„Kein bisschen schüchtern, nicht? Blicke, die töten könnten! Wie heißt du?“ fragte er.
Sie antwortete nicht. Sie wog, es war besser, der Mann gäbe ihr einen neuen Namen. Nach einer Eigenschaft, die er an ihr zweifellos entdecken würde.
„Wie heißt du?“ wiederholte Quintus ärgerlich.
Locusta betrachtete die aufgesprungenen Lippen des Mannes und die Bewegung der fetten, roten Zunge in seinem Mund.
„Ich denke, sie spricht Latein? Was soll das? Warum starrt sie mich so an?“ fragte Quintus zornig.
„Sie ist anders“, erklärte Alba. „Wir nennen sie Locusta.“
„Locusta? Ha! Was für ein Name! Schön. Und kannst du nicht selbst für dich sprechen, Locusta?“ wandte sich Quintus an sie. „Und hör auf, mich so anzustarren!“
Locusta senkte nicht den Blick. Konnte nicht, wollte nicht. Sie studierte die porige, sonnengebräunte, sehr glatt rasierte Haut des Mannes, den schwindenden Haaransatz, darin graue Haare sich mit schwarzen zu mengen begannen.
„Rede!“, verlangte Quintus. Er war wütend. Er wähnte, Locusta spielte Spiele mit ihm. „Du sprichst, wenn dein Herr dich fragt! Rede, sonst kannst du was erleben. Und sieh mich nicht mehr an.“
„Über Rom brennt die Sonne licht und heiß. Bald erreichen ihre goldenen Finger dein Haus, Quintus. Ihre Strahlen werden deinen Acker nähren, bis sie im Tiber versinkt.“ Es waren nicht ihre Worte, die von ihren Lippen flogen wie Sperlinge. Es waren fremde Worte.
Quintus stutzte. Zwar hatte er Locustas Rede verstanden, die in fehlerlosem Latein geführt, doch ihr Sinn blieb ihm verschlossen. Er ahnte ein Orakel. Eine günstige Prophetie. Er wollte eine Erklärung verlangen, besann sich dann aber eines Besseren. Überwand den Keim abergläubischer Neugier, der im Herzen aller Bauern wohnt. Er straffte seinen Leib, stemmte die Fäuste in die Flanken.
„Ach, so ist das“, rief er aus. „Eine Idiotin! Wunderbar.“ Er wandte sich seinem Sohn zu. „Du bringst mir eine weißhaarige Hexe und eine Idiotin. Eine gute Beute, bei den Göttern!“
Er schüttelte den Kopf, rieb sich die Stirn.
„Schade um den Hengst Ares. Ein gutes Tier. Ich gab einen Weinberg für ihn. Als Fohlen kam er zu mir. Ich zog ihn auf. Ich nährte ihn. Er fraß Hafer aus meiner Hand.“ Als wollte er seine Liebe zu dem Tier beweisen, zeigte er seine großen schwieligen Hände vor. Bauernhände.
„Ah. Es ist, wie es ist. Schade um das Tier. Das Tier ist verloren, dafür bringt mir mein Sohn eine Hexe und eine Idiotin. Geh hinein, Sohn. Iss. Da sind Linsen auf dem Herd. Und Wein von letztem Jahr. Geh und iss. Wir wollen beratschlagen, was nun zu tun ist.“
Marius fasste Albas Hand. Zog sie mit sich.
„Nein“, widersprach sein Vater. „Die geht zu den Sklaven. Und die Idiotin auch.“
„Sie hat mir das Leben gerettet“, protestierte Marius schwach.
„Hätte sie nur dem Pferd das Leben gerettet“, zischte Quintus.
„Komm“, sagte Marius in einem Anflug von Mut und zog Alba eine Schritt weiter.
„Nein“, donnerte sein Vater. „Und bei den Götter, Marius, ich schwöre dir...“ Er vollendete den Schwur nicht. Wandte sich stattdessen um und ging mit langen Schritten und gesenktem Haupt dem Hause zu.
Marius biss die Zähne zusammen. Ließ Albas Hand los.
„Später“, sagte er leise, „komme ich dich holen. Er muss sich erst an dich gewöhnen. Er ist kein schlechter Mensch. Auch nicht hartherzig. Nur trotzig. Bitter.“
*
Die Sklaven sahen verschreckt zu Alba auf, als sie das niedrige Quartier betrat. Ihre weiße Haut, ihr weißes Haar verschmolzen mit dem Kalk an den Wänden. Ihre grauen, harten Augen wanderten über sie. Augen einer Wölfin, dachten sie. Wie eine Göttin wandelte sie über das schmutzige Stroh, das nach Fäulnis und brünstigen Träumen roch. Sie waren dürr, die Sklaven des Quintus. In Lumpen gekleidet. Vier Männer, zahnlos von hartem Brot, mit krummen Rücken von endloser Plackerei auf steinigen Äckern. Und drei Frauen mit hängenden Brüsten und gebeugten Nacken.
Ohne auf die Sklaven zu achten, schritt Alba auf einen riesenhaften aus groben Brettern gezimmerten Tisch zu. Darauf trockenes Brot. Sie nahm, brach und reichte Locusta, die ihr folgte, eine Kante. Sie selbst enthielt sich der Nahrung.
Einer der Männer, der älteste vielleicht, weil er noch etwas gebückter ging als seine Leidensgenossen, trat schüchtern vor Alba. Rieb sich die Arme. Sah sie an. Lange und schamlos. Bis ihm Tränen in die Augen schossen. Er fiel auf die Knie. Er fasste den Saum ihres Gewandes. Schluchzte lautlos. Die Frauen steckten die Köpfe zusammen. Dann holten sie frisches Stroh. Stahlen es aus den Ställen der Pferde, die allein Liebe und Zuneigung ihres Herrn erfuhren. Sie machten ein Bett für die weiße Frau und das schwarze Kind. Sie würden für ihre Gastfreundschaft bezahlen müssen. Sie wussten es. Quintus würde sie schlagen. Seinen Zorn wegen ein wenig Stroh auf ihren Rücken zeichnen. Sie kümmerten sich nicht darum. Sie zupften das Lager zurecht. Sie zeigten. Sie waren verlegen. Ihre Hände waren rot und aufgesprungen. Gering war, was sie taten. Nicht würdig der sonderbaren weißen Frau, die in ihrer Mitte erschienen wie ein gutes Omen. Die zweifellos eine Gottgesandte, wenn nicht gar eine leibhaftige Göttin. Weiße Göttin aus dem Norden. Die ihr Glück wenden würde – sie fühlten die Nähe der Rettung wie Tiere eine Gefahr wittern. Sie zupften weiter und sie kicherten. Sahen einander mit lachenden Augen an. Scherzten. Es war lange her gewesen, dass sie Gelächter gehört. Ihr eigenes Gelächter. Leichtherzig und ungestüm sprudelte es aus ihnen. Und sie erschreckten ein wenig vor dem unbekannten Klang ihrer Stimmen, zuckten zusammen. Dann aber lachten sie wieder und begannen fröhlich zu schwatzen.
Der alte Sklave, dem die Tränen nicht aufhören wollten zu fließen, wischte sich die Augen trocken. Er rief seine Brüder zusammen. Er sprach zu ihnen. Sie sahen auf die Weiber. Sie wogen, sie durften hinter jenen nicht zurückstehen. Sie erbrachen die morsche Türe des Lagerhauses. Fanden einen Topf mit Linsen und etwas Speck. Sie nahmen auch eine Amphore mit Wein. Der Herr würde einen Preis für ihren Diebstahl fordern. Er würde seinen Unwillen auf ihre Rücken zeichnen. Das Knallen der Peitsche würde sein Gebrüll übertönen. Doch sie lachten. Sie kochten die Linsen und schnitten den Speck mit einem stumpfen Messer. Sie tranken aus der Amphore. Kleine Schlücke nur, obgleich ihr Durst und Begehren nach dem dünnen Getränk maßlos. Die Weiße sollte statt ihrer trinken. Und essen. Sie richteten den Tisch. Schafften Bänke herbei. Räumten Alba den Ehrenplatz am Kopf der Tafel ein.
Die Frauen richteten ihre Aufmerksamkeit endlich auch auf Locusta. Sie hatte im Abseits gewartet. Still. Wie ein Mäuschen. Auge und Ohr. An der harten Brotkante knabbernd. Nun aber streichelte man ihr schwarzes Haar. Und berührte ihre Stirn, ihre Hände, ihre Schultern. Küsste sie auf Wangen und Lippen. Die Frauen gingen über vor Liebe. Eine brachte ein geschnitztes Pferd. Eine unförmige Arbeit. Sie hatte das Ding hinter einem losen Stein in der Mauer versteckt. Sie bedeutete, es hatte ihrer Tochter gehört. Sie weinte lachend. Sie sagte, auch sie habe schwarzes Haar gehabt.
„Wo ist deine Tochter?“, fragte Alba, die den Reden der Frau gelauscht.
„Der Herr verkaufte unsere Kinder. Es waren schöne Kinder. Sie brachten einen guten Preis. Einen Säugling, der letztes Jahr geboren wurde, begrub er“, antwortete die Frau. Ihre Stimme bebte. Ihr Gesicht zuckte vor Schmerz. Schmerz eines Tieres. Ohnmächtiger Schmerz, der nie die Kraft finden würde, zum Zorn zu reifen. Schmerz der Sklaven. Lebende Dinge ohne Seele, ohne Schicksal, ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. Ein dumpfer Schmerz, sinnlos und ewig.
Man aß und trank. Man stahl mehr Wein. Man wurde lustig. Man vermengte Erinnerungen. An etwas Fernes, Vergangenes, das mit Alba zurückgekehrt zu sein schien. Man berauschte sich an der Idee, ein anderes Leben sei möglich. Was gewesen, mochte wiederkehren. Das Krumme gerade werden. Sie nannten einen der drei Namen, die den Römern Alpträume bereitete. Spartakus. Die anderen beiden waren Hannibal und Catilina. Eroberer, Aufrührer, Vernichter einer Ordnung, die Rom über alle Länder der Welt gebereitet. Catilina hatte Sklaven in seine Armee aufgenommen, ihnen Freiheit im Falle des Sieges zugesagt. Tod oder Freiheit. Die Rechnung war simpel. Auch Hannibal hatte Sklaven in seinen Reihen zugelassen. Euch wird gehören, was wir ihnen nehmen, hatte er gesagt. Sie waren gescheitert, diese drei. Aber ihr Sieg war möglich gewesen. Und war es noch immer.
„Was kann der Herr gegen uns ausrichten? Es sind vier von uns gegen zwei von ihnen, der Herr und sein Sohn. Die Köchin wird nichts tun als kreischen.“
Die Reden der Entrechteten wurden wilder, wagemutiger. Man vergaß die Anwesenheit der Gäste. Der Tag verblutete. Das Rot des Himmels spiegelte die Träume der Sklaven wider.
*
Quintus war noch immer im Haus. Redete mit dem Sohn. Redete auf ihn ein. Schalt ihn. Entwarf Pläne. Verwarf sie. Suchte den Weg nach Rom. Wohin alle Wege führen. Oder nicht. Der Sohn erwiderte wenig. Albas Name fiel gelegentlich. Er brachte sie als Variable in die Rechnungen des Vaters mit ein. Schuf ihm ein unlösbares Problem.
„Deine Hure ist schuld. Wie kann ich dich verheiraten, wenn du ein Liebchen hast? Wir sind arm. Alles, was du hast ist ein Name, deine Jugend und dein Quantum an Ruhm.“
„Alba...“
„Genug!“
Quintus sprang auf. Stürmte über den Hof. Stieß die Türe des Sklavenquartiers auf. Rot und fürchterlich stand er da. Und er war nicht ein Mann, sondern Tausend. Er war Rom. Die Macht, die die Götter über alle anderen Mächte erhoben. Die Frauen schrien auf und liefen auseinander. Verbargen sich in Ecken und Winkeln. Wie Mäuse, wie Ungeziefer. Die Männer blieben reglos sitzen. Ihre Augen waren weit und verzweifelt. Ihre Münder bebten. Ihre dürren Arme zitterten.
Quintus griff einen Stock. Wahllos schlug er um sich. Kopf, Schulter, Rippe, Schenkel. Er traf, was er traf. Er war gerecht, weil er ohne Ansehen der Person strafte. Er strafte Dinge. Er behauptete eine Ordnung. Er war der Herr. Der Stock, der schlug und zertrümmerte und zerquetschte, war der Beweis dieser ansonsten haltlosen Behauptung. Er gab ihm Recht. Schaffte Wahrheit, wo Zweifel geherrscht.
Auch Alba war geflohen. Langsamer als die anderen. Bedächtiger. Sie wähnte, der Stock war nicht für sie bestimmt. Und ihre zu jähe Flucht mochte sie in den Augen des Menschen einer Schuld überführen, die sie keinesfalls auf sich geladen. Doch als sie die Raserei des Quintus sah, wog sie, sie mochte sich geirrt haben. Sie schob Locusta hinter sich. Drängte sie weiter zurück. An eine Mauer. In eine Ecke. Wie Mäuse, Ungeziefer. Quintus Blick fand sie. Seine Augen waren blutunterlaufen. Er keuchte. Schweiß rann von seiner Stirn. Adern traten an Hals und Armen hervor. Er stürzte auf sie zu. Er schrie eine Beleidigung. Hure, Verführerin, Diebin. Er hob den Stock.
Plötzlich hielt er in der Bewegung inne. Wurde starr. Ließ den Stock sinken. Sein Gesicht verzog sich. Wurde zur grinsenden Fratze.
„Hure“, zischte er. „Hure, Hure. Hat mein Sohn seine Freude an dir? Ich kann es kaum glauben. Hexe, die du bist. Greisin im Leib einer jungen Frau.“
Er sah sie gierig an. Er trat dicht vor sie. Nahe. Er stank sauer. Nach Wein. Auch er hatte getrunken. Er fasste Alba in den Schritt, an die Brust. Er leckte ihre Wange. Sie rührte sich nicht. Sagte nichts. Sah ihn an. Ausdruckslos und stumm.
Er ließ erst ab von ihr, als er ein Geräusch hinter sich hörte. Schritte, die über den Hof huschten. Er wandte sich um. Marius stand in der Türe. Mit gezogenem Schwert.
„Du würdest deinen Vater für diese Hure töten?“ spottete Quintus.
Marius schwieg. Doch sein Blick war beredet. Die Klinge seines Schwertes war beredet.
Quintus schnaubte. Doch er ging. Trat einem Sklaven, der in seinem Weg kauerte, nochmals krachend in die Rippen. Als der Sohn ihm den Weg freigab, hielt er kurz inne. Stierte ihm in die Augen.
„Mutig bist du geworden“, sagte er leise und klopfte ihm auf die Schulter. „So mutig, dass du deinen Vater um eine Hure töten würdest. Immerhin.“
*
Alba schlief im Herrenhaus. Im Bett des Marius. Dessen Leben sie gerettet. Der in ihrer Schuld stand. Der sie liebte, still und innig und wider alle Vernunft. Locusta wurde ein Alkoven in der Küche zugewiesen. Nahe dem Herd, in dem eine Glut stets gütig glomm.
Die Herrin der Küche und einzige Sklavin, der neben Alba der dauerhafte Aufenthalt im Haus gestattet, war die Köchin des Quintus. Skythia nannte er sie. Ihre Herkunft war trotz des Namens zweifelhaft wie die Herkunft vieler Unfreier. Ihr Vater mochte ein sarmatischer Reiter gewesen sein, den das Unglück in römische Gefangenschaft geführt. Ein Mann mit geschlitzten Augen und hohen Wangenknochen. Sohn ferner Steppen. Braunhäutig. Ihre Mutter war eine syrische Köchin in den Diensten eines Beamten, der weitläufig mit Quintus verwandt, und von dem er sie vor vielen Jahren um einen guten Preis erstanden.
Skythia war rundlich, klein, mit pockennarbiger Haut, schmalen Augen und schwarzen, fettig glänzenden Haaren. Sie war stumpfsinnig, abergläubisch, aber gutmütig und meist bester Laune. Und sie liebte Locusta heiß und innig von dem Moment an, da diese die Küche zum ersten Mal betrat.
Sie klatschte in die Hände. Küsste Locusta. Und begann zu reden. Ein endloser Schwall lateinischer und syrischer Worte. Sie fütterte Locusta. Im Zubereiten und Verabreichen reichlicher Mahlzeiten zeigte sich ihre Liebe. Lachend schalt sie das Kind, das zu schmal in den Hüften. Und zwang Locusta Honigkuchen und Linsen und Kleie und eingelegten Fisch zu essen. In großen Mengen und mehrmals am Tag.
Locusta aß. Ohne Widerspruch, ohne Widerwillen. Sie blieb indes dürr. Die Nahrung verschwand in ihr wie in einem bodenlosen Abgrund. Skythias Liebe blieb ohne Effekt. Locusta Arme und Beine blieben knochig. Eine Verschwendung von Mehl und Honig und Öl und salzigen Fleisch, dass man dürrem Vieh von den Knochen gezogen. Sykthia schien sich am Misserfolg ihres Tuns nicht weiter zu stören. Lachend schalt sie und kochte immer weiter.
Manche Nacht kam Quintus in die Küche. Still lag Locusta in ihrem Alkoven, den Blick fest auf die rötliche Glut im Ofen gerichtet, während sie in der Dunkelheit auf Quintus schweren Atem und das verhaltene Kichern Skythias lauschte, mit dem die Köchin dem Antragen ihres Gebieters antwortete. Sie sprach einmal zu Skythia davon. Es war eine jener seltenen Gelegenheiten, bei der Locusta sich den Mühen einer längeren Konversation aussetzte. Sie fragte die Köchin also, was es mit den Besuchen auf sich habe. Sie wusste freilich von der Vereinigung der Geschlechter. Von der Nacktheit der Leiber. Vom Samen der Männer, der die Bäuche der Frauen mit Leben füllte. Sie wusste all das. Und doch blieb das seltsame Treiben ihr rätselhaft. Etwas schien ihr zu entgehen. Ihr Wissen war oberflächlich, musste es sein. Wie sonst war begreiflich, dass Männer und Frauen fast wahnsinnig an der Sehnsucht nach einander werden konnten. Und wurden. Oft waren Eifersucht und Begehrlichkeit der Anlass für blutige Streitereien im Lager gewesen. Alba hatte viele Lippen genäht und gebrochene Nasen gerichtet. Sie hatte auch die unerwünschten Folgen gedankenloser Affären mittels eines gewissen Kräutersuds zu beseitigen gewusst. All das wusste Locusta und wusste doch nichts von all dem.
„Was ist das, was der Herr und du machen?“, fragte sie Skythia eines Tages.
Skythia kicherte. Ihr Kichern klang ein wenig wie das Echo jenes nächtlichen Kicherns, das Locusta abscheulich und faszinierend fand. Das ihr Rätsel aufgab.
„Wir lieben einander.“
Locusta begriff nicht.
„Erklär es mir.“
„Ach“, rief Skythia schwärmerisch aus und schlug die Hände vor der gewaltigen Brust zusammen. „Er ist ein guter Mann. Fest und ausdauernd.“
Locusta begriff nicht. Sie schüttelte den Kopf.
Skythias weitere Erklärungen blieben vage und nutzlos. Sie suchte nach einer Rezeptur, einem genauen Verhältnis von ausgewählten und keineswegs zufälligen Bestandteilen, die ein Mittel mit spezifischer Wirkung hervorbringen mussten. Sie suchte nach einer einfachen und klaren Wahrheit in den endlosen Labyrinthen flüchtiger Herzen. Sie wiederholte ihre Frage mehrfach, bemühte sich andere Formulierungen zu finden, um jenes geheime Wissen, in dessen Besitz sie Skythia wähnte, jener zu entlocken. Es half nichts.
„Ach, die Liebe! Ein guter Mann.“
Nichts half. Locusta wurde ungeduldig, zornig. Warum? Warum? Ihre Wangen röteten sich und ihr Blick wurde hart und argwöhnisch.
Ratlos und mitleidig blickte Skythia das Kind an, die Hände nun in die fetten Hüften gestemmt, den Kopf ihrerseits schüttelnd: „Mädchen, warum fragst du nicht deine Mutter? Sie liebt den jungen Herrn. Und er liebt sie. Und einmal wirst du selbst lieben. Dann wirst du wissen, was und wie es ist. Ach, und es ist so schön. Das Schönste. Wer liebt, der wird heil.“
Ihre Mutter fragen! Wie hätte sie ihre Mutter je fragen können? Nach der Liebe, der Anziehung zwischen den Geschlechtern, dem unsichtbaren Band das Mann und Frau aneinander kettet? Alba hätte ihr keine Antwort gegeben, die ihre Neugier gestillt haben würde. Zu sehr war ihr eigenes Denken in den höheren Ordnungen der Naturkräfte verhaftet. Ihr Wissen war von anderer Art. Immateriell, allegorisch. Den Dingen zugehörig, die dem Blick entzogen. Doch Locusta sah und hörte und roch. Sah und hörte und roch Quintus und Skythia, ihren Schweiß, ihren Speichel, Samen und Ausfluss. Und sie verstand nicht und sie fühlte sich betrogen um etwas. Ahnte und griff ins Leere. Ins Dunkle. Und fühlte sich verloren, einsam.
*
Ins Dunkle gehen. Werden, wovor man sich ängstigt. Unbekannten Göttern sich als Opfer antragen.
Es war Winter geworden. Der Himmel lag grau und schwer auf dem Land. Kein Schnee fiel, keine Flocke. Nirgends. Nur Regen. Schwer und grau. Locusta vermisste den Schnee. Seine Reinheit und Klarheit, seine ehrliche Kälte. Sie hasste den Regen. Sie ging auf Streifzüge wie sie es in ihrer Heimat getan. Schritt aus ohne Ziel, gelenkt nur von Stock und Stein auf ihrem Weg. Wanderte in der Hoffnung, Fügung oder Zufall würden sie an heilige oder verfluchte Orte führen. Trollhöhlen, Verstecke, Klüfte, darin Knochen alter Götter aufgebahrt. Flüstern von Geistern in Borke und Fels. Doch nichts davon. Nur Regen und Schlamm und weiter Horizont. Dieses Land war ohne Geheimnis. Kein Wald, dicht und unergründlich, umgab die Handvoll der steinernen Gebäude, die ohne Wall und Mauer schutzlos und anmaßend zugleich auf der sanften Anhöhe hockten und das langweilige Nichts von Äckern, Weinbergen und Olivenhainen übersahen. Keine Berge, Täler, Moore, Bäche. Nur künstliche Reihen von verschnittenen Bäumen, gefurchte Äcker und zu Matsch gewordene Gärten. Ein einsamer alter Baum in einer unzugänglichen Senke und ein wilder Busch auf nutzlosem Grund – das war alles, was von der wilden Welt der Vorzeit übriggeblieben. Kein Ort, wo Unsterbliche gerne geweilt hätten. Locusta besah das Land des Quintus und urteilte: Es war schrecklicher als ein Schlachtfeld. Leer und tot. Nichts. Und sie sann: Die Bewohner dieses Landes waren Mörder und Zerstörer und Leichname und Gefangene dieser leeren und toten Welt, die sie selbst geschaffen.
Sie dachte an einen Mann, einen gefangenen Germanen, dem man erst die Augen ausgedrückt und danach die Ohren ausgebrannt. Um ihn einzuschließen in Finsternis und Stille. Ein Kerker aus dem kein Entrinnen möglich. Und sie erinnerte sich, wie der Mann, blind und taub, durch das Lager taumelte. Immer wieder fiel er unter dem Gelächtern vieler Männer und Frauen in den Schlamm. Und stöhnte. Und schlug sich auf den Kopf, auf die Stirn. Und Blut lief aus seinen Augenhöhlen und aus seinen Ohren und es verfing sich in seinem dunkelbraunen Bart und tropfte auf seine Brust und auf den Boden. Und Locusta erinnerte sich daran, wie er immer weiter ging, stolpernd und schluchzend, ins Leere vor sich greifend. Und sie dachte, dass jener durch eine große Leere und Düsternis ginge. Und fragte sich, ob sein Gedächtnis noch diese Düsternis und Leere mit alten Bildern füllte oder ob die Schwärze, schrecklich und vollkommen, das Land seiner Sinne schon beherrschte.
Es regnete an jenem Tag. Schwer und grau ruhte der Himmel über dem Land. Man führte den Mann aus dem Lager. Stieß ihn in die Richtung, aus der er tags zuvor mit seinen Brüdern gekommen, um zu morden und zu stehlen. Er fiel. Kroch auf allen Vieren weiter. Seine Finger