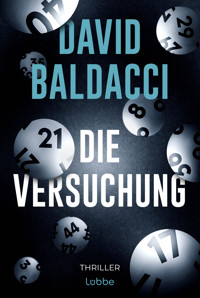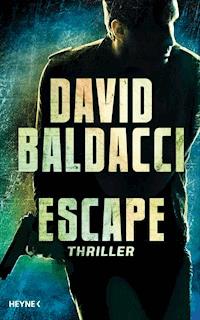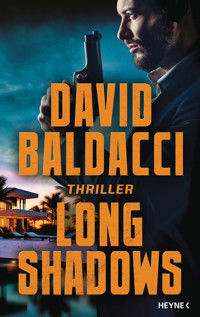
18,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Memory-Man-Serie
- Sprache: Deutsch
Amos Decker, der Memory Man, wird nach Florida gerufen, um einen grausigen Doppelmord aufzuklären: Opfer sind eine Bundesrichterin und ihr Bodyguard. Die berufliche Vergangenheit der Richterin sorgt für eine Fülle von Verdächtigen. Doch auch der tote Leibwächter gibt Decker und seiner neuen Partnerin, Special Agent White, Rätsel auf. Als Zeugen verschwinden, werden Decker und White immer tiefer in ein Labyrinth aus Geheimnissen und Verbrechen gezogen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
DASBUCH
Amos Decker steckt in einer Krise: Er hat einen tragischen persönlichen Verlust zu verkraften, zudem bringt ein medizinischer Routinetest ein besorgniserregendes Ergebnis. Dann wird er nach Florida gerufen, um in einem grausigen Mordfall zu ermitteln. Eine Bundesrichterin ist in einer bewachten Wohnanlage gemeinsam mit ihrem Bodyguard getötet worden. Der Richterin wurde post mortem eine zerstochene Augenbinde angelegt. Eine Anspielung auf die blinde Justizia? Über frühere Fälle der Richterin ergibt sich schnell eine Fülle von Verdächtigen: gewalttätige Gangmitglieder, Drogenhändler, Schmuggler … Oder stammt der Täter aus dem privaten Umfeld?
Der getötete Leibwächter gibt ebenfalls Rätsel auf. Ein Blick in seine Vergangenheit zeigt verdächtige Aktivitäten. War am Ende er das eigentliche Ziel des Killers?
Zu allem Überfluss muss der Memory Man mit einer neuen Partnerin ermitteln: Frederica »Freddie« White, die in vielerlei Hinsicht das Gegenteil von ihm zu sein scheint. Beide stehen sich äußerst misstrauisch gegenüber. Aber als die ersten Zeugen verschwinden und der Fall immer schrecklichere Dimensionen offenbart, sind Amos Decker und Freddie White zur Zusammenarbeit gezwungen, um das Schlimmste zu verhindern.
DERAUTOR
David Baldacci, geboren 1960 in Virginia, arbeitete lange Jahre als Strafverteidiger und Wirtschaftsjurist in Washington, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Sämtliche Thriller von ihm landeten auf der New-York-Times-Bestsellerliste. Mit über 150 Millionen verkauften Büchern in 80 Ländern zählt er zu den weltweit beliebtesten Autoren. »Long Shadows« ist nach »Memory Man«, »Last Mile«, »Exekution«, »Downfall«, »Flashback« und »Open Fire« der siebte Band seiner Bestsellerserie um Amos Decker.
DAVID BALDACCI
LONG SHADOWS
THRILLER
Aus dem Amerikanischen von Norbert Jakober
Die Originalausgabe LONGSHADOWS erschien erstmals 2022 bei Grand Central Publishing/Hachette Book Group, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2022 by Columbus Rose, Ltd.
Copyright © 2025 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
[email protected] (Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Redaktion: Wolfgang Neuhaus
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design
Umschlagabbildung: shutterstock/Stokkete
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-31636-5V002
Für Ginny und Bill Colwell, zwei ganz besondere Menschen. Ihr habt für viele Leute viel Gutes getan.
1
»Wer zum Teufel ist da?«, blaffte Amos Decker.
Er hatte lange nicht mehr so tief geschlafen, bis der Klingelton des Handys ihn unsanft weckte. Die Schlafstörungen waren schlimmer geworden, was seine Stimmungsschwankungen nicht besser machte. Ohne auf das Display zu schauen, ging er ran. In seinem Beruf konnte zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Anruf kommen – und nicht immer von jemandem, der auf seiner Kontaktliste stand.
»Ich bin’s, Amos. Mary Lancaster.« Ihre Stimme war leise und zittrig. »Erinnerst du dich an mich?«
Decker setzte sich steif im Bett auf und rieb sich das unrasierte Gesicht. Auf dem Display sah er, dass es drei Uhr war.
»Du weißt doch, dass ich kaum etwas vergesse. Wie wahrscheinlich ist es da, dass ich dich vergessen hätte, Mary?« Er klatschte sich auf die Wangen, um die Benommenheit zu vertreiben. Drei Uhr früh, verdammt noch mal. Dann erst wurde ihm bewusst, dass der Zeitpunkt des Anrufs ein Alarmsignal sein konnte.
»Stimmt was nicht, Mary?«, fragte er, plötzlich angespannt. »Warum bist du mitten in der Nacht auf?«
Mary Lancaster war Deckers ehemalige Partnerin beim Burlington Police Department in Ohio. Sie hatte erst vor einigen Monaten erfahren, dass sie an frühzeitiger Demenz litt. Ihr Zustand hatte sich kontinuierlich verschlechtert und nicht nur ihre Denkfähigkeit, sondern auch ihre psychische Verfassung beeinträchtigt.
»Alles in Ordnung. Ich konnte bloß nicht schlafen.«
Für Decker klang es ganz und gar nicht so, als wäre alles in Ordnung. Aber er hatte eine ganze Weile nichts mehr von Mary gehört. Vielleicht war zu ihren vielen Problemen die Schlaflosigkeit hinzugekommen.
»Das kenne ich.«
»Ich wollte nur mal wieder deine Stimme hören, Amos. Ich weiß nicht … es war mir einfach wichtig. Hat ein bisschen gedauert, bis ich den Mut hatte, dich anzurufen.«
»Da brauchst du keine Hemmungen zu haben. Du kannst dich jederzeit melden. Auch zu nächtlicher Stunde.«
»Danke, Amos. Die Sache ist die, dass ich mit der Zeit nicht mehr richtig klarkomme. Mit Tag und Nacht, morgens und abends. Das geht mir auch mit anderen alltäglichen Dingen so. Es ist alles furchtbar schwierig geworden, und das macht mir Angst. Mit jedem Tag … ist ein bisschen weniger von mir da …«
Decker seufzte. Ihre schonungslose Offenheit versetzte ihm einen Stich ins Herz. »Ich weiß, was du meinst, Mary.«
»Ich dachte mir schon, dass du mich verstehst.« Ihre Stimme war ein wenig fester geworden.
Decker lehnte sich an das knarrende Kopfbrett des Bettes, als bräuchte er eine Stütze, um sich für dieses unerwartete Gespräch zu wappnen. Er schaute sich im Halbdunkel seines kleinen Schlafzimmers um. Er wohnte schon seit einigen Jahren hier, doch das Apartment sah aus, als wäre er eben erst eingezogen oder als hätte er sich nur vorübergehend einquartiert.
Amos Decker arbeitete nach langer und wechselhafter Karriere in der Strafverfolgung als Berater für das FBI, nachdem er mit Anfang zwanzig ein vielversprechender College-Footballer gewesen war und eine dahingehende Karriere angestrebt hatte. Doch schon sein erstes Spiel bei den Profis hatte sein Leben für immer dramatisch verändert, als sein Gegenspieler ihn bei einem Bodycheck so schwer verletzt hatte, dass er ins Koma fiel und beinahe gestorben wäre. Decker überlebte, doch sein Gehirn hatte so schwere Schäden davongetragen, dass ein anderer Mensch aus ihm geworden war. Das brutale Foul hatte Hirnbereiche aktiviert, die Decker außergewöhnliche Fähigkeiten verliehen. Zum einen eine sogenannte Hyperthymesie, was nichts weniger bedeutete als ein nahezu perfektes Erinnerungsvermögen und ein fotografisches Gedächtnis; zum anderen eine Synästhesie, die sich darin äußerte, dass er Zahlen, Personen, Ereignisse und sogar Empfindungen mit bestimmten Farben verknüpfte. Das verhasste Stahlblau beispielsweise assoziierte er mit Leichen, Tod und Verfall.
Nach dem jähen Ende seiner Footballkarriere war er Cop geworden und hatte in seiner Heimatstadt zuerst als Streifenpolizist, später als Detective der Mordkommission gearbeitet. Deshalb war er von Berufs wegen schon oft mit dem Tod konfrontiert worden.
Im Polizeidienst hatten Decker und Mary ein erfolgreiches Team gebildet und dank Deckers Fähigkeiten Fälle aufgeklärt, an denen andere gescheitert wären. Für einen Ermittler mochte ein perfektes Gedächtnis ein willkommenes Geschenk sein, für den Menschen Amos Decker jedoch war es eine Bürde, denn für ihn konnte die Zeit keine der tiefen Wunden heilen, die das Leben ihm geschlagen hatte, und davon gab es reichlich. Im Gegenteil – manches wurde mit den Jahren nur noch schlimmer.
Inzwischen wohnte er in einem kleinen Apartment in Washington, D. C., in einem Haus, das seinem Freund Melvin Mars gehörte. Decker hatte Mars kennengelernt, als dieser in einem texanischen Gefängnis auf seine Hinrichtung wartete. Er hatte beweisen können, dass Mars den Mord, den man ihm zur Last legte, nicht begangen hatte. Für die zwanzig Jahre, die Melvin zu Unrecht im Gefängnis schmorte, war er mit einem stattlichen Betrag entschädigt worden. Einen Teil davon hatte er für den Kauf des Apartmenthauses aufgewendet, in dem Decker nun wohnte. Mars hatte erst kürzlich geheiratet und lebte mit seiner Frau in Kalifornien.
Deckers langjährige Partnerin beim FBI, Alex Jamison, war nach New York versetzt worden und mit einem Wall-Street-Investmentbanker liiert. Ross Bogart schließlich, der Mann, der Decker zum FBI geholt hatte und all die Jahre sein Vorgesetzter gewesen war, hatte sich in den Ruhestand nach Arizona zurückgezogen und verbrachte seine Zeit hauptsächlich mit Golfspielen – angeblich mit mäßigem Erfolg.
Decker war wieder mal allein. Er hatte immer damit gerechnet, dass es irgendwann darauf hinauslaufen würde; daher war ihm der Anruf Mary Lancasters willkommen, selbst mitten in der Nacht.
»Wie geht es dir, Mary? Sei ehrlich.«
»So lala«, sagte sie. »Jeder Tag ist eine Herausforderung.«
»Aber wenn ich dich so höre, kommst du gut klar.«
Mary lachte gequält auf. »Du meinst, ich bringe sogar noch zusammenhängende Sätze zustande? Na ja, die Medikamente helfen mir ein wenig dabei. Heute ist einer meiner besseren Tage. Normalerweise ist es … nicht so gut.«
Decker versuchte, das Thema zu wechseln. »Wie geht es Earl und Sandy? Ich nehme an, sie schlafen.« Er sprach von ihrem Mann und ihrer Tochter.
»Sie sind zu Earls Mutter nach Cleveland gefahren. Ihr geht’s nicht besonders. Wahrscheinlich lebt sie nicht mehr lange. Sie ist alt und gebrechlich und genauso wirr im Kopf wie ich.«
»Na, na. Für mich klingst du überhaupt nicht wirr im Kopf, Mary. Du klingst besser als beim letzten Mal.«
»Du konntest nie gut lügen, Amos.«
Decker kam ein plötzlicher Gedanke. »Moment mal. Wenn Earl und Sandy in Cleveland sind, wer ist dann bei dir? Die Betreuerin von damals?« Als er Mary das letzte Mal besucht hatte, war eine junge Frau bei ihr gewesen.
»Nein, niemand. Aber im Moment komme ich ganz gut zurecht, Amos. Auch allein.«
»Ich weiß nicht, Mary, das gefällt mir nicht.«
»Du brauchst dir keine Sorgen zu machen.«
Sie klang beinahe wie die alte Mary. Beinahe.
Trotzdem überkam Decker schlagartig ein ungutes Gefühl.
2
Decker schwang seine großen Füße auf den kalten Holzboden. »Weißt du was, Mary. Ich mach mich auf den Weg zu dir. Ich wollte dich sowieso mal wieder besuchen. Ist viel zu lange her.«
»Ja, es ist wirklich eine Weile her. Das alles hier dauert ohnehin schon viel zu lange … die Quälerei … für mich. Für alle.«
Decker richtete sich auf und schaute zum Fenster, von wo ihm die Lichter der Stadt träge zuzwinkerten. »Wie meinst du das, Mary? Ich fürchte, ich bin noch nicht ganz wach.« Doch er wusste, dass er log: Das Problem war, dass Mary in Rätseln sprach.
»Es ist furchtbar … mit meiner Verwirrtheit, meine ich. Ich hasse es.«
»Ich weiß, Mary. Und ich würde dir so sehr wünschen, dass du es nicht durchmachen musst.« Er hielt inne und versuchte, Worte des Mitgefühls zu finden. Früher, in der Zeit vor seinem Sportunfall, wäre ihm das nicht schwergefallen. Doch seit damals fehlte ihm in den meisten Situationen das Gespür, sich in andere Menschen hineinzufinden. »Wenn man es bloß heilen könnte.«
»Kann man aber nicht. Genauso wenig wie das, was du hast, Amos.« Es schien Mary ein wenig Trost zu spenden, dass es eine Gemeinsamkeit zwischen ihnen gab. Dass sie beide an einer Veränderung des Gehirns litten, die wiederum eine Veränderung ihrer Persönlichkeit bewirkt hatte, sodass ihrer beider Leben so sehr auf den Kopf gestellt worden war, dass sie aller Voraussicht nach daran sterben würden.
»Ja, in der Hinsicht sind wir uns ähnlich«, pflichtete Decker ihr bei.
»Trotzdem gibt es einen großen Unterschied«, entgegnete Mary in einem Tonfall, den er nicht von ihr gewohnt war. Sie klang auf seltsame Weise fest und entschlossen, wie ein Mensch, der sich von niemandem mehr etwas sagen ließ.
Decker wusste nicht, wie er darauf reagieren sollte, also schwieg er, saß auf dem Bett und lauschte ihren Atemzügen. In der einsetzenden Stille spürte er, wie sich irgendetwas zusammenbraute. Es fühlte sich an wie eine plötzliche, drückende Gewitterschwüle, bevor die ersten Blitze zuckten.
Decker wollte etwas sagen, doch Mary kam ihm zuvor.
»Verändert es dich immer noch?«, fragte sie.
Er wusste, was sie meinte. »Ich glaube schon. Andererseits verändert sich unser aller Persönlichkeit mit den Jahren, ob auf normale Weise oder nicht … was immer normal sein mag.«
»Aber du bist der Einzige, den ich kenne, der vielleicht verstehen kann, wie es mir geht.«
Er hörte ein klatschendes Geräusch, als würde sie sich selbst ins Gesicht schlagen, um das zu vertreiben, was sie nach und nach umbrachte. Verzweifelt suchte er nach Worten, um das Gespräch nicht abreißen zu lassen.
»Hast du nicht gesagt, dass du Therapiestunden nimmst, Mary? Mir hat es geholfen. Es würde auch dir guttun.«
»Ich habe eine Therapie gemacht, hab aber damit aufgehört.«
»Warum?«, fragte er mit wachsender Beunruhigung.
»Sie haben mir alles gesagt, was ich wissen musste. Danach wäre es nur noch Zeitverschwendung gewesen. Und ich habe keine Zeit zu verschwenden, keine einzige verdammte Sekunde.« Der Fluch hing in der Luft wie Pulverrauch nach dem Abfeuern einer Waffe.
Mit einem Mal fröstelte Decker. »Bitte, Mary, sag mir, was los ist. Ich spüre doch, dass irgendwas nicht stimmt.«
»Heute habe ich Sandy vergessen«, brach es aus ihr heraus, scharf wie ein Pistolenschuss. »Kurz bevor sie und Earl nach Cleveland gefahren sind. O Gott, Amos, ich habe meine eigene Tochter vergessen!«
»Es passiert jedem mal, dass man einen Namen vergisst, Mary«, erwiderte Decker beinahe erleichtert, denn mit etwas Ähnlichem hatte er gerechnet. Nicht aber mit dem, was Mary als Nächstes sagte.
»Ich habe nicht ihren Namen vergessen. Ich wusste nicht mehr, wer sie ist.« Es folgte eine längere Pause. Decker hörte ihr Atmen, dann einen Schluchzer, trocken und erstickt.
»Du meinst …«, setzte Decker an.
Sie sprach weiter, als hätte sie ihn gar nicht gehört. »Erst kurz bevor ich dich angerufen habe, ist mir wieder eingefallen, wer sie ist. Und das auch nur, weil ich auf ein Foto mit ihrem Namen geschaut habe. Ich hatte vergessen, dass ich eine Tochter habe, Amos. Eine Zeit lang gab es für mich keine Sandy Lancaster mehr. Kannst du dir vorstellen, wie furchtbar das ist?«
Er glaubte die Tränen zu sehen, die ihr über die Wangen liefen.
»Ich war kurz davor, sie für immer zu verlieren. Mein eigenes Kind, Amos.«
»Ich komme zu dir, Mary. Du solltest jetzt nicht allein sein. Ich verstehe nicht, dass Earl weggefahren ist, ohne …«
Sie ließ ihn nicht ausreden. »Earl weiß nicht, dass ich alleine bin. Er hätte es niemals zugelassen. Er achtet immer sehr darauf, dass jemand bei mir ist.«
Decker erhob sich vom Bett und stand starr vor Sorge da. Als Mary fortfuhr, klang ihre Stimme beinahe triumphierend. Er spürte, wie ihm der kalte Schweiß ausbrach.
»Und jetzt bist du ganz allein? Ist die Betreuerin vom letzten Mal nicht da?«
»War sie, aber ich habe sie nach Hause geschickt.«
Er konnte es nicht glauben. »Was hast du zu ihr gesagt? Sie hätte dich nie allein gelassen …«
»Ich habe eine Waffe, Amos. Meine alte Dienstpistole. Ich habe sie lange nicht mehr hervorgeholt, aber sie liegt immer noch gut in der Hand. Ich konnte mich sogar an die Kombination des Waffentresors erinnern – ist das nicht unglaublich? Und das, nachdem ich fast alles vergessen habe. Ich glaube, das muss … ein Omen sein.«
Jeder Muskel in Deckers Körper spannte sich an. »Warte, Mary. Tu nichts Unüberlegtes.«
»Kaum hatte ich die Pistole auf sie gerichtet, war sie aus der Tür raus. Das war eben erst, kurz bevor ich dich angerufen habe. Ich hab sie mit der Waffe in der Hand geweckt. Du glaubst nicht, wie schnell jemand wach ist, wenn er in die Mündung einer Pistole schaut.«
Decker war plötzlich so wach wie nie zuvor in seinem Leben. Er schaute sich verzweifelt um, als suchte er in den Schatten nach den richtigen Worten. »Hör zu, Mary, leg die Waffe weg. Bitte. Dann setz dich hin, mach die Augen zu und atme tief durch. Ich schick dir in zwei Minuten jemanden vorbei. In einer Minute. Nur eine Minute, dann ist jemand da, der dir hilft. Bleib dran, hörst du? Ich mache nur einen kurzen An…«
Sie hörte gar nicht zu. »Ich habe meine Tochter vergessen. Ich habe Sandy vergessen.«
»Ja, aber dann hast du dich wieder an sie erinnert. Nur das ist wichtig. Das ist … du musst …«
Decker fasste sich an die Brust. Sein Atem ging schwer, und sein Herzschlag dröhnte ihm in den Ohren. Er spürte ein Stechen in der Seite, als wäre er eine lange Strecke gerannt, obwohl er keinen Schritt getan hatte. Übelkeit stieg in ihm auf, und die Knie wurden ihm weich. Er fühlte sich hilflos, ohnmächtig.
Er überlegte fieberhaft. Die Betreuerin hatte wahrscheinlich die Polizei verständigt. Bestimmt war schon jemand unterwegs.
»Was wird morgen sein?«, riss Mary ihn aus seinen Gedanken. »Werde ich mich morgen noch an Sandy erinnern können? Oder an Earl? An dich? Oder an … mich selbst? Kann man so leben? Kannst du mir das sagen?«
»Mary, hör zu …«
»Sie hat so geweint, mein Mädchen. ›Mommy kennt mich nicht mehr‹, hat sie gesagt. Sie war furchtbar traurig, so todunglücklich, dass ich sterben wollte. Ich habe ihr das angetan. Meinem kleinen Mädchen. Wie kann man jemandem, den man liebt, so wehtun?« Ihr Tonfall war so hart, so vernichtend, dass ihm das Blut in den Adern gefror.
»Bitte, Mary, hör mir zu. Alles wird wieder gut. Ich helfe dir. Aber zuerst musst du die Pistole weglegen. Jetzt. Sofort.« Decker stützte sich an der Wand ab. Er stellte sich die Waffe in Marys Hand vor. Vielleicht starrte sie auf die Pistole und überlegte, was sie tun sollte.
Der Boden unter seinen Füßen schien zu schwanken, als wäre er auf einem Schiff auf stürmischer See. Er suchte nach den richtigen Worten, um sie von dem Abgrund wegzuziehen, an dem sie stand. Um sie dazu zu bringen, die kleine Automatikpistole wegzulegen, mit der sie, wie er wusste, als Polizistin mindestens einen Menschen erschossen hatte.
Decker überlegte fieberhaft. Wenn er die richtigen Worte fand, würde die bedrohliche Situation sich in Luft auflösen. Er wollte etwas sagen, irgendetwas, wollte Mary überzeugen, Hilfe anzunehmen. Plötzlich glaubte er zu wissen, wie er sie überreden konnte, die Waffe wegzulegen.
Doch bevor er auch nur ein Wort hervorbrachte, hörte er das Geräusch, von dem er sehnlichst gehofft hatte, es niemals hören zu müssen.
Den peitschenden Knall eines Schusses, der – wie er Mary Lancaster kannte – mit größter Sorgfalt und Präzision abgefeuert worden war. In die Schläfe, unter das Kinn oder in den Mund. Jede dieser Optionen würde den Zweck erfüllen.
Dann der dumpfe Aufprall, als Marys Körper zu Boden fiel.
Decker wusste, dass sie tot war. Mary hatte immer ganz genau gewusst, was sie tat, hatte immer konsequent und zielgerichtet gehandelt. Eine Frau wie Mary Lancaster würde genauso effizient handeln, wenn es darum ging, sich das Leben zu nehmen.
»Mary? Mary!«, brüllte er ins Handy. Als keine Antwort kam, verpuffte seine Energie.
Warum schreist du noch? Sie ist tot. Das weißt du doch.
Er lehnte sich an die Wand, ließ seinen massigen Körper zu Boden sinken. Und verharrte so reglos wie Mary Lancasters Leichnam in ihrer Wohnung.
Doch er war am Leben. Auch wenn ihm der Unterschied in diesem Augenblick nicht viel bedeutete. Er saß in seinem kleinen Zimmer, das plötzlich in das verhasste stahlblaue Licht des Todes getaucht war, dessen Schimmer er über tausend Meilen hinweg zu sehen glaubte.
Vor vielen Jahren war Decker selbst einmal drauf und dran gewesen, den Abzug einer Pistole zu drücken, deren Lauf er sich in den Mund geschoben hatte.
Doch anders als Mary war er ins Leben zurückgekehrt. Und mit ihrem Tod war auch in ihm etwas gestorben.
3
Asche zu Asche, Staub zu Staub.
So endete es jedes Mal. Mit salbungsvollen Sprüchen und einer Grube, die mit Erde zugeschüttet wurde.
Alles Gelaber, dachte Decker voller Bitterkeit.
Decker, der sich normalerweise nur in Jeans oder einer zerknitterten Khakihose und einem weiten Sweatshirt wohlfühlte, stand im Anzug vor der Grube, die als ewige Ruhestätte für den Sarg mit Mary Lancasters sterblichen Überresten vorgesehen war.
Es war ein kalter, verregneter Tag in Ohio, ein für diese Gegend ganz normales Frühlingswetter. Hier gab der Winter sich nicht so schnell geschlagen und haftete wie ein taufeuchtes Spinnennetz an einer vereisten Fensterscheibe. Es war eine große Trauergemeinde, die sich auf dem Friedhof versammelt hatte. Earl und Mary Lancaster waren bekannt und beliebt, und Sandy hatte viele Freundinnen in ihrer Schule. Decker sah nicht wenige ehemalige Kollegen von der örtlichen Polizei, ihre düsteren Blicke zu Boden gerichtet.
Alex Jamison war dienstlich unterwegs und hatte nicht kommen können, hatte aber eine Beileidskarte geschickt; ebenso Ross Bogart, zusammen mit einem Blumenstrauß. Sie hatten Mary nicht allzu gut gekannt; trotzdem wäre Decker froh gewesen, wenn sie es hätten einrichten können, zur Beerdigung zu erscheinen. Normalerweise war er lieber für sich, doch heute hätte er ein paar vertraute Gesichter zu schätzen gewusst.
Der Sarg war geschlossen. Mary hatte sich mit einem Schuss in den Mund das Leben genommen; es kam nicht infrage, sie den Hinterbliebenen so zu zeigen.
Decker schaute zu Earl Lancaster, der aschfahl, alt und verloren aussah. Er hielt die Hand seiner Tochter Sandy, die mit dem Downsyndrom geboren war und besondere Aufmerksamkeit benötigte. Ihre Blicke huschten hin und her, während sie die Welt auf ihre Weise wahrnahm. Decker bezweifelte, dass ihr die Endgültigkeit des Todes so richtig bewusst war. Vielleicht ein Segen, dachte er. Natürlich würde sie ihre Mutter bald vermissen und sich fragen, wann sie zurückkommen würde. Decker beneidete ihren Vater nicht um die Aufgabe, dem Mädchen erklären zu müssen, was geschehen war. Dafür gab es kein Rezept, keine angemessenen Worte. Trotzdem musste man es versuchen; das Mädchen hatte ein Recht auf eine Erklärung.
In diesem Augenblick schaute Sandy zu Decker herüber, löste sich von der Hand ihres Vaters und lief zu ihm. Sie sah zu dem hünenhaften Mann auf, und ihr Gesicht leuchtete inmitten der Düsternis.
»Du bist Amos Decker«, sagte sie freudig.
Es war ein kleines Spiel, das Sandy irgendwann erfunden hatte. Und Decker antwortete immer auf die gleiche Weise, auch wenn es ihm diesmal nicht leichtfiel.
»Weiß ich. Und du bist Sandy Lancaster.«
»Weiß ich«, gab sie lächelnd zurück.
Kaum hatte sie ausgesprochen, verdüsterte sich Deckers Miene bei der Erinnerung an Marys Worte, und er schloss die Augen.
Ich hatte vergessen, dass ich eine Tochter habe, Amos. Eine Zeit lang gab es für mich keine Sandy Lancaster mehr.
Für Mary war es die schlimmste denkbare Sünde, ihre eigene Tochter zu vergessen. Decker war überzeugt, dass dies letztlich der Grund gewesen war, weshalb sie den Abzug gedrückt hatte.
Er spürte ein Ziehen an der Hand, öffnete die Augen und sah, wie Sandys kleine Hand sich um seine langen, dicken Finger legte.
»Amos Decker?« Sie musterte ihn eindringlicher, als ihm lieb war. Aus irgendeinem Grund wusste er, was sie ihn gleich fragen würde. Einen Moment lang stieg Panik in ihm auf. »Wo ist meine Mommy? Da sind so viele Leute. Siehst du Mommy irgendwo? Ich muss mit ihr reden.«
Decker hatte Sandy noch nie belogen, kein einziges Mal. Er brachte es auch jetzt nicht fertig, also schwieg er.
»Sandy!« Earl kam herbeigeeilt und nahm seine Tochter an der Hand. »Sorry, Amos.«
Decker machte eine resignierte Geste, drehte sich zur Seite und wischte sich die Tränen aus den Augen. Dann beugte er sich zu Earl und flüsterte ihm ins Ohr, sodass Sandy es nicht hören konnte.
»Es tut mir schrecklich leid.«
Earl legte die Hand auf Deckers Arm. »Danke. Äh … wir treffen uns hinterher noch bei uns zu Hause. Ich hoffe, du kommst auch. Mary hätte es sich gewünscht.«
Decker nickte, obwohl er nicht vorhatte, hinzugehen. Earl schien es ihm anzusehen und sagte: »Es hat mich jedenfalls gefreut, dass du gekommen bist.«
Decker schaute zu Sandy, deren Blick immer noch auf ihn geheftet war. Ihr Gesicht schien auszudrücken, dass sie sich betrogen fühlte; vielleicht war es aber auch nur sein schlechtes Gewissen, das er auf sie projizierte.
Earl drehte sich zu ihm und sagte leise: »Ich habe von der Polizei erfahren, dass Mary dich angerufen hat. Danke, dass du alles versucht hast, sie davon abzuhalten, dass sie …« Seine Stimme verebbte.
»Ich wollte, ich hätte mehr tun können.«
»Ich weiß.«
Decker sah den beiden nach, als sie zu dem Auto gingen, das vom Bestattungsunternehmen bereitgestellt worden war. Die Trauergäste verliefen sich nach und nach. Einige nickten ihm im Vorbeigehen zu, ein trauriges Lächeln auf den Lippen, doch keiner kam direkt auf ihn zu. Sie kannten ihn nur zu gut.
Dann war Decker allein. So wie es ihm am liebsten war.
Als die Friedhofsarbeiter den Sarg hinunterließen, wandte er sich ab und schlurfte bedrückt zwischen den Gräbern hindurch, bis er zu einem bestimmten Platz unweit eines Baumes gelangte. Er hätte kein unfehlbares Gedächtnis gebraucht, um die Stelle zu finden. Sein trauerndes Herz hätte das Ziel auch so gefunden. Es war jedes Mal ein schwerer Weg für ihn. Wie hätte es auch anders sein können.
Cassandra Decker. Molly Decker. Mutter und Tochter. Seine Frau, sein Kind. Die Liebe seines Lebens, sein Fleisch und Blut – für immer entrissen durch die Hand eines Mörders. Die Blumen, die er bei seinem letzten Besuch auf die Gräber gelegt hatte, waren längst verwelkt und verrottet, so wie die Leichen unter der Erde. Er wischte die Überreste weg und kniete sich vor die Gräber.
Einmal, bei einem von Deckers Friedhofsbesuchen, war ein gewisser Meryl Hawkins auf ihn zugekommen und hatte Gerechtigkeit von ihm verlangt. Es war um Deckers ersten Fall als Detective der Mordkommission gegangen. Er hatte die Herausforderung angenommen und den Fehler wiedergutgemacht, der ihm einst als junger Polizist unterlaufen war. Hawkins war letztlich Gerechtigkeit widerfahren, wenn auch viel zu spät. Als Decker den Fall aufgeklärt hatte, war der Mann bereits tot.
Decker hatte auch den Mörder seiner Frau und seiner Tochter aufgespürt.
In beiden Fällen hatte er die Täter zur Rechenschaft gezogen, doch es war ein schaler Triumph, der die Opfer nicht ins Leben zurückholen konnte. Die Genugtuung, die Wahrheit herausgefunden zu haben, blieb überschattet von einem Verlust, der niemals wettzumachen war.
Er richtete ein paar Worte an seine Frau und seine Tochter; dann erhob er sich vom kalten Boden und schaute zur Seite. Links neben den beiden Gräbern war ein freier Platz.
Meiner.
Mehrere Male hatte nicht viel gefehlt, dass Decker hier geendet wäre. Einmal hätte er beinahe selbst dafür gesorgt, als er vor seiner ermordeten Tochter stand, die Waffe schussbereit auf sich selbst gerichtet.
Wird mein perfektes Gedächtnis mich eines Tages im Stich lassen? Werde auch ich vergessen, dass ich je eine Tochter hatte?
Er hatte die Telefonverbindung noch nicht getrennt, als die Polizei in Mary Lancasters Haus eingetroffen war. Zuerst hatte er mit einem Streifenpolizisten, dann mit dem zuständigen Detective gesprochen, den er noch von seiner Zeit in Burlington kannte. Sie hatten beide den Verlust der Kollegin betrauert, ihre Entscheidung jedoch – wenn auch widerstrebend – nachvollziehen können.
Decker ging zu seinem Mietwagen. Morgen früh würde er zurück nach Washington, D. C., fliegen. Er hatte keine Ahnung, was ihn dort erwartete.
Die Wahrheit war, dass es ihn auch kaum noch interessierte.
4
Der Brief, der zu Hause auf Decker wartete, kam vom Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Chicago.
Decker war letzten Monat dort gewesen, um ein paar Routinetests durchführen zu lassen, so wie jedes Jahr seit seiner schweren Hirnverletzung.
Decker stellte den Koffer neben der Wohnungstür ab und riss den Brief mit seinen dicken Fingern auf. Zu seinem Erstaunen war er mehrere Seiten lang. Normalerweise fassten sie sich deutlich kürzer, was daran lag, dass sie ihm kaum etwas Neues mitzuteilen hatten. Diesmal schien es anders zu sein.
Er setzte sich und las den Brief zweimal, obwohl der Inhalt sich ihm schon beim ersten Lesen eingeprägt hatte.
Dann zerriss er die Seiten in mehrere Streifen und warf sie in den Abfalleimer.
Okay, was soll’s.
Sein Handy summte. Er rief die Nachricht auf und stöhnte.
Sein Vorgesetzter beim FBI forderte ihn auf, unverzüglich ins Washington Field Office zu kommen.
Decker warf einen letzten Blick auf den zerrissenen Brief im Abfalleimer; dann schnappte er sich den Autoschlüssel und ging zur Tür.
*
»Amos Decker – Ihre neue Partnerin, Special Agent Frederica White«, sagte John Talbott mit der Stimme eines Spielshow-Moderators, der den Hauptgewinn verkündete.
Der hünenhafte Decker schaute auf die eins sechzig große dunkelhäutige Frau hinunter – und sie zu dem Berg auf, der sich vor ihr auftürmte. Es war schwer zu sagen, wer von ihnen überraschter dreinschaute.
»Neue Partnerin?« Decker blickte zu Talbott, der Ross Bogarts Posten übernommen hatte. »Ich habe nicht um eine neue Partnerin gebeten. Alex …«
»Special Agent Jamison kommt nicht zurück, jedenfalls nicht so bald. Deshalb haben wir Agentin White aus Baltimore kommen lassen. Sie wird von nun an mit Ihnen zusammenarbeiten.«
White starrte Decker immer noch an. Ihr Gesichtsausdruck war schwer zu deuten. Sie war Mitte dreißig, schlank und drahtig und brachte höchstens fünfzig Kilo auf die Waage. Ihr vorschriftsmäßig geschnittenes karamellbraunes Haar wurde von zwei Schildpatt-Haarspangen im Zaum gehalten.
Decker bemerkte das kleine Loch im linken Nasenflügel, das für ein Piercing gedacht war. Die FBI-Vorschriften erlaubten keinen derartigen Körperschmuck im Dienst. Am Ende der rechten Jackenmanschette war eine grüne Verfärbung auf der Haut zu erkennen.
Eine Tätowierung.
Dank ihrer Reißverschlussstiefel verringerte White den Größenunterschied zwischen ihnen beiden auf etwa dreißig Zentimeter. Vielleicht hätte sie Stöckelschuhe getragen, hätte es nicht gegen die Vorschriften verstoßen. Solche Freiheiten durften sich höchstens Agentinnen in Fernsehserien herausnehmen. White trug außerdem eine schwarze Jacke und Hose, dazu ein weißes, bis oben zugeknöpftes Hemd. Kein Ausschnitt – auch das ein Gegensatz zur Aufmachung mancher TV-Polizistinnen. White hatte schmale Lippen, grüne, funkelnde Augen mit dunklen Brauen, eine scharf geschnittene Nase, hohe Wangenknochen und ein markantes Kinn. Eine Frau mit Ecken und Kanten.
»Wenn Sie sich die Hände schütteln möchten …«, schlug Talbott vor.
Beide ignorierten die Aufforderung, standen einfach nur da und beäugten einander misstrauisch.
Talbott, ein Mann, der nur noch auf seine Pensionierung wartete, grinste breit und sagte mit aufgesetzter Heiterkeit: »Dann lasse ich Sie beide mal allein, damit Sie sich kennenlernen können.«
Die Tür schloss sich hinter ihm.
»Nur damit Sie’s wissen – ich hab mir das nicht ausgesucht«, stellte White klar.
»Warum sind Sie dann hier?«
Sie musterte ihn mit gehobenen Augenbrauen. Ihr durchlöcherter Nasenflügel bebte vor mühsam unterdrückter Energie, vielleicht auch Zorn.
»Mir war nicht bewusst, dass es meine Entscheidung ist. Immerhin bezahlt das FBI mein Gehalt. Und dass ich mit Ihnen zusammenarbeiten soll, habe ich erst vor ungefähr dreißig Sekunden erfahren.«
»Dann haben wir etwas gemeinsam«, erklärte Decker. »Es ist nur so, dass ich nicht mit einer neuen Partnerin zusammenarbeiten will.«
»Dann sind Sie also in der Position, das zu entscheiden?«, entgegnete sie.
»Ich fürchte nein.«
»Ich kenne Alex Jamison. Sie ist eine gute Agentin. Sie hat mir einiges über Sie erzählt.«
»Ach? Vor ein paar Augenblicken haben Sie noch gesagt, Sie hätten eben erst erfahren, dass Sie mit mir zusammenarbeiten würden.«
»Sie sind nun mal kein Unbekannter im Bureau, Decker. Einen wie Sie gibt es wahrscheinlich kein zweites Mal beim FBI.«
»Was hat Jamison Ihnen gesagt?«
»Das war vertraulich. Man nennt mich übrigens Freddie.«
»Okay, war’s das dann mit dem Kennenlernen? Mir genügt es jedenfalls.«
»Kein Problem. Aber wenn wir hier rausgehen, wird Talbott wahrscheinlich vorschlagen, dass wir zusammen essen sollen oder so etwas. Ich schätze, Sie werden nicht gerade scharf darauf sein.«
Decker trat ans Fenster und schaute hinaus in den bewölkten Tag und zum trüben Himmel empor. Seine Gedanken waren nicht minder trüb. Er hasste Veränderungen, wurde in diesen Tagen aber ständig damit konfrontiert. Obendrein waren es Veränderungen der unerfreulichen Art. Nun hatte er die Wahl, das FBI zu verlassen oder sich mit einer neuen Partnerin namens Frederica oder »Freddie« abzufinden. Welches Szenario wäre schlimmer? Er wusste es nicht.
»Ich habe gehört, was mit Ihrer ehemaligen Partnerin in Ohio passiert ist. Das ist eine Tragödie. Mein Beileid«, sagte White. Es klang aufrichtig.
»Mary war eine gute Polizistin. Sie hätte etwas anderes verdient gehabt.«
»Wer hat so etwas schon verdient.«
»Da würden mir einige Leute einfallen.«
»Möchten Sie irgendwas über mich wissen?«
Er drehte sich zu ihr um, nun doch ein klein wenig neugierig. »Okay, erzählen Sie ein bisschen was von sich.«
»Ich bin geschieden, habe zwei Kinder. Meine Mutter lebt bei uns und hilft mir, sich um die beiden zu kümmern. Ich bin in Philly aufgewachsen, habe eine Schwester und hatte drei Brüder.«
»Sie hatten?«
»Ein Bruder ist bei einer Schießerei zwischen zwei verfeindeten Gangs gestorben, der zweite sitzt im Gefängnis, wahrscheinlich, bis er alt und grau ist. Mein ältester Bruder ist Anwalt und arbeitet als Pflichtverteidiger in Boston. Meine Schwester hat eine Technologiefirma und wohnt in einem Haus in Palo Alto, das mehr wert ist, als ich in meiner ganzen Laufbahn verdienen werde.«
»Sind Sie immer so auskunftsfreudig gegenüber Fremden?«
»Sie sind mein Partner. Das heißt, ich muss mich auf Sie verlassen können. Und Sie sich auf mich. Okay, um die Liste meiner persönlichen Highlights zu vervollständigen – ich war zuerst auf der Howard University und habe meinen Master an der Georgetown gemacht. Beim Bureau habe ich vor dreizehn Jahren angeheuert. Ich habe bisher zweimal im Dienst meine Waffe benutzt. Ich bin klein, kann mich aber gut wehren. Ich habe den schwarzen Karategürtel – nicht weil ich Kampfsport so toll finde, sondern weil ich es hasse, mir in den Hintern treten zu lassen. Ich habe null Toleranz gegenüber Idioten, Faulheit und dummem Gequatsche. Leider begegnet mir im Bureau viel mehr davon, als mir lieb ist. Und ich weiß immer gern, woran ich bin. Nur so kann ich als farbige Frau in diesem Umfeld bestehen und dafür sorgen, dass es meiner Familie gut geht. Das ist für mich das Allerwichtigste.«
»Wie alt sind Ihre Kinder?«
»Neun und zwölf. Tochter und Sohn. Calvin ist nach meinem Vater benannt. Meine Tochter heißt Jacqueline, wird aber nur Jacky genannt.«
»Teilen Sie sich das Sorgerecht mit Ihrem Ex?«
»Ich war noch mit Jacky schwanger, als mein Verflossener darauf kam, dass Ehe und die Vaterrolle doch nichts für ihn sind. Ich habe das alleinige Sorgerecht. Calvin erinnert sich gar nicht an seinen Vater, und das ist verdammt gut so.«
»Wohnen Sie noch in Baltimore?«
»Ich habe bis heute früh in Baltimore gearbeitet.«
»Haben Sie vor, hierherzuziehen?«
»Sofern ich es mir leisten kann, ja. Was aber wohl nie der Fall sein wird, wenn ich nicht im schäbigsten Viertel leben will. Also warte ich erst einmal ab. Manchmal ist so eine Versetzung ja nicht von Dauer.«
»Ja, das kommt vor.« Decker sprach ein stilles Gebet, dass es auch diesmal so sein würde.
»Und Sie?«
»Was ist mit mir?«, fragte Decker.
»Haben Sie über sich auch etwas mitzuteilen?«
»Wenn Sie mit Alex geredet haben, wissen Sie wahrscheinlich alles, was Sie über mich wissen müssen.«
»Niemand kann es so gut mitteilen wie die betroffene Person selbst.«
»Ich habe aber nichts Gutes zu sagen – nicht über mich und auch nicht über sonst jemanden.«
White steckte die Bemerkung weg und konterte gedankenschnell. »Wissen Sie, dass Sie kleiner sind, als ich dachte?«
Er schaute auf sie hinunter. »Ich bin eine Wand – aber keine, an die man sich anlehnen kann.«
»So wie Alex von Ihnen geredet hat, hätte man denken können, dass Sie drei Meter groß sind und dreihundert Kilo schwer. So gesehen wirken Sie fast mickrig. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber was soll’s. Können wir loslegen, Partner?«
Decker antwortete gewohnt unverblümt. »Klar, auch wenn’s mich im Moment keinen Deut interessiert.«
»Sind Sie immer so zu den Leuten, mit denen Sie zusammenarbeiten?«
»Zu Anfang ja.«
»Dann hoffe ich, dass wir den Anfang bald hinter uns haben.«
Decker musterte sie einen Augenblick. »Ich bin überzeugt, dass Sie eine gute Agentin sind. Ich habe nichts gegen Sie. Aber Veränderungen sind nun mal nicht mein Ding. Und ich hatte in meinem Leben mehr davon als die meisten Leute.«
Sie blickte zu ihm auf. »Sie waren mal Footballspieler, hab ich gehört. Bei den Cleveland Browns, nicht wahr? Ich hasse die Browns. War immer schon ein Fan der Philadelphia Eagles. Die Baltimore Ravens mag ich auch nicht, nur hab ich sie leider dauernd vor der Nase.«
»Football interessiert mich nicht mehr besonders.«
Sie beäugte ihn ein paar Sekunden nachdenklich. »Kann ich verstehen.«
Die Tür ging auf, und Talbott kam herein. Er wirkte mit einem Mal sehr ernst. Von dem Gute-Laune-Gesicht, das er zuvor gezeigt hatte, war nichts mehr zu sehen.
»Sie beide haben Ihren ersten Fall. Sie werden sofort nach Florida aufbrechen.«
»Was ist passiert?«, wollte Decker wissen.
»Eine Bundesrichterin und ihr Bodyguard. Beide tot.«
5
»Gott sei Dank gibt es Mütter«, meinte White, die im Flugzeugsitz neben Decker wie verloren wirkte. »Wer sonst würde so kurzfristig aushelfen?«
»Ihre Mutter kümmert sich um die Kinder, wenn Sie unterwegs sind?«
»Ja. Anders könnte ich den Job nicht machen. Kinderbetreuung ist sauteuer, sofern man überhaupt jemanden findet. Zum Glück ist Mom sehr jung Mutter geworden und hat noch jede Menge Energie.«
»Fünf Kinder lassen einen schnell altern.«
»Sie war stellvertretende Direktorin an der Schule, die wir alle besucht haben. Mein Dad war Cop in Philly und hat nie viel verdient.«
»Ist er im Ruhestand?«
»Er ist im Dienst gestorben.«
»Das tut mir leid.«
»Meine Mutter hat eine größere Entschädigung von der Stadt bekommen.«
»Warum das?«, fragte Decker neugierig.
»Weil der Typ, der ihn erschossen hat, auch ein Cop war, dem die Hautfarbe meines Dad nicht gepasst hat. Das Department wollte es vertuschen und als Unfall hinstellen. Das war vor zwanzig Jahren. Damals war ich noch auf der Highschool.«
»Die Gesellschaft entwickelt sich nicht immer zum Besseren. Manchmal geht es auch wieder ein paar Schritte zurück.«
»Das hätte ich jetzt nicht von Ihnen erwartet.«
»Warum?«, fragte er.
»Ich weiß nicht. In unserem Umfeld sehen es wahrscheinlich nicht viele so.«
Nachdem der Jet abgehoben hatte, fragte White: »Haben Sie die E-Mail gelesen, die sie uns über die Vorfälle in Florida geschickt haben?«
Decker nickte.
»Was halten Sie davon?«
»Im Moment habe ich noch keine Meinung dazu. Was wir haben, ist nur eine Darstellung der Fakten in einer E-Mail, die von jemandem kam, den ich nicht kenne. Ich muss mir selbst ein Bild machen.«
»Für mich deutet einiges darauf hin, dass der Täter aus dem näheren Umfeld des Opfers kommt. Er muss Dinge gewusst haben, die er nicht hätte wissen dürfen.«
»Ich glaube, Sie sind ein bisschen vorschnell mit Ihren Annahmen.«
»Was genau meinen Sie?«
»Sie gehen davon aus, dass es nur ein Täter war. Und ein Mann.«
»Das war ganz allgemein gesprochen.«
»Ich mag es präzise. Also gut, erklären Sie mir, wie Sie zu Ihrer Annahme kommen«, forderte er sie auf.
»Der oder die Täter haben den Tagesablauf der Richterin gekannt. Es gab kein gewaltsames Eindringen. Ihr Sicherheitsmann hat keinen Widerstand geleistet, als er getötet wurde. Das sagt mir, dass der Mann keinerlei Bedrohung gesehen hat. Die Richterin wurde umgebracht, ohne dass irgendetwas auf einen Kampf hindeutet. Sie hat nicht einmal versucht, Hilfe zu rufen.«
»Das bedeutet, sie könnte den oder die Täter gekannt haben. Und der Sicherheitsmann genauso.«
»Aber warum hat die Richterin jemanden hereingelassen, der kurz zuvor ihren Bodyguard getötet hat?«, wunderte sich White.
»Entweder hat sie’s nicht gewusst, oder die Sache ist vertrackter, als wir ahnen. Die Frau war geschieden. Ihr Ex lebt in der Gegend.«
»Stimmt. Also käme er als Verdächtiger infrage.«
»Partner und Ex-Partner muss man immer in Betracht ziehen.«
»Wem sagen Sie das«, seufzte White.
Anderthalb Stunden später ging das Flugzeug in den Sinkflug, und sie landeten auf dem Southwest Florida International Airport bei Fort Myers. Dort wartete bereits ein Mietwagen auf sie.
White setzte sich ans Lenkrad, während Decker sich auf den Beifahrersitz des mittelgroßen Viertürers zwängte.
White drehte sich zu ihm, als sie den Wagen in den Verkehr einfädelte. »Sorry, etwas Größeres hatten sie nicht. Die haben anscheinend nicht genug Fahrzeuge verfügbar.«
»Ich bin noch nie mit etwas halbwegs Bequemem gefahren, also hatte ich keine großen Erwartungen.«
»Ein Agent der dortigen RA ist vor Ort.« White sprach von der örtlichen Resident Agency, einer der vielen kleineren Zweigstellen des FBI.
»Ich weiß.«
»Auch die Leichen sind noch da. Die Kollegen hier vor Ort wollten anscheinend auf uns warten, damit wir uns ein Bild machen können.«
»Sie müssen mir nicht ständig erklären, was ich schon weiß«, erwiderte er gereizt.
»Ich wollte nur Informationen austauschen.«
»Lassen Sie’s.«
»Alex hat mir schon gesagt, dass Sie ziemlich reizbar sein können.«
»Im Moment bin ich eher gut drauf.«
»Danke für die Info. Ich weiß gern, woran ich bin.«
Er zitierte aus dem Gedächtnis: »›Nur so kann ich als farbige Frau in diesem Umfeld bestehen und dafür sorgen, dass es meiner Familie gut geht.‹«
»Ah, das Superhirn. Alex sagte mir schon, dass Ihr Gedächtnis einem manchmal ziemlich auf den Senkel gehen kann. Aber sie hat anscheinend einen Weg gefunden, damit klarzukommen.«
Decker schaute aus dem Fenster auf den Himmel. »Ich habe Florida noch nie gemocht. Wenn wir mit dem College-Footballteam gegen die Mannschaften hier gespielt haben, war es jedes Mal wie eine Strafe. Nicht nur, weil die Typen viel schneller und athletischer waren als wir.«
»Warum dann? Ist es Ihnen in Florida zu warm, oder gibt es für Ihren Geschmack zu viele alte Leute hier? Oder beides?«
»Nein, es liegt einfach daran, dass ich ein Arbeiterkind aus dem Mittleren Westen bin.«
»Und was hat das mit Florida zu tun?«
»Ich kann Sand nicht ausstehen.«
6
Sie fuhren zu einer Gated Community in Ocean View, einer geschlossenen, bewachten Wohnanlage etwa eine halbe Autostunde nördlich von Naples. Das Rauschen der Wellen, das vom nahen Golf von Mexiko herüberdrang, begleitete sie auf der gesamten Fahrt.
»Hier sieht es aus wie auf einer Postkarte«, bemerkte White, als sie beim Wachhaus hielt.
»Nicht dort, wo wir hinmüssen«, konterte Decker.
Der Wachmann kam aus seinem Häuschen. Er war Mitte vierzig und wirkte mit seinem breitbeinigen Gang eher wie ein Elitesoldat der Navy SEALs als wie der Wachmann einer Luxuswohnanlage.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte er, als White das Fenster herunterließ.
Sie zeigte ihm ihre FBI-Dienstmarke. »Frederica White und Amos Decker. Wir ermitteln im Mord an Richterin Julia Cummins.«
»Verstehe«, sagte der Mann und beäugte Decker argwöhnisch. Während White immer noch ihren schwarzen Hosenanzug trug, war Decker mit Khakihose und einem ausgeblichenen dunkelblauen Sweatshirt bekleidet.
»Sie müssen aus dem Norden kommen«, meinte der Wachmann. »Einen Sweater werden Sie hier nicht brauchen.«
»Haben Sie die Liste der Gäste und Bewohner schon übergeben, die in den vergangenen vierundzwanzig Stunden die Anlage betreten haben?«, fragte Decker.
»Wem soll ich sie gegeben haben?«
»Den Cops«, erklärte White.
»Die haben nicht danach gefragt.«
»Aber wir fragen danach«, betonte Decker.
»Das muss ich mit meinem Vorgesetzten abklären.«
»Dann klären Sie. Wir warten solange. Wir brauchen die Liste nämlich sofort.«
»Brauchen Sie für so etwas nicht einen richterlichen Beschluss?«
»Haben Sie die Richterin und ihren Sicherheitsmann umgebracht?«, fragte White.
Der Wachmann wich einen Schritt zurück. »Was? Nein!«
»Dann gibt es keinen Grund für einen richterlichen Beschluss«, sagte White. »Die Leute, die hier reinkommen, machen ja wohl kein Geheimnis daraus. Außerdem handelt es sich hier um eine Mordermittlung. Darum müssen wir wissen, wer in den vergangenen vierundzwanzig Stunden die Anlage betreten hat. Mit der genauen Zeit.«
»Also rufen Sie Ihren Vorgesetzten an«, bekräftigte Decker. »Und bringen Sie die Liste zum Haus der Richterin. Wir warten dort.«
»Okay.«
»Und machen Sie das Tor auf, wenn’s geht«, fügte White hinzu.
»Ja, sicher, klar.« Der Mann öffnete rasch das Tor, und sie fuhren in die Wohnanlage.
»Bei dem Sicherheitspersonal wundert es mich fast, dass nur zwei Leute tot sind«, meinte White.
»Vielleicht sind es mehr, und wir wissen es bloß noch nicht«, erwiderte Decker.
Richterin Cummins’ geräumige Villa war im mediterranen Stil gehalten, mit viel weißem Stuck und einem roten Ziegeldach. Sie lag inmitten eines gepflegten Gartens in einer ruhigen Sackgasse. Doch die Idylle wurde von der Anwesenheit der Polizeifahrzeuge gestört, die vor dem Haus parkten. Ein gelbes Absperrband flatterte im frischen Wind.
Decker bemerkte einen leicht ramponierten blauen Wagen in der Auffahrt. »Der gehörte vielleicht dem toten Bodyguard.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Sonst stehen hier nur Streifenwagen und Fahrzeuge von Regierungsbehörden.«
»Es könnte Richterin Cummins’ Wagen sein.«
»Eine Frau mit einem Haus, das zwei oder drei Millionen wert ist, fährt keinen verbeulten alten Mazda. Außerdem hätte sie ihn in einer der drei Garagen abgestellt und nicht in der Auffahrt stehen lassen. Und sehen Sie sich den Aufkleber auf der Stoßstange an.«
White las laut die Aufschrift: »Die Feds haben dich im Auge.«
»So etwas würde sich eine Bundesrichterin kaum aufs Auto kleben«, meinte Decker.
Sie parkten am Rand der Auffahrt, zeigten dem Sicherheitsmann an der Tür ihre FBI-Ausweise, zogen Überschuhe und Gummihandschuhe an, die ein Kollege von der Spurensicherung ihnen gab, und traten ein.
Decker, dessen Leben von einem hyperaktiven Gedächtnis und einer unberechenbaren Verkettung verschiedenster Sinneseindrücke geprägt war, wurde augenblicklich von dem intensiven stahlblauen Licht umhüllt, als seine Synästhesie sich mit aller Macht bemerkbar machte. Er schauderte. Stahlblau stand für Leichen, Tod und Verwesung. Er stützte sich mit der Hand an der Wand ab, denn das Licht brachte wie immer ein heftiges Schwindelgefühl mit sich.
Tief durchatmen.
White sah ihn an, sagte jedoch kein Wort, was Decker unwillkürlich misstrauisch machte, sogar auf seltsame Weise mit Wut erfüllte. Wieso schwieg seine neue Partnerin? Sie sah doch, was mit ihm los war.
Ein kleiner, stämmiger Mann betrat das Wohnzimmer, als wäre er ein CEO auf dem Weg zu einer Vorstandssitzung. Er war Ende vierzig, trug eine gebügelte Hose und eine marineblaue Jacke. Hemd und Krawatte waren genauso makellos. Seine Haare sahen aus wie mit dem Bügeleisen geplättet. Seine Gesichtszüge waren scharf geschnitten, sein Blick noch schärfer.
Er entsprach genau dem Typus des arroganten Exekutivbeamten, den Decker nicht ausstehen konnte.
Der Mann zückte seine Dienstmarke. »FBI Special Agent Doug Andrews von der RA Fort Myers.«
Hab ich ein Glück, dachte Decker resignierend.
»Und Sie sind?«, fragte Andrews.
White zeigte ihm ihren Ausweis. Decker schaute schweigend zur Tür.
»Und das ist Amos Decker«, fügte White hinzu. »Wir kommen gerade aus D. C.«
Andrews’ Miene verfinsterte sich. »Mir hat keiner gesagt, dass Agenten von auswärts kommen. Ich hatte nur die Anweisung, die Leichen noch hierzubehalten. Ohne dass man mir einen Grund genannt hätte, wie ich hinzufügen möchte.«
»Okay, der Grund sind wir«, stellte White klar.
Andrews beäugte Deckers legeres Outfit. »Von Ihnen habe ich noch keinen Ausweis gesehen. Wie war noch mal Ihr Name? Decker?«
Decker würdigte ihn keiner Antwort, schaute sich stattdessen in dem geräumigen Wohnzimmer um. Es war ebenso stilvoll wie teuer eingerichtet. In einer Ecke tickte eine antike Standuhr vor sich hin. Die luxuriösen Teppiche waren flauschig und farbenfroh. Ein prachtvolles Zimmer, nur dass ihm aus jeder Ecke der Geruch des Todes entgegenwehte. Das war keine Einbildung. Die Leichen, die in dem Zimmer zu verwesen begannen, waren sehr real.
An der Wand unweit der Treppe sah er einen blutigen Handabdruck. Auch auf dem Treppenläufer waren Blutflecken zu erkennen. Die Spurensicherer hatten jeden Fleck mit einer Nummer markiert. Überall war das Pulver verstreut, mit dem Fingerabdrücke gesichert wurden. Decker hörte Kameras klicken und Stimmen murmeln. Die Dinge nahmen ihren Lauf. Decker hätte sich gern auf die Arbeit konzentriert, was ihm durch dieses Arschloch von einem Kollegen jedoch erschwert wurde.
Ohne den Mann anzusehen, sagte Decker: »Man hat uns hergeschickt, damit wir bei der Ermittlung helfen.«
»Wir haben die Sache im Griff. Und ich …«
Decker stapfte an ihm vorbei ins Zimmer nebenan.
»Hey!«, blaffte Andrews, als Decker hinter der Tür verschwand. Er wandte sich an White. »Was zum Teufel ist mit diesem Kerl los?«
»Er macht seinen Job, so wie ich. Und wenn Sie ein Problem damit haben, dass wir hier sind, müssen Sie sich an die Zentrale wenden. Aber bis dahin werden wir an dem Fall arbeiten, so wie Sie auch.«
Sie folgte Decker ins Nebenzimmer.
Andrews eilte hinterher.
7
Decker hatte in seiner Zeit als Polizist und FBI-Berater mehr als genug Tatorte gesehen und sich jeden einzelnen in allen Details eingeprägt. Dieser hier glich den meisten anderen, hatte aber auch einige Besonderheiten aufzuweisen.
Er befand sich im Arbeitszimmer der Richterin. Bücherregale, ein Schreibtisch, eine kleine Ledercouch, ein hölzerner Aktenschrank, Desktop-Computer und Kopiergerät. Ein Fenster mit Blick auf den Rasen hinter dem Haus. Gemälde an den Wänden, hübscher Schnickschnack, ein farbenfroher Perserteppich. Nichts schien durcheinandergebracht worden zu sein. Es gab keine Anzeichen, dass jemand das Zimmer in aller Eile durchsucht haben könnte. Keine Spuren von Diebstahl oder körperlicher Auseinandersetzung. Alles war sauber und an seinem Platz.
Es gab nur eins, was die Ordnung störte: die Leiche auf dem Boden. Nicht die der Richterin. Die eines Mannes. Offensichtlich der Bodyguard. Ein privater Sicherheitsmann, kein U.S. Marshal, wie es bei Bundesrichtern üblich war. Der Tote war Mitte dreißig, schlank, knapp über eins achtzig groß und hatte kurz geschnittene braune Haare, die den Schädel wie eine Kappe bedeckten. Er trug keine Uniform, sondern einen dunklen Maßanzug. Auf dem weißen Hemd hatte sich ein roter Fleck ausgebreitet. Zwei Einschusslöcher waren die Ursache für die Blutung und den Tod des Mannes. Der Täter war auf Nummer sicher gegangen.
Unter der Jacke des Toten ragte das Ende des Griffs seiner Waffe hervor. Decker ging in die Knie und checkte das Etikett des Anzugs: Armani. Er blickte auf die Armbanduhr: Cartier. Die Schuhe: Ferragamo.
Interessant.
Der Tote lag mit ausgebreiteten Armen und Beinen auf dem Boden; die leeren Augen starrten zum Kronleuchter an der Decke. Kinn und Wangen zierte ein Dreitagebart. Noch im Tod sah er gut aus, wenn auch sehr blass. Sein Gesicht wirkte überrascht, was zur Art und Weise seines Ablebens passte.
Decker blickte zu den Leuten von der Spurensicherung, die ruhig und effizient ihre Arbeit verrichteten, und ging auf eine Angehörige des Teams zu, eine Frau in den Vierzigern im blauen Overall, die gerade ein paar Informationen auf ihrem iPad festhielt. Frederica White folgte ihm.
»Sind Sie die Gerichtsmedizinerin?«, fragte Decker.
Sie sah ihn überrascht an und schaute sich um, bis sie Andrews in der Tür stehen sah. Er nickte widerstrebend, ehe er zu Decker trat.
»Ich bin die Gerichtsmedizinerin. Mein Name ist Jacobs, Helen Jacobs. Und was die Leiche betrifft … wir haben es mit zwei Schusswunden in der Brust zu tun, allem Anschein nach ins Herz. Er muss auf der Stelle tot gewesen sein.«
»Haben Sie schon einen vorläufigen Todeszeitpunkt ermittelt?«
»Zwischen Mitternacht und zwei Uhr früh.«
White schaute zu Andrews. »Gibt es Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen?«
»Nein.« Andrews blickte von ihr zu Decker und wieder zurück. »Wer hat Sie beide eigentlich hergeschickt, Agentin White?«
»Special Agent John Talbott vom Washington Field Office. Hat man Sie nicht informiert?«
Andrews schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Geben Sie mir Ihre Nummer, dann schicke ich Ihnen Talbotts Kontaktdaten.«
Andrews ratterte die Ziffernfolge runter, und White leitete ihm die Informationen weiter.
»Wurde etwas mitgenommen?«, fragte sie dann.
»Das steht noch nicht endgültig fest. Auf den ersten Blick scheint aber nichts zu fehlen.«
»Wie heißt der Tote?«, hakte White nach.
Jacobs, die Gerichtsmedizinerin, meldete sich zu Wort. »Alan Draymont.«
»Nach unseren Informationen war er ein privater Sicherheitsmann«, warf Decker ein. »Bei welchem Sicherheitsdienst war er beschäftigt?«
»Gamma Protection Services«, erklärte Andrews. »Wir haben die Firma verständigt und werden eine Befragung ansetzen.«
»Warum trägt er Anzug, keine Uniform?«
»Gamma bietet ein breites Spektrum an. Security für Kaufhäuser, Lager und Bürogebäude, aber auch Personenschutz. Dafür haben sie speziell ausgebildete Leute.«
»Speziell ausgebildet? So wie dieser Tote hier?«, erwiderte Decker skeptisch.
»Ja, so wie er«, hielt Andrews dagegen. »Niemand ist perfekt.«
»Warum hatte die Richterin einen Bodyguard?«, wollte White wissen. »Hat sie Drohungen bekommen?«
»Das wird man uns bei Gamma Protection sagen können«, entgegnete Andrews.
»Warum hatte sie einen privaten Sicherheitsmann?«, hakte White nach. »Wurde sie denn nicht von einem U.S. Marshal bewacht, wie bei Bundesrichtern üblich?«
»Auch das werden wir überprüfen«, erwiderte Andrews genervt. »Aber es stand ihr frei, für ihren persönlichen Schutz anzuheuern, wen sie wollte. Und sie konnte sich einen privaten Bodyguard leisten.«
Decker blickte zu ihm. »Sie haben die Frau gekannt?«
»Flüchtig. Ocean View ist keine Großstadt. Hier kennen sich die Leute.«
»Hat Draymont seine Waffe benutzt?«, fragte White.
»Sie steckt noch im Holster«, gab Andrews zurück.
»Der oder die Täter können sie ihm unter die Jacke geschoben haben, nachdem er sie abgefeuert hatte«, gab Decker zu bedenken.
Andrews’ Haltung versteifte sich. »Wir werden es überprüfen.«
»Hat der Täter irgendwelche Spuren hinterlassen?«, fragte White.
Es war Jacobs, die die Frage beantwortete. »Die meisten Fingerabdrücke, die wir bisher gefunden haben, stammen von der Richterin, einige wenige von Draymont. Es gibt noch andere, die wir bisher aber niemandem zugeordnet haben. Fußabdrücke konnten wir keine finden, auch nicht auf dem Treppenläufer. Es gibt hier fast überall Hartholzböden – da ist es schwer, Spuren festzustellen. Es hat auch nicht geregnet, sodass wir nicht mit Schuhabdrücken rechnen können.«
»Und die Leiche der Richterin?«, fragte Decker. »Wie ist die Frau die Treppe raufgekommen, wenn sie schon verletzt war?«
Jacobs musterte ihn nachdenklich, ehe sie antwortete: »Sie haben die Blutspuren auf dem Treppenläufer und dem Holzboden bemerkt, oder?«
»Aber sicher. Dank der kleinen Kegel, die Sie bei jedem Fleck aufgestellt haben, sind die kaum zu übersehen. Ich meine vor allem den blutigen Handabdruck an der Wand bei der Treppe. Ich wette, der stammt ebenfalls von Richterin Cummins. Ihr Bodyguard konnte mit seinen Schusswunden das Zimmer bestimmt nicht mehr verlassen.«
»Ich glaube, dass die Richterin hier unten eine Stichwunde erlitten hat und später oben in ihrem Schlafzimmer getötet wurde«, erklärte Jacobs.
»Okay, gehen wir rauf«, entschied Decker. Es gefiel ihm nicht, dass die Gerichtsmedizinerin ihre Einschätzung mit einem »Ich glaube« einleitete.
Sie umgingen die markierten Blutspuren auf der Treppe und stiegen in den ersten Stock hinauf, wo Andrews sie zum Schlafzimmer führte.
»Ist der Täter nicht in das Blut getreten, als er der Frau gefolgt ist?«, fragte White.
»Nein, er hat anscheinend gut aufgepasst«, erklärte Jacobs.
Richterin Julia Cummins lag in einem kurzen weißen Frotteebademantel auf ihrem Bett. Der Mantel war geöffnet, sodass der schwarze Slip und ein weißes Unterhemd zu sehen waren. Jemand hatte ihr eine Augenbinde angelegt und an der Stelle der Augen zwei Löcher in den Stoff gestochen. Ihre Kleidung war blutgetränkt, ebenso die Bettdecke. Auch Hände, Knie und Füße der Leiche waren voller Blut.
»Der Täter hat mehrmals auf sie eingestochen«, erklärte Jacobs. »Mindestens zehnmal. Hinzu kommen die Wunden, die sie erlitten hat, weil sie sich wehrte. Die Todesursache war der Blutverlust infolge der Stichwunden.«
»Sie wurde also unten angegriffen und ist nach hier oben geflüchtet, worauf der Täter ihr gefolgt ist und sie in diesem Zimmer getötet hat«, folgerte White.
»Sieht jedenfalls so aus«, stimmte Jacobs vorsichtig zu.
»Wenn jemand so oft zusticht, geht es um etwas Persönliches«, stellte Decker fest.
»Mag sein, aber es gibt noch eine Menge zu klären«, wandte Andrews ein. »Wir haben es hier mit einem komplizierten Tatort zu tun.«
Decker betrachtete die zerwühlte Bettdecke und stellte fest, dass die Matratze leicht verschoben war.
White erahnte seine Gedanken. »Es sieht nach einem Kampf aus.«
Decker wandte sich an die Gerichtsmedizinerin. »Sie haben Wunden erwähnt, die darauf hindeuten, dass die Richterin sich gewehrt hat.« Er blickte auf die Schnittwunden an den Unterarmen der Toten.
»Ja«, bestätigte Jacobs. »Es ist normal, dass jemand versucht, sich mit den Armen zu schützen, wenn er mit einem Messer oder einem stumpfen Gegenstand angegriffen wird. Unter den vielen Wunden gibt es eine, die letztlich tödlich war: der Einstich unterhalb des Brustbeins. Die Klinge dürfte die Aorta durchtrennt haben. Genaueres kann ich Ihnen aber erst nach der Obduktion sagen.«
»Irgendwelche Spuren unter ihren Fingernägeln?«, fragte White.
»Bei der ersten Untersuchung habe ich keine gefunden. Aber bei der Obduktion werde ich noch einmal genauer nachsehen.«
»Blut an den Händen, Knien und Fußsohlen …«, warf Decker ein.
Es war Andrews, der eine Erklärung parat hatte. »Sie wurde unten im Erdgeschoss angegriffen und ist in ihr eigenes Blut getreten. Auf der Flucht könnte sie gestürzt sein, deshalb das Blut an den Knien. Der Handabdruck an der Wand rührt sicher daher, dass sie sich abgestützt hat.«
»Deutet irgendetwas auf sexuelle Gewalt hin?«, fragte Decker, den Andrews’ Theorie nicht wirklich überzeugte, als er sich die Anordnung der Blutflecken im Arbeitszimmer und auf der Treppe vor Augen führte.
Jacobs zuckte die Achseln. »Bei einer ersten Untersuchung habe ich keine entsprechenden Anzeichen entdeckt. Mehr kann ich Ihnen erst sagen, wenn ich die Leiche auf dem Obduktionstisch habe. Ich glaube aber nicht, dass sexuelle Gewalt im Spiel war.«
Decker schaute nachdenklich auf die Augenbinde. »Nett von den Tätern, dass sie uns dieses kleine Symbol hinterlassen haben.«
Andrews trat einen Schritt vor. »Warum legt der Täter ihr eine Binde an und sticht dann Löcher aus, damit man die Augen sieht?«
»Die Augenbinde wurde ihr höchstwahrscheinlich post mortem angelegt«, meinte Jacobs.
»Natürlich«, bestätigte Decker, ohne lange zu überlegen.
»Sie halten es für einen symbolischen Akt?«, warf White nachdenklich ein.
»Die Frau war Richterin«, erklärte Decker. »Wie Sie wissen, trägt Justitia eine Augenbinde, die verdeutlichen soll, dass sie ohne Ansehen der Person urteilt. Der Mörder scheint der Meinung zu sein, dass die Richterin diesem Anspruch nicht gerecht wurde. Das wollte er damit ausdrücken, indem er die Löcher in die Maske stach, als könnte die Tote hindurchblicken.«
Andrews sog scharf den Atem ein. »Scheiße, da könnte was dran sein.«
»Woher stammt die Augenbinde?«, fragte Decker.
»Aus dem Kleiderschrank der Richterin«, sagte Jacobs. »Es ist eines ihrer Taschentücher.«
»Hat der Täter im Kleiderschrank irgendwelche Spuren hinterlassen?«, hakte White nach. »Oder irgendwo sonst im Haus? Fußspuren im Blut vielleicht?«
»Wie ich schon sagte«, antwortete Jacobs, »haben wir bisher nichts gefunden. Wir haben aber noch nicht alle Fingerabdrücke gesichert. Außerdem brauchen wir die Abdrücke von Freunden und Verwandten, um alle auszuschließen, die nicht von Unbekannten stammen.«
»Es deutet vieles darauf hin, dass der Täter im Affekt gehandelt hat«, meinte Decker. »Offenbar hat er spontan eines ihrer Taschentücher als Augenbinde benutzt, statt eines zu diesem Zweck mitzubringen. Womit wurden die Löcher in den Stoff geschnitten?«
»Wir haben nichts mit Blutspuren daran gefunden«, erklärte Andrews.
»Der Täter könnte die Tatwaffe benutzt und dann mitgenommen haben«, folgerte White, ehe ihr eine Karte auffiel, die in einem Beweismittelbeutel steckte, der neben der Toten lag. »Hat man diese Karte im Zimmer gefunden?« fragte sie.
Jacobs nickte. »Sie lag auf der Leiche.«
Frederica White besah sich die Karte genauer und las laut vor: »Res ipsa loquitur.«
Sie blickte zu Decker, der sie beobachtet hatte.
Decker wandte sich an Andrews. »Hat man schon festgestellt, ob diese Karte und der Kuli von hier sein könnten?«
»Es wurde ein normaler Kugelschreiber benutzt, also könnte er von hier sein. Aber Karten dieser Art haben wir hier bisher nicht gefunden«, berichtete Andrews. »Also wird der Täter sie mitgebracht haben.«
»Sind Fingerabdrücke darauf?«, hakte White nach.
»Nein.«
»Wenn der Täter die Karte mitgebracht hat, deutet das auf Vorsatz hin«, gab White zu bedenken.
»Stimmt«, bestätigte Decker. »Genauso wie die Augenbinde, auch wenn sie nicht vom Täter selbst stammt. Die vielen Stichwunden allerdings sagen etwas anderes.« Er schaute sich im Zimmer um und bemerkte ein Foto auf dem Nachttisch. Es zeigte die Ermordete zwischen einem Mann und einem Jungen im Teenageralter.
Andrews nahm das Bild in seine behandschuhte Hand. »Das ist Richterin Cummins mit ihrem Ex-Mann Barry Davidson und ihrem Sohn Tyler. Nach dem Hintergrund zu schließen, dürfte das Foto im Club gemacht worden sein.«
»Im Club?«, fragte White.
»Im Harbor Club, ungefähr fünf Minuten die Küste runter. Sie waren dort Mitglieder. Zumindest die Richterin.«
»Was ist mit dem Ex und ihrem Sohn? Wo sind sie zu Hause?«
»Wir haben Barry Davidson schon verständigt. Er wohnt ganz in der Nähe.«
»Alibi?«
»Er war mit seinem Sohn zusammen. Der Junge ist diese Woche bei ihm.«
»Das heißt, der Sohn ist sein Alibi?«, hielt Decker fest.
»Ja. Der arme Kerl ist fix und fertig.«
»Wie alt ist er?«
»Siebzehn.«
»Kennen Sie den Mann und seinen Sohn?«, hakte Decker nach.
»Ich bin Davidson ein paarmal begegnet.«
»Und Sie kennen auch den Club, oder? Sonst hätten Sie ihn auf dem Foto nicht erkannt.«
»Ja. Ich bin ebenfalls Mitglied.«
Decker beäugte das kostspielige Outfit des Agenten. »Ist das Ihr Lexus draußen?«
»Ja. Was ist damit?«
»Nichts. Und der Mazda – gehörte er Draymont?«
»Ja«, bestätigte Andrews.
Jacobs schaute beunruhigt zwischen den beiden Männern hin und her.
»Okay, Agent Andrews«, sagte Decker. »Wie ist Ihre Sicht auf die Geschehnisse, die sich letzte Nacht hier zugetragen haben?«
Andrews schaute zu White und ließ sich einen Augenblick Zeit, um seine Gedanken zu ordnen. »Nun, das dürfte ziemlich klar sein. Es gab kein gewaltsames Eindringen, also müssen die Türen unverschlossen gewesen sein, oder der Täter wurde eingelassen. Dass Richterin Cummins in Unterwäsche hier liegt, deutet darauf hin, dass Draymont zuerst erschossen wurde. Die Richterin hört unten im Haus Geräusche, zieht sich einen Bademantel über und geht nach unten, wo sie angegriffen wird. Sie flieht die Treppe rauf, will sich wahrscheinlich einschließen, kommt aber nicht mehr dazu. Sie wird umgebracht, der Täter hinterlässt die Karte und legt ihr die Augenbinde an.«
»Wenn Draymont, der Bodyguard, die Person hereingelassen hat, muss er sie gekannt haben«, folgerte White. »Entweder persönlich oder weil sie mit der Richterin gut bekannt war.«
»Wenn die Morde zwischen Mitternacht und zwei Uhr passiert sind, müsste es ein später Besucher gewesen sein«, merkte Decker an.