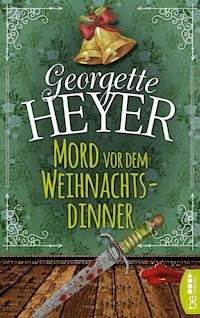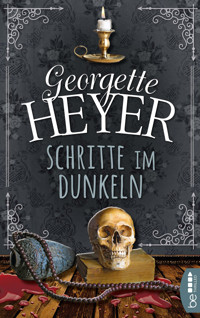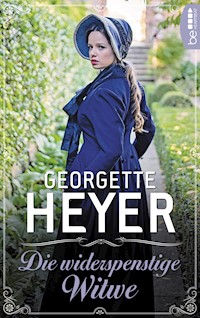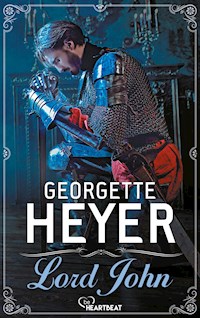6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Liebe, Gerüchte und Skandale - Die unvergesslichen Regency Liebesromane von Georgette
- Sprache: Deutsch
Sussex, 1817. Der alte Lord Darracott erleidet einen schweren Schicksalsschlag: Nachdem sein eigentlicher Erbe bei einem Unglück ums Leben kommt, sieht er sich gezwungen, alles seinem unbekannten Neffen Major Hugo Darracott zu vermachen. Die Familie ist entsetzt! Ein einfacher Webersohn mit ungeschliffenen Manieren und breitem Yorkshire-Dialekt soll das neue Familienoberhaupt werden? Einzig und allein die junge Anthea macht sich die Mühe, den Major näher kennenzulernen und schöpft schon bald Verdacht ... Ist Hugo wirklich der, für den ihn alle halten?
"Lord Ajax" (im Original: "The Unknown Ajax") ist einer der humorvollsten Regency-Romane von Georgette Heyer, in dem sie auf liebenswerte Art und Weise mit dem Standesdünkel des englischen Adels abrechnet.
"Keine andere Autorin hat meine eigenen Romane so stark beeinflusst wie Georgette Heyer. Wenn mein Haus in Flammen aufgehen würde und ich nur Zeit hätte, ein einziges Buch mitzunehmen, würde ich mir auf dem Weg nach draußen "Lord Ajax" schnappen. Der Humor ist unübertroffen und Hugo Darracott ist mein absoluter Lieblingsheld!" (Sheri Cobb South)
Jetzt als eBook bei beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel l6
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Über dieses Buch
Sussex, 1817. Der alte Lord Darracott erleidet einen schweren Schicksalsschlag: Nachdem sein eigentlicher Erbe bei einem Unglück ums Leben kommt, sieht er sich gezwungen, alles seinem unbekannten Neffen Major Hugo Darracott zu vermachen. Die Familie ist entsetzt! Ein einfacher Webersohn mit ungeschliffenen Manieren und breitem Yorkshire-Dialekt soll das neue Familienoberhaupt werden? Einzig und allein die junge Anthea macht sich die Mühe, den Major näher kennenzulernen und schöpft schon bald Verdacht ... Ist Hugo wirklich der, für den ihn alle halten?
Über die Autorin
Georgette Heyer, geboren am 16. August 1902, schrieb mit siebzehn Jahren ihren ersten Roman, der zwei Jahre später veröffentlicht wurde. Seit dieser Zeit hat sie eine lange Reihe charmant unterhaltender Bücher verfasst, die weit über die Grenzen Englands hinaus Widerhall fanden. Sie starb am 5. Juli 1974 in London.
Georgette Heyer
Lord Ajax
Aus dem Englischen von Lida Winiewicz
Digitale Neuausgabe
«be» – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Copyright © Georgette Heyer, 1959
Die Originalausgabe THE UNKNOWN AJAX erschien 1955 bei William Heinemann.
Copyright der deutschen Erstausgabe:
© Paul Zsolnay Verlag GmbH, Hamburg/Wien, 1961.
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven © Richard Jenkins Photography
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7517-0302-4
www.lesejury.de
Kapitel 1
Im Esszimmer herrschte Stille, seitdem Seine Lordschaft mitten im ersten Gang seiner verwitweten Schwiegertochter auf das Rüdeste anbefohlen hatte, ihn mit Dienstbotenklatsch zu verschonen. Ein Tadel, der ungerechtfertigt schien, war Mrs Darracott doch lediglich damit beschäftigt gewesen, ihrer Tochter auseinanderzusetzen, was sie an diesem Tag unternommen hatte. Allein sie nahm ihn hin, wenn schon nicht mit Gleichmut, so mit milder, langer Gewohnheit entspringender Ergebenheit, und beschränkte sich darauf, einen belustigten Blick mit Anthea zu tauschen und ihrem jungen, wohlgestalten Sohn warnend zuzunicken. Drohend fixierte der Butler den jüngereren der beiden Lakaien, doch die Vorsichtsmaßregel erwies sich als überflüssig: Charles diente zwar noch keine sechs Monate auf Schloss Darracott, war jedoch kein solcher Tropf, um sich, sobald Seine Lordschaft missgestimmt war, auch nur im Geringsten bemerkbar zu machen. »Missgestimmt.« So beliebte Chollacombe sich nämlich auszudrücken, wenn er von Seiner Lordschaft sprach, dem närrischsten alten Kauz, dem aufwarten zu müssen Charles jemals das Missgeschick gehabt hatte. Knorrig, das war er, ein alter Knacker, der immer nur schalt, mäkelte, brummte – und das nun seit Monaten!
Charles hatte sich glücklich geschätzt, auf Schloss Darracott Aufnahme zu finden. Jetzt aber war er fest entschlossen, sein Jahr abzudienen und keine Sekunde länger. Nein, Sir. James mochte es vielleicht zusagen – der stammte aus Kent –, in einem riesigen, weitläufigen Haus zu arbeiten, am Ende der Welt, inmitten öden Marschlands, angesichts dessen jedermann trübsinnig werden musste, in völliger Einsamkeit. Weit und breit niemand, nur die Familie! Ja – Charles war fest entschlossen: kam erst der Tag der Kündigung, ging er nach London. Erstens blies er nicht gerne Trübsal, zweitens gab es in London kleine Zubußen zu verdienen, Aufträge zu bestellen, Briefchen zu übermitteln – Aufträge, kurzum, die jeweils einen Shilling einbrachten. Aber hier, auf dem Land? Waren Botschaften zu überbringen, so stand es zehn zu eins, dass sie einem der Reitknechte anvertraut wurden; und was die »zahlreichen freigebigen Gäste« betraf, denen er aufwarten sollte – Dads Prophezeiungen zufolge –, nun, derlei hatte Dad vielleicht gesehen, in seiner Jugend, nicht aber er, Charles, und am allerwenigsten auf Schloss Darracott!
Oh, über die Erwartungen, die zu hegen Charles sich nicht entblödet hatte, als er sein Glück pries, im Hause eines Edelmannes die Stelle des zweiten Lakaien errungen zu haben! Schöner Reinfall! Das würde er Dad auch sagen.
Charles’ Vater, ehemals Butler eines besseren Herrn, nunmehr in ehrenvollem Ruhestand, hatte seinem Sohn nämlich versichert, Dienst auf dem Landsitz eines Lords bedeute durchaus nicht zwölf Monate ländlicher Einsamkeit. Mylord, versicherte Dad, würde die Wintermonate in Kent verbringen, zu Beginn der »Saison« in sein Londoner Stadtpalais übersiedeln und, sobald letztere ihrem Ende zuging, ein Haus in Brighton mieten. Überdies würde sich Seine Lordschaft selbstredend von Zeit zu Zeit entfernen, um Freunde zu besuchen, Zeitspannen, während welcher die Dienerschaft größte Freiheit genießt, ja, vielleicht sogar die Erlaubnis erhalten würde, ihrerseits Urlaub zu nehmen.
Nichts dergleichen geschah auf Schloss Darracott, nichts jedenfalls seit dem Tag, da Charles dort eingezogen war. Mylord, dessen grimme Miene und eiskalter Blick nicht nur Charles’ Knie schlottern machten, sondern auch weit kräftigere, residierte jahrein, jahraus auf seinem Stammschloss, lud niemanden ein, wurde von niemandem eingeladen. Und zwar keinesfalls – das konnte Charles niemand weismachen –, weil die Familie um Mr Granville Darracott und Mr Oliver Trauer trug, die beide unweit der Küste Cornwalls ertrunken waren, bei einer unseligen Bootsfahrt. Zugegeben, als das Entsetzliche geschah, diente Charles erst wenige Monate, aber dessen ungeachtet redete niemand ihm ein, dass Mylord seinem Erben auch nur eine einzige Träne nachweinte. Fragte man ihn, Charles, würde er sagen, Mylord mochte nur einen einzigen Menschen: Master Richmond. Denn was Mr Matthew Darracott anlangte, den nächstältesten seiner Söhne, so konnte er ihn sichtlich nicht ausstehen. Und was Mr Claud betraf, Mr Matthews jüngeren Sohn, so bedurfte es größter Willenskraft, um nicht laut aufzulachen, wenn man zuschauen musste, wie Mylord ihn ansah. Als wäre er eine Wanze oder ein Mistkäfer. Ebenso wenig wäre man auf den Gedanken verfallen, Mylord hinge an Mr Vincent, wenngleich er ihn nicht ganz so durchbohrend betrachtete. Und was Mrs Darracott anlangte – eine herzensgute Dame, wenn auch eine rechte Plaudertasche –, so schien es, als brauchte sie nur den Mund aufzumachen, um von Mylord auf das Hässlichste zurechtgewiesen zu werden. Zu Miss Anthea benahm er sich nie so, das stimmte zwar, aber wahrscheinlich nur deshalb, weil Miss Anthea ihn nicht fürchtete, im Gegensatz zu ihrer Mama, und ihm – wer weiß – nichts schuldig bliebe. Keinesfalls aber zügelte Mylord seinen Groll, weil er sie etwa mochte, wie man von einem Großvater gemeiniglich glaubte voraussetzen zu dürfen. Ja, es gab nur einen, dem es gelang, ihn seiner Unleidlichkeit zu entreißen, mit Schmeicheln und guten Worten: der junge Richmond.
Richmond jedoch, Großvaters Liebling, schien sich nach einem gedankenvollen, wimpernumschatteten Blick auf Mylords unnachgiebige Miene in eigene Überlegungen zu verlieren. Man hatte eben zwei Schüsseln abserviert – gewürzten Hummer, ein Gericht, das Richmond nicht berührt hatte, sowie eine Wildpastete –, und Richmonds Schwester, die um den gewichtigen silbernen Tafelaufsatz guckte, der den Bruder ihren Blicken fast entzog, stellte fest, dass er auch hiervon kaum gegessen hatte. Da Richmond jedoch zwei Speisen des ersten Ganges auf das Herzhafteste zugesprochen hatte, beunruhigte Anthea lediglich die Tatsache, dass diese Enthaltsamkeit ihrem Großvater entgangen war. Für gewöhnlich hätte Lord Darracott seinen Enkel lautstark genötigt, von der Pastete zu essen, mit strenger, seine angstvolle Liebe zu dem Jungen, dessen frühe Kindheit Krankheiten aller Art überschattet hatten, nur ungenügend verbergender Unnachgiebigkeit. Und Richmond gab nach, furchtlos, aber gefügig.
Im Übrigen war Charles, der Lakai, nicht der einzige, der sich über die Ursache des brütenden Grolls Seiner Lordschaft Gedanken machte, auch Anthea, Mrs Darracott, selbst Richmond suchten nach dem Grund, wiesen jedoch die Möglichkeit, die Missstimmung Seiner Lordschaft könnte der Trauer um den ältesten Sohn entspringen, vielleicht noch entschiedener zurück als der junge Charles. Seine Lordschaft hatte Granville weder geliebt noch geachtet, war aber dennoch, als die Kunde vom tödlichen Unfall Schloss Darracott erreichte, minutenlang dagestanden wie zu Stein erstarrt; hatte dann, als das Entsetzen verklungen war, zum fassungslosen Grauen seines Sohnes Matthew sowie seines Verwalters Lissett wieder und wieder gesagt, in eisiger Wut: »Gott verdamm ihn! Verdamm ihn! Verdamm ihn!« Und Matthew und Lissett hatten zugehört, offenen Mundes, bangend um seinen Verstand, bis er ihnen heftig die Tür wies. Matthew hatte niemals gewagt zu fragen, welch außergewöhnliche Umstände für diesen absonderlichen Wutanfall verantwortlich waren, und Seine Lordschaft gab weder Erklärungen ab noch erwähnte er die Angelegenheit jemals wieder. Eine düstere Wolke schien sich über ihn zu senken. Er wurde unleidlicher denn je und so reizbar, dass Mrs Darracott nur unter Zittern und Bangen das Wort an ihn richtete und selbst Richmond mehr denn einmal hart angelassen wurde.
Das Nachtessen, niemals von kurzer Dauer, schien heute endlos, fand aber letztlich doch seinen Abschluss. Die Diener griffen nach Schüsseln und Tellern, Mrs Darracott nach ihrem Pompadour. Sie schickte sich an aufzustehen, als Seine Lordschaft die Stirn runzelte und befahl, knapp und unfreundlich: »Sie bleiben.«
»Bleiben, Sir?«, wiederholte Mrs Darracott mit unsicherer Stimme. – »Jawohl, bleiben«, bestätigte er unwillig. »Setzen Sie sich. Ich habe mit Ihnen zu reden.«
Mrs Darracott sank auf den Stuhl zurück, mit verwirrter, angstvoller Miene. Anthea jedoch, die sich, wie ihre Mutter, erhoben hatte, blieb stehen, das Gesicht dem Großvater zugewandt, die Brauen ein wenig gehoben. Er beachtete sie nicht. Sein Blick ruhte auf den beiden Lakaien, und er fuhr nicht eher fort, als bis sie das Zimmer verlassen hatten. So fürchterlich blickte er, dass Mrs Darracott sich mit zunehmendem Grauen fragte, welcher Verfehlung oder Unterlassung sie sich wohl schuldig gemacht haben mochte. Sachte schloss Chollacombe die Türe hinter seinen Untergebenen, nahm den Portweinkrug vom Abstelltischchen und sah auf die Hände seines Herrn: sie krampften und entkrampften sich, ballten sich, auf den Armlehnen liegend, zu Fäusten, öffneten sich wieder. Der Butler seufzte unhörbar. Schon den ganzen Tag braute Sturm. Jetzt würde er sich entladen.
Endlich sprach Seine Lordschaft, und es war, als koste ihn jedes Wort Mühe. – »Elvira, haben Sie die Güte, Flitwick mitzuteilen, dass ich morgen meinen Sohn und seine Familie erwarte. Treffen Sie, was Sie an Vorbereitungen für nötig erachten.«
Überraschung verleitete Mrs Darracott zu dem Ausruf: »Guter Gott! Das ist alles? Was in aller Welt – ich meine – ich hatte keine Ahnung –«
Anthea eilte ihrer Mutter zu Hilfe: »Was führt sie her, Sir?« Eine Sekunde sah es aus, als wäre Mylord drauf und dran, seiner Enkelin eine seiner berühmten scharfen Zurechtweisungen zu erteilen. Allein, er schwieg und erwiderte nach kurzer Stille: »Sie kommen, weil ich sie rufen ließ, Miss.« Er verstummte wieder und sagte: »Im Übrigen bleibt es sich gleich, ob ihr es jetzt erfahrt oder später: ich berief auch meinen Erben.«
Bei diesen bitteren Worten ließ Chollacombe um ein Haar den Portweinkrug fallen.
»Beriefst – auch – deinen Erben?«, wiederholte Richmond. – »Onkel Matthew ist doch dein Erbe, Großvater? Oder nicht?«
»Nein.«
»Wer denn, Sir?«, fragte Anthea.
»Ein Webersbalg«, erwiderte Seine Lordschaft, und seine Stimme bebte vor Abscheu.
»Nein so was!« Damit brach Mrs Darracott das verblüffte Schweigen, das Mylords Mitteilung folgte.
Die hoffnungslose Unzulänglichkeit dieses Ausrufs reizte Anthea zu unterdrücktem Lachen, schürte jedoch den schwelenden Groll Seiner Lordschaft zu heller Glut.
»Das ist alles, was Sie zu sagen wissen? Alles, Weib? Sie sind eine Gans, eine Rohrdommel – eine – fort, heben Sie sich hinweg – mitsamt Ihrer Tochter – geht, schwatzt, staunt, bekreuzigt euch, aber bleibt mir aus den Augen und Ohren! Herrgott, ich weiß wirklich nicht, wie ich euch hier ertrage!«
»Wirklich nicht!«, versetzte Anthea auf der Stelle. »Es ist auch zu arg, Sir.« Und, zu ihrer Mutter: »Wie konntest du einen so gütigen, so gefälligen, so liebenswürdigen Herrn wie unseren Großvater überhaupt ansprechen, Mama? Einen solchen Gentleman? Komm auf der Stelle mit mir.«
»So denkst du über mich, Mädel?«, sagte Seine Lordschaft, und in seinen Augen blitzte es auf.
»Oh, durchaus nicht«, erwiderte sie mit einem Knicks, »so spreche ich von Ihnen! Meine – gefiederte – Mama, das müssen Sie nämlich wissen, hat mich gelehrt, mich mit aller Ziemlichkeit zu betragen! Und mit letzterer wäre es unvereinbar, wollte ich sagen, was ich von Ihnen denke. Komm, Mama.« Mylord lachte bellend. »Schlagfertig, was?« Anthea hatte die Tür erreicht – Chollacombe hielt sie offen drehte sich um und sagte: »Jederzeit zu Diensten.«
»Ich werde die Dienste in Anspruch nehmen!«, versprach er. »Oh, bitte, Anthea«, flüsterte Mrs Darracott flehend und zerrte die Tochter beinahe aus dem Zimmer. Und als Chollacombe hinter ihnen die Tür schloss, fügte sie hinzu: »Liebes, das sollst du nicht! Du weißt, du solltest es nicht! Was wird aus uns – frage ich dich –, wenn er uns die Tür weist!«
»Oh, das wird er nicht«, versetzte Anthea vertrauensvoll. »Selbst er muss erkennen, dass es mehr als genug ist, eine derartige Torheit im Leben einmal zu begehen. Der Weberssohn, nehme ich an, wird wohl der Sprössling des Onkels sein, den wir niemals erwähnen dürfen? Wer ist er? Was ist er? Oh, bitte, Mama – erzähle mir, was du weißt! Du hast ja gehört: wir dürfen schwatzen und staunen, so viel wir wollen.«
»Ich weiß nicht das Geringste«, wandte Mrs Darracott ein, leistete jedoch keinen Widerstand, als ihre Tochter sie in einen der Salons zog, deren Türen sich in die Halle öffneten. – »Ja, ich wusste nicht einmal, dass es einen Erben gibt, bis dein Großvater ihn mir jetzt ins Gesicht schleuderte, sozusagen. Und im Übrigen« – sie setzte es entrüstet hinzu – »finde ich, dass ich mich durchaus geziemend betrug, denn ich nahm es mit Fassung zur Kenntnis. Und dabei wäre es sehr wohl dazu angetan gewesen, mir Krämpfe zu verursachen! Ja, dein Großvater hätte es sich selber zuzuschreiben gehabt, wäre ich vor seinen Augen in Ohnmacht gesunken! Wirklich, meine Liebe: Nichts hat mich jemals heftiger erregt.«
In den Augen der Tochter blitzte ein Lächeln auf, doch sie versetzte mit angemessenem Ernst: »Zweifelsohne. Aber Wohlerzogenheit und Zurückhaltung – das solltest du wissen – sind an Großvater verschwendet.« Und sie fuhr fort: »Weißt du, wie du aussiehst, Mama, wenn du die Federn so aufstellst? Wie ein überaus niedliches Rebhuhn.« – »Ich trage doch keine Federn«, widersprach die Witwe. »Federn! Wenn keine Gäste da sind! Und auf dem Land noch dazu. Das wäre ganz unschicklich, Liebes. Außerdem solltest du derlei Dinge nicht sagen.«
»Nein, wahrhaftig nicht. Der Vergleich war zu albern. Wer sah jemals ein Rebhuhn in purpurnem Federkleid? Nein, nein, Mama. Weißt du, wie du aussiehst? Wie eine Turteltaube.«
Mrs Darracott ließ die Bemerkung hingehen, und ihre Aufmerksamkeit, nie sehr beharrlich, wandte sich dem schimmernden Stoff ihres Kleides zu. Sie hatte es selbst verfertigt, aus Seide, die einem alten, bauchigen, auf dem Dachboden aufgestöberten Koffer entstammte, und das beachtliche Ergebnis ihrer Handfertigkeit befriedigte sie verzeihlicherweise nicht wenig. Zwar prangte das Modell auf einem der Farbdrucke des »Modespiegels« vom Vormonat – Mrs Darracott hatte es jedoch insoweit verfeinert, als der Chenilleputz des Originals durch überaus kunstreich gearbeitete Brüsseler Spitze – ein Überbleibsel ihrer Aussteuer – ersetzt worden war. Ihr Schwiegervater mochte sie ruhig »Gans« schimpfen, nicht einmal er hätte zu leugnen vermocht – wäre ihm auf diesem Gebiet das geringste Verständnis beschieden gewesen –, dass sie mit Nadel und Faden aufs Beste umzugehen verstand. Außerdem war Mrs Darracott eine bemerkenswert hübsche Frau, mit niedlicher, vollschlanker Figur, großen blauen Augen und Fluten blonden Haars, die sie unter vorteilhaften Käppchen verbarg. Seit dem Tag, da Mrs Darracott den ersten Verdacht eines Doppelkinnansatzes geschöpft hatte, schneiderte sie nur mehr Kopfbedeckungen, die unter dem Kinn, oder – kühner – hinter dem Ohr zu binden waren, und zwar mit bewundernswertem Ergebnis. Antheas Mutter war weder gebildet noch klug. Aber sie brachte es zuwege, sich mithilfe einer dürftigen Börse aufs Beste zu kleiden, und ihre geschickten Finger machten wett, was ihr an Mitteln fehlte. Und nicht ein einziges Mal während der zwölf Jahre ihrer Witwenschaft hatte sie vor der Schroffheit des Schwiegervaters die Waffen gestreckt, noch vor den zahlreichen Unzukömmlichkeiten, die ihre Lage mit sich brachte. Mrs. Darracott blieb unverändert liebenswürdig und ließ sich, von Veranlagung fröhlich und optimistisch, von Sorgen, denen abzuhelfen nicht in ihrer Macht stand, niemals verdrießen.
Anthea, ihre Tochter – Mrs Darracott liebte sie zärtlich –, zählte schon zweiundzwanzig Jahre und war noch immer ledig. Richmond, ihr Sohn – Mrs. Darracott betete ihn an –, stöhnte in rastloser Untätigkeit, des Großvaters Launen zu Gebot. Mrs Darracott erkannte diese Verhältnisse als durchaus beklagenswert. Aber sie konnte sich dennoch des Gefühls nicht entschlagen, dass etwas geschehen würde, das alles in Ordnung brächte. Kein Wunder, dass sie daher ohne allzu große Schwierigkeit in der Lage war, trübe Gedanken beiseitezuschieben und ihre Besorgnis geringeren, lösbaren Problemen zuzuwenden. Eines von letzteren kam ihr durch Antheas Frage wieder zum Bewusstsein, und sie sagte sehr ernst, während sie eine Falte der purpurfarbenen Seide zurechtstrich: »Es wird überaus unangenehm sein, Liebes.«
»Was? Der Weberssohn?«
»Oh, der! Nein, nein – der arme Junge. Obgleich es sehr unangenehm sein wird, ihn hier zu haben. – Nein, ich dachte an deine Tante Aurelia. Zweifellos wird sie erwarten, uns beide in Trauer zu finden, du weißt, wie genau sie es nimmt, mit allem und jedem – ich versichere dir, sie wird es überaus sonderbar finden, dass wir nicht Schwarz tragen, ja, unschicklich.«
»Durchaus nicht«, versetzte Anthea ungerührt, »Großvater wird sie nämlich sofort auf das Schärfste zur Rede stellen, welche Ursache sie eigentlich habe, Trauer zu tragen, und ihr ferner mitteilen, was er von Frauen hält, die sich wie Krähen auftakeln. Also wird sie unschwer verstehen, warum wir beide wohlweislich farbige Kleider wählten.« Mrs Darracott betrachtete die Tochter zweifelnd. »Gewiss – ja – aber – auf deinen Großvater ist doch kein Verlass. Ich finde, wir sollten zumindest schwarze Bänder anstecken.«
»Also schön, Mama, wir stecken an, was du willst – ich werde es jedenfalls tun –, vorausgesetzt, dass du aufhörst, dich mit solchen Nichtigkeiten abzugeben, und mir vom Weberssohn erzählst und dem Onkel, der nicht erwähnt werden darf.«
»Aber ich weiß nicht das Geringste!«, widersprach Mrs Darracott. »Außer, dass er der zweitälteste Bruder war, nach dem armen Granville – und der Lieblingssohn deines Großvaters. Deshalb geriet Großpapa in Wut – pflegte dein Papa zu sagen, obwohl ich, für meinen Teil, nicht glauben kann, dass Großpapa zu Granvilles Bruder auch nur die geringste Zuneigung hegte. Denn niemals, niemals könnte ich mich dazu verstehen, meinen Sohn aus dem Haus zu jagen – und wenn er ein Dutzend Weberstöchter geheiratet hätte.«
»Oh, dann bliebe uns wohl keine andere Wahl, als ihn zu verstoßen«, bemerkte Anthea, »wenn er ein Dutzend geheiratet hätte. Das wäre sehr ungenügsam – und überaus peinlich. Komm, komm, schau nicht so böse. Stirnrunzeln steht dir nicht. Außerdem bin ich von jetzt an ganz ernst. Ich verspreche es. Das hat mein Onkel also getan? Eine Weberstochter geheiratet?«
»So viel ich weiß«, erwiderte Mrs Darracott vorsichtig. »All das geschah, bevor ich deinen Papa heiratete, also bin ich nicht gänzlich sicher. Im Übrigen hätte Papa mir niemals davon erzählt, wäre nicht die Anzeige von Hughs Tod in der Gazette erschienen, und hätte er nicht gefürchtet, ich läse sie und würde mich dazu äußern.«
»Wann starb er, Mama?«
»Das kann ich dir zufällig sagen. Er starb nämlich in meinem Hochzeitsjahr, und wir waren eben von der Hochzeitsreise zurückgekommen, um uns hier niederzulassen. 1793. Hugh fiel in der Schlacht, der Arme, wo, weiß ich nicht mehr, nur, dass es irgendwo in Holland war. Dort muss es wohl Krieg gegeben haben, denn er war Offizier. Und es würde mich durchaus nicht wundern, Anthea, wenn das der Grund wäre, warum dein Großvater Richmond um keinen Preis zur Armee lassen will: nicht, weil Hugh fiel – das meine ich nicht –, sondern weil man ihn, wäre er nicht beim Militär gewesen, niemals in Yorkshire stationiert hätte! Und wäre er nicht dort stationiert gewesen, hätte er dieses Frauenzimmer nie kennengelernt, geschweige denn geehelicht – bedenke doch! Eine so verhängnisvolle Beziehung! Sie dürfte eine vulgäre, ordinäre Person gewesen sein, aus Huddersfield, was sagst du, und ich muss gestehen, wirklich nicht die Art Frau, die man seinem Sohn wünschen würde.«
»Nein, durchaus nicht«, pflichtete Anthea bei. »Was in aller Welt mag ihn nur dazu bewogen haben? Einen Darracott noch dazu!«
»Ja, das fragt man sich, Liebes. Das Unbesonnenste, was er tun konnte! Denn er durfte doch wirklich nicht annehmen, dein Großvater würde solch hausträubende Mésalliance jemals verzeihen! Du weißt doch, wie überlegen er auf durch und durch achtbare Leute herabsieht – niemals die Hauptstadt besucht, weil er findet, sie sei ‹Tummelplatz aller Stutzer und Parvenus›! Nie, das muss ich schon sagen, nie habe ich jemanden gesehen, der sich selbst so hoch eingeschätzt hätte wie dein Großvater – und wenn dann der eigene Sohn eine Weberstochter heimführt – das muss hart sein.«
»Und noch härter, den Sohn dieser Weberstochter als Erben begrüßen zu sollen«, sagte Anthea. »Kein Wunder, dass er die letzten Monate herumgeschlichen ist wie ein Bär an der Kette. Glaubst du, er wusste, wie sich die Sache verhielt, als Oliver und Onkel ertranken? War er deshalb so unfassbar zornig? Aber warum ließ er sich so lange Zeit? Warum nur? Oh, es ist aufreizend, wenn man bedenkt, dass er es nicht sagen wird, und dass wir zu feig sind, ihn geradeheraus zu fragen!«
»Vielleicht verrät er es Richmond«, meinte Mrs Darracott hoffnungsvoll.
»Nein«, versetzte Anthea und schüttelte entschieden den Kopf, »Richmond wird ihn nicht fragen. Richmond stellt niemals Fragen, von denen er im Vorhinein weiß, dass Großvater sie nicht beantworten wird. Ebenso wenig streitet er mit ihm noch widerspricht er ihm jemals.«
»Der liebe Richmond«, seufzte Mrs Darracott zärtlich, »sicher gibt’s auf der ganzen Welt keinen besser erzogenen Jungen.«
»Jedenfalls keinen gefügigeren Enkel«, bemerkte Anthea nicht eben freundlich.
»Ja, das ist er«, stimmte ihre Mutter zu. »Manches Mal setzt er mich fast in Erstaunen, weißt du. Im Allgemeinen sind junge Männer durchaus nicht so gefällig, nachgiebig und gleichbleibend freundlich. Noch dazu, wo es ihm bei Gott nicht an Mut fehlt.«
»Nein«, sagte Anthea. »An Mut fehlt es ihm nicht.«
»Er hat eben das sanfteste Gemüt unter der Sonne«, fuhr Mrs Darracott fort. »Das ist es. Bedenk doch – wie entgegenkommend von ihm, Abend für Abend mit Großvater Schach zu spielen, wo’s auf der Welt kaum etwas Langweiligeres gibt! Und ich möchte wissen, wie viele armeenärrische Burschen, die nur eines im Kopf haben – ein Offizierspatent –, sich so prächtig benommen hätten wie er – als dein Großvater ihm verbot, an etwas Derartiges auch nur zu denken! Ja, ich stehe nicht an, dir zu vertrauen, meine Liebe, dass ich tagelang kein Auge schloss. So sehr fürchtete ich, Richmond würde etwas Närrisches, Unüberlegtes tun. Denn schließlich ist er ein Darracott! Selbst dein Onkel Matthew war in seiner Jugend überaus ungestüm.« Mrs Darracot seufzte. »Armer Richmond! Ich weiß, es war ein schwerer Schlag für ihn! – Du darfst mir glauben, es zerriss mir das Herz, ihn so rastlos, so melancholisch zu sehen. Ein Glück, dass das endlich vorbei ist! Es wäre über meine Kräfte gegangen, hätte dein Großvater ihm gestattet, sich zur Armee zu melden. Wohl eine Bubenlaune – sonst nichts.«
Anthea sah auf, als wollte sie sprechen, schien sich jedoch eines Besseren zu besinnen und machte den Mund wieder zu.
»Ja, glaub mir«, sagte Mrs Darracott behaglich, »ist er erst einmal in Oxford, so denkt er nicht mehr daran. Gott, wird er mir fehlen! Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne ihn anfangen werde.«
Die Falte zwischen Antheas Brauen vertiefte sich. Dann, nach kurzem Zögern, sagte das junge Mädchen: »Mama – Studieren ist für Richmond nicht das Richtige, glaub mir. Er versagte schon einmal – und was mich betrifft, so glaube ich, er wird wieder versagen. Denn er hat nicht den Wunsch, zu bestehen. Jetzt ist September, das heißt, wenn er nach Oxford geht – falls er nach Oxford geht –, ist er neunzehn vorbei, und wird noch ein Jahr hier vertan haben.«
»Nichts dergleichen«, unterbrach Mrs Darracott, prompt zur Stelle, wenn es galt, ihrem Abgott zu Hilfe zu eilen. »Er wird studieren, wird sich vorbereiten –«
»Oh«, sagte Anthea mit ausdrucksloser Stimme, warf einen unsicheren Blick auf die Mutter, zögerte wieder und sagte schließlich: »Soll ich Licht bringen lassen, Mama?«
Mrs Darracott, damit beschäftigt, den zerrissenen Spitzenbesatz eines Unterrocks mit exquisiten Stichen auszubessern, nickte, und wenig später waren beide Damen emsig beschäftigt: die ältere mit Nadel und Faden, die jüngere mit einem Stück Pappe, das sie, der neuesten Mode entsprechend, zu einem Pompadour in Form einer etruskischen Vase zu verarbeiten gedachte. Sofern man dem »Modespiegel« Glauben schenken durfte, konnte jede »gewandte Dame« das erstrebte Ergebnis unschwer erzielen. »Was mich in dem trüben Argwohn bestärkt, jeglicher Gewandtheit zu ermangeln«, bemerkte Anthea. »Ganz abgesehen davon, dass ich zehn Daumen besitzen müsste!«
Sie legte ihre Arbeit beiseite, da Chollacombe das Teetablett brachte.
»Wenn du sie erst bemalt hast, wird die Tasche sehr elegant aussehen«, tröstete Mrs Darracott, blickte auf und sah, dass Richmond dem Butler folgte. Ihr Gesicht leuchtete auf.
»Oh, Richmond! Du kommst, mit uns Tee zu trinken. Wie reizend von dir!« Ein Gedanke streifte sie, und ihre Miene erfuhr eine wahrhaft erheiternde Veränderung. »Kommt vielleicht auch dein Großvater, Liebling?«
Richmond verneinte, aber in seinen Augen blitzte es belustigt auf. Anthea sah es sehr wohl. Mrs Darracott jedoch, mit minder scharfer Beobachtungsgabe gesegnet, sagte erleichtert: »Nein, das tut er ja selten, nicht wahr? Danke, Chollacombe. Das ist alles. Komm, Richmond. Nimm Platz und erzähle!«
»Was? Vom Weberssohn? Bedaure. Großpapa riss mir fast den Kopf ab, also spielten wir Tricktrack, ich gewann, und dann sagte er, ich solle mich trollen – er wünsche mit dir zu sprechen, Mama.«
«Du bist wirklich ein Nichtsnutz!«, bemerkte Anthea. »Achtung, Mama. Du verschüttest den Tee. Sei unbesorgt! Gewiss will er dich nur mit einer Unzahl von Anordnungen bombardieren – wie wir den Erben empfangen sollen, und so weiter.«
»Ja«, stimmte Mrs Darracott bei, rasch gefasst, »natürlich. Ich frage mich nur, ob ich sogleich zu ihm soll oder –«
»Nein, Mama«, versetzte Anthea mit fester Stimme, »zuallererst trinkst du deinen Tee.« – Und zu Richmond: »Ließ er denn nicht ein Wort verlauten, Richmond? Über unseren unbekannten Vetter?«
»Ach, nur, dass er bei der Armee ist, dass er in Frankreich war, mit der Besatzung, als Onkel Granville ertrank, und dass er geschrieben hat, er würde uns besuchen – übermorgen.«
»Das war wohl der Brief, den James vom Postamt brachte«, rief Mrs Darracott aus, »nun, wenigstens kann er schreiben, der arme junge Mann! Ja, ich kann mir nicht helfen, ich muss ihn bedauern – obgleich ich mir selbstredend nicht verhehle, wie betrüblich es ist – für uns alle –, dass es ihn gibt. Aber dafür kann ihn dein Großvater ja nicht verantwortlich machen.«
»Schäm dich, Mama. Du unterschätzt meinen Großvater auf die leichtfertigste Weise! Und ob er kann!«
Mrs Darracott konnte nicht umhin, diese Feststellung zu belachen, allerdings nicht ohne verweisend den Kopf zu schütteln und ihrer allzu lebhaften Tochter zu bedeuten, sie dürfe von ihrem Großvater nicht gar so keck sprechen.
Dann leerte sie ihre Tasse, ersuchte Richmond, nicht eher zu Bett zu gehen, als bis sie von der Prüfung zurückkehrte, die ihrer harrte, und verließ die Bibliothek.
Anthea erhob sich, füllte ihre Tasse aufs Neue, blickte auf Richmond hinab, der in einem tiefen Lehnstuhl saß, nachlässig und müde, und ein Gähnen erstickte.
»Du scheinst nicht eben munter zu sein. Schläfst du?«
»Nein – ja – ich weiß nicht – ich hatte wieder einmal eine schlimme Nacht, das wird’s wohl sein – mach kein Aufhebens und sag um Gottes willen kein Wort zu Mama!«
»Wie freundlich von dir, mich zu warnen«, bemerkte Anthea und ließ sich auf den leeren Lehnstuhl der Mutter nieder, »eben wollte ich Mama nachlaufen – allerdings nicht, ohne dir vorerst Beruhigungstropfen zu holen.«
Richmond grinste. »Nur nicht übertreiben.« – Und er setzte hinzu: »Was Großpapa wohl von ihr will?«
»Ich weiß nicht. Aber was immer es sei – ich hoffe, er sagt es ihr höflich. Wie konntest du einfach dasitzen, Richmond, vorhin beim Abendessen – und zulassen, dass er so mit ihr sprach! In diesem Ton!«
»Kann ich ihn hindern? Ich bin, weiß Gott, zu vernünftig, ihn so aufzureizen wie du. Außerdem weißt du genau, dass der Gedanke, er könnte über dich oder mich wütend werden, Mama nur entsetzlich aufregt.«
»Aber er lässt’s einen nicht entgelten, wenn man mit gleicher Münze heimzahlt«, wandte Anthea ein. »Wenigstens eine Tugend, die man ihm zugestehen muss; die einzige übrigens.«
»Dich vielleicht nicht«, sagte Richmond. »Aber du bist eine Frau. Da liegen die Dinge ganz anders.«
»Das glaube ich nicht. Unser Papa war ihm seit jeher lieber als Onkel Matthew oder Onkel Granville. Aber wie oft die zwei stritten, das kann ich dir gar nicht sagen. Du wirst dich wohl nicht mehr daran erinnern, aber ich –«
»Und ob ich mich daran erinnere!«, unterbrach Richmond. »Großpapa schmähte Papa, als sei er der ärgste Strolch, Papa schrie zurück wie ein Tollhäusler, und alle zwei brüllten, dass die Fenster klirrten. Daran sollte ich mich nicht erinnern? Ich erinnere mich bestens daran, und viel zu gut, das kannst du mir glauben, um mich der Behandlung auszusetzen, die Papa einstecken musste! Das lass dir gesagt sein.«
Anthea betrachtete ihn mit seltsamer Neugier. »Du fürchtest dich doch nicht vor ihm? «
»Nein, ganz und gar nicht. Aber ich hasse das Gekläffe und Geschrei, wenn er in Wut gerät. Außerdem ist es zwecklos, Großpapa zu reizen: du erlangst damit nichts von ihm, nicht das Geringste. Und ich schwör dir: mir gibt er mehr, als Papa je bekam!«
Anthea bedachte, dass dies der Wahrheit entsprach. Lord Darracott, den jeder Penny schmerzte, den er anderen Zwecken als seinem eigenen Wohl opfern musste, leistete den Launen seines geliebten Enkels bereitwillig Vorschub, auch den verrücktesten. Richtete Schmeicheln nichts aus, misslang es Richmond nur selten, ihn auf andere Weise gefügig zu machen, und zwar, indem er in Trübsal verfiel. Solcherart war er in den Besitz des herrlichen, feurigen Füllens gelangt, das er persönlich zähmen und zureiten durfte. Erst hatte Richmond vergebens gebettelt. »Soll ich zuschauen, wie du dir den Hals brichst, Junge?« – Richmond war nicht weiter in seinen Großvater gedrungen, und selbst eine so gewiegte Beobachterin wie seine ältere Schwester hätte ihn unmöglich des Trotzens bezichtigen können. Er war gelehrig wie stets, zeigte sich dem Großvater gegenüber unvermindert zuvorkommend, ließ kein Wort der Klage hören. Allein, er gab jedermann zu verstehen, dass seine Lebensgeister arg darniederlagen. Zwei Wochen Melancholie – von Mrs. Darracotts Verzweiflungsanfällen ganz zu schweigen –, und das Pferd war erobert. Alles sei besser, fand Lord Darracott, als den Jungen so lustlos dahinsiechen zu sehen.
Ähnliche Taktik hatte Richmond ein Segelboot eingebracht. Um ihn der stummen Verzweiflung zu entreißen, in die Mylords Weigerung, dem Enkel jemals ein Offizierspatent zu kaufen, Richmond gestürzt hatte, opferte Lord Darracott schließlich den ansehnlichen Kaufpreis des schmucken Kutters.
Plötzlich fragte sich Anthea, ob er etwa von Anfang an nur nach dem Segler gestrebt hatte, und sie fragte unvermittelt, forschenden Blicks: »Willst du eigentlich nach wie vor zur Armee, Richmond?«
Richmond – er hatte nach einer Wochenzeitschrift gegriffen und durchblätterte sie – blickte rasch auf, und seine ausdrucksvollen Augen blitzten. »Und ob! Ich habe nichts anderes im Kopf.«
»Ja, aber...«
»Gib dir keine Mühe. Warum ich ‹verzichtet› habe? Nicht das tue – oder dies – oder jenes? Weil ich haargenau weiß, dass nichts, nichts, was ich tun oder sagen könnte, Großpapa je überzeugen wird! Darum. Ich bin minderjährig – und wenn du dir einbildest, ich geh auf und davon und ‹unter die Soldaten› – für des Königs Handgeld –, dann sind das echte Weiberflausen und sonst gar nichts. So will ich nicht zur Armee, als Gemeiner, verstehst du? Ich – ach was. Reden wir von was anderem. Ich will nicht davon sprechen – das ist aus und vorbei. Wer weiß, hätte es mir überhaupt gefallen...«
Er wandte sich wieder der Zeitung zu, mit ungeduldigem Achselzucken, und Anthea, die wusste, es würde sinnlos sein, das Gespräch weiterzuführen, sagte kein Wort mehr. Dennoch empfand sie tiefe Besorgnis, und nicht zum ersten Mal.
Zugegeben, Richmond war halsstarrig und verwöhnt, doch sie liebte den Bruder und war klug genug zu erkennen, dass diese Fehler seiner Erziehung entsprachen, einer »Erziehung«, für die nur ein Mensch verantwortlich war: Lord Darracott.
Antheas Bruder war ein schwächlicher Knabe gewesen, die sichere Beute jeglicher Kinderkrankheit, nicht die Art Junge kurzum, dem man den Ehrenplatz in Lord Darracotts Herz prophezeit hätte. Seine Lordschaft hatte ihn kaum beachtet, bis er nicht umhinkonnte, zu erkennen, dass dem winzigen, kränklichen Knirps wahre Tollkühnheit innewohnte. Seit jenem Tag – ein schreckensbleicher Reitknecht hatte den kleinen Knaben zu Mylord gebracht, der unentwegt brüllte »Loslassen! Loslassen! Ich kann reiten, ich kann!« – und Seiner Lordschaft zitternd mitgeteilt, dass sein kleiner Enkel (wie, wusste man weder, noch vermochte man es sich vorzustellen) eines der Jagdpferde erklettert und glücklich zum Stalltor manövriert hatte, das auf die Straße führte – betete er Richmond an. Des Kleinen Knochen waren heil. Er war nur ein wenig betäubt vom prompten Sturz und arg zerschunden. Aber er schrie nichtsdestoweniger: »Loslassen! Loslassen! Ich werde ihn reiten! Jawohl!«
Mylord war selbst ein Mensch von eisernem Mut. Es überraschte und entzückte ihn, an dem Schwächling der Familie eine Kühnheit zu entdecken, die es nur mit der seinen aufnehmen konnte. Vorbei die Beschwerden über »winselnde Bälger« und »elende Schreihälse«. Von nun an wurde der kleine Richmond von seinem Großvater nur mehr ein »wohlgeratener Junge« genannt, der »munter sei wie ein Zicklein«, und Mylord, der zeit seines Lebens kaum einen Tag im Krankenbett verbracht hatte, zeigte nur zu bald, was seinen Liebling betraf, solch übertriebene Ängstlichkeit, dass jene der liebenden Mutter weit in den Schatten gestellt wurde. Arme Mrs Darracott! Eben noch mit dem Stigma behaftet, eine alberne, »in den eigenen Balg vernarrte« Person zu sein, sah sie sich plötzlich, zu ihrer nicht unbeträchtlichen Verwirrung, in eine »Rabenmutter« verwandelt, deren roher Lieblosigkeit jede einzelne der Krankheiten ihres Söhnchens zugeschrieben werden musste. Dennoch nahm sie den Wandel mit Seelenstärke hin, zu dankbar für den Gefühlsumschwung Seiner Lordschaft, als dass sie die widerfahrene Ungerechtigkeit ernstlich übel genommen hätte. Sie fürchtete seit Langem den Tag, da sie ihren kränkelnden Sohn nach Eton schicken musste. Und als er endlich herankam, bestimmte Mylord – nicht sie –, dass Richmond unbedingt daheim unterwiesen werden müsse, ein Entschluss, den Anthea, vier Jahre älter als Richmond, voll und ganz billigte. Ein Glück, dass Richmond den Härten des Internats entging. Erst später, viel später, erkannte das junge Mädchen, dass der elfjährige Richmond längst keiner Schonung mehr bedurfte. Jetzt, knapp achtzehn, war Richmond zweifellos ein magerer Junge, schien aber an nichts anderem zu leiden als an chronischer Schlaflosigkeit. Schon als Kind war er beim geringsten Geräusch hellwach geworden, und diese Überempfindlichkeit schien auch dem Jüngling treu zu bleiben. Kein Wunder, dass Richmond sein Schlafgemach so weit abseits wie möglich gewählt hatte, seine Tür versperrte und seiner besorgten Familie verbot, der Tür nahe zu kommen, sobald er einmal schlief. Ein Wunsch, dem niemand zuwiderhandelte. Doch nur Anthea argwöhnte, dass Richmonds Verbot weniger der Unfähigkeit entsprang, einschlafen zu können, sobald man ihn weckte, als der stark ausgeprägten Abneigung gegen Angebote, die sich von heißen Ziegeln über Laudanumtropfen und stärkende Suppen bis zu bitteren Tränken erstreckten. Niemand, der unter Schlaflosigkeit litt, dachte Anthea – jedoch im Stillen –, konnte so tatendurstig sein wie Richmond.
Zwar – er sah diesmal richtig verschlafen aus, gähnte von Zeit zu Zeit beim Durchblättern der Zeitung. Da er jedoch sein Tagewerk damit begonnen hatte, seine Jagdhunde zu trainieren, den Morgen damit zugebracht hatte, sich im Traben zu üben, seine Schwester bei mehreren Partien Federball vernichtend zu schlagen, sich sodann in ein Rübenfeld zu verfrachten, wo er etliche Kaninchen schoss, wäre es überraschend gewesen, hätte der junge Mann am Abend nicht etwas müde gewirkt.
Er blickte von der Zeitung auf – ein Gedanke streifte ihn – und sagte, fast koboldhaft in seiner Erheiterung: »Ich möchte nicht in seiner Haut stecken! Du?«
»In der unseres unbekannten Vetters? Nein, wahrhaftig nicht! Wenn er sich nicht zu benehmen weiß, wird Großpapa sich abscheulich aufführen, und wir alle werden uns schämen müssen – in Grund und Boden. Was meinst du wohl, Richmond? Wie sieht er aus? Wenn er beim Militär ist, kann er doch nicht ganz so vulgär sein. Glaubst du nicht? Es sei denn ... Guter Gott! Er wird doch kein gemeiner Soldat sein? Was glaubst du?«
»Ein Dragoner? Nein, natürlich – Gott, daran dachte ich gar nicht!« Richmond sagte es beinahe ehrfurchtsvoll. Und er fügte hinzu: »Wenn er wirklich nur Dragoner ist, wird hier die Hölle los sein! Ob mein Onkel wohl weiß, was ihn erwartet? Und Vincent! Weißt du, Anthea, Onkel Matthew ist mir ganz gleichgültig. Aber ich finde, es ist eine Schande und Schweinerei, dass Vincent von diesem Kerl um sein Erbe gebracht wird!«
Anthea erwiderte nichts, denn in diesem Augenblick kehrte Mrs Darracott in den Salon zurück.
Kapitel 2
Anthea und Richmond sahen auf den ersten Blick, dass ihre Mutter nicht deshalb zu Lord Darracott befohlen worden war, um Alltäglichkeiten mit ihm zu besprechen, wie etwa die für den Empfang des Erben zu treffenden Vorbereitungen. Sie wirkte leicht benommen. Als Anthea jedoch fragte, ob Seine Lordschaft sich unliebenswürdig gezeigt hätte, erwiderte sie, nicht wenig erregt: »Nein – nein! Ganz und gar nicht! Ich meine – außer, dass – nicht dass ich es besonders beachtet hätte – es war wirklich nicht ärger als gewöhnlich – ich meine – ich bin vernünftig genug, mich über Kleinigkeiten nicht ungebührlich zu echauffieren. Dennoch muss ich gestehen, dass es mich durchaus nicht wundernimmt, wie sehr die Geschichte ihm zusetzt. Sie ist wirklich sehr peinlich! Aber wie dem auch sei – er gibt mir nicht die Schuld daran, wirklich nicht!«
»Das möchte ich mir wohl ausgebeten haben«, rief Anthea, halb erheitert, halb erzürnt. »Wie könnte er denn!«
»Gewiss, Liebes, da hast du ganz recht«, gestand Mrs Darracott zu, »das dachte ich auch, geriet aber trotzdem ein wenig außer Fassung, als Richmond bestellte, er wolle mich sprechen. Weil sich im Allgemeinen herausstellt, dass ich an Dingen Schuld trage, von denen ich nicht einmal weiß! Aber, wie gesagt – heute war es nicht so. Wo hab ich nur meinen Fingerhut? Ich muss diesen hässlichen Riss flicken, bevor deine Tante kommt.«
»Nein«, erklärte Anthea, »das wirst du nicht.« Und sie stellte das Arbeitskörbchen außer Reichweite ihrer Mutter. »Du gehst schwanger, Mama, mit großen Neuigkeiten!«
»Ich weiß nicht im Entferntesten, was dich auf einen solchen Gedanken bringt. Außerdem solltest du nicht so sprechen. Es ist höchst unschicklich.«
»Nicht halb so unschicklich wie der Versuch, seine Kinder aufs Eis zu führen. Komm, Mama! Komm! Du weißt genau, dass du es nicht zusammenbringst! Also: was hat Großpapa dir eröffnet? Erzähl es uns auf der Stelle.«
»Gar nichts«, behauptete die Witwe, mit lächerlich schuldbewusster Miene. »Guter Gott! Als ob er mir je das Geringste erzählte! Wie kommst du nur auf den absurden Gedanken!«
»Du unterschätzt uns wirklich!«, sagte Richmond anklagend.
»Du alberner Junge! Du bist genauso arg wie deine Schwester. Und was euer armer Papa dächte, könnte er euch so hören – daran will ich erst gar nicht denken. Im Übrigen solltest du längst zu Bett sein, Richmond. Du siehst abgezehrt aus!«
Eine Behauptung, die Mrs Darracotts gewalttätige Nachkommenschaft damit quittierte, dass sie sich auf die gute Dame stürzte und sie in einen Lehnstuhl drückte. Anthea sank auf einen Schemel zu ihren Füßen, und Richmond setzte sich auf die Lehne des Sessels.
»Und wir wollen erst gar nicht daran denken, was der arme Papa dazu sagte, dass du uns so hinhältst, Mama!«, versetzte Anthea. »Großpapa – gesteh’s nur! – hat dir über den Weberssohn alles erzählt.«
»Nein, nein! Hat er nicht! Glaubt mir doch! Er hat nichts über ihn gesagt – ich meine – nichts Näheres. Erst als ich mich aufraffte, ihn zu fragen, ob es ihn nicht hart getroffen hätte – ich meine –, vom Vorhandensein dieses jungen Mannes überhaupt zu erfahren – erwiderte er, er wüsste es seit je. Hättet ihr das nur für möglich gehalten, Kinder? Anscheinend setzte der unselige Hugh seinen Großvater vor siebenundzwanzig Jahren von der Geburt des kleinen Hugh in Kenntnis. Und bis heute hat euer Großvater kein Wort darüber verloren – zu keiner Seele! Es sei denn, er hätte Granville ins Vertrauen gezogen, aber ich bin vom Gegenteil überzeugt. Denn eure Tante Anne und ich waren eng befreundet. Sie hätte es mir sicher erzählt, wäre ihr das Geringste bekannt gewesen. Wie’s ihr wohl geht, der guten Seele? Und ob sie sich wohlfühlt, bei Tochter und Schwiegersohn? Sir John Caldbeck machte auf mich immer einen sehr guten Eindruck. Abgesehen davon fand Anne zweifellos alles erträglicher, als weiterhin hier zu wohnen. Und dabei war Großvater zu ihr weitaus höflicher als zu –«
»Gewiss, Mama«, unterbrach Anthea. »Aber das gehört nicht hierher. Großpapa wusste also seit jeher von dieser Sache. Dass er kein Wort darüber verlor, solange Granville und Oliver am Leben waren – das braucht uns nicht zu wundern. Dass er aber Onkel Matthew alle diese Monate im Glauben beließ, er sei der Erbe der Baronie – das ist wirklich zu arg! Und abgesehen davon ist es völlig verrückt. Oder hoffte Großpapa, der junge Mann sei inzwischen gestorben? Vergessen kann er ihn doch nicht haben?!«
»Nun, so viel ich verstanden habe, trug er sich mit dem Gedanken, Hughs Sohn zu enterben – sofern dies möglich wäre. Aber es erwies sich als unmöglich – wieso, weiß ich nicht, ich kenne mich mit Verlassenschaftsverfügungen nicht aus – vielleicht aufgrund einer Fideikommissbestimmung – nein, das war es nicht –, und natürlich hätte ich nicht im Traum daran gedacht, euren Großvater um Erklärungen zu bitten, denn nichts – ihr wisst ja – reizt ihn mehr, als wenn man Fragen stellt – obwohl ich wirklich nicht begreife, warum.«
»Ich habe noch nie gehört, dass man den Titelerben einfach übergehen kann«, gab Richmond zu bedenken.
»Dass Großpapa es nicht kann, scheint jedenfalls ziemlich klar«, sagte Anthea.
»Sequestration!«, rief Mrs Darracott strahlend. »Das war es! Ich wusste ja, es würde mir einfallen. Derlei Dinge fallen mir letzten Endes nämlich immer ein, ja, mitunter sogar mitten in der Nacht! Sequestration, das war der Ausdruck, den Großvater gebrauchte! Aber diese ‹Sequestration› ist leider nicht durchführbar. Also findet Großvater, es bleibe nichts anderes übrig, als sich mit dem jungen Mann abzufinden.«
»Das sagte er, Mama?«, fragte Anthea ungläubig.
»Ja«, nickte Mrs Darracott und fügte hastig hinzu: »Ich meine – darauf lief es hinaus.«
»Aber was sagte er?«, beharrte Richmond.
»Ach, das weiß ich wirklich nicht mehr so genau. Jedenfalls scheint er der Ansicht zu sein, dass es jederzeit mit ihm zu Ende gehen kann – obwohl ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, warum dies der Fall sein sollte – ich habe mein Lebtag niemand Gesünderen gesehen, und es würde mich durchaus nicht überraschen – Ach, lassen wir das. Mein Gott! Jetzt habe ich richtig vergessen, was ich eigentlich sagen wollte.«
»Dass es dich durchaus nicht überraschen würde, wenn er uns allesamt überlebte«, half Anthea bereitwillig aus.
»Ganz und gar nicht«, widersprach Mrs Darracott errötend. »Dieser Gedanke hat mich niemals gestreift.«
»Schwindlerin!«, erklärte Richmond, eine vorlaute Bemerkung, die er durch einen Kuss zu mildern suchte. »Du willst uns bloß aufs Eis führen, Mama. Aber wenn du glaubst, wir lassen uns – dann bist du ein Gänschen.«
»Richmond!«, mischte sich Anthea ein, überaus streng. »Wie oft soll Mama dir noch sagen, nicht so keck zu sein?«
»Ihr seid beide dumm und keck«, erklärte Mrs. Darracott und kämpfte gegen ihr aufsteigendes Lachen. »Ich brauche nur daran zu denken, was eure Tante Aurelia sagen wird, wenn ihr euch so unpassend ausdrückt! Da werde ich krank vor Angst!«
»Wir werden uns nicht unpassend ausdrücken, Mama«, versprach Anthea. »Denn wir sind uns wohl bewusst, dass jegliches schlechte Betragen unsererseits auf dich zurückfiele, und werden uns daher mit aller gebotenen Ziemlichkeit aufführen –«
»– vorausgesetzt, dass Mama endlich mit der Wahrheit herausrückt«, unterbrach Richmond.
»Oh, das versteht sich von selbst! Also, Mama: wie gedenkt Großpapa sich mit unserem neuen Vetter ‹abzufinden›?«
Mrs Darracott streckte die Waffen. »Meine Lieben – er scheint der Ansicht zu sein, es würde notwendig sein, den unseligen jungen Mann ‹zurechtzubiegen›. Zumindest erklärte er das.«
»‹Unselig› – das kann man wohl sagen.«
»Ja, auch ich muss sagen – man kann nicht umhin, ihn zu bedauern. Dennoch lässt sich nicht leugnen, dass es für deinen Großvater ein sehr harter Schlag ist – bedenkt doch! Von solch vulgärem Menschen beerbt zu werden! Das würde selbst mich sehr stören, und der Himmel weiß – ich halte mich nicht für halb so bedeutend wie euer Großvater. Und wie peinlich es sein wird! Zwar hoffte ich, als ich erfuhr, der junge Hugh sei bei der Armee, er würde vielleicht doch ein Gentleman sein, aber euer Großvater sagt, die Armee steckt voller Parvenus, Möchtegern-Aristokraten, so nennt er sie – weil der Krieg doch kein Ende nahm und man immer neue Streitkräfte brauchte – obwohl mir nicht klar ist, woher er das eigentlich weiß, da er sich doch nie von zu Hause wegrührt. Und zu allem Überfluss ist der junge Mann nicht beim richtigen Regiment.«
»Was?«, rief Richmond und redete sich in Feuer. »Er ist beim 95.! Bei der Leichten Division! Möchte wissen, was daran ‹nicht richtig› sein soll.«
»Du weißt, Liebling, ich verstehe nichts von diesen Dingen, aber Großpapa sagte, die sei zu ‹modern› – und das erklärt seine Abneigung zur Genüge.«
»Wenn das der Ton ist, den Großvater anzuschlagen gedenkt, wird er sich lächerlicher machen, als unser neuer Vetter je könnte – und wenn er der ärgste Tölpel ist! Wie kann man so altmodisch sein! So arrogant!«
»Komm, Richmond, reg dich nicht auf«, empfahl seine Schwester, »du glaubst doch nicht ernstlich, dass für einen Darracott etwas anderes infrage kommt als ein Kavallerieregiment, oder – allenfalls – die Königliche Garde.«
»Unsinn«, sagte Richmond. »Ich will nicht behaupten, dass ich nicht selbst gern Kavallerist wäre, aber wenn das nicht geht – ich meine, nicht ginge, wäre ich viel lieber ein ‹Leichter› als irgendwas anderes auf der Welt! Und wenn Großvater sich tatsächlich abfällig äußern sollte – o Gott! Dann weiß ich wirklich nicht, wo ich hinschauen soll! Glaubst du, ist dieser Hugh nach Talavera mitmarschiert? Dann wäre er nämlich –« Er verstummte, des verzweifelten Blicks seiner Mutter gewahr. »Na schön.« Er zuckte die Achseln. »Weiter nicht wichtig. Ich hoffe nur, Großvater macht sich nicht lächerlich. Komm, erzähl weiter, Mama. Wie soll unser Vetter ‹zurechtgebogen› werden? Beabsichtigt Großvater, diese Arbeit persönlich in Angriff zu nehmen? Dann wird das unglückliche Opfer wohl die erstbeste Gelegenheit ergreifen, dem Haus seiner Väter zu entfliehen.«
»Nein«, sagte Mrs Darracott, »ich meine – ich bin überzeugt, euer Großvater hat nicht die Absicht, selbst zu – ich meine, er sagte etwas davon, dass Vincent wohl imstande sein würde, seinen unbekannten Vetter in die gewünschte Form zu bringen.«
»Vincent? Wird er nie tun!«, sagte Richmond mit Überzeugung.
»Gott – ich meine – euer Großvater, das steht jedenfalls fest, wünscht ausdrücklich, dass wir dem jungen Mann freundlich begegnen.« Mrs Darracott bemerkte, dass ihre Kinder sie ungläubig ansahen. Röte stieg in ihr Gesicht. Sie zupfte den Schal zurecht, der ihre Schultern bedeckte, und erklärte, ein wenig zu unbekümmert: »Und das ehrt ihn, jawohl, und ist durchaus nicht, was man von ihm erwartet hätte. Der arme junge Mann! Ich meine euren Vetter, nicht Großpapa! Sicherlich wird er sich sehr fehl am Platze fühlen, und wir werden unser Bestes tun müssen, um es ihm halbwegs behaglich zu machen. Ich jedenfalls bin dazu entschlossen, und ich hoffe sehr, dass auch du es bist, liebste Anthea. Großpapa legt besonderen Wert darauf, dass du dich seiner annimmst. Davon abgesehen, besteht natürlich nicht der leiseste Grund, dass du es nicht tun solltest. Nicht, dass ich etwa andeuten will –« Zwei Augenpaare – von bemerkenswert schönem Grau – blickten sie unverwandt an. Mrs Darracott vermochte den Satz nicht zu vollenden und stürzte sich in den nächsten. »Mein Gott, wie spät es schon ist! Anthea, Liebes –«
»Mama!«, rief Anthea anklagend, «entweder du erzählst auf der Stelle, was Großpapa gesagt hat, oder ich gehe in die Bibliothek und frage ihn.«
Diese furchtbare Drohung beraubte Mrs Darracott jeglicher Fassung. Sie schalt, weinte, versicherte, dass Mylord überhaupt nichts gesagt hätte, und schloss diesen Bericht mit der Mitteilung, Mylord hätte den glücklichen Gedanken gefasst, zwischen seinem »möchtegern-aristokratischen« Erben und seiner einzigen ledigen Enkelin eine Verbindung zu stiften. »Damit die Sache in der Familie bleibt«, erläuterte sie ernsthaft.
Mehr brauchte es nicht: Richmond brach in brüllendes Gelächter aus. Seine Schwester hingegen, sonst überaus humorbegabt, widerstand mit Leichtigkeit der Versuchung, seine Heiterkeit zu teilen. In unheilverkündendem Schweigen wartete sie, bis seine Fröhlichkeit nachließ, blickte dann bald auf ihn, bald auf die Mutter und fragte schließlich, sehr beherrscht: »Kommt dir zuweilen in den Sinn, Mama, dass mein Großvater irr ist?«
»Zuweilen? Sehr oft!«, beruhigte Mrs Darracott ihre Tochter. »Das heißt – oh, mein Gott, was sag ich denn da! Natürlich nicht. Er ist vielleicht etwas exzentrisch –«
»Exzentrisch? Er ist ein Tollhäusler! Und was seine Ansichten betrifft, so stammen sie aus dem schwärzesten Mittelalter.« Anthea war offenbar entschlossen, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. »Das ist wirklich der Gipfel, mein Wort!«
»Ich fürchtete ja, es würde dir nicht recht sein«, stimmte Mrs. Darracott zu, sehr unglücklich. Und sie wandte sich an Richmond: »Wenn du nicht bald zu lachen aufhörst, kriegst du noch Keuchhusten! Törichter Junge! Da gibt’s nichts zu lachen!«
»Lass ihn ruhig Keuchhusten kriegen, Mama! Vielleicht erstickt er noch!«
Mrs Darracott, entsetzt von solch fühllosen Worten, warf einen prüfenden Blick auf Antheas erhitztes Gesicht und hielt es für das klügste, Richmond fortzuschicken. Er ging, aber dennoch währte es eine gute Weile, ehe Antheas Entrüstung verebbte. Sie war aufgesprungen und strich durchs Zimmer, in einer hastigen, ungestümen Art, die Mrs Darracott nichts Gutes verhieß. Aber schließlich fasste sie sich und sagte, zwar noch erzürnt, aber immerhin schon imstande, über sich selbst zu lachen: »Ich sollte wirklich nicht so dumm sein, mich derartig aufzuregen, nur weil der entsetzliche Alte das oder jenes sagt! Vergib, Mama, aber weißt du, es macht mich so wütend, wenn er sich aufführt, als sei er der Großmogul und wir ein Pack Sklaven. Ich soll also den Weberssohn heiraten, was? Dass auf meine Meinung in dieser Sache offenbar verzichtet wird, nehme ich hiermit zur Kenntnis. Und was ist mit ihm? Hat der Weberssohn Recht auf Meinung? Weiß er bereits, welch ein Schicksal hier seiner harrt?«
»Oh, nein! Das heißt – ich meine – ich war so frei, deinen Großvater darauf hinzuweisen, aber er sagte – du kennst ihn doch –, der bedauernswerte junge Mann würde tun ‹wie geheißen›.«
»Wird er auch!«, sagte Anthea. »Das heißt – er wird es probieren. Oh, der arme Teufel! Ich bedauere ihn von ganzem Herzen! So jämmerlich fehl am Platz, und schon in der Feuerlinie! Großpapa wird höchstens fünf Minuten benötigen, um ihn vollends zu entnerven. Oh, Mama, es ist infam! Hast du Großvater auch gesagt, ich würde diesen Machenschaften nie zustimmen?«
»Nun – das nicht gerade –« gestand Mrs Darracott mit heftigem Missbehagen, »um dir die Wahrheit zu sagen, Liebes, ich war so überrumpelt –«
Anthea war bereits auf dem Weg zur Türe. »Dann werde ich es tun. Und zwar sofort.«
Ein Schrei der Herzensangst ließ sie jäh stehen bleiben. »Anthea! Ich verbiete dir – flehe dich an – Er würde toben! Würde dir sagen, dass er mir auftrug, kein Wort darüber zu verlieren – was er auch tat –«
Anthea konnte dieser Bitte nicht unzugänglich bleiben. Sie verharrte regungslos.
Mrs Darracott nützte ihren Vorteil und sprach emsig weiter: »Liebes – du bist doch so vernünftig – wirst es dir reiflich überlegen, bevor du irgend – nicht, dass ich dich zu irgendetwas drängen möchte – ich meine – wenn es dir nicht gefällt, brauchst du ihn ja nicht zu heiraten, und ich verspreche dir, dass ich nie – nie – Aber was willst du denn tun, Anthea? Ich bin ganz verzweifelt, wann immer ich daran denke! Oh, mein liebstes Kind! Jetzt bist du zweiundzwanzig – und wie kannst du jemals auf ein standesgemäßes Angebot hoffen, wenn du niemals mit Menschen zusammenkommst! Immer hier in der Einsamkeit sitzest, nur mit deiner Familie? Weißt du, was Großvater sagt? Du hättest, als er die Güte hatte, deinen Aufenthalt in London während der ‹Saison› zu finanzieren, all deine Chancen vertan. Also müsstest du dich mit dem Gatten zufriedengeben, den er für dich aussucht.«
»Während meines Aufenthaltes in London bekam ich zwei Heiratsanträge«, sagte Anthea mit ausdrucksloser Stimme. »Den ersten von einem Witwer. Er war alt genug, mein Vater zu sein. Den zweiten vom jungen Oversley. Er ist nicht eben eine Leuchte. Aber abgesehen davon, hatte er die feste Absicht, im elterlichen Haus weiterzuwohnen. Und zwischen Großpapa und Lady Aberford dürfte kein allzu großer Unterschied bestehen. Ich habe nicht umsonst miterlebt, was du alles ausstehen musstest, Mama.«
Mrs Darracott seufzte. »Mein liebes Kind! Ich bin die Letzte, die dich in solcher Lage sehen möchte, das weiß der Himmel!«
»Der Einzige, für den ich eine Art Attachement empfand, war Jack Froyle«, fuhr Anthea nachdenklich fort, »aber wie du weißt, war Jack gezwungen, nach einer reichen Partie Ausschau zu halten. Und da meine Mitgift dank dem nur zu gut bekannten Leichtsinn der Darracotts bestenfalls armselig genannt werden kann... Zieht Großpapa auch diesen Umstand in Betracht, wenn er von meinen ‹vertanen Chancen› spricht? «
»Nein«, erwiderte Mrs Darracott mit überraschender Bitternis, »tut er nicht. Aber ich. Und es stimmt mich sehr traurig. Und deshalb meine ich auch – ich kann mir nicht helfen –, dass du dich gegen den Plan deines Großvaters vielleicht nicht von allem Anfang gar so entschieden stellen solltest. Ich meine – warte doch wenigstens, bis du ihn siehst – kennengelernt hast – Sollte eine Verbindung sich als ganz unmöglich erweisen, dann selbstverständlich... Aber – ein halber Darracott ist er doch schließlich!«
»Und das ist genau die Hälfte, auf die ich mit Freuden verzichte.«
»Ja, ja – aber – du wärest versorgt!«, gab Mrs Darracott zu bedenken. »Denn selbst wenn der junge Mann ein Tropf ist – und ich hoffe zu Gott, dass er es nicht sei –, so bleibt deine Stellung als Lady Darracott unantastbar. Anthea – ich ertrage es nicht, dich hinwelken zu sehen – zu einer alten Jungfer!«
Dieser leidenschaftliche Ausruf nötigte Anthea ein Lächeln ab. Mrs Darracott jedoch, der durchaus nicht zum Scherzen zumute war, fuhr ernsthaft fort: »Das muss ich doch fürchten, Liebes, wo dich kein einziger standesgemäßer Freier auch nur zu Gesicht bekommt! Früher, da war es noch anders. Die gute Anne versprach mir, sie würde dich zu sich nach London einladen, sobald sie einmal Elizabeth und Caroline versorgt hätte. Ja, ja – sie stimmte mir in dieser Sache voll und ganz bei. Jetzt aber, seit Onkel Granville tot und sie nach Gloucestershire übersiedelt ist, wäre es sinnlos, auf sie zu zählen. Was Aurelia betrifft, so hat sie selbst noch zwei Töchter unter die Haube zu bringen, und – Gott, freilich könnte ich meinem Bruder schreiben, aber –«
»Kommt gar nicht infrage!«, rief Anthea. »Onkel ist der gütigste Mensch unter der Sonne – aber glaub mir, weit lieber welke ich zur alten Jungfer dahin, ehe ich nur einen Tag unter Tante Sarahs Dach verbringe! Im Übrigen glaube ich kaum, dass du sie dazu bewegen könntest, mich einzuladen.«
»Ja, da dürftest du recht haben. Eine bemerkenswert unsympathische Frau. Was soll also aus dir werden? Wenn Großvater stirbt, müssen wir Schloss Darracott verlassen. Das ist dir bekannt. Und was wird uns übrig bleiben, als eine Wohnung zu suchen? In einem schrecklichen Hinterhof? Ach, Anthea! Wir werden billigen Pudding essen, unsere Kleider wenden müssen –«
Eine Lachsalve zerriss diese düsteren Prophezeiungen. »Hör auf, Mama, hör auf, oder du verfällst in unheilbare Melancholie! Wir werden nichts dergleichen tun, ganz im Gegenteil. Wir werden uns als marchan-des-de-mode etablieren – bei deiner Geschicklichkeit als Näherin – und meiner als Erzeugerin eleganter Handtaschen! In Bath, zum Beispiel: kein großes, aber ein überaus distinguiertes Geschäft. Wie sollen wir’s nennen? ‹Darracott›? Um die Familie wild zu machen? Oder ‹Elvira›? Das klänge noch distinguierter, nicht wahr? Ja, kein Zweifel: ‹Elvira›, das wäre ein Riesenerfolg. Ein einziges Jahr – und schon kauft jede elegante Dame bei uns, denn wir werden so wahnsinnig teuer sein, dass kein Mensch an unserer Vornehmheit zweifeln wird.«
Ein unsinniger Gedanke, den Mrs Darracott weit von sich wies, obgleich sie nicht umhin konnte, ihn überaus anziehend zu finden. Anthea ermutigte ihre Mutter nach Kräften, das Luftschloss weiter auszubauen, und mit Erfolg: bald hatte sie die Genugtuung, die beeinflussbare Dame fröhlich und hoffnungsvoll zu sehen. Und nicht eher wurde des unbekannten Vetters wieder gedacht, als bis die Damen zu Bett gingen. Der junge Hugh kam Mrs Darracott in den Sinn, als sie nach der Kerze griff, und sie war so frei, Anthea zu ersuchen, die Angelegenheit ihrem Großvater gegenüber nicht zu erwähnen. Eine Bitte, die Anthea zu Mrs Darracotts unbeschreiblicher Erleichterung mit einem begütigenden Kuss und einem Klaps auf die Schulter erwiderte. »Nein«, sagte sie sodann, »es wäre ja zwecklos.«
Worauf die erfreute Mrs Darracott ruhigen Gemüts zu Bett ging. Am nächsten Morgen nahmen sie Haushaltspflichten voll und ganz in Anspruch, sodass sie ihre Aufmerksamkeit keinen anderen Problemen zuwenden konnte als jenen, welches Schlafgemach dem Erben zukam, wie man Lady Aurelia verbergen sollte, dass es im ganzen Haus kein ungeflicktes Laken mehr gab, und ob es dem Unterstallknecht wohl möglich sein werde, in Rye genügend Hummer aufzutreiben, um daraus, mithilfe entsprechender Garnierung, einen passenden zweiten Gang für das am selbigen Abend geplante Nachtessen abzugeben. Auch Mrs Flitwick – nicht nur Mrs. Darracott – wäre höchst dankbar und erfreut gewesen, hätte man ihr mitgeteilt, für wie viele Tage Mylord fünf Gäste auf Schloss Darracott gebeten hatte. Allein, keine der beiden Damen dachte auch nur eine Sekunde an die Möglichkeit, diesbezügliche Erkundigungen einzuholen. Außer einer rüden Antwort war von Lord Darracott nichts zu erwarten. Er würde außerstande sein zu verstehen, warum man sich um derlei bekümmerte – ebenso wenig, warum fünf Leute mehr oder weniger die Haushaltungskosten auch nur im Geringsten beeinflussen sollten. Da er es aber gleichzeitig äußerst übel aufnahm, wenn bei irgendeinem Gang weniger als sieben oder acht Gerichte auf den Tisch kamen, war die Aufgabe, für Mylord zu wirtschaften, nur einer der Arbeiten Herkules’ zu vergleichen. »Denn Sie wissen ja, Ma’am«, bemerkte Mrs Flitwick weise, »ich darf Godney um keinen Preis anweisen, das restliche Lammfleisch mit Bohnen zu mischen, oder gar ein paar Austern in Teig zu panieren. Seine Lordschaft erwartet, dass alles vom Besten sei.«
Bald stellte sich jedoch heraus, dass es etwas gab, auf dessen Erstklassigkeit Seine Lordschaft nicht den geringsten Wert legte. Als Mrs Darracott fragte, ob das Schlafgemach des armen Granville für dessen Nachfolger gerüstet werden sollte, lautete die ebenso wütende wie unmissverständliche Antwort, der Webersbalg würde sich glücklich schätzen – sowie fürstlich untergebracht –, wenn man sein Bett in einer der Dachkammern aufschlug.
Wenig später erschienen die ersten Gäste: Mr Matthew Darracott und Lady Aurelia; sie erreichten Schloss Darracott kurz nach Mittag in der eigenen, zweispännigen Reisekutsche. Die beiden waren am Vortag aufgebrochen und hatten die Nacht in Tonbridge verbracht.
Matthew, der dritte Sohn Seiner Lordschaft, hatte seinem Vater die wenigsten Mühen und Auslagen verursacht. Seine Jugendsünden – durchwegs lässlicher Art – hatte er entweder auf Anstiften seiner älteren Brüder oder nur deshalb begangen, um es ihnen gleichzutun; nur deshalb geheiratet; und von dem Tag, da er Lady Aurelia Holt zum Altar führte, ein ebenso untadeliges wie erfolggekröntes Leben geführt: Lady Aurelia, eine ausgezeichnete Partie, war nicht schön, ihr Vermögen jedoch beachtlich, ihre Verbindungen erstklassig. Außerdem verstand sie es auf das Beste, ihren Willen geltend zu machen. Es währte nicht lange, und Matthew, den Whig-Ketzereien seiner Jugend endgültig entwöhnt, landete, unter Führung seines wackeren Schwiegervaters, bescheiden, aber sicher auf der untersten Sprosse der politischen Leiter. Er machte stetige Fortschritte. Und wenn auch nur geringe Aussicht bestand, dass er die obersten Sprossen jemals erklimmen würde, war er nur einmal amtlos: während der kurzen Regierung »sämtlicher Talente«. Gut, es gab Leute, die nicht anstanden, seine dauernde Tätigkeit als Wichtigtuerei zu bezeichnen. Dass er sich jedoch seiner Pflichten mit pünktlichster Ehrenhaftigkeit entledigte, das konnte niemand bestreiten.
Solch wackerer Sohn, hätte man meinen mögen, wäre dem Herzen des Vaters – des politischen Anfalls ungeachtet – am nächsten gestanden. Nicht also. Lord Darracott fand Tugend langweilig und jeden verächtlich, der vor ihm Furcht hegte. Und Matthew, seit jeher der gefügigste seiner Söhne, zollte ihm noch immer eine Art ängstlicher Ehrerbietung. Dabei hatte ihn seine Heirat vom Vater so gut wie unabhängig gemacht. Aber er gehorchte den seltenen, darum nicht minder gebieterischen Vorladungen auf Schloss Darracott mit zitternder Bereitwilligkeit und sagte zu Seiner Lordschaft jeglicher Äußerung Ja und Amen. Und wie behandelte ihn Seine Lordschaft zum Dank für so große Treue? Er nannte ihn »Puddingherz«, mit weniger Courage als ein Hahn auf dem Mist. Und da Matthews Betragen weitgehend von den Anordnungen seiner ebenso selbstherrlichen wie peinlich gerechten Gattin bestimmt wurde, konnte Mylord seinen zahllosen Beleidigungen mit Fug und Recht die Bezeichnung »Pantoffelheld« hinzufügen.