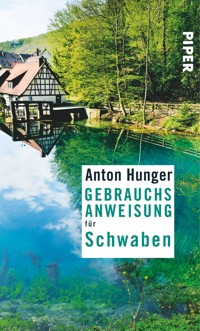11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Molino Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit feiner Ironie, philosophischem Ernst und Präzision entfaltet Anton Hunger eine Reflexion über das Leben im Angesicht der Endlichkeit. Er schreibt sich durch von literarischen Vorbildern wie Proust, Kafka und Roth, von Geistesmenschen wie Seneca und Heidegger bis zu Alltagsbeobachtungen zwischen Bestattungsritualen, Friedhöfen und Treppenliften. Ein Essay über Sprache, Würde und die Kunst, sich dem Unausweichlichen schreibend zu nähern. Ein Buch, das die Angst vor dem Ende nicht verdrängt, sondern in Literatur verwandelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Loslassen
Anton Hunger
Loslassen
Wie man das Alter mit Gelassenheit schafft
Essay
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Hunger, Anton
Loslassen
Wie man das Alter mit Gelassenheit schafft
Essay
Lektorat: Frank Brunner und Erdmann Wingert
Satz und Gestaltung: Jutta Nelißen
Umschlagmotiv: Hommage an die Nahe, Rüdiger Heins
Umschlaggestaltung: Molino GmbH
Projektberatung: Rüdiger Heins
Printed in Germany
Die Originalausgabe erschien in der Edition Maya
ISBN 978-3-911682-36-7 (gebunden)
eISBN 978-3-911682-42-8
© 2025 Anton Hunger, publiziert in der Molino GmbH,
Schwäbisch Hall und Sindelfingen
Alle Rechte vorbehalten.
Sobald wir alt werden, verkriecht sich die Schönheit nach innen
Ralph Waldo Emerson,
amerikanischer Schriftsteller, 1803 – 1882
INHALT
Der erste Satz
Das Alter kommt vor dem Ende
Über allen Gipfeln ist Ruh
Der Charme der Treppenlifte
Placebo-Effekt Aberglaube
Jopi Heesters mag's intim – bis zuletzt
Das Paradies ist ein einziges Wunderland
Der Weltuntergang und die Wiedergeburt
Ein Bausparvertrag für die Zeugen Jehovas
In aller Stille beigesetzt
Leichenschmaus nach Römer-Art: cena funeris
Selig sind die, die lachen können
Das Schicksal darf man nicht herausfordern
Graf und das Leben seiner Mutter
Die Schlacht um Dien Bien Phu
Beim Tod entweicht die Seele aus dem Körper
Das Sein bestimmt das Bewusstsein
Altsein ist durchgeformte Reife
Giuseppe Verdi kannte keine Jogginghosen
Es lohnt sich zu leben
Die Frau mit dem Moped
Die Faszination von Autorennen im Alter
Der alte Mann und sein Haus am See
Lebenskunst ist anstrengend
Das Jüngste Gericht
Trau keinem über dreißig
Das Vergehen der Zeit
Der Tod kennt keinen Kalender
Die Angst vor dem Alter überwinden
Nachwort
Vita
Der erste Satz
Alt wird man, wenn man nicht vorher stirbt, und dann tritt der Tod ins Leben.
Der Satz ist ein Gemeinplatz. Jeder weiß, was auf ihn zukommt, auch wenn das Unvermeidliche Angst einflößt. Man will halt, wie Woody Allen einmal sagte, „nicht gerne dabei sein“, wenn es soweit ist. Im besten Fall ist man schon sehr alt, hat die längste Strecke des Lebens hinter sich, halt noch nicht die ganze. Auf der Zielgeraden ahnt man die Zeit, wann abgewunken wird. Man ist dem Tod aber nicht hilflos ausgeliefert. Die Begleitumstände des Ablebens kann man im Alter gestalten, selbst wenn man sie in der Holzbox nicht mehr mitbekommt. Im Hier und Jetzt aber zu wissen, dass die Regie dereinst festgelegten Regeln folgen wird, ist für Sterbende eine letzte Genugtuung. Schließlich wird ihre Sache verhandelt – „tua res agitur“. Die Niederschrift des letzten Willens für die Bestattungszeremonie ist eine sinnliche Beschäftigung, Hinterbliebene könnten sie sogar als hilfreich empfinden. Am besten schreibt man noch eine Botschaft an den Pfarrer oder den Trauerredner, wie sich das Leben rückblickend zu neuen Bildern formte. Gerne geschönt, Trauerreden sind keine Anklagen. Und wenn man die Anzeige
oder die Trauerkarte selbst formuliert, müssen sich die Hinterbliebenen nicht mit den vielfach verwendeten Textbausteinen aus dem Poesie-Album des Bestatters herumplagen.
Die Todesanzeige, mit der mich meine Hinterbliebenen verabschieden sollen, ziert das Wort des römischen Dichters Horaz: „Littera scripta manet“ – „Das geschriebene Wort bleibt“. Es wird der erste Satz meines Nachrufs sein, ein Angebot, den Text zu lesen. Marcel Proust beginnt seinen monumentalen Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit mit dem Satz: „Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen.“ Die Aussage ist nicht aufregend, sie schmiedet in ihrer Banalität aber einen Pakt mit dem Leser: Nicht loslassen! Ähnlich Franz Kafka, der seinen Proceß mit den Worten beginnt: „Jemand musste Josef K. verleumdet haben…“ Ein Klassiker! Feuilletonisten zitieren ihn rauf und runter.
Die Nachkommen kennen meine Neigung zum Schreiben, manche schätzen sie sogar. Deshalb lege ich Ihnen zu Lebzeiten das lateinische Gelehrtenzitat ans Herz. Ich mag das Dichterwort, es entspricht meiner Berufung, meinem Leben, vor allem in leicht abgewandelter Form: „Das gedruckte Wort bleibt“: Schriftsetzerlehre und journalistisches Volontariat bei der Südwest-Presse, Redakteur bei der Stuttgarter Zeitung, stellvertretender Chefredakteur beim Industriemagazin, Kommunikator bei Porsche, Schriftsteller von vier Romanen und acht Sachbüchern. Mein Leben ist ohne Druck und Papier nicht vorstellbar.
William Caxton war der erste englische Buchdrucker. Er verwendete das Horaz-Wort für seine Werbung um Kunden. Es ist nicht überliefert, ob er damit Erfolg hatte. Man weiß noch nicht einmal wann genau er lebte, irgendwann im 15. Jahrhundert. Aber das Zitat ist mächtig. Caxton beherrschte die Kunst der Kommunikation, der er auf Papier Beständigkeit verschaffte. Beständigkeit auf Papier reicht über den Tod hinaus.
Es gibt im Leben helle und dunkle Tage, im Alter tauchen sie aus der Versenkung auf. Meinen Universitätsabschluss als Volkswirt erlebte ich wie den Eintritt in ein zweites Leben. Fast war ich seinerzeit geneigt mir einzubilden, als notwendigen Schritt der Menschwerdung. Ein Anfall von Hybris, Menschwerdung hat schließlich nichts mit akademischen Weihen zu tun. Aber das Gehirn schüttete massenhaft Glückshormone aus, die angenehmen Botenstoffe erfassten den ganzen Körper. Ich fühlte mich belohnt, dem Berufswunsch Journalist stand nichts mehr im Wege. Ein heller Tag. Mit den Jahren ging ich damit weniger weihevoll um. Dunkler wurde es, als ich mich einer Herzoperation unterziehen musste, ein Bypass wurde mir gelegt. Später wurde ein Prostata-Karzinom entdeckt – Krebs! Alles, was wichtig war, verlor schlagartig an Gewicht. Zwei Jahre zuvor erlitt meine Frau einen Schlaganfall, eine neue Erfahrung auch für mich. Die rechte Seite des bis dahin starken Körpers lahmte. Das schnelle Eingreifen der Ärzte verhinderte Schlimmeres. Mein Krebs war nach vierzig Bestrahlungen besiegt. Das Prinzip Hoffnung reichte immerhin zu einer philosophischen Rettung: „Nichts wird so heiß gegessen wie gekocht.“ Der Tod ist mit dem Schicksal eine Liaison eingegangen, aber wenn es das Schicksal gut meint, muss der Tod warten. Die Wahrheit über das Leben auch, sie „kommt am Ende auf den Tisch“, wie Heinrich Bedford-Strohm, ehemaliger Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche, dem Spiegel verriet: „Mit den hellen und dunklen Seiten.“
Worin besteht der Sinn des Lebens, wenn man am Ende doch stirbt? Bestattern stellt sich die Frage nicht, ihr Geschäft brummt, wenn der Tod ins Leben tritt. Was vorher war interessiert Leute, die getragene Worte über die Verblichenen finden müssen. Leben ist immer eine Achterbahnfahrt zwischen „Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt“, wie es Goethe sah, zwischen „Freiheit und Unfreiheit“, wie es Kafka verstand. „Verstehen“ könne man das Leben nur „rückwärts“, lehrte der dänische Philosoph Sören Kierkegaard und wies das „Verstehen“ der Zukunft weit von sich: „Leben muss man vorwärts.“ Leben! Kein Verstehen, kein Wissen um das, was kommt. Zukunft ist immer eine zwiespältige Wahrnehmung, selbst im Alter, wenn man das Ende spürt. Schwankend zwischen Freiheit und Unfreiheit.
Franz Kafka, einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dichter des zwanzigsten Jahrhunderts, war von seinem Vater in hohem Maße abhängig, er fühlte sich in seiner Gegenwart nicht frei. „Ich war ja schon niedergedrückt durch Deine bloße Körperlichkeit“, schrieb er ihm. Seine Abscheu vor der Ehe war nicht minder ausgeprägt, in einer geordneten Beziehung sah er das Ende der Freiheit. Kafka, der durchaus die Gesellschaft von Freunden schätzte, sprach über sich vom „Zwang zur Einsamkeit“. Nur dem „Alleinsein“ hätte er seine schriftstellerischen Leistungen zu verdanken. Beim Schreiben könne es „nicht genug still um einen sein.“
Altsein kannte er nicht, er starb mit vierzig Jahren. Philipp Roths Roman Das sterbende Tier handelt von einem ergrauten Professor, der Seminare über Literaturkritik hält und mit Fernsehauftritten einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. Für weibliche Schönheit ist er empfänglich: „Die oberen beiden Knöpfe der Seidenbluse sind geöffnet, so dass man sehen kann, dass sie ausladende, wunderschöne Brüste hat.“ Es ist die Liebesbeziehung eines alten Mannes zu der viel jüngeren Consuela. Eines Mannes, der mit den Jahren die Hinfälligkeit des Körpers spürt: „Ein junger Mann wird sie finden und sie mir wegnehmen.“ Altersweisheit kann nicht treffender formuliert sein. Auf einer Party kommt er Consuela näher: „Wir standen dicht nebeneinander in meinem Arbeitszimmer, wo ich ihr ein Kafka-Manuskript gezeigt hatte, drei handschriftliche Seiten, eine Rede, die er als Versicherungsangestellter anlässlich der Feier zur Pensionierung des Direktors gehalten hatte.“ Consuela ist fasziniert. Sein Altsein, das ihn belastet, stört sie nicht. Für ihn scheinen die letzten Jahre eine neue Erfahrung zu sein: „Man weiß ja nichts über das Alter, ehe man selbst dort ankommt.“
„Manchmal tut es weh, zu leben“, sagt der norwegische Schriftsteller Karl Ove Knausgard, „aber es gibt immer etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Meinst du, du kannst dir das merken?“ Ich versuche, mir das zu merken.
Das Alter kommt vor dem Ende
Den Tod erlebte ich zum ersten Mal bei meinem Großvater. Als ich dazukam, lag er aufgebahrt in seinem Bett. Das Schlafzimmer hinterließ den tristen Eindruck eines Vorhofes für das unbekannte Jenseits, kein Bild störte die weiß gekalkten Wände. Über dem Bett hing lediglich ein schlichtes Holzkreuz. Seinen besten Anzug, ein dunkelgraues Kleidungsstück, hatte ihm meine Großmutter angezogen, sogar eine Krawatte zum weißen Hemd hatte sie ihm gebunden. Er sah aus, als ob er noch lebte, die Augen geschlossen wie im Schlafzustand. Ich berührte ihn, spürte nach seinem Atem, fühlte seinen Puls – nichts tat sich. Er hatte sich verabschiedet. Meine Gedanken kreisten um die Frage, wie es mit ihm nun weiterginge? Auf welche Reise wird er sich begeben? Damals im Alter von gerade mal fünfzehn Jahren, war ich aufgrund katholischer Erziehung gläubig. Die Antwort war klar, sie hilft über den Schrecken der Gewissheit hinweg: Priester, Sterbesakramente, Gebete, das himmlische Paradies. Alles hatte seine Ordnung. Heute bin ich nicht mehr gläubig, einfacher wird die Antwort dadurch nicht.
Meine Großmutter öffnete die Nachttischschublade und holte zwei Goldmünzen heraus. Eine sei für mich, die andere für meinen Cousin. Das hätte der Großvater verfügt. Es war nicht viel, lediglich eine Viertel Unze. Aber als ich das Goldstück mit dem Ahorn-Blatt-Motiv, dem Maple Leaf, in den Händen hielt, meinte ich ein Lächeln auf seinem Gesicht zu entdecken.
In jungen Jahren schuftete mein Großvater in einem Steinbruch, besuchte an Wochenenden volkswirtschaftliche Seminare an einer Gewerkschaftsschule in Regensburg und las in seiner kargen Freizeit philosophische Bücher. Später wurde er zum Bürgermeister seiner kleinen Heimatgemeinde im Bayerischen Wald gewählt. Nach dem Krieg machte er sich mit einer Kiesbaggerei selbständig, Kies war in den Zeiten des Wiederaufbaus eine begehrte Ressource. Auch im Alter ließ sein Tatendrang nicht nach. Er engagierte sich im Fremdenverkehrsverein, hielt sich ein paar Schafe und einen Karpfenteich. Den Kirschbaum im Garten beschnitt er jedes Jahr. Die Goldmünze bedeutete mir weniger als die handschriftlichen Briefe, die ich aufbewahrt habe und in denen er mir Mut machte. In einem Brief wagte er sogar eine Prophezeiung, die sich bewahrheitete: „Vielleicht wirst Du eines Tages sogar ein guter Journalist.“ Ich absolvierte zu jener Zeit gerade meine Schriftsetzerlehre beim Metzinger-Uracher Volksblatt, einer Lokalausgabe der Südwest-Presse, und spielte mit dem Gedanken, später in eine Redaktion einzutreten. Mein Großvater wusste davon, er kannte meine Leidenschaft fürs Schreiben. Journalist wurde ich, ob ein „guter“ müssen andere entscheiden.
Im schlicht möblierten Wohnzimmer warteten die Trauergäste, die ihm die letzte Ehre erweisen wollten. Ihre Beileidsbekundungen wirkten bemüht. Mitleidige Blicke, halbherzige Umarmungen und die gebetsmühlenartigen Rituale der Trauerbezeugung schienen eingespielt. Es war, wie man es halt so macht, wenn sich einer aus dem Kreis der Vertrauten auf die große Reise begibt. Ohne eine Adresse zu hinterlassen.
Über das Altsein zu philosophieren, kann zur Lust werden. Warum hätten sich sonst zahllose Dichter und Denker damit beschäftigt? Goethe reimte: „Ich hör es gern, wenn auch die Jugend plappert: das Neue klingt, das Alte klappert.“ Oder die Schriftstellerin Helga Schubert: „So darf ein Leben ausatmen.“ Oder Ciceros Redenschreiber Cato: „Alle wollen es erreichen, doch wenn es erreicht ist, klagen sie es an.“ Der Kirchenvater Augustinus schreibt in seiner Civitas Dei, der Mensch vergegenwärtige seinen Tod „vorlaufend“. Dem Leben in der Welt weist er nur eine „Rolle des Übergangs zu.“
Diese Geistesmenschen waren Meister in der Beobachtung der Lebenswirklichkeit alter Menschen. Es ist der Lebensabschnitt, den man durchschreitet, wenn man nicht in jungen Jahren stirbt. Oft werde ich gefragt, wie ich es mit dem Altsein halte? Meine Antwort überrascht die meisten: „Ich schreibe bis zum Tod. Das Alter ist für mich keine Beeinträchtigung.“ Es ist vielleicht Übermut, mag sein. Für mich ist es eher der Wille, nicht aufzugeben und im Alter noch das Beste herauszuholen. Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung sagte einmal: „Schreiben ist Glück. Warum schreibe ich? Weil es nicht Zeit und Kraft kostet, sondern Zeit und Kraft gibt.“ Schreiben ist erotisch, prickelnd. Niemand schaut einem dabei zu, es bleibt eine einsame Beschäftigung. Manche betrachten die Empfehlung, im Ruhestand weiter zu arbeiten, als Angriff auf die Mühe, eine Rente angespart zu haben. Der Sinn eines erfüllten Lebens ist für sie keine Kategorie. Aber der Sinn des Lebens ist Arbeit, gleich wie man Arbeit definiert. „Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's achtzig Jahre, und wenn's köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen“, gab uns Martin Luther in seiner Übersetzung des Psalms 90, Vers 10, mit auf den Weg. Soll heißen, nur Menschen, die fleißig sind und arbeiten, umweht ein Hauch von innerer Fröhlichkeit und Friedfertigkeit.
Ich bin in Bayern geboren, katholisch getauft, aber im protestantischen Schwabenland aufgewachsen. Das pietistische Arbeitsethos habe ich über Schullehrer, Berufsausbilder und dem Einfluss „schaffiger“ Schwaben verinnerlicht. Arbeit und Rechtschaffenheit ist für protestantische Schwaben nicht nur Voraussetzung für Wohlstand, sie ist vor allem der Schlüssel für das Tor zum Paradies. Wirtschaftlicher Erfolg verspricht Erlösung, sichert die Gnade Gottes. Es ist eine asketische Leistungsphilosophie, die sich tief in die Seele der Schwaben eingegraben hat. Der Sozialökonom Max Weber adelte die religiöse Verzichts-Gemeinde mit seinem Standardwerk Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Die „protestantische Ethik“ sei eine der „entscheidenden Wurzeln der typisch abendländischen Form des Wirtschaftens“, sie böte dem Kapitalismus eine „ideelle Grundlage“. Glaube und Askese, Beten und Arbeiten seien Voraussetzungen für Wohlstand. „Sobald das Leben in Genusssucht und Nachlässigkeit zerrinnt, merken wir erst unter dem Druck der letzten Notwendigkeit, dass es vergangen ist“, sagte nicht etwa ein Schwabe, sondern schrieb der spanische Philosoph Seneca in seinem Essay Von der Kürze des Lebens. Genusssucht und Nachlässigkeit haben von mir nicht Besitz ergriffen, auch wenn ich einen guten Tropfen schätze.
Die Kürze des Lebens mahnt uns auch, den richtigen Zeitpunkt für das Aufhören zu finden. Gerhard Schröder und Tony Blair kannten den Termin nicht, Helmut Kohl und Boris Johnson auch nicht. Konrad Adenauer wurde aus dem Amt gedrängt, die meisten Verteidigungsminister und -ministerinnen ebenso. Unzähligen Wirtschaftsführern wurde der Abschied vor dem Ende der Spielzeit nahegelegt: Herbert Diess von Volkswagen, Markus Duesmann von Audi, Carla Kriwet von Fresenius Medical Care oder Martina Merz von Thyssen-Krupp. Helmut Schmidt wurde mitten in seiner Amtszeit abgewählt, seinen Abgang inszenierte er mit Würde und avancierte im Alter zum „elder statesman“. Als Herausgeber der Wochenzeitung Die Zeit begann er ein neues Leben. Er hatte Talent für Niederlagen, das gewöhnlich Mächtigen abgeht. Donald Trump zerreißt der Amtsverlust, seine Agitation dagegen steigert sich in staatsgefährdenden Aufruhr, von seinen Anhängern ließ er sogar das Kapitol stürmen. Seine Verbalattacken auf alles, was er für minderwertig hält, verfing beim Wahlvolk: Trump hat den Präsidentenstuhl, das Amt, zurückerobert. Wladimir Putin scheint besessen zu sein, ewig Präsident spielen zu wollen. Im gesetzten Alter lässt er sich mit nacktem Oberkörper beim Angeln oder auf einem Pferd reitend ablichten, um seine „Unsterblichkeit“ zu beweisen. Sein Problem ist: Er kann sich ein Leben im Alter ohne Amt nicht vorstellen. Macht und Machtausübung beherrschen ihn, seine demonstrativ zur Schau gestellten Muskelpakete und die gespielte Männlichkeit sollen davon Zeugnis geben. Amtsverzicht ist für Menschen wie Trump oder Putin keine Option.
Christian Streich, der ehemalige Trainer des SC Freiburg, ist das schiere Gegenteil zu den Alphamännern. Der Mann hat Emotionen, ist bekannt für seine offenen Worte, auch zu gesellschaftspolitischen Themen. Vor Rechtspopulisten und Demokratiefeinden warnt er, auch auf Pressekonferenzen nach Fußballspielen. Seine Sprüche sind nicht weichgespült. Als es einmal auf dem Spielfeld nicht so gut lief, antwortete er einem Kritiker: „Am beschde: Machsch'de Fernseher aus.“ Mit seinen goldenen Händchen formte er die Kicker seines badischen Clubs zu einer Erfolgstruppe. Vor allem aber ist er geerdet, was ihm über die Fußballwelt hinaus große Sympathie verschaffte. Für die reichen Clubs hatte er nur Spott übrig: „Es motiviert uns, dass wir es anders machen als diejenigen, die einfach den Geldbeutel aufmachen.“
Streich erklärte im März 2024, dass er schon bald sein Amt als Fußballtrainer abgeben werde. Nach zwölf Jahren sei es Zeit, „Platz zu machen für neue Energien und neue Leute.“ Die Fußballwelt war überrascht, Streich war erst achtundfünfzig, erfolgreich und hätte locker noch ein paar Jahre dranhängen können. Aber der knorrige Trainer beherrscht die Kunst des Aufhörens, er kann sich ein Leben im Alter vorstellen. Auch ohne Amt.
Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern wusste ebenfalls, wann sie sich für das Amt überfordert fühlte. Auch Bundespräsident Horst Köhler dankte nach scheinheiliger Kritik aus Politik und Medien ab und verzichtete auf sein Amt. Es war eher ein Frustrücktritt wie bei seinem Nachfolger Christian Wulff. Rudolf Seiters übernahm die Verantwortung für den tödlichen Polizeieinsatz gegen einen RAF-Terroristen und demissionierte als Innenminister. David Cameron trat nach dem Brexit-Referendum zurück, es ging nicht so aus, wie er es sich vorstellte. Angela Merkel und Jürgen Trittin wussten auch, wann Schluss ist. Ebenso Papst Benedikt XVI., er legte sein kirchliches Amt nieder, als er seine Kräfte schwinden sah. Selbst Volker Bouffier, der frühere Ministerpräsident von Hessen, hörte die Stunde schlagen. Seinem Nachfolger Boris Rhein richtete er noch das Bett, bevor er abdankte. Auch Malu Dreyer, die rheinland-pfälzische Kollegin von Bouffier, hat das Kunststück eines guten Rücktritts geschafft. Sogar Joe Biden hat noch rechtzeitig die Reißleine gezogen, als seine geistigen und körperlichen Schwächen nicht mehr zu verbergen waren. Nichts wird vom Publikum so sehr gewürdigt, wie ein rechtzeitiger, freiwilliger Rücktritt, weil die meisten, die ihn schätzen, ihn selbst nicht tun würden.
Über allen Gipfeln ist Ruh
Wir waren eine kleine Truppe, vier weltlich orientierte Gleichgesinnte, die jedes Jahr über Christi Himmelfahrt Ausflüge unternahmen. Meistens enterten wir ein Plattbodenboot in Holland und schipperten übers Ijsselmeer mit Abstechern in anliegende Kanäle. Oder kreuzten mit einem Segelboot von Rijeka aus vor der Küste Kroatiens. Rijeka liegt im Norden des Landes, die Marina ist mit dem Auto gut an einem Tag erreichbar.
Ein Freund von mir, Autohändler in Padua, charterte für uns einmal einen Zweimastklipper, der im ligurischen La Spezia im Hafen lag. Zwei Besatzungsleute waren an Bord, die auch für das leibliche Wohl sorgten. Sie hielten zur Begrüßung Champagner bereit. Etwas übertrieben, dachte ich. Ein leichter Pinot Grigio täte es auch, sagte ich den Schiffsleuten, die meine Zurückweisung nicht verstanden. Prosecco hätten sie auch an Bord, antworteten sie. Ich war einverstanden.
„Was soll denn das?“, beschwerte sich Christian. „Uns wird Champagner angeboten und du verlangst nach Prosecco.“
„Champagner ist zu großspurig“, gab ich zu Bedenken. „In Italien trinkt man Prosecco.“
Rolf und Peter nippten am Glas, Christian war sauer und ließ demonstrativ sein Getränk stehen. „Das Leben ist zu kurz, um minderwertigen Sekt zu trinken“, grummelte er.
„Das fängt ja gut an“, stöhnte ich in die Runde und leerte mein Glas in einem Zug. Christian, eher schmächtig von Gestalt, nahm meinen Arm und flüsterte mir ins Ohr: „Du wirst sehen, die Skipper saufen den Champagner und feixen sich einen.“
Leinen los, jeder packte mit an. Der Trip ging über Porto Venere nach Riomaggiore. Die Steilhänge der Cinque Terre waren spektakulär. Das Segelschiff durchschnitt die spiegelglatte Wasseroberfläche wie ein scharfes Messer, eine leichte Brise schob uns nach vorne. Es waren verzückende Augenblicke, wir redeten nicht viel. Als die Besatzung um die Mittagszeit Parma-Schinken mit Melone servierten und hinterher Pulpo-Salat mit frischen Kräutern und Croutons, besserte sich die Stimmung. Statt eines Pinot Grigio schenkte einer der Schiffsführer einen Scaia Bianco vom Weingut Tenuta Sant' Antonio ein. Wir waren angekommen.
Nach dem Mahl schlich ich mich zu den Steuermännern. Tatsächlich, sie hatten eine Flasche Champagner geöffnet, labten sich an dem köstlich-prickelnden Getränk und waren bester Laune. Christian bestätigte ich seine Vermutung, der prompt konterte:
„Von Genusssucht scheinst du nicht befallen zu sein, ich hätte den Champagner gewählt.“
Ich ließ ihn abblitzen, seine Genusssucht empfand ich als verstörend. Er solle trinken, was aus dem Kühlfach gereicht werde, beschied ich ihm. Tat er dann, wenn auch widerwillig, hatte aber offensichtlich Gesprächsbedarf. Er insistierte nach meinem Tagesablauf: „Ich brauche meinen Rechner und meine Phantasie, damit beschäftige ich mich“, sagte ich. Christian, der Das fliehende Pferd