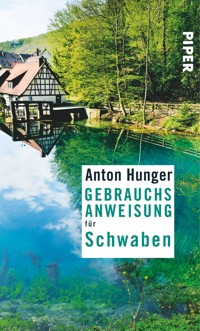
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Schwabenland ist der ewige Konjunkturzünder Deutschlands, die Heimat berühmter Dichter, Mäzene und Automarken, prämierter Rotweine und Designeroutlets, gefeierter Sterneköche und des bisher einzigen grünen Ministerpräsidenten Deutschlands. Anton Hunger zeigt den ganzen Charme des Ländles zwischen Stuttgart und Friedrichshafen, Tübingen und Marbach, Bietigheim und Metzingen, zwischen Blautopf und Neckar. Er begibt sich nonder, nuff und mitten nei. Dechiffriert die berüchtigtste Mundart des Landes, enthüllt das Wesen der schwäbischen Hausfrau und lüftet die Geheimnisse der Maultaschenconnection. Und er ergründet das Naturell des schwäbischen Protests: von den Bauernkriegen über Friedrich Hecker bis zu »Stuttgart 21«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-97283-3
Juli 2016
Überarbeitete und erweiterte Neuausgabe 2016
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2007, 2011 und 2016
Coverkonzept: Büro Hamburg
Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, Egling
Covermotiv: Blautopf, Blaubeuren (Andreas Strauß/Look-foto)
Karte: cartomedia, Karlsruhe
Datenkonvertierung: le-tex publishing services, Leipzig
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Der Schwabe und sein Schwabenland
Ja freilich.
Mit den Schwaben kennt man sich aus im großen deutschen Vaterland. Da kann jeder mitreden. Das sind doch die Nachkommen jener tölpelhaften Sieben Schwaben, die vor einem Häslein flohen, weil sie es für ein Ungeheuer mit feurigen Augen hielten. Das sind doch die Urenkel jenes famosen Götz von Berlichingen, der laut Goethe dem Hauptmann der kaiserlichen Armee bestellen ließ, er könne ihn am, will sagen im – na ja, der Rest ist bekannt. Und schließlich sind das jene etwas beschränkten, weil maulfaulen Leute, die sogar die Schotten in puncto Geiz übertreffen. Dazu noch ein paar Zeilen aus Ludwig Uhlands Ballade »Schwäbische Kunde« über ungemein wirksame Schwertstreiche (»Als Kaiser Rotbart lobesam, zum heil’gen Land gezogen kam«), ein paar dahingeschnaufte Zitate des ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss, ein röhrender Porsche, unweit daneben der leuchtende Mercedesstern – und fertig ist das Schwabenbild.
Putzige Leutchen sind das da drunten im tiefen Süden, angesiedelt zwischen Hefezopf und Kuckucksuhr. Stellen sich abends mit dem Bauch an den Kachelofen, um das Mittagessen aufzuwärmen, haben dem schnurlosen Telefon den Namen gegeben, weil einer von ihnen fragte: »Hän’di koi Kabel?«, schwäbeln unverständlich durch die Nase und bemühen mit ihrem dauernden »Grüß Gott, grüß Gott« den Namen des Herrn.
Oha, jetzt geht uns aber gleich der Gaul durch. Deshalb ein paar kleine Korrekturen. Zum Beispiel die, dass sich unter den sagenhaften Sieben Schwaben zwar zwei Allgäuer, der Überlinger Seehas, der Bopfinger Gelbfüßler und der Nestelschwab aus dem Breisgau befanden, aber kein einziges Neckartäler Mannsbild. Zum Beispiel zweitens, dass der Götz von Berlichingen genau genommen kein Schwabe war, sondern ein Franke. Und dass der göttliche Gruß keine Blasphemie ist, sondern ein Relikt aus besseren, frommeren Zeiten: »Gott grüße dich« – und das soll ja besagen: Gott segne dich. Außerdem ist das Schwabenland, wie der Theologe und Historiker Christian Gottlob Barth schon 1843 festgestellt hat, neben Palästina das einzige »gelobte Land«. Und sei es nur, »weil es kein besseres gibt in der ganzen Welt, und weil es wenigstens von den Schwaben gelobt wird, wenn es auch niemand sonst loben wollte«.
Auf der Roten Liste
Leider stirbt dieses Wissen langsam aus. Längst stehen die richtigen Schwaben auf der feuerroten Liste der bedrohten Arten. Nehmen wir einfach einmal ein spezielles Biotop, die Landeshauptstadt Stuttgart, als Muster für eine kleine Bestandsaufnahme.
Rund 600 000 Einwohner hat die Stadt an Neckarfluss und Nesenbach. Doch wer glaubt, er werde auf der Königstraße mit ganzen Schwabenrotten konfrontiert, der irrt sich. Schließlich kommt jeder vierte Stuttgarter aus Italien, Spanien, Griechenland, Kroatien, der Türkei oder sonst woher. Mehr als die Hälfte der verbliebenen 450 000 Deutschen besteht längst aus Preußen, Hessen, Badenern, Westfalen, Nieder- und anderen Sachsen, die alle ihre eigene Mundart importiert haben. Von den 200 000 Einheimischen ist die Hälfte auf Dienstreise oder im Urlaub, und wiederum die Hälfte der übrig gebliebenen 100 000 steckt auf den Autobahnen 8 und 81 im Stau. Ziehen wir von den 50 000 die Kinder und die Alten ab, bleiben gerade noch 25 000 Präsenzschwaben übrig – doch 22 000 davon sind durch den Einfluss von Vorschulerziehung, Fernsehen und dem streng »proissisch« parlierenden Südwestrundfunk sprachlich längst deformiert. Wobei preußisch alles ist, was nicht schwäbisch, badisch oder bairisch klingt. Jedenfalls sind selbst viele gebürtige Schwaben heute außerstande, ihr Losungswort »O’a’g’nehm« korrekt auszusprechen.
Blieben theoretisch gerade noch 3000 waschechte schwäbische Stuttgarter übrig, doch leider sind die meisten von denen nach Hamburg oder Berlin ausgewandert, wo sie als Manager, Drehbuchautoren, Prominentenfriseure, Journalisten oder Wirte Entwicklungshilfe für den Rest der Republik leisten. Man sieht, die paar Leutchen, die als kernfeste Schwaben durchgehen, könnte man in einer Untertürkheimer oder Cannstatter Weinbeiz unterbringen.
Das war einmal ganz anders. Oder eigentlich doch nicht. Die Schwaben sind sich zwar ganz sicher, wie ihr Musterländle einstmals erschaffen wurde. Es war nämlich so, dass der liebe Gott am siebten Schöpfungstag von seinem Landschaftsmaterial noch die schönsten Batzen übrig hatte und daraus, sozusagen im Freilauf, ein abwechslungsreiches Stück Erde schuf – mit Bergen und Tälern, Seen und Flüssen, Wäldern, Wiesen und ein paar besonders hübschen Misthaufen zur Dekoration. Ein Musterländle halt. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass der frühere Ministerpräsident Erwin Teufel das Wort »Ländle« gern als rufschädigende Verkleinerung ausmerzen wollte. Und auch nichts, dass die Badener behaupten, die Schwaben seien ganz anders entstanden: Der liebe Gott habe auf dem Feldberg, mit Blickrichtung Rhein sitzend, lauter schöne Badener geschnitzt. Die missratenen Exemplare habe er hinter sich geworfen, über den Schwarzwald hinüber ins Württembergische. Na ja, so sehen es halt unsere badischen Freunde.
Migranten, wohin man blickt
Wie die Schwaben wirklich zu den Schwaben wurden, darüber gibt es viele Theorien, weshalb wir es kurz machen wollen. Kaum war das Jurameer unter Hinterlassung zahlreicher Fossilien und Kalkberge abgeflossen, kaum hatten die Steinzeitväter und -mütter vom Homo Steinheimensis (einer jungen Dame übrigens) bis zur alten Parre (einer streitbaren Uroma aus David Friedrich Weinlands Roman »Rulaman« aus dem Jahr 1876) das Zeitliche gesegnet, da besiedelten die Kelten das Land am mittleren Neckar. Weiter westwärts, jenseits des Rheins, hießen die Kelten Gallier und hatten als Asterix und Obelix ihren Spaß an Römerhatz und Wildschweinjagd. In den feuchten, manchmal nebeligen Neckarauen aber entwickelten sich diese Kelten zu nachdenklichen Leuten mit einem Hang zum Grübeln und Spintisieren. Kein Wunder, denn damals war es noch üblich, den Obergott Teutates mit Menschenopfern davon abzuhalten, den Himmel einstürzen zu lassen. Kein Keltenmensch war sich sicher, ob ihm die Druiden nicht mit ihren goldenen Sicheln zu Leibe rückten. Das, die dunklen Winter und die traurigen Lieder der Barden sorgten für eine trübe Stimmung. Und den Neckarwein als Seelendoping gab’s noch nicht.
Dieser Hang der Kelten zur Schwermut besserte sich nicht, als sie im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt von römischen Legionen überrollt wurden. Und erst recht nicht, als die Besatzer sie hinter einer Art Mauer einsperrten, dem Limes. Dieser Grenzwall bot zwar einen gewissen Schutz vor den Bajuwaren und anderen Barbaren und ist deshalb inzwischen zum Weltkulturerbe befördert worden. Doch die nächste Überrumpelung inklusive Vermischung 200 Jahre später konnte er nicht verhindern. Damals nahten aus dem hohen Norden unrasierte, blond- und rothaarige Völkerschaften mit Kuhhörnern auf dem Kopf. Diese germanischen Invasoren stürmten aus den Frostregionen von Elbe und Ostsee herunter, den sonnigen Süden mit Seele und Speeren suchend. So scharf waren diese verfrorenen Gesellen auf ein paar Grad Wärme, dass sie unter Absingen von »Brüder zur Sonne, zum Strandbad« gleich bis zum Mittelmeer durchgebrochen wären, hätten sich ihnen nicht die längst aufgetürmten Alpen entgegengestellt. Ein paar schafften es bis zum Gardasee und begründeten damit die deutsche Sehnsucht nach dem Land, »wo die Zitronen blühn«. Leider trugen diese blauäugigen Besatzer keine Personalausweise bei sich, denen man ihre Nationalität hätte entnehmen können. Zwei Stammesnamen hielten sich: Sueben und Alemannen. Dieser kunterbunte Verein namens »Alle Männer« siedelte am Neckar, beiderseits des Rheins, im Schwarzwald und in der Schweiz, weshalb eigentlich alles, was im Südwesten seine Vorfahren hat – ob Schwaben, Badener, Schwyzer oder Elsässer –, alemannischen Ursprungs ist. Wie sagte der Reichenauer Benediktinerabt Walahfrid Strabo schon im 9. Jahrhundert? »Alemannen oder Schwaben, die beiden Wörter bedeuten ein Volk …«
Doch leider blieb nicht genügend Zeit, die Namensfrage abschließend zu diskutieren. Kaum hatten die Alemannen keltisches und römisches Erbgut genetisch integriert, da nahten bereits die nächsten Okkupanten: die ebenfalls germanischen Franken. Sie führten das Christentum ein, nicht aber die Nächstenliebe. Unter einem Vorwand lockten sie die festesfrohen Alemannenführer in das alte römische Kastell Cannstatt – und brachten sie um. Feindliche Übernahme kann man das nennen. Dazu reichten Kraft und Mittel, nicht aber zur flächendeckenden Besiedlung der alemannischen Lande. So kommt es, dass bis heute eine zwar nicht sichtbare, wohl aber noch immer hörbare Sprachgrenze zwischen Schwarzwald und Ostalb, zwischen Hornisgrinde, Hessigheimer Felsengärten und dem Hohenberg bei Ellwangen die Schwaben von den Franken scheidet. Hier sagt man zu jungen Damen Mädle, dort Madlich, hier heißt der Geist Goischd, dort Gaaschd.
Man erkennt deutlich: Den lupen-, gar rassereinen Schwaben hat es nie gegeben. Er war, von ein paar auf Inzucht spezialisierten Dörfern auf der Schwäbischen Alb und im Heckenbeerlesgäu einmal abgesehen, immer eine bunte Mischung aus keltischen, romanischen und germanischen Genen – zumindest bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Danach kamen die Heimatvertriebenen unfreiwillig, aber scharenweise ins Land; ihnen folgten später die Gastarbeiter aus dem Süden Europas, die »Reingeschmeckten« aus dem wirtschaftlich nicht ganz so blühenden deutschen Norden, die Aussiedler, manchmal tatsächlich Urenkel der Donau- und Wolgaschwaben, aus dem Osten – und schließlich die Freunde aus den neuen Bundesländern, die die Region mit ihrem sächselnden Originalton beschallen.
Angesichts eines solchen Völkergemischs mit durchgängigem Migrationshintergrund stellen sich dem Leser zwei grundlegende Fragen. Erstens: Wenn das alles so ist, was ist dann heute ein Schwabe? Und zweitens: Wo liegt dessen Schwabenland?
Alle gleich verdruckt?
Beginnen wir damit, ein weit verbreitetes Missverständnis auszuräumen: Das Schwabenland ist keineswegs deckungsgleich mit dem Bundesland Baden-Württemberg – dagegen würden sich die badischen Karlsruher und Freiburger, die kurpfälzischen Mannheimer und Heidelberger samt den fränkischen Heilbronnern und Hohenlohern mit Händen und Füßen wehren. Schlimmer noch: Schwaben fällt nur teilweise mit dem Territorium des ehemaligen Landes Württemberg zusammen. Damals, so ums Jahr 1000 nach Christi Geburt, reichte das Herzogtum Schwaben vom Gotthardpass bis nach Nördlingen, von Weißenburg im Elsass bis zum Comer See. Heute aber besteht die schwäbische Heimat, grob gesagt, aus dem alten Kernland der Staufer, später der Württemberger Grafen am mittleren Neckar, zwischen Tübingen und Schorndorf, zwischen Freudenstadt und Backnang. Dazu kommt das einst teils vorderösterreichische, jedenfalls aber kernig Schwäbisch sprechende Oberland bis zum Schwarzen Grat bei Isny – und der bayerische Regierungsbezirk Schwaben von Neu-Ulm bis Augsburg. Beweis: Früher gab es einen ruhmreichen Fußballclub namens Schwaben Augsburg. Und als die Stadt der Fugger und Welser vor einiger Zeit ihren 2000. Geburtstag feierte, riefen besorgte Augsburger bei der »Stuttgarter Zeitung« an und baten darum, den Jubeltag auch im Württembergischen zu würdigen. Das dürfe man nicht den imperialen Münchnern überlassen.
Damit nähern wir uns dem Schwaben selbst, diesem unbekannten Wesen. Ein bayerischer Suebe, der frühere Bundesfinanzminister Theo Waigel, hat dazu eine ebenso infame wie erhellende Definition beigetragen: »Es liegen sieben Schwaben aufeinander. Was unterscheidet den untersten vom obersten?« Antwort: »Nichts, alle sind gleich verdruckt.«
Nun bedeutet »verdruckt« nicht nur »platt gedrückt« wie eine überfahrene Pfautzkrott, sondern auch verschlossen. Gut, es gibt Schwaben, die herumdrucksen, nicht herauswollen mit der Sprache, hehlinga, also heimlich gescheit sind – und das sogar schon vor ihrem 40. Geburtstag. Aber die sollen auch bei anderen deutschen Stämmen vorkommen. Also muss es ein anderes Erkennungsmerkmal geben.
Ja, das gibt es: Es ist, erstens, die Sprache. Als Schwabe darf sich bezeichnen, wer Schwäbisch spricht. Doch weil das inzwischen auch Luigi, Manolo und Aishe können, kommt ein Zweites dazu: Von sich als Schwabe reden darf, wer Schwäbisch denkt und versteht, ob es sich um das Stuttgarter Hoch- oder das älblerische Rustikalschwäbisch handelt. Er oder sie muss ein Ohr haben für die feinen Zwischentöne dieser Sprache, vom groben »Leck me em Arsch« bis zum romantischen »Jetzt gang i ans Brünnele«. Dazu eine feine Zunge, um mit verbundenen Augen einen Trollinger von einem Lemberger unterscheiden zu können. Er sollte einmal an Königs Geburtstag die Nationalhymne »Preisend mit viel schönen Reden« gesungen haben. Oder ersatzweise »Auf de schwäb’sche Eisebahne«. Und schon einmal heimlich eine Träne verdrückt haben, wenn Ludwig Uhlands »Ich hatt’ einen Kameraden« erklang.
Vom schwäbischen Wesen
Womit wir bei jenem Phänomen angekommen wären, das sich »schwäbische Wesensart« nennt. Am einfachsten wäre es, man könnte sie an Persönlichkeiten festmachen, so wie das Bayerisch-Bierdimpflige an Franz Josef Strauß oder das Hanseatisch-Schnoddrige am einstigen Kanzler Helmut Schmidt. Doch solche Identifikationsfiguren sind rar in diesem Land der Einzelgänger, wo zu Urgroßmutters Zeiten zwischen zwei Nachbardörfern ein Bach, drei Weidezäune und sieben Berge lagen. Wenn es sie gab, sind sie meist zu Unrecht vergessen, wie jener sagenhafte Landtagsabgeordnete Tiberius »Bere« Fundel aus Indelhausen auf der Alb. Der sagte nach dem Zweiten Weltkrieg zu Gebhard Müller, dem eben gewählten, stolzen Staatspräsidenten von Südwürttemberg-Hohenzollern: »Des eine musch’ du dir merken, Gebhard: Je öfters du in der Zeitung komm’sch, umso öfters putzet die Leut den Hintere mit dir.«
Inzwischen gab und gibt es theoretisch andere Galionsfiguren aus dem Land der Schwaben: den mittlerweile pensionierten, brummigen Tatortkommissar Bienzle alias Dietz-Werner Steck, den spitzzüngigen Entertainer Harald Schmidt alias Dirty Harry aus Nürtingen, den barocken Fernsehkoch Vincent Klink, den sein Weg von Schwäbisch Gmünd nach Schwäbisch Stuttgart geführt hat. Oder den blonden Fußballhelden Jürgen Klinsmann, der seine erste Gesellenprüfung, lang vor der Weltmeisterschaft 2006, daheim in der familiären Backstube in Stuttgart-Botnang gemacht hat. Oder Horst Köhler oder Joschka Fischer, denen Württemberg zur Heimat wurde. Ja, alles ganz wunderbare Leute. Aber sie leiden unter demselben Makel wie eine Artistin aus Stuttgart-Heslach, über die ein Biograf schrieb: »Eine Schwäbin war sie nicht, sie war eine Künstlerin.« Das hat etwas mit professionellem Rollenspiel zu tun, und genau das liegt dem Normalschwaben nicht.
Dennoch unterliegt der Deutsche dem Wahn, seine Schwaben zu kennen – natürlich aus dem Fernsehen. Da stolpern sie herum, diese köstlich maulenden Hausmeister, die keifenden Klatschweiber, die spruchbeutelnden Pfarrer, die groben Büttel. Und die versponnenen Tüftler, denen man es zutraut, aus ein paar alten Konservendosen einen Zeppelin zu basteln. Oder aus Witzen, die so gehen: Fährt ein Schwabe in eine Autowaschanlage und kommt Sekunden später herausgerannt – patschnass. Fragt ihn der Betreiber, was passiert sei. Antwortet der Mann: »Da stand auf dem Schild: Gang raus!« Zum besseren Verständnis: »Gang« ist im Schwäbischen auch der mundartliche Imperativ von gehen …
So also sind sie angeblich, die Schwaben: bruddelig, b’häb, knitz, raubauzig, tüftelig, herzensgut. In einem gerade vierzeiligen Vers hat es August Reiff so zusammengefasst: »Ufrichtig und gradraus,/guetmütig bis dort naus,/wenn’s sein muss, au saugrob,/des isch der Schwob.« Diese Charakteristik scheint ihre Wirkung getan zu haben, denn im Bayerischen gab es lange den Spruch: »Willst du keinen Streit und Ärger, meide jeden Württemberger.« Und Theodor Heuss legte auf seine diplomatische Art nach: »Die Schwaben sind vielleicht der komplizierteste, gewiss aber der spannungsreichste unter den deutschen Stämmen.«
Weicher Kern in rauer Schale
Saugrob? Spannungsreich? Der arglose Leser von auswärts mag es kaum glauben: So sieht sich mancher Schwabe bis heute selbst gern. In Zeiten von Rap und Hip-Hop pflegt er seine landsmannschaftliche Identität, indem er, wie die Kulturwissenschaftler sagen würden, seine Existenz in eine idealtypische Basiserzählung eingliedert. Sprich: Wir sind halt, seit Adam und Eva, aufrechte Kerle und Weiber, ein bissle tappig, aber nicht blöd; selten parkettsicher, aber immer ehrlich. Wir schimpfen wie die Rohrspatzen, schaffen wie die Brunnenputzer und haben alle irgendeinen Fürsten, einen Professor oder einen Prälaten in der Ahnenreihe. Kurz, ein weicher Kern in rauer Schale, wenig Form, viel Inhalt, dazu immer ein Funken Genie und natürlich die schönsten Mädle, gell. Diese manchmal inflationär eingesetzte Floskel »gell« steht übrigens für »gilt«: So ist es.
Um der Wahrheit und der Gegenwart näherzukommen, müsste man allerdings differenzieren. Der heutige Urbanschwabe unterscheidet sich nämlich von seinem ländlichen Vetter wie die Stadtmaus von der Landmaus. Wobei Stadt in diesem Fall Stuttgart heißt, aber schon nicht mehr Stuttgart-Obertürkheim. Oder Ulm, aber schon nicht mehr Ulm-Wiblingen. Oder Reutlingen, aber nicht mehr Reutlingen-Sondelfingen.
Der Stadtschwabe hat, weil auch am Neckar das Sein das Bewusstsein bestimmt, das Bauernwams schon vor 300 Jahren ausgezogen. Er futtert Tapas und Safranrisotto, fährt – früher undenkbar – einen bayerischen BMW, sitzt heute im Ballett, morgen in der Schickibar, liest Michel Houellebecq, liebt Tango und Salsa und trinkt im Chillout-Heaven Latte macchiato und Caipirinha. Er ist so austauschbar wie die Fußgängerzonen deutscher Metropolen. Kinder, die mit dem Kinderkanal und der »Sendung mit der Maus« aufwachsen, lernen schon im Kindergarten, korrekt Schaiße zu sagen, statt Scheijsele. Wenn sie nicht gleich auf Kacke, Pampe oder Shit ausweichen.
Draußen aber, in den Dörfern und Kleinstädten, in ehrwürdigen Fachwerkbauten und uniformen Reihen-Eckhäusern, verstecken sich noch ein paar Originalschwaben. Dort, wo es in der Wirtschaft noch einen kernigen Wirt und einen Stammtisch gibt. Dort, wo die Leute noch nicht bloß Maier oder Müller heißen, sondern Zwetschgen-Karle, Bobbes oder d’Schlitzäugles-Sofie, auch d’Kineese genannt. Dort, wo die Diarrhöe unter »Schnellkätter« läuft und der Kleintierzüchter unter »Hennavögler«. Die Chance, solche Oasen zu finden, steigt mit zunehmender Entfernung zum Stuttgarter Schlossplatz.
B’häb und bruddelig
Wer solchen Schwaben begegnet, ob auf dem Rathaus oder in der Autowerkstatt, ob auf dem Acker oder bei Aldi, lernt Paradoxes. Zum Beispiel, dass Klischee und Wirklichkeit zuweilen übereinstimmen. Diese Landsleute sind tatsächlich manchmal b’häb, bruddelig, grob. Aber auch knitz, wissbegierig, freundlich. Und mit einem ganz eigenen Humor ausgestattet.
B’häb? Das hat beileibe nichts mit behäbig zu tun, also mit satt-gemütlich, sondern mit knauserig und engherzig. Nicht Raffke, sondern Entenklemmer. Das waren jene Leute, die den Hintern ihres Federviehs mit einem Klemmgriff kontrollierten, damit ein im Rohr steckendes Ei nicht in Nachbars Garten lande. Diese Vorsicht aus Zeiten, in denen Vogelgrippe ein Fremdwort war, entsprang keinem charakterlichen Defekt, sondern einem harten irdischen Los. Solange sich die Schwaben nämlich von der Landwirtschaft ernähren mussten, war Schmalhans Küchenmeister. Viele Leute waren so arm, dass sie nicht nur den Pfennig, sondern auch den faulen Apfel dreimal umdrehen mussten. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts herrschte auf der rauen Alb Hungersnot – vorne Weh und hinten Ach. Deshalb suchten die vielen Auswanderer in Russland, Amerika oder Brasilien weniger die goldene Freiheit, sondern fruchtbare Felder und gut gefüllte Teller.
Die langen Notjahrhunderte haben die Lehre vom »Des duads no lang« und »Mr lässt nix verkomme« in die Bauernschädel eingehämmert. Dort sitzt sie noch heute. Man »hält sein Gerstle« zusammen, wirft nix weg, weder ein trockenes Brot noch einen verschlissenen Pullover, noch ein altes Radio. Man weiß nie, wozu das noch gut ist. So wie jener nur einmal benützte Zahnstocher, den der Schwabe im Lokal wieder ins Büchsle zurücklegte: »Der duad’s nomal.« Also kein »Mir san mir«, sondern lieber »Älles mei«, was so viel heißt wie »Das gehört alles mir«. Dann herrscht Seelenfrieden. So wie bei jenem Mann, der eine Buchhandlung betrat, um seiner Frau ein Geschenk zu kaufen: »Mörikes Gesammelte Werke, bitte.« Fragte der Buchhändler: »Welche Ausgabe …« Antwortete der Mann: »Da haben Sie auch wieder recht!«, und verließ den Laden. Schon wieder Geld gespart.
Böse Menschen behaupten ja, sie wüssten, wie der amerikanische Grand Canyon entstanden sei: Ein Schwabe habe dort nach einem verlorenen Groschen geschürft. Und es wird berichtet, wie der Schwabe es angeblich mit den Präsenten für seine Mitmenschen hält: »Lieber zehn Minute gschämt als a groß’ Gschenk gmacht.« Selbst Eduard Mörike hat an diesem Ruf mitgedichtet: »Sparsamkeit ist eine Tugend,/während Geiz ein Laster ist. / Ach, dass unsre heut’ge Jugend,/dieses gar zu leicht vergisst. / Liebes Kind, ich bitt dich drum,/eh du einen Kreuzer ausgibst,/dreh ihn zweimal – einen Groschen/sechsmal in der Hand herum!« Genau so, behaupten die Spötter, sei der Kupferdraht erfunden worden.
Parole »Schwätz nix«
Wie dem auch sei, Sparsamkeit fängt im Kopf an. Deshalb sind manche Schwaben bis heute auch sparsam beim Reden, getreu dem Motto »A stiller Mensch isch ruhig«. Für diese Maulfaulheit steht exemplarisch die Szene auf dem Land, wo ein Bauernbub nach Hause rennt und daheim ganz aufgeregt mitteilt, dass Nachbars Kühe ausgebrochen seien und die eigene Wiese abweideten. Ein-, nein, zweisilbiger Kommentar des Bauern: »Melka!«. Sprich: Melken! Nein, das ist nicht »verdruckt«, das ist nur vernünftig. »Schwätz nix, dann komm’sch in nix nei«, hieß es oft, ehe das Handy eingeführt wurde. Und so mancher, der zu Hause am Esstisch oder bei seinem Chef eine Lippe riskierte und danach abgekanzelt wurde, musste sich eingestehen: »Um den Preis hätt’sch dein Maul auch halte könna.«
Bruddelig, also brummig-abweisend, war und ist der Schwabe nicht etwa, weil er bösartig wäre. Sondern einerseits, weil er seine Gesundheit pflegt, wie der Autor Sebastian Blau feststellte: »Wer bei uns einen Kropf hat, hat ihn kaum wegen verschluckter Grobheiten.« Und andererseits, weil er die Welt nach Art seiner Vorfahren grundsätzlich skeptisch betrachtet – und damit leider meist recht behält. Der Rest ist Temperamentssache. Das sesshafte Exemplar zieht sich hinter seinen Ofen, hinter sein Viertele zurück und räsoniert über die Schlechtigkeit der Zeit. Der Umtriebige aber geht in die verquere Welt hinaus und versucht, sie sich besser zurechtzuzimmern: indem er Motoren entwickelt und Zündkerzen und Werkzeugmaschinen und Computer. Und Harmonikas und Leitz-Ordner. Oder indem er, wie der gebürtige Ulmer Albert Einstein, die Relativitätstheorie erfindet. Im Übrigen hat sich die ursprüngliche Grobheit stark relativiert. Wurde ein Schwabe früher angerempelt, schlug er dem Übeltäter aufs Maul – »oine an d’Gosch na«. Später beließ er es bei einem gemäßigten Hinweis: »Hoppla, du Dackel, glotz au, wo du na’dappsch.« Heute kommt er mit einem einzigen Wort aus: »Entschuldigung«. Manche halten das für ein Zeichen von Degeneration.
Aber der Schwabe kann nicht nur raubauzig sein, sondern auch scheißfreundlich. So wie jener Landpfarrer, der einst seinem Herzog folgende Schadensmeldung übermittelte: »Dero allerhöchste Säue haben geruht, meine allerunterthänigsten Kartoffeln aufzufressen.« Und knitz. Knitz? So ist ein Mensch, dessen Qualitäten zwischen einfallsreich, clever und listig liegen. Jedenfalls hat er das, was man ein »Gelenk im Hirn« nennt. Meist ist er neugierig und wissbegierig, tut aber, als könne er nicht bis drei zählen. Und dann überrascht das Schlitzohr die anderen mit seinen Einfällen. Er weiß, wie man seinen »Vortl« nützt; also den vorteilhaften Schwung aus dem Handgelenk heraus, mit dem man leichter einen Ast am Kirschbaum kappt. Oder wie man die psychologische Finte platziert, um ein Geschäft zu befördern. Auch wenn andere zunächst lachen, macht er mit Pfennigartikeln wie Schrauben oder Dübeln oder schlichtem Dreck Millionen – wie die Vorzeigefabrikanten Reinhold Würth, Artur Fischer oder Helmut Aurenz. Man muss das Pulver nicht erfinden, sondern nur machen. Dann wird man von allen geliebt, sogar von den einheimischen Medien.
Das also ist die schwäbische Dialektik: dieses »Sowohl« einerseits und das »Als auch« andererseits, diese Mischung aus verhockt und umtriebig, dieser wohlhabende Biedersinn, diese maulende Sentimentalität, dieses Wechselbad von Heimweh und Fernweh. Nur einem Schwaben kommt in Australien der Gedanke: »Do sitzt mr en Sydney rum, ond daheim sott mr d’Bäum schpritza!« Max Eyth, dieser weltenbummelnde Dichteringenieur aus Kirchheim/Teck, war aus solchem Holz. Als er 1861 in Antwerpen eine Wurst aß, fiel ihm der wesentliche Unterschied auf: »Es fehlte ihr die schlichte Treuherzigkeit, die man am Neckar auch in einer Knackwurst findet.«
Schwäbisch lustig
Viele solch kritischer Situationen meistert der Schwabe mit seinem sehr speziellen Humor. Der ist wie der traditionelle Neuffener Täleswein: immer ziemlich trocken, manchmal arg räs. Ein Franzose fällt in den Neckar, droht zu ersaufen und schreit: »Au secour! Au secour!« Der Tübinger auf der Brücke ruft dem um Hilfe Flehenden mitleidig zu: »Hättesch du lieber schwemma g’lernt als Französisch.«
Lacht da jemand? Natürlich nicht, wozu hat einem der liebe Gott ein Pokergesicht geschenkt? Auswärtige Humoristen sind immer wieder fasziniert von der fast übermenschlichen Fähigkeit des Schwaben, eine noch so brillante Pointe stoisch auszusitzen.
Robert Gernhardt, der 2006 verstorbene Frankfurter Satiriker und Dichter, hat das als Kontrast zum stets lachbereiten Kölner so formuliert: »In Stuttgart schweigen die Menschen, das ist fast unheimlich. Aber hinterher kaufen sie Bücher. Als wollten sie zu Hause nachlachen.« Im Keller wahrscheinlich. Aber das kann eigentlich nicht sein, denn da liegt der technisch perfekt ausgestattete Hobbyraum. Dort wird geschafft, nicht gealbert.
Ein unerschöpflicher Brunnquell der Freude ist für den Einheimischen auch stets die Faschingszeit. Das gilt vor allem für die katholischen Hochburgen der schwäbisch-alemannischen Fasnet, wo die Hansele und die Schwellköpfe gerade so wild herumtanzen, wie es der Narren-Tüv erlaubt. Motto: »Narren müssen sauber bleiben.« Und noch viel mehr beim Stuttgarter Gaudiwurm, bei dem der Zuschauer, der laut »Narro« ruft, Gefahr läuft, wegen Ruhestörung abgeführt zu werden. Der Schwabe guckt zu und macht sich seine Gedanken. Zum Beispiel über die Büttenrede des seinerzeitigen Stuttgarter Oberbürgermeisters Wolfgang Schuster, diesem Meister rhetorischen Understatements, der folgendes Geständnis ablegte: »Find im Narrensein höchstes Glück – drum ging ich in die Politik.« Tätä, Tätä, Tätä.
Früher gab es im Südwesten Politiker, die sprachliche Geistesblitze zucken ließen. Reinhold Maier etwa, Ministerpräsident in den Fünfzigerjahren, erteilte allzu markigen liberalen Parteifreunden den Rat: »O glaubet no net alles, was ihr saget.« Auch sein Parteifreund, der starke Raucher Theodor Heuss, war ein schlagfertiger Mann. Als ihn ein Besucher des Bundespräsidialamtes darauf hinwies, dass Zigarrenasche auf seine Weste gefallen sei, beschied ihn der Präsident kurz: »Des isch die g’wöhnt.« Günther Oettinger dagegen fiel zu seinen Amtszeiten als Ministerpräsident höchstens dann auf, wenn er einen Freund vor versammelter Geburtstagsgesellschaft samt Damen einen »württembergischen Meister im Seitensprung« nannte. Dies auch nur deshalb, weil er die Pointe schon einmal, bei einem anderen Herrn, verschossen hatte.
Deshalb gibt es ernsthafte Schwaben, die sagen: »Man könnte gerade meinen, älle rechte Leut seien gestorben – ond unter de Lebige gäb’s koine G’scheite meh.« Das gilt nicht nur für Politiker, sondern auch für Firmenchefs, Intendanten und Feinkosthändler.
Zugegeben, dieser bunte Strauß an Eigenheiten mag auf einen jovialen Rheinländer einen eher grimmigen, eigenbrötlerischen Eindruck machen. Aber das ist eben das keltische Erbgut – ein gewisser gutnachbarlicher Ausgleich zu den lebensfrohen Badenern und den bräsig-krachledernen Bayern. Umso mehr strahlt unser Landsmann, wenn er ausnahmsweise und wider Erwarten positiv überrascht wird: durch eine Gehaltserhöhung (bei schwäbischen Chefs unwahrscheinlich), durch ein Lob des Vorgesetzten (dito) oder durch ein Küssle seiner Gemahlin oder Gefährtin (nicht ausgeschlossen). Dann kann er richtig nett werden, gemütlich und leutselig. Ja sogar gesprächig und großzügig. Dann streift er sein skrupulöses, in sich gekehrtes Wesen ab und gibt sogar eine Runde aus. Dafür geniert er sich am nächsten Morgen ein bisschen: »Sapperlott, i glaub, i werd’ leichtsinnig.« Damit meint er verschwenderisch, und das wäre eine Sünde.
Schätzla und Hyänen
Fehlt nur noch eins zum Glück: die Schwäbin. Und die ist auch bitter nötig. Denn sie muss mit ihrer ausgleichenden, charmanten, nach außen zurückhaltenden, am Esstisch und im Ehebett aber bestimmenden Art all die Beulen ausbügeln, die ihr Schwabengatte sich und anderen zugefügt hat.
Mag der schwäbische Mann noch so oft behaupten, er habe die Hosen an – zu Hause lebt er in einer milden Form des Matriarchats. Das war schon bei den Ureinwohnern in den Albhöhlen so, wo die erwähnte alte Parre Wunden heilte und Entscheidungen traf. Auch die berühmten Weiber von Schorndorf unter der Führung der Bürgermeisterfrau Anna Barbara Künkelin haben eindrucksvoll gezeigt, wie Frauen ihren Mann stehen, wenn die Herren der Schöpfung schwächeln. Mit Mistgabeln und Besenstielen bewaffnet, belagerten die Damen 1688 das Rathaus, um ihren verzagten Männern droben im Ratssaal klarzumachen: »Mit uns keine Kapitulation vor den Franzosen!« Das wirkte, auf Freund und Feind übrigens.
Dabei entsprachen die allermeisten schwäbischen Mädle gar nicht dem Bild jener keifenden Marktweiber, deren eine der anderen im Streit einen Rossbollen, einen Pferdeapfel, ins Maul gestopft hatte, worauf jene hinter dem Hindernis hervorkeifte: »Der bleibt drin, bis d’Bolizei kommt!« Nein, längst nicht alle Schwäbinnen hatten und haben die Neigung, im schillerschen Sinne »zu Hyänen« zu werden. Im Gegenteil, selbst einer der härtesten Schwabenkritiker, ein norddeutscher Anonymus, lobte die »oftmals sehr zierlichen und wohlgestalteten Mägde« im Land und gestand den Mädchen »ein weit heißeres Blut zu« als den Damen »unserer Küstenregion«. Die Schwäbin bilde durch ihre »angeborene Glut« den Übergang zu »den leidenschaftlichen Italienerinnen«. In der Tat, manches Mädchen vom Lande sieht noch heute so aus, als ob sich in ihrer Ahnenreihe ein schwarzhaariger römischer Legionär befunden hätte – eine Tradition, um deren Wiederbelebung sich die italienischen Kaffeesieder und Pizzabäcker seit einem halben Jahrhundert erfolgreich bemühen.
Der Schwabe sucht bei seinem Schätzle, seinem Mäusle, seinem Moggele und Doggele nicht nur Leidenschaft, sondern vor allem Ordnungssinn und Fürsorge. Auf diese Eigenschaften legen auch viele Evastöchter Wert, wenn man Christian Friedrich Daniel Schubarts mehr als 200 Jahre altem Bekenntnis eines Mädchens glauben darf, das nichts von Gezier und Bücherstudium hielt: »Mir fehlt zwar diese Gabe,/fein bin ich nicht und schlau,/doch kriegt ein braver Schwabe,/an mir ´ne brave Frau.«





























