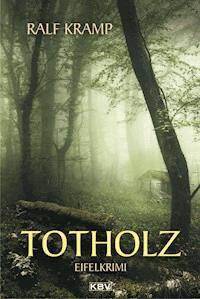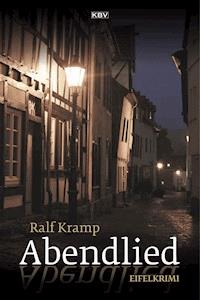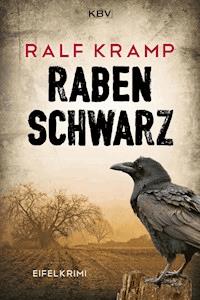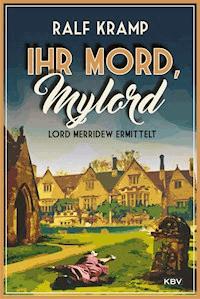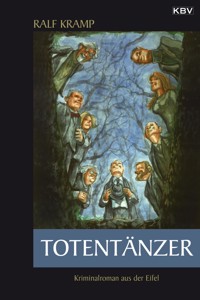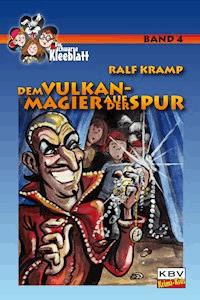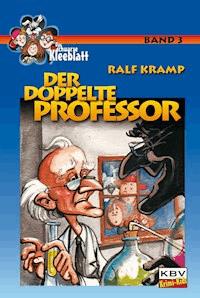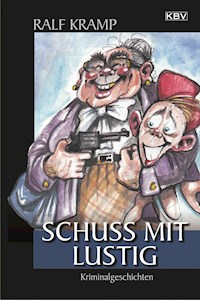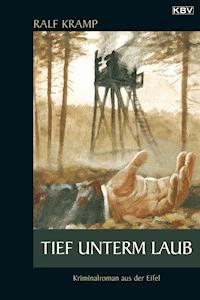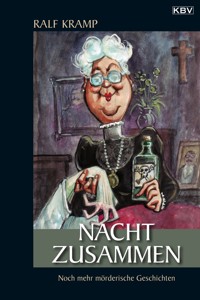Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Herbie Feldmann
- Sprache: Deutsch
Ein Männlein stirbt im Walde … Herbie Feldmanns 12. Fall Das sieht nach einem leichten Job aus, den ihm Tante Hettie aufs Auge gedrückt hat: Herbie soll die Beschilderung eines neuen Wanderwegs übernehmen. Doch schon bald bewahrheiten sich die düsteren Prophezeiungen seines Begleiters Julius, und er irrt orientierungslos durch den Eifelwald. Ein Glück für den angeschossenen Fremden, dem er an einem See das Leben rettet. Von da an ist nichts mehr wie zuvor, denn Bernd »Bermuda« Muckendahl, der vor vierzig Jahren aus der Eifel floh und in Hamburg zum Kiez-König wurde, überschüttet ihn aus Dank mit Geschenken. Vor allem aber spannt er Herbie bei der Suche nach dem Schützen ein, der ihn umbringen wollte. Im Handumdrehen verstricken sich Herbie und Julius in eine wilde Geschichte um eine alte Gärtnerei, eine Truppe Lost-Place-Sucher und eine böse, alte Geschichte, die noch nicht zu Ende erzählt ist …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ralf Kramp
Lost Place Eifel
Ralf Kramp, geb. 1963 in Euskirchen, lebt in einem alten Bauernhaus in der Eifel. Für sein Debüt Tief unterm Laub erhielt er 1996 den Förderpreis des Eifel-Literatur-Festivals. Seither erschienen zahlreiche Kriminalromane und Kurzgeschichten. In Hillesheim in der Eifel unterhält er zusammen mit seiner Frau Monika das »Kriminalhaus« mit dem »Deutschen Krimi-Archiv« (30.000 Bände), dem »Café Sherlock«, einem Krimi-Antiquariat und der »Buchhandlung Lesezeichen«. Im Jahr 2023 wurde er mit dem Ehren-Glauser für »herausragendes Engagement für die deutschsprachige Krimiszene« ausgezeichnet.
www.ralfkramp.de · www.kriminalhaus.de
Ralf Kramp
Lost Place Eifel
Ein Herbie-Feldmann-Krimi
Originalausgabe
© 2025 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH
Am Markt 7 · DE-54576 Hillesheim · Tel. +49 65 93 - 998 96-0
[email protected] · www.kbv-verlag.de
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an unsere Herstellung: [email protected] · Tel. +49 65 93 - 998 96-0
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp
Lektorat: Tanja Karmann, Zweibrücken
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-95441-686-8 (Taschenbuch)
ISBN 978-3-95441-695-0 (eBook)
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
Hinterher …
Für Volker, mit großem Dank.
Kaum einer kennt Herbie so gut wie Du.
In einem gelben Wald, da lief die Straße auseinander, und ich, betrübt, daß ich, ein Wandrer bleibend, nicht die beiden Wege gehen konnte, stand und sah dem einen nach so weit es ging: bis dorthin, wo er sich im Unterholz verlor. (aus: Robert Frost, Der unbegangene Weg, übersetzt von Paul Celan)
1. Kapitel
Es war überhaupt kein Problem gewesen hereinzukommen. Das Schloss der Hoftür war kaputt. So kaputt, dass sie nicht mal einen Schraubenzieher benutzen mussten. Nur das wuchernde Efeu hatte die Tür daran gehindert, sperrangelweit offen zu stehen.
Die ersten Augenblicke waren auch heute, trotz der Dunkelheit, gewaltig. Eine knisternde Erregung, zur Hälfte Angst, zur Hälfte Neugier, jeder Schritt in das Unbekannte voller Vorsicht, gesteuert von der Erwartung des Unerwarteten, jeder Handgriff, jeder Atemzug und jeder Gedanke wie ein geheimer Pakt mit dem Verbotenen.
»Also … das ist es«, murmelte Clara, während sie den Schein der Taschenlampe durch das staubige Wohnzimmer gleiten ließ. Der Lichtkegel strich über ein ausgebleichtes Cordsofa, einen rissigen Couchtisch, einen alten Fernseher und eine Vitrine mit zerbrochenem Glas. »Das Gärtnerhaus.«
»Sieht aus, als hätte hier einer einfach den Stecker gezogen und die Zeit wäre stehen geblieben.« Jonas trat vorsichtig auf das knarrende Parkett. Während er sich mit geübtem Blick umsah, um die gesamte Szenerie zu erfassen, öffneten seine Finger ganz automatisch die Umhängetasche und holten die Kamera heraus. Er benutzte lichtstarke Objektive mit großer Blendenöffnung. Simple Handybildchen verabscheute er. »Fünfzigerjahre-Bau. Die Einrichtung ein paar Jahrzehnte jünger. Guck dir diesen Teppich an. Bei dem Muster wird man ja fast ohnmächtig. Späte Siebziger, frühe Achtziger, würde ich sagen.«
»Guter Jahrgang«, sagte Clara schwärmerisch. »Vom Geruch her würde ich mich auf einen 82er festlegen wollen. Dezente Noten von Katzenpisse sind dabei und die verhaltene Würze von Nikotin.«
»Und im Abgang ein bisschen pelzig und dumpf, mit einer komplexen Note von Motten«, fügte Jonas hinzu und lachte leise.
Hendriks Gesicht war nur im flackernden Licht seines Handydisplays sichtbar. Er machte Fotos von den weiß lackierten Rippen der Heizkörper, zwischen denen sich Spinnennetze spannten. Er hatte die Lippen ein wenig gekräuselt. Von seinem ersten Abend hatte er sich mehr versprochen. Das hier war nur ein olles, vergammeltes Haus. Davon sah er in seiner Ausbildung bei der Sanitärfirma mehr als genug. Um das Badezimmer würde er jedenfalls einen großen Bogen machen Da konnte er sich schon vorstellen, wie das aussah …
Nachdem sie hereingekommen waren, hatten sie zuallererst die Vorhänge zugezogen. Die dicken Stoffbahnen in mulmigen Ockertönen ließen kaum etwas durch. Das umherwandernde Licht ihrer Taschenlampen zerschnitt die Dunkelheit, zuckend und schmal wie Messerklingen.
Meistens gingen sie tagsüber, dann war es einfacher. Aber Hendrik konnte nur nach Feierabend. Er hatte so lange gedrängelt, bis sie nachgegeben und ihn mitgenommen hatten. Schließlich hatten sie von ihm überhaupt diesen Tipp mitten in der Eifel bekommen. Er wohnte selbst nicht weit von hier.
»Okay«, sagte Jonas und schraubte ein Objektiv auf die Kamera. »Ich schau mir die Küche an.«
»Ich geh ins Schlafzimmer«, sagte Hendrik fast im selben Moment. Die beiden anderen sahen ihn fragend an. »Na, irgendwo wird ja wohl eins sein, oder?«
Jonas grinste. »Immer wieder seltsam, welche Räume einen am meisten anziehen.«
Clara zuckte mit den Schultern. »Ich bleibe erst mal hier.«
Die Jungs verschwanden, und sie blieb allein im Wohnzimmer zurück.
Für einen Moment war es totenstill. Nur das scharfe Klicken der Foto-App, das leise Knirschen von Schritten über vergessenem Schmutz und ein entferntes Tropfen irgendwo in einem der anderen Räume unterbrach die Geräuschlosigkeit.
Clara näherte sich der Vitrine. Die Glastür knirschte in ihrer Führung, als sie sie aufschob. Ein Schleier von Spinnweben wehte zur Seite. Hinter dem schlierigen Glas fand sie Porzellanteller mit altmodischem Muster, eine Tonfigur mit abgebrochener Hand. Sie leuchtete mit dem Handy hinein, machte ein paar Fotos. Der Staub schimmerte im Licht wie feiner Nebel.
»Jonas?« Ihre Stimme war nicht laut, aber sie hallte trotzdem fast dröhnend in der staubigen Geräuschlosigkeit. Es kam keine Antwort. »Bist du in der Küche?«
Sie wartete und lauschte.
»Hendrik?« Wieder nichts. Clara biss sich auf die Lippe.
In der Ferne klirrte etwas.
Sie fuhr herum. »War das einer von euch?«
»Ich war’s nicht!«, rief Hendrik von irgendwoher.
»Nix passiert«, kam es von Jonas. »Nur ein Fläschchen. Hier stehen lauter Medikamente rum.«
»Nimm lieber nichts davon«, gluckste Clara erleichtert und schob die gläserne Schiebetür wieder zu.
Sie drehte sich nach allen Seiten um, um so viel zu speichern wie irgend möglich.
Hinter dem Durchgang zur Tür sah sie die Jungs hantieren. Sie entdeckte einen alten Zeitungsständer. Hör Zu, Wochenspiegel, Rätselhefte.
Hendrik öffnete eine Zimmertür rechts am Ende des Flurs. Sie klemmte ein wenig, gab dann mit einem trockenen Quietschen nach. Das Zimmer dahinter war klein, stickig, gefüllt mit dem Geruch von Staub, altem Linoleum und etwas anderem – etwas Kindlichem, längst Vergangenem.
Er leuchtete im Raum herum. Ein niedriger Schrank mit abblätterndem Lack, eine kleine Kommode mit abgebrochenem Griff. Orange und braun waren hier die vorherrschenden Farben. Das war so dermaßen von gestern. Garantiert gab es Leute, die auf so was standen.
Es war nicht das Schlafzimmer. In einer Ecke erkannte er zwar ein Bettgestell, schmal wie ein Sarg, das Bettzeug zu einem Klumpen zusammengefallen, aber die Tapete machte deutlich, dass es sich um ein Kinderzimmer handeln musste.
Das Licht der Taschenlampe glitt über die Wand. Popmusik-Poster, Fotos von einer Fußballmannschaft. Das Kopfteil des Bettes war übersät von Fußballer-Stickern.
Es klirrte leise, als er gegen etwas Metallisches trat. Ein Matchbox-Auto. Verstaubt, mit blinden Kunststofffenstern, die Farbe teilweise abgeplatzt – aber eindeutig erkennbar. Ein alter giftgrüner Ford Capri.
Er bückte sich, um ihn aufzuheben. Rund um das Bett lagen noch mehr. Ein chaotisches Schlachtfeld aus kleinen Fahrzeugen. Ein paar davon sahen aus, als hätten Kinder mit Steinen auf sie eingeschlagen. Andere waren mit Filzstift bekritzelt. Doch dann – in der hintersten Ecke des Raumes, halb unter einer umgekippten Plastikbox – entdeckte er weitere, die sofort sein Interesse weckten. Eine kleine Sammlung, aufgereiht wie Soldaten. Etwa ein Dutzend Fahrzeuge. Glänzend, fast unberührt. Der Lack makellos, die Scheiben klar.
Er schluckte. »Wie neu …«
Von Autos verstand er was. Das waren die legendären Sportwagen der 60er und 70er: ein Ford Thunderbird, ein Ferrari Berlinetta, ein Ford Mustang, ein Lamborghini Miura … Beim Jaguar war er sich nicht sicher, ob es die 3,4-Liter- oder die 38er-Ausführung war. Der MG 110 schimmerte im spärlichen Licht wie Chrom. Sie alle sahen makellos aus. Es war, als hätte noch nie jemand mit ihnen gespielt, hätte sie nur voller Besitzerstolz aufgestellt. Ein Altar aus der Kindheit.
Hendrik zückte wieder das Handy. Klick. Und noch ein Foto. Und noch eins.
»Hendrik!«, kam Claras Stimme gedämpft aus dem Wohnzimmer. »Du denkst dran – erstes Mal mit uns. Wir packen nix an, wir dekorieren nix um. Und vor allem: Wir nehmen nix mit!«
Er richtete sich langsam auf. »Jaja!«, rief er. »Klar doch!« Und dann leise: »Macht euch bloß nicht ins Hemd.«
Er sah wieder zu den Autos. Und dann geschah es – dieser Moment, in dem die Gier die Vernunft überrennt.
Fünf der kleinen Fahrzeuge verschwanden in der Kängurutasche seines Hoodies. Sie waren schwerer als erwartet. Kalt. Und sie fühlten sich kostbar an. Es war fast so, als würde er Münzen stehlen, keine Spielzeuge.
Einen Moment lang stand er reglos da, die Taschenlampe auf die nackte Wand gerichtet. Dann holte er das Handy hervor. Galerie öffnen. Wischen. Foto löschen. Eins nach dem anderen. Keine Spuren.
Nur das leise Klackern der Autos in seiner Tasche erinnerte noch an das, was er getan hatte.
Als Jonas’ Gesicht im Türrahmen erschien, schrak er zusammen. »Fuck, spinnst du? Mich so zu erschrecken!«
»Was Besonderes hier?«
»Kinderzimmer. Olle Poster und so was. Uriah Heep, Kiss … Mein Alter hört so was noch.«
Ein Poltern ertönte. Jonas fuhr herum.
»Clara?«
»Alles okay.«
»Kein Poltergeist?«
»Quatsch.« Sie stand im Flur und betrachtete die Medikamente auf dem Sideboard. Gleich daneben das Telefon. Ein alter, grauer Apparat, aber schon mit Tasten. Er stand auf einem Telefonregister mit einem Schubfach aus schwarzem Plastik. So was hatte sie früher mal bei ihrer Oma gesehen.
»Mach dich nicht lustig«, murmelte sie. »Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier was ist … Irgendwas. Ich weiß nicht.«
Sie blickten sich einen Moment lang an. Draußen, hinter dem schweren Stoff der Vorhänge, flüsterte der Wind.
Jonas brach das Schweigen. »In der Küche hab ich einen alten Einkaufszettel gefunden. Butter, Filtertüten, Licht. Wer schreibt sich Licht auf?«
Clara zuckte mit den Schultern. »Glühbirnen? Kerzen?«
»Vielleicht ein Stromausfall«, vermutete Hendrik, der auf sie zukam und unmotiviert mit seinem Handy herumfotografierte.
Clara hatte ein Taschentuch hervorgeholt und wischte sich die Finger ab, während sie ins Wohnzimmer ging. Irgendwas war klebrig. Kam wahrscheinlich von den Medikamentenfläschchen. »Wir hätten lieber bei Tageslicht herkommen sollen.«
Die beiden anderen folgten ihr. »Ging bei mir aber nicht anders«, sagte Hendrik unwirsch. »Ich hab es gleich gesagt. Es geht nur dieser eine Abend. Entweder heute oder gar nicht. Obwohl, wenn ich ehrlich bin … Ich hatte mir das auch irgendwie anders vorgestellt.«
»Mehr so eine Villa? Ein Palast? Die Idee war doch von dir« knurrte Jonas und hantierte an seinem Fotoapparat herum.
»Ja, Villa. Warum nicht? So was gibt’s auch hier in der Eifel. Ich hab da krasse Fotos gesehen. Das hier … na ja …«
Sie schwiegen. Wieder dieses ferne Tropfen. Oder waren es Schritte? Ganz leise? Hinter den Wänden?
Claras Lichtschein fand eine dunkelgelbe stockfleckige Stelle an der mit Raufaser beklebten Decke. Hier tropft es durch. Die Ecke des Perserteppichs darunter war von schwarzem Schimmel zerfressen, und das Muster war kaum noch zu erkennen.
Sie richtete das Handy auf ein vergilbtes Familienfoto an der Wand über der Kommode. Ein Mann, eine Frau, zwei Kinder. Lachende Gesichter. Bis auf den kleinen Jungen, der ein Gesicht machte, als ob ihm irgendwas nicht zu passen schien. Etwas an der Fröhlichkeit der anderen ließ Clara frösteln. Als wäre das zur Schau gestellte Glück nicht echt.
»Ob die alle tot sind?«
»Die Eltern wahrscheinlich. Ist sicher fünfzig oder sechzig Jahre her. Guck mal, das Auto im Hintergrund«, sagte Jonas.
Hendrik tastete unwillkürlich nach den Matchboxautos in der Tasche seines Hoodies.
»Ich will wissen, warum keiner von denen mehr hier ist«, sagte Clara. »Fünfzehn Jahre ist das Haus jetzt unbewohnt, haben sie im Dorf erzählt. Fünfzehn Jahre war keine Menschenseele hier, aber alles andere ist noch da.«
Jonas zuckte mit den Schultern. »Manchmal verschwinden Menschen eben. Schulden, Krankheit, Tod …«
»Oder was anderes«, sagte Hendrik.
Sie wandten sich zu ihm um. »Was meinst du?«
Hendrik sah sie nicht an. Er starrte auf den Teppich unter seinen Füßen. »Ich weiß nicht. Nur so ein Gedanke.« Er grinste breit und machte eine beschwörende Bewegung mit den gespreizten Fingern. »Vielleicht haben sie sich … entmaterialisiert!«
»Blödmann.« Clara war nicht nach Witzen zumute.
Jonas machte ein Foto von einer gerahmten Kinderzeichnung. Eine Kuh, die auch ein gefleckter Hund oder ein Pony sein konnte. »Okay, wir haben es kapiert. Gefällt dir hier nicht. Ist dir zu läppisch. Tut uns leid, dass wir dich überhaupt mitgenommen haben.« Er ging nach nebenan.
Ein leiser Luftzug fuhr durch das Zimmer. Einer der Vorhänge blähte sich sachte.
Clara hob wieder das Handy. »Wir sollten noch mehr Fotos machen. Damit das hier nicht ganz umsonst war. Die Gewächshäuser geben sicher mehr her.«
»Wie nennen wir es?«, fragte Hendrik. »Ihr gebt den Häusern doch immer Namen.« Er deutete auf die Medikamente. »Wie wäre es mit Haus Pillenglück?«
»Es hat schon einen Namen. Es ist das Haus des Gärtners.«
»Klingt nicht spektakulär. Aber auf die Glashäuser bin ich echt gespannt.«
»Ich auch. Aber das wird heute nicht gehen. Wir haben da keine Chance zu verdunkeln. Da müssen wir tagsüber noch mal wiederkommen.«
»Mann, tagsüber geht bei mir aber schlecht. Ich muss arbeiten, während ihr euch ’nen schönen Lenz …«
»Kommt mal gucken!«, rief plötzlich Jonas aus der Küche.
Der Küchentisch lag im Licht von Jonas’ Handytaschenlampe. Kein Staub hatte sich darübergelegt. Auf der hellgrau gemusterten Kunststoffplatte lagen verstreut die Reste einer kalten Mahlzeit. Die runzelige Hülle einer Supermarkt-Salami, ein leer gekratzter Frischkäsebecher, ein angebrochenes Glas Marmelade, zwei kleine, leere Folienverpackungen, die noch glänzten, fast wie neu.
Hendrik trat näher und bückte sich. Er hob eine der bunten Plastikhüllen auf und drehte sie im Licht. »Ein Müsliriegel«, murmelte er. »Nutri Score B …«
Jonas stutzte. »Nutri Score? Echt jetzt? Den gibt’s doch erst seit ein paar Jahren.«
Clara trat einen Schritt zurück. »Aber … das Haus ist seit fünfzehn Jahren verlassen.«
»Offiziell, ja. So erzählen es alle im Dorf«, murmelte Hendrik. »Vielleicht war es aber ja nie wirklich leer.«
Ein leises Kratzen kam von irgendwoher. Oder war das nur in ihrer Vorstellung? Hendrik ließ die Verpackung fallen, als hätte sie ihn gebissen.
»Hier hat jedenfalls jemand was gegessen«, sagte Clara. Ihre Stimme war jetzt leise, gepresst. »Und zwar nicht vor fünfzehn Jahren. Das hier ist … frisch.« Sie nahm mit spitzen Fingern das Marmeladenglas, dessen Deckel nur lose darauf lag. »Kein Schimmel.«
Sie starrten einander durch das Zwielicht an.
»Okay«, sagte Jonas. »Das war heute kurz, aber total okay. Ich bin hier fertig.«
»Aber wir haben doch gerade erst angefangen!«, protestierte Hendrik. Er wollte nach Claras Arm fassen, um sie zurückzuhalten, aber sie entfernte sich mit energischen Schritten durch die Küchentür. Er sah Jonas wütend an. »Der ganze Aufriss wegen nichts?«
»Wir gehen jetzt, bevor …« Jonas vollendete den Satz nicht, weil aus dem Wohnzimmer ein kurzer, erstickter Schrei kam.
Clara.
Sie stürzten zu ihr.
Clara stand vor dem Sofa, die linke Hand vor den Mund gepresst. Mit der anderen deutete sie starr auf eine zerknüllte Decke mit Karomuster, die auf dem Boden lag.
»Die lag vorhin noch da obendrauf.«
»Wodrauf?«, fragte Jonas.
»Auf dem Sofa hat sie gelegen! Ganz ausgebreitet. Jetzt liegt sie da unten!«
»Du spinnst doch«, sagte Hendrik mit erzwungener Lässigkeit. »Glaubst du jetzt etwa an Gespenster, oder was?«
»Ich weiß, was ich gesehen habe!«, schrie Clara schwer atmend. »Ich mache jetzt das Licht an, verdammt.«
»Nein, nicht!« Jonas wollte sie daran hindern, aber sie sprang auf die Tür zu und tastete nach dem Lichtschalter. Aber sie fühlte etwas anderes. Instinktiv richtete sie den zitternden Schein ihrer Handylampe dorthin.
Halb von dem herabhängenden Stoff der Kleidung verdeckt war eine Hand zu erkennen. Eine alte Hand, braun, lederartig, die Haut trocken und rissig wie altes Holz, eingefroren in einer starren Geste.
Clara schrie, wie sie noch nie zuvor in ihrem Leben geschrien hatte.
»Raus hier, los raus!«, brüllte Jonas, und sie stürzten in die Nacht hinaus.
2. Kapitel
Major a. D. Karl-August Dassler hatte ein Gesicht so hart wie gefrorene Erde beim Wintermanöver, die Züge waren scharf und klar geprägt wie eine Frontlinie.
»Sie haben doch wohl nicht vor, in diesen Schuhen zu wandern?« In den großen, groben Händen hielt er einen Haselnusszweig, den er während des Redens pausenlos hin- und herbog und den er jetzt auf Herbies Füße richtete.
»Ich denke schon«, murmelte Herbie unsicher und blickte auf seine ausgetretenen Feld-Wald-und-Wiesen-Latschen hinunter. »Es waren die einzigen, die mir halbwegs geländegängig erschienen.«
»Machen Sie sich nicht lächerlich. Sie haben neunzehn Komma drei Kilometer zurückzulegen! Wollen Sie sich etwa morgen im Lazarett wiederfinden? Für einen Einsatz auf diesem Terrain benötigt man robuste, knöchelhohe Stiefel aus Leder mit durchgehender, rutschfester Profilsohle und Stahlkappe. Nichts zum Spazierengehen, sondern etwas zum Durchhalten. Das hatte ich Ihrer Tante deutlich mitgeteilt.«
»Na gut, ich kann ja zu Hause noch mal nachschauen, ob ich …«
»Mann, uns läuft die Zeit weg!«, herrschte der Major ihn an. »Der Wanderweg wird am Sonntag, exakt um elf Uhr null eröffnet! Die erste Etappe endet pünktlich um dreizehn Uhr fünfzehn am Verpflegungsstand bei der Buchenverjüngungsfläche hinter dem Eichenaltbestand. Dort dann Suppe fassen und Erfrischungen. Finden Sie alles im Ablaufplan, den ich Ihnen geschickt habe. Sie tragen ihn bei sich?«
»Selbstverständlich!« Herbie zog ein Bündel DIN-A4-Blätter hervor.
»Sie haben die markierte Karte?«
»Aber natürlich, hier!«
»Dieses Tagesprogramm wurde sorgfältig ausgearbeitet. Unser Ehrengast ist es gewohnt, nach präzisen Zeitabläufen zu …«
»Karl-August!«, ertönte schwach die Stimme seiner Frau, die im Geländewagen wartete.
»Was denn?«
»Karl-August, ich will nicht drängeln, aber der Arzttermin …«
»Ja, Herrgott! Ich beeile mich ja schon!«, blaffte er über die Schulter, ohne zu ihr hinzusehen.
Die kleine, zerbrechliche Frau passte hinter das Steuer des bulligen Gefährts ungefähr so gut wie ein Häkeldeckchen auf einen Schmiedeamboss. Sie hatte kurz geschnittenes, fast weißes Haar, und an ihren blau durchäderten Schläfen perlte der Schweiß herab. Ihr Mann hatte ihr trotz der Hitze befohlen, im Auto sitzen zu bleiben.
»Verdammter Zehennagel«, knurrte er.
»Er ist nämlich eingewachsen, Herr Feldmann, und es eitert ordentlich«, piepste seine Frau.
»Normalerweise würde ich das ja alles selbst erledigen.« Die stahlblauen Pupillen des Majors verschwanden fast völlig in den verästelten Furchen seiner zusammengekniffenen Augen. Er ließ den Blick über die Lichtung schweifen. »Dann wüsste ich wenigstens, dass es korrekt ausgeführt wird. Das da zum Beispiel …« Er wies mit dem Zweig auf eins der kleinen Kunststoffschilder, die Herbie mühevoll mithilfe einer Silikonspritze auf einen der Baumstämme am nahen Waldsaum geklebt hatte. »Halten Sie das etwa für einen mustergültig angebrachten Wanderwegweiser?«
Herbie trat an seine Seite, um das Ergebnis seiner Arbeit im selben Blickwinkel betrachten zu können. »Hm, bisschen schief vielleicht. Könnte rechts etwas tiefer, oder? Meinen Sie das?«
Der Major schnaubte verächtlich. »Schief, ha! Wenn es nur das wäre.« Er piekte Herbie mit dem Stock gegen die Brust. »Also, angenommen, der Wanderer kommt von da …«
Ein Glucksen ertönte im Hintergrund. Bis jetzt hatte sich die Person vornehm zurückgehalten. Der Mann war groß, bärtig und mehr als wohlgenährt, trug einen adretten Dreiteiler und blank polierte Schuhe, deren Anblick den Major vollends aus der Fassung gebracht hätte …
… wenn der ihn hätte sehen können. Der Name des Mannes war Julius, und er war Herbie Feldmanns ständiger Begleiter. Wo immer Herbie war, da war auch er, aber für alle anderen blieb er stets unsichtbar.
Die Ärzte, die man in Herbies Jugend auf ihn losgelassen hatte, hielten Julius für blanke Einbildung, für eine Halluzination, die seiner Psyche entsprang, die durch verschiedene Schicksalsschläge stark in Mitleidenschaft gezogen worden war.
Julius war so etwas wie ein Fantasiegefährte, eine Art imaginärer Freund, mit dem Kinder häufig kommunizieren. Obwohl Herbie hinter den Begriff Freund durchaus mehrere Fragezeichen gesetzt hätte. Denn wie ein echter Freund verhielt sich Julius nur sehr selten. Er mäkelte an ihm herum, machte Späßchen auf seine Kosten und hatte die größte Freude, ihn immer wieder in peinliche Situationen zu bringen.
Für Herbie war dieser korpulente, hochnäsige Besserwisser mehr oder weniger ein Mensch aus Fleisch und Blut, obwohl er objektiv gar nicht existierte.
Zuerst kam von Julius nur ein amüsiertes Grunzen, das Herbies Aufmerksamkeit gleich auf sich zog. Und als der Major schließlich herumfuhr, mit dem Zweig durch die Luft fuchtelte, auf die andere Seite der Lichtung wies und trompetete: »Und in der entgegengesetzten Richtung kommt der andere Wanderer von da!«, war es mit Julius’ Beherrschung vorbei.
Er warf sich in die Brust, ruderte mit den Armen und trompetete lautstark Befehle, die nur Herbie hören konnte: Posten meldet Sichtkontakt. Südostflanke, gestaffelte Formation! Alle Einheiten in Gefechtsbereitschaft! Feind in Anmarschrichtung Nord, zwanzig Mann, leicht versetzt, Flankenschutz offen! Julius ahmte den Befehlston des Exsoldaten perfekt nach.
Der allerdings merkte nicht das Mindeste davon. Er piekte Herbie wieder mit dem Zweig. »Können Sie mir sagen, wieso Sie das Schild so angebracht haben, dass man es aus keiner der beiden Richtungen sehen kann?«
Julius war noch nicht fertig. Auf Kommando Nebelgranaten zünden! Rückzug antäuschen! Wir brauchen Chaos, keine Klarheit.
»He, Feldmann, was sagen Sie dazu, Mann?«
»Chaos, keine Klarheit!«, entfuhr es Herbie. »Wir führen den Feind in die Irre!«
Major Dassler starrte ihn fassungslos an. Sein Nussknackerkinn klappte herunter. »Feind? In die Irre führen? Sagen Sie mal, was reden Sie denn da für ein Blech?«
»Verzeihung, Herr Major. Es kam so über mich.«
Julius kicherte enthemmt.
»Wir sind hier bei der Vervollständigung eines neuen Wanderwegs, nicht im Manöver!«
»Karl-August!« Der Ruf seiner Frau war nicht viel mehr als ein schwachbrüstiges Zwitschern.
»Lieselotte, bitte! Es dauert so lange, wie es dauert!« Seine röhrende Stimme ließ das Laub erzittern.
Herbie knetete nervös seine Fingerknöchel. Wo war er da nur wieder hineingeraten? Als seine Tante ihm vor ein paar Tagen diesen Job vermittelt hatte, war ihm das wie eine erfreuliche Abwechslung zu seinen letzten Aushilfsstellen erschienen, bei denen er hauptsächlich mit dem Abkratzen von Preisschildern auf Keramikkatzen, mit Leergutmanagement oder dem Auseinanderdröseln von Einkaufswagenketten beschäftigt gewesen war.
Die Vorstellung, in Gottes freier Natur, begleitet von munterem Vogelgezwitscher, ein paar Wegweiser auf Bäumen anzubringen und damit ein wenig Geld zu verdienen, war ihm ausgesprochen attraktiv erschienen. Ein neuer Wanderweg, das hörte sich reizvoll an, das klang nach praller Sommersonne und kühlem Schatten in erfreulichem Wechsel, das hatte ihm den Eindruck von bezahltem Aktivurlaub vermittelt.
Und jetzt stand er hier mitten in einem riesigen Waldgebiet südöstlich von Münstereifel, hatte gerade mal sechs Schilder montiert und ließ sich dafür vom Ersten Vorsitzenden des Heimat- und Geschichtsvereins Buchscheid nach Kommissmanier zusammenbrüllen.
Du hättest es wissen müssen. Es wäre der erste Auftrag deiner Tante, der ohne Haken ist. Julius lehnte sich an einen Baumstamm und reckte sein pausbäckiges Gesicht der Sonne entgegen.
»Karl-August, bitte!«
Der Major holte tief Luft, um sich mit einer geharnischten Erwiderung Luft zu verschaffen, besann sich dann aber eines Besseren, machte kehrt und humpelte zu seinem Geländewagen zurück. Sein Fluchen war nicht zu verstehen, bestand aber unverkennbar aus einer Aneinanderreihung unflätigster Militärverwünschungen.
»Hören Sie, Ihre Tante ist Fördermitglied unseres Vereins, und als sie uns die Hilfe ihres Neffen anbot, kam das hochwillkommen, denn uns rinnt die Zeit zwischen den Fingern davon. Sie sagte, dann seien Sie von der Straße. Was immer das heißen soll. Jedenfalls muss ich mich auf Sie verlassen können, Feldmann. Verlassen, hören Sie! Das Ding da hinten korrigieren Sie schleunigst. Und am Wochenende ist hier alles fertig, Feldmann.« Er hievte sich umständlich auf den Beifahrersitz und zog sein Bein nach wie ein Kriegsversehrter. »Sonst Gnade Ihnen Gott.«
»Sie können sich auf mich verlassen, Herr Major«, rief Herbie. »Ihr Ehrengast wird begeistert sein!«
Während Lieselotte Dassler sich unter aufbrüllendem Motorenlärm mit Aufbietung all ihrer spärlichen Kräfte am Lenkrad abmühte, winkte Herbie zum Abschied mit der Silikonspritze.
Die Gesichtszüge des Majors hatten sich in ein engmaschiges Gitter aus Stacheldraht verwandelt. Er starrte bewegungslos nach vorn, ohne Herbie noch einmal eines Blickes zu würdigen.
Auf Herbies Höhe hielt seine Frau den Wagen noch einmal an, ließ die Scheibe herunter und sagte piepsend: »Mein Mann kann es nicht so deutlich zeigen, Herr Feldmann, aber er ist Ihnen sehr dankbar. Der Köhlerweg ist sein Herzensprojekt, und es gibt so wenige Menschen, die ihre Dienste so selbstlos in den Dienst der guten Sache stellen. Das Ehrenamt ist so eine wichtige Stütze der Gesellschaft, und deshalb freuen wir uns sehr über Ihre Mithilfe. Ist es nicht so, Karl-August?«
»Ja, Ehrenamt, immerhin. Abfahrt, Marsch«, knurrte ihr Mann. Und sie fuhren davon.
Herbie starrte ihnen fassungslos hinterher.
»Sag jetzt nichts, Julius.«
Es fällt mir schwer, aber ich versuche es.
Herbie sprach es selbst aus: »Ehrenamt. Nicht zu fassen!«
Unbezahlte Arbeit im Dienst der guten Sache. Wenigstens bist du von der Straße. Dafür aber auf dem Holzweg.
»Waldweg, Julius, Waldweg.« Herbie hievte sich den Rucksack auf die Schultern und marschierte los. Wenn er schon keinen Lohn bekam, wollte er es wenigstens schnell hinter sich bringen.
»Ich weiß gar nicht, was der Major hat. Meine Schuhe sind bequem. Sie sind richtig schön eingelaufen. Ich vermute, dass er sich mit zivilem Schuhwerk nicht so gut auskennt.«
* * *
Die Sonne stand schon eine Weile jenseits des Zenits und ließ die weißen Mauern der Kirche St. Hubertus in einem warmen Glanz aufleuchten. Der Friedhof von Buchscheid war von einer halbhohen Bruchsteinmauer umgeben, dahinter dehnte sich ein breiter Streifen von Feldern und Hecken aus, die träge in der nachmittäglichen Sommerhitze lagen. In den hohen alten Linden am Rand des Friedhofs raschelte leise das Laub in einem erfrischenden Lufthauch. Eine Amsel pickte zwischen den Kieswegen nach Käfern, und irgendwo gurrte eine Taube träge im Dachgebälk des Kirchturms.
Der Friedhof war gepflegt, aber nicht aufdringlich ordentlich. Die Grabsteine – manche neu, andere schon von Flechten überzogen – standen in ruhiger Reihenfolge, umgeben von kleinen Buchsbaumhecken und ein paar halb verwilderten Rosensträuchern. Es duftete nach Erde, warmem Stein und verblühendem Sommerflieder.
Rosemarie Kreuser rieb mit dem Taschentuch über den Grabstein, auf dem in Metallbuchstaben der Name ihres Mannes und zwei Daten befestigt waren. Sechs Jahre lag er jetzt schon hier. Sie kam nicht unbedingt regelmäßig hierher, um nach dem Rechten zu sehen. Sie wusste, dass er das auch gar nicht gewollt hätte. Ihr Theo war von Zeit zu Zeit immer schon mal gerne für sich gewesen. Ständig hatte er was in seiner kleinen Gartenhütte zu hantieren gehabt. »Lass mich mal zwei Stunden, Röschen«, hatte er immer gesagt.
Röschen wischte sich die Finger ab und wies dann mit dem Taschentuch wedelnd in die Richtung, in der die neueren Gräber lagen. Dort, im hinteren Teil des Friedhofs, wo der Schatten der Kirschlorbeerbüsche über den Kiesweg kroch, tuckerte ein kleiner gelber Bagger vor sich hin.
»Du kriegst Gesellschaft, Theo«, sagte sie. »Bongarts Köbes. Mit dem hast du doch früher immer Karten gespielt.«
Von dem vor ihr liegenden Grab kam keine Antwort. So kannte sie ihren Theo. »Lungenkrebs, weißt du. Hätte ich eigentlich schon viel früher mit gerechnet.«
Das anschwellende Knattern des Baggers zerschnitt jetzt die ruhige Nachmittagsluft, und bei jeder Bewegung der hydraulischen Schaufel vibrierte der Boden leicht, als hätte der Friedhof einen Herzschlag bekommen. Auf dem Sitz des John-Deere-Geräts thronte Hemmersbachs Fränz. Er arbeitete konzentriert und hob mit vorsichtigem Schwenken der Schaufel das neue Grab aus.
Trotz der lauten Arbeit und der Graböffnung lag an diesem Ort nichts Schweres in der Luft. Es war ein friedlicher Platz, wie geschaffen für ein freundliches Nachmittagslicht, für Erinnerungen und einen leisen Hauch von Ewigkeit.
Röschen wandte ihr Gesicht der Sonne zu. Wenn es einmal so weit war, dann würde sie gerne im Sonnenschein sterben. Auf keinen Fall im Herbst oder im Winter. Ein schöner Frühlingstag im Mai müsste es sein oder ein warmer Spätnachmittag im August. Aber das konnte man sich ja nicht aussuchen. Sie hatte zwar noch ein paar Jahre Zeit, aber sie würde bestimmt keine hundert werden, so viel stand für sie fest.
Als sie die Augen halb öffnete und in die Sonne zwinkerte, nahm sie eine Silhouette wahr. Eine Gestalt in einem seltsam unförmigen Mantel stand da zwischen zwei alten Grabsteinen und kramte mit gesenktem Kopf in einer großen Umhängetasche herum.
An welchem Grab stand dieser Mensch? War es das von Lotte Stoffels? Doch, ja, das sah ganz so aus. Die war früher die Haushälterin des verstorbenen Pastors Rövenstrunck gewesen. Aber die hatte doch keine noch lebenden Verwandten, da war sich Röschen sicher.
Sie steckte das Taschentuch ein und griff sich den Gehstock. Beim Zurückbringen der leeren Gießkanne konnte sie einen kleinen Umweg gehen. Fremde im Dorf erregten immer ihre Aufmerksamkeit.
»Ich lass dich jetzt in Ruhe, Theo«, murmelte sie beiläufig und wackelte los.
In einiger Entfernung war unterdrücktes Gelächter zu hören, und Röschen wandte sich um. Am Wasserhahn standen zwei junge Frauen im Schatten eines Baumes, hielten ihre Gießkannen und tuschelten kichernd miteinander. Als Röschen sich wieder umdrehte, war die Gestalt verschwunden. Sie blickte zwischen den Gräbern hin und her, aber nirgends war eine Spur von der fremden Person zu entdecken.
Sie ärgerte sich. Wenn man mal einen Moment nicht aufpasste!
Als sie die Stelle erreichte, an der die Gestalt noch vor wenigen Momenten gestanden hatte, stutzte sie. Es war nicht das Grab von Lotte Stoffels, sondern das gleich daneben. Neben der klobigen Grableuchte aus Messing lag ein kleines Sträußchen Feldblumen. Sie sahen schon schwächlich und welk aus. Den Abend würden sie nicht mehr erleben.
Eine laute, raue Stimme ertönte. »Tach, Röschen!«, rief Fränz zu ihr herüber.
Sie hatte gar nicht mitbekommen, dass sein Bagger verstummt war. Fränz hatte eine Knollennase und ein markantes Stoppelkinn. Sein ganzer Kopf war feuerrot und schien in der Sonne regelrecht angeschwollen zu sein. Er trank aus einer Sprudelflasche und rülpste laut. Franz Hemmersbach war auch schon über achtzig, aber der Personalmangel machte auch vor dem Bauhof nicht Halt. Und in Urlaubszeiten mussten mitunter dann auch die Rentner noch mal ran.
»Warst du schon wieder beim Theo?«, rief er fröhlich. »Der will doch mal seine Ruhe haben!«
Röschen hob zum Gruß ihren Gehstock. »Sag mal, Fränz, hast du hier gerade einen gesehen? Einen mit Mantel?«
»Nee, keine Ahnung. Wenn ich auf dem Bagger sitze, kriege ich nix mit!«
Sie deutete mit der Spitze des Stocks auf das Grab zu ihren Füßen. Es war ein mit vielen blühenden Pflanzen geschmücktes Beet, das Franz Hemmersbach seit ein paar Jahren mit großer Hingabe persönlich hegte und pflegte. Schließlich war hier seine verstorbene Frau begraben.
»Fränz, guck mal. Deiner Luise hat einer gerade ein paar Blümchen hingelegt.«
3. Kapitel
Vierzig kleine Markierungsschilder hatte Herbie in den Rucksack gepackt und zusätzlich noch eine Schablone und eine Dose Sprühlack, mit deren Hilfe er auch auf Felswänden und anderen Dingen Wegweiser hinterlassen konnte, an denen die Schilder nicht anzubringen waren.
Er arbeitete auf Sicht, so wie es ihm eingeschärft worden war. Wenn es geradeaus ging, reichte etwa alle 200 Meter eine Erinnerungsmarkierung; wenn der Weg sich schlängelte, musste an jeder Biegung markiert werden. Und der Weg schlängelte sich oft.
Der Wanderweg führte zwanzig Kilometer an siebzehn Stellen vorbei, an denen in früheren Zeiten Kohlemeiler gestanden hatten. In den Zeiten der napoleonischen Besatzung blühte in der Eifel der Erzabbau, und zur Verhüttung waren unfassbare Mengen von Holzkohle nötig. Zu diesem Zweck wurde damals fast das gesamte Land kahl geschlagen, und das Holz wurde verkokelt.
Der Heimat- und Geschichtsverein Buchscheid, dem dieser Major vorstand, beschäftigte sich mit der Historie des Dorfes und der näheren Umgebung. Und seit ein paar Jahren auch mit dem Aufspüren und der Kartierung der alten Köhlerstellen. Für Herbie waren diese Orte kaum zu identifizieren. Er verstand nicht, was jemanden am Abklappern solcher Relikte reizen sollte.
Ab und zu begegneten sie Wanderern, die ihnen entweder entgegenkamen oder sie mit einem Affenzahn überholten. Sie hatten ausnahmslos alle deutlich bessere Laune als Herbie und grüßten fröhlich. Zudem steckten sie in Funktionskleidung in Tarnfarben und massiven Wanderschuhen.
Profis. Julius nickte anerkennend. Sieht man gleich. Die haben GPS im Blut und den Kompass im Herzen!
Herbies Füße schmerzten inzwischen gewaltig. Der Major hatte ihm keineswegs zu viel versprochen. Brombeerranken rissen ihm die Waden blutig, ständig veranstalteten aufgebrachte Waldvögel über seinem Kopf ein Riesenspektakel, und einmal fuhr ihn sogar ein Mountainbiker fast über den Haufen – er empfand seine Mission mehr und mehr als Himmelfahrtskommando.
Julius trabte die ganze Zeit munter neben ihm her und schien die körperliche Ertüchtigung sehr zu genießen. Ab und zu pfiff er eine schmissige Melodie und versuchte erfolglos, Herbie zum Mitsingen eines Marschlieds zu animieren. O du schöhöhöner Wehehesterwald!
»Du bist eine Nervensäge, Julius!«
Eukalyptusbonbon!
Immer wieder hielt Herbie inne und verglich die Markierungspunkte auf der Karte mit denen, die auf den Hinweisschildern an den einzelnen Stationen zu sehen waren.
Mit dem großen Kohlemeiler, der jeden Sommer im Dörfchen Düttling bei Gemünd errichtet wurde, hatten diese Plätze so gut wie nichts gemein. Den hatte sich Herbie schon ein paarmal angeguckt.
Die Stationen dieses Meiler-Wanderwegs waren uralt und unscheinbar. Allesamt waren sie dem Erdboden gleich, und obwohl sie von den Mitgliedern des Vereins in den letzten Jahren mühevoll freigelegt worden waren, blieben es doch nur kreisrunde, kohlschwarze Verfärbungen auf dem Waldboden, der für ihn sowieso überall ähnlich aussah. Laub, Erde, Steine, Wurzeln. Wald eben.
Sie waren schon zwei Stunden unterwegs, und die Hitze des Tages wurde von einem sanften Lüftchen vertrieben. Die Schatten der Bäume wurden länger. Es ging inzwischen auf halb sieben zu.
»Ehrenamtlich«, knurrte er und sprühte einen schwarzen Richtungspfeil auf das weiße Quadrat, das er auf einem mächtigen Findling angebracht hatte. »Und wieso bin ich jetzt der Trottel, der auf den letzten Drücker den ganzen Weg noch mal ablatschen muss und anderer Leute Arbeit erledigt? Ehrenamtlich!«
Weil du es nie lernst. Man handelt vorher einen Stundenlohn aus. Das machen viele Menschen. Versuch es doch auch mal.
»Ach ja? Verhandeln mit meiner Tante?« Herbie versuchte verzweifelt, die Stöckchen und das dürre Laub von seinen lackierten Fingern zu bekommen. »Oder mit des Teufels General? Da komme ich ja mit Putin schneller ins Geschäft.«
Um mal zu einem erfreulicheren Thema zu kommen: Bist du dir eigentlich sicher, dass du noch auf dem richtigen Weg bist?
Herbie holte die Karte hervor. »Wieso fragst du? Denkst du, wir sind falsch?«
Ich meine nur.
»Die Bäume sehen aber auch alle gleich aus. Wir waren hier … und hier … und hier …«
Hui, fantastisch. Das sind doch schon mal ganze anderthalb Kilometer! Von zwanzig!
Herbies Finger klebten an der Karte fest. Er wusste nicht, ob das vom Lack oder vom Silikon kam.
»Mein Auto steht da … Nein, da!«
Bist du dir sicher?
»Was soll dieses Bist du dir sicher? Mach mich nicht unnötig nervös!«
Ich finde das nicht unnötig.
»Achtzehn Schilder haben wir schon. Das geht jetzt ratzfatz. Jetzt sind es nur noch zweiundzwanzig.«
Und dann noch die drei Dutzend, die in deinem Auto sind. Wo stand es noch gleich?
»Da. Nein, warte mal … da!«
Bist du dir sich…?
»Hauptsache, ich finde vor Einbruch der Dunkelheit dahin zurück. Vorhin habe ich ein paarmal Motorenlärm gehört. Wir müssen ganz in der Nähe einer Straße sein. Ob es die hier ist?« Er drehte suchend die Karte ein paarmal hin und her.
In diesem Moment zerriss ein lauter Knall die Abendluft. Er kam aus nächster Nähe. Im ersten Moment hatte Herbie das Gefühl, es sei irgendetwas explodiert. Die Waldvögel stoben mit lautem Gezeter durch das Blätterdach davon.
Dann folgte eine zweite Detonation. Herbie warf sich instinktiv auf den Boden.
»Schüsse, Julius! Das waren doch Schüsse, oder?«
Julius ging neben ihm in die Hocke und stützte sich mit den Unterarmen auf den Knien ab. Ich vermute, es ist der Major, der dich zur Strecke bringen will. Du hast alles falsch gemacht!
Ein dritter Knall.
»Das sind eindeutig Schüsse, Julius! Das sind verdammte Jäger! Die können doch hier nicht am helllichten Tag rumballern!«
Keine Sorge, mein Bester. Du hast weder Ähnlichkeit mit einer wilden Sau noch mit einem Rehlein.
Herbie lauschte angestrengt in die Stille und löste sich langsam aus seiner Schockstarre. Zögernd richtete er sich auf und spähte dabei hektisch hin und her.
Nein, wenn ich richtig drüber nachdenke, hast du eher so was Karnickelartiges.
»He! Hallo! Nicht schießen!«, rief Herbie, so laut er konnte. »Hier sind Menschen unterwegs! Hier ist ein Wanderweg!«
Es kam keine Antwort. Selbst das Vogelgezwitscher war nicht mehr zu hören, da die Tiere zur Sicherheit das Weite gesucht zu haben schienen.
Aber dann erscholl eine Stimme. Zuerst waren es unverständliche Laute, die eher wie ein lautes Stöhnen klangen, aber dann verstanden sie die Worte ganz deutlich.
»Hilfe!«, rief jemand. Ein Mann. »Nicht schießen! Hilfe! Ich brauche Hilfe!«
Herbie und Julius starrten einander mit schreckgeweiteten Augen an.
»Da ist anscheinend was schiefgelaufen«, hauchte Herbie. »Gehörig schief.«
Ich glaube, das kam von da drüben. Von der anderen Seite der kleinen Anhöhe da. Ausnahmsweise machte auch Julius ein besorgtes Gesicht.
Was nun folgte, war wieder einmal einer dieser Momente, in denen Herbie sich keinen überflüssigen Gedanken über die Konsequenzen seines Tuns machte. Ohne zu zögern, zog er den Rucksack von den Schultern, warf ihn an den Wegesrand und lief den bemoosten kleinen Hang hinauf. Er strauchelte durch widerborstiges Brombeergestrüpp und schlug sich die Spinnweben aus dem Gesicht, die zwischen den Ästen wie hauchdünne Fallen gespannt waren. Der Boden unter seinen Schuhen war weich und federnd, durchzogen von Wurzelgeflecht und dem fauligen Duft alten Laubs.
Julius folgte ihm auf den Fuß. Gib wenigstens ein paar menschliche Laute von dir, damit du nicht doch noch als gespickter Hasenbraten endest.
Das leuchtete Herbie ein. Er ruderte wild mit den Armen. »Hallo! Wer auch immer da ist! Nicht schießen!«
Und augenblicklich krachte ein weiterer Schuss, dessen Echo sich im endlosen Dunkel des Waldes verlor.
Herbie ging in die Hocke. »Ach du Scheiße, ich hätte still sein sollen.«
Wollte ich dir auch gerade raten.
»Na danke!«
»Hilfe!«, rief es erneut. Die Stimme klang jetzt näher als zuvor.
»Verdammt, was ist das hier, Julius? Schüsse … Hilferufe …«
Es dauerte einen Moment, bis er sich traute, den Kopf vorsichtig zu heben. Nur ein Stück, gerade so, dass er über das Gestrüpp blicken konnte. Er reckte den Hals, schob sich millimeterweise nach oben – und sah Wasser. Ein kleiner Teich. Etwas Gelbes. Ein Auto. Durch das struppige Laub erkannte er nur Bruchstücke.
Woher kamen diese Rufe?
Wer zum Teufel schoss hier?
»Hilfe!«
Dann brauste etwas auf Herbie zu, stampfend, schnaufend. Das Dickicht erbebte – und eine Gestalt taumelte direkt in ihn hinein. Etwas traf ihn mit voller Wucht am Kinn – ein Knie, ein Fuß möglicherweise –, und er kippte rücklings um und rollte ins Unterholz.
Ein stechender Schmerz durchzuckte seinen Kopf, wie ein Kurzschluss im Schädel. Alles wirbelte um ihn herum: Blätter, Zweige und dazwischen Julius’ Gesicht.
Doch eines hörte er glasklar: ein hastiges Keuchen und sich entfernende Schritte.
Und dann wieder die Hilferufe.
Herbie rappelte sich auf, schwankte kurz und stand.
Sei vorsichtig, Mann!
»Wer auch immer das war – er hat geschossen. Und da unten ist jemand, der unsere Hilfe braucht!«
4. Kapitel
Aus einem kleinen Transistorradio plärrte Popmusik durch den Garten. Der Schlagerbarde Teddy Marco sang mit kehliger Inbrunst und butterweichem Vibrato: »Unter deiner Haut brennt mein Name.«
Kreusers Röschen schüttelte mit milder Fassungslosigkeit den Kopf. In ihrer Jugend hatte man auch so manchen peinlichen Kitsch gehört, aber immerhin war der damals noch halbwegs mit Haltung, gepflegter Frisur und Stimmvolumen vorgetragen worden. Heute dagegen klang es oft, als würde sich ein Staubsauger den Herzschmerz von der Seele singen.
SWR4 war jedenfalls auch nicht mehr das, was es mal gewesen war.
»Weißt du, Purzel, es gab Zeiten, da konnte man noch den lieben langen Tag wunderschöne Volksmusik hören. Aber heute sind das nur noch Oldies und so ein billiges Schlagergeknödel.«
Purzel störte sich nicht an der Musik. Er war ein neunzehnjähriger, dicker Kater, der schwarz-weiß gescheckt war wie eine Holsteiner Kuh und nur einen einzigen roten Fleck auf der Stirn hatte. Er döste in der Sonne und dachte vermutlich darüber nach, wie viel Spaß man mit all den Hummeln haben könnte, wenn man sich dafür nicht würde bewegen müssen.
Röschen schaltete das Gerät aus. Diese Art von Musik hatte sie ihr ganzes Leben lang hören müssen, damals, als sie noch die Kneipe unten im Ort gehabt hatte.