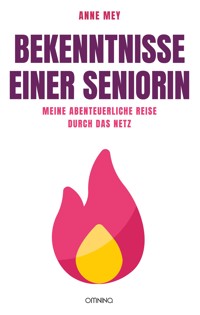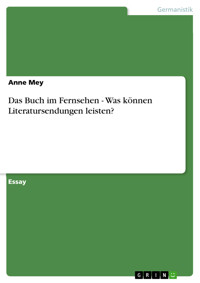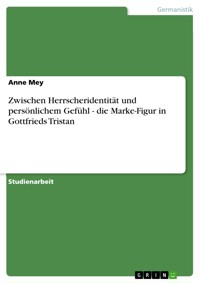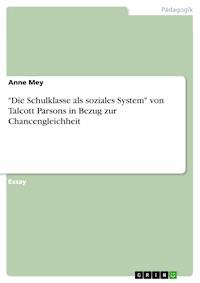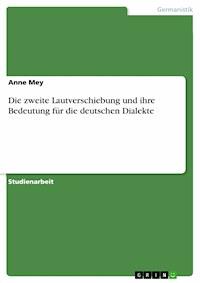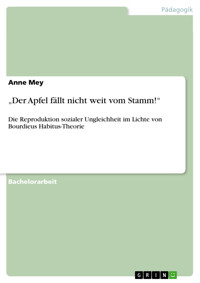14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Omnino Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman über Wahnsinn, Wahrheit und das Erbe unserer Mütter. Clara wächst als jüngste Tochter in einer Familie auf, in der das Schweigen lauter ist als jedes gesprochene Wort – und in der die Vergangenheit tief in das Leben der Gegenwart hineinreicht. Ihre Mutter Agnes ist schön, stolz und fanatisch: Anhängerin der NS-Rassenideologie, überzeugt von ihrer arisch-nordischen Herkunft – und bereit, jeden zu opfern, der diesem Bild nicht entspricht. Ihren ersten Mann, den Physiker Hans Mesmer, erklärt man 1941 für schizophren. Agnes lässt ihn fallen. Jahre später wird ihre Tochter Clara selbst zur Patientin der geschlossenen Psychiatrie. In zwei ineinander verwobenen Erzählebenen führt Löwenzahnmilch in ein Leben zwischen Realität und Wahn. Zwischen Missbrauch und gesellschaftlicher Blindheit. Es berichtet aber auch von Freundschaft, Widerstand und der Kraft der Sprache. Während Clara sich immer wieder in die fremdartige Welt ihrer Psychosen verliert – eine Welt aus Magie, Hexerei und geheimen Botschaften –, gelingt ihr ein ungewöhnlicher Weg zurück ins Leben: ein Studium, eine Familie, eine vage Normalität. Doch als ihre Ehe zerbricht und ihre Mutter im Sterben liegt, bricht die Vergangenheit mit aller Wucht erneut in ihr Leben. Ein berührender und klarsichtiger Roman über psychische Krankheit, Schuld und Vergebung – und darüber, wie wir durch das Erzählen lernen, uns selbst zu verstehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Löwenzahnmilch
Anne Mey
Löwenzahnmilch
Roman
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 9783958942905
© Copyright: Omnino Verlag, Berlin / 2025
Am Friedrichshain 22 / 10407 Berlin / [email protected] / www.omnino-verlag.de
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.
Dem Gedenken meiner Mutter, die so nicht war.
Inhalt
Text Begin
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Über das Buch
Über die Autorin
Das Kind lag im Schatten eines großen Rhododendron mit dichten lila Blüten und blickte in den wolkenlosen Nachmittagshimmel. Plötzlich hörte es aus der Ferne seinen Namen rufen: „Clara.“ Und wieder, ungeduldig, böse: „Clara!“ Da spürte das vierjährige Mädchen auf einmal ein Brennen und Stechen. Es lag in einem Gestrüpp von Brennnesseln. Wieder hört es die böse Stimme rufen. Da beeilte es sich, fast missmutig, freizukommen. In den Nesseln hatte sich das vierjährige Kind wunderbar einsam und geschützt gefühlt.
„Clara!“ Jetzt hört sie die Stimme ganz in der Nähe, eine zu Tode gehetzte Stimme. Es ist Henry, der verzweifelt um Hilfe schreit. Henry war der erste Freund in ihrem Leben. Aber eines Nachts hat er sie verraten. In einer überfüllten Kneipe standen sie eng nebeneinander und tranken Bier. Clara, eine Weile in Gedanken versunken, wandte sich schließlich wieder ihm zu und erstarrte vor Entsetzen bei dem, was sie sah. Gierig wühlte Henrys Zunge im Mund eines fremden Mädchens. Das schaute kurz hoch, schuldbewusst. Da rannte Clara in die Nacht hinaus, und sofort sprang Henry ihr nach. Das habe alles nichts zu bedeuten, beteuerte er, er liebe doch nur sie. Aber er kehrte in die Kneipe zurück. Noch in derselben Nacht packte sie ihre Sachen und verließ die gemeinsame Wohnung. Und bald danach ist sie durchgedreht.
Als sie jetzt Henrys Stimme hört, denkt sie voll abgrundtiefen Entsetzens: „Er stirbt, und ich bin schuld.“ Plötzlich ist die Feuerwehr da. Männer mit Helm und blauer Uniform packen sie derb am Arm. „Nun halten Sie doch still. Sie haben uns ja selber gerufen.“ Und auf einmal ist Henry da, und sie fühlt erleichtert: „Ich habe ihn also nicht getötet.“ Auch die panische Angst, Agnes, ihrer Mutter, zu begegnen, lässt nach.
Kapitel 1
Agnes Körner und Hans Mesmer hatten sich das Jawort vor dem Standesamt Berlin-Pankow gegeben. In der Wohnung des jungen Paares, direkt am Pankower Schlosspark gelegen, traf sich nach der Trauung ein kleiner Kreis von Verwandten und Freunden. Strahlend ging die Braut mit einem Glas Sekt in der Hand von Gast zu Gast und prostete jedem zu. Ihr Mann dagegen hielt sich still im Hintergrund, aber das nahm ihm keiner übel, Physiker sind eben Sonderlinge. Hochbegabt war dieser Hans, hieß es bewundernd, er werde als Physiker noch eine glänzende Karriere machen. Hans Mesmer kam aus einfachen Verhältnissen, sein Vater war ein kleiner Postbeamter in Günzburg, einem Städtchen östlich von Ulm. Und nun heiratete der Sohn die Tochter eines Landrats!
Vor vier Jahren allerdings, im Mai 1934, hatten die Nazis Landrat Karl Körner ins ferne Ostpreußen abgeschoben. Kurz und knapp und kaltgestellt, pflegte die Landrätin zu sagen, die sich gern an griffigen Formulierungen ergötzte. Körner, ein stattlicher, etwas arrogant wirkender Mann, war Mitglied des Stahlhelms gewesen, des Bundes der deutschen Frontsoldaten, und hatte sich dessen Eingliederung in die Partei nicht gefügt. Denn nicht durch einen Verwaltungsakt wollte er Parteimitglied werden, sondern, wenn überhaupt, aus Überzeugung, und war dann aus dem gleichgeschalteten Stahlhelm ausgetreten. Das zog die Strafversetzung in den Osten nach sich. So kamen die protestantischen Körners ins ostpreußische Allenstein, mitten unter die Katholiken, da die Stadt Allenstein, nun im Regierungsbezirk Königsberg gelegen, lange zum Königreich Polen gehörte.
Gerade hatte der Landrat begonnen, dem Postmeister, einem hageren Mann mit gütigen Augen, aus seiner alten Amtszeit in Nordfriesland zu erzählen. Einen historischen Prozess habe er damals in Niebüll geführt, erläuterte Körner mit weittragender Stimme, und zwar gegen die Dänen, die nie spurten, wenn es um die gemeinsame Ausbesserung des Deiches im Grenzbezirk ging. Das waren Körners Spezialitäten: das Prozessieren und der Deichbau. Am 1. Juni des Jahres 1927 hatte er den Hindenburgdamm eingeweiht, jenen elf Kilometer langen Damm, der endlich die Insel Sylt mit dem Festland bei Klanxbüll verband, wie es schon der Wunsch des Kaisers gewesen war.
„Unsere Tochter überreichte beim Festakt dem Reichspräsidenten einen Blumenstrauß“, sagte der Landrat stolz und warf einen bewundernden Blick auf Agnes, die gerade in der Tür erschien, in ihrem sonnenblumengelben Kostüm, mit schwarzer Kette und schwarzen Pumps, eine schöne, fast extravagante Erscheinung.
„Wo ist mein Mann?“, fragte Agnes, die die Worte ihres Vaters gehört haben musste, leise und kehrte unvermittelt, ohne die Antwort abzuwarten, in das angrenzende Balkonzimmer zurück.
„Bitte schweig doch“, flüsterte die Landrätin ihrem Mann zu. Der Postmeister blickte erstaunt, und Körner verstummte abrupt. Dann nahm Elisa Körner, eine zierliche und mit ihren fünfzig Jahren immer noch hübsche Frau, ihren stattlichen Gatten beim Arm und zog ihn ein paar Schritte fort zu der Anrichte am Fenster, auf der die Hochzeitsgeschenke lagen. „Musst du immer an die alte Geschichte rühren?“, klagte sie. „Es war schlimm genug für das arme Kind.“
Unter der Aufsicht des Fräuleins durften Agnes und ihre vier Jahre jüngere Schwester Anna nachmittags am Strand spielen. Wenn die Zwölfjährige sich langweilte, gab sie vor, Pippi machen zu müssen, und das Fräulein, das die Kleine nicht unbeaufsichtigt lassen konnte, erlaubte der Großen, kurz zu verschwinden. Glücklich, allein zu sein, rannte Agnes den Deich hinauf, von dem ein langer Pfad zu den wenigen verstreut liegenden Gehöften hinabführte. Am Wegrand standen vereinzelt Büsche, da konnte sie sich niederhocken und dann beobachten, wie der Pippistrahl auf dem staubigen Sommerboden ein kleines, unregelmäßiges Bächlein bildete, das langsam versickerte und dabei eine dunkle Spur hinterließ. Agnes liebte diese Wasserzeichnung auf dem Erdboden und verweilte lustvoll in der Hocke, wobei sie ein beachtliches Können beim Ausrichten des Strahles entwickelte sowie in der Technik, die zurückstiebenden Tröpfchen zu meiden.
Eines Nachmittags, wenige Tage vor der Einweihung des Hindenburgdammes, hockte sie in der flirrenden Frühsommerhitze wieder genüsslich im Gebüsch, als sie plötzlich Schritte hörte. Schuldbewusst fuhr sie hoch und zog den Schlüpfer hastig über das nackte Hinterteil. Da stand der riesige Mann schon vor ihr. Er hielt ein Messer in der Hand und stieß sie mit einem dumpfen Laut zu Boden. Da hat sie jedoch nicht geschrien, wie es natürlich gewesen wäre, sondern hat etwas anderes, genauso Natürliches getan. Sie hat laut das Vaterunser gebetet. Und es geschah ein Wunder: Der Mann mit dem Messer wälzte sich von dem Mädchen herunter und rannte davon. Dem Fräulein erzählte Agnes nichts. Am Abend aber bekam sie hohes Fieber, und der herbeigerufene Arzt hörte aus ihrem wirren Gestammel die wiederkehrenden Worte „Mann“ und „Messer“ heraus. Der alte Hausarzt reimte sich die Geschichte zusammen und informierte die Landrätin. Diese reagierte ungewöhnlich gefasst. Als Mutter von zwei Töchtern und selbst mit drei Schwestern aufgewachsen, hatte sie immer mit so einer Geschichte gerechnet. Nicht dass sie froh war, dass eine gefürchtete Katastrophe fast eingetreten war, aber nun hatte man die endlich hinter sich, und zum Glück war ja nichts Schlimmes passiert.
„Wir müssen das Kind vorsichtig aushorchen, sobald es wieder gesund ist“, endete Frau Körner den Bericht abends an ihren Mann. „Das Schwein werd’ ich fassen“, rief der, und am nächsten Tag stand die Geschichte bereits in der lokalen Zeitung. Bald wusste es der ganze Landkreis. Der Landrat erhob Anklage gegen unbekannt. Mit dem ihm eigenen Eifer stürzte er sich auch in diesen Prozess.
Einer sehr blassen Agnes wurde drei Tage später der große, bunte Blumenstrauß für den Reichspräsidenten in den Schoß gedrückt, nachdem sie mit der Mutter im zweiten Wagen der feierlichen Autokolonne Platz genommen hatte, die Hindenburg und Körner von Niebüll nach Klanxbüll brachte. Als der Vater dem hohen Gast die Schere überreichte zum Durchschneiden der roten Kordel, die den neuen Damm zur Insel Sylt nur noch symbolisch von der Küste trennte, da hätte Agnes sich fast übergeben. Stumm überreichte sie die Blumen, mit einem entzückenden Knicks und einem traurigen Lächeln. Die Zuschauer blickten mit größerer Bewunderung auf das tapfere Mädchen als auf den greisen Landesvater.
Der Prozess gegen den Kinderschänder machte noch viel von sich reden. Er geriet zum Musterprozess, von dem die Zeitungen täglich berichteten. Der Täter wurde schnell gefasst, ein aus dem Zuchthaus in Flensburg geflohener Häftling, ein Irrsinniger, der in religiösem Wahn gemordet hatte. Daher die Wirkung des lauten, kindlichen Gebets. Lange berieten die Geschworenen, ob die Zwölfjährige in den Zeugenstand zu rufen sei. Doch der öffentliche Auftritt wurde ihr erspart. Es reichte die Aussage des Vaters und des Arztes, zumal der Zuchthäusler schließlich geständig war.
Noch nie hatte es in Nordfriesland einen Prozess wegen versuchter Vergewaltigung an einem Kind gegeben. Natürlich kamen solche Dinge vor, aber eigentlich schwieg man doch lieber darüber. Der Landrat, darin war man sich einig, zeigte sich wieder einmal als moderner, aufgeklärter Mann. Böse Zungen behaupteten allerdings, er wolle sich mithilfe des Prozesses den Weg an die Spitze des Landesjustizministeriums ebnen.
Die Trauung von Agnes und Hans am Standesamt Pankow fand an einem Schalttag statt, dem 29. Februar 1938. Ob es ein gutes Omen sei, wenn der Hochzeitstag nur alle vier Jahre wiederkehre, hatte Agnes besorgt ihren Verlobten gefragt. Eine Ehe bleibe dadurch ungewöhnlich jung, antwortete Hans lachend und erklärte ihr begeistert die mathematische Funktion des Schaltjahres. Und außerdem reime sich das gut zum Ehestandsdarlehen, das nach der vierten Geburt abgekindert sei. Das Erste, da waren sie sich mittlerweile sicher, trug Agnes schon seit Weihnachten in ihrem Bauch, und deshalb musste alles rasch gehen. Sobald das Aufgebot im Schaukasten des Rathauses hing, hatte Hans die Papiere für das Ehestandsdarlehen besorgt. Ja, mindestens vier Kinder wollten sie, eine richtig große Familie.
Im ostpreußischen Allenstein fand drei Wochen später die kirchliche Trauung statt. Die Landrätin entfaltete ihr großes Organisationstalent bei der Vorbereitung der Feier: Betont schlichte Einladungskarten wurden versandt, zusätzliches Personal gemietet, Pferdekutschen für die vielen Gäste bestellt. Eine Hochzeitstorte so groß wie ein Wagenrad wurde in Auftrag gegeben, mit mehreren Schichten und den Vornamen des Paares in buntem Zuckerguss. Das opulente Kunstwerk gefiel Agnes überhaupt nicht. Sie träumte von einer sanft gestuften, hohen Sahnetorte, gekrönt von einem kleinem Brautpaar aus Marzipan, wie in dem amerikanischen Film, den sie vor Kurzem gesehen hatte: er im schwarzen Anzug wie ein Schornsteinfeger, sie in einem rosa Ballerinakleid. Vielleicht in Königsberg, berühmt für sein Marzipan, könne ein Konditor so etwas herstellen, hatte die Mutter beschieden, jedoch nicht in Allenstein. Die zwanzigjährige Anna jedoch betrachtete die Prunktorte voller Sehnsucht, als ob sie ahnte, dass ihr Fest einmal weit bescheidener ausfallen würde.
Die Landratsvilla, ein weißer Jugendstilbau, lag am Fluss. Ihre rückseitige Fensterfront gab den Blick auf die Ordensburg jenseits des Alle-Flusses frei, während vorn hinaus das Kaiser-Wilhelm-Denkmal zu sehen war und weiter dahinter die einzige evangelische Kirche, ein mächtiger, roter Backsteinbau aus der Gründerzeit. Die Kirche wurde jedoch nicht so gedrängt voll, wie der Landrat erwartet hatte. Die Körners blieben eben Zugereiste. Die guten Leutchen hier haben gehofft, pflegte der Landrat zu spötteln, dass ihnen endlich der katholische Hitler einen Katholiken an die Spitze der Verwaltung stellt. Unter den wenigen Katholiken, die aus Anlass der Hochzeit das protestantische Gotteshaus betraten, befand sich auch Doktor Michowski, der Hausarzt, ein eingedeutschter Pole, der oft in die Landratsvilla gerufen wurde. Denn bei der kleinsten Erkältung fürchtete Körner, nun völlig taub zu werden. Sein Gehör hatte im Weltkrieg, 1916 in der Schlacht an der Somme, Schaden genommen, als eine Kanone direkt neben ihm explodierte.
Der Innenraum der Kirche mit seinen weiß getünchten Wänden machte einen sehr nüchternen Eindruck. Immerhin standen neben dem Altar auf beiden Seiten hohe Vasen, dicht gefüllt mit weißen und hellroten Gladiolen. Als das Brautpaar zum Altar schritt, spielte die Orgel das Lied Geh aus mein Herz und suche Freud in dieser schönen Sommerzeit. Auf diesem, jahreszeitlich völlig unpassenden Auftakt hatte Agnes heftig bestanden, und weil es das einzige Mal war, dass sie bei den Hochzeitsvorbereitungen auf etwas beharrte, ließen die Eltern diese Ungereimtheit schließlich durchgehen. Sogar beim Entwerfen des Brautkleides hatte Agnes der Mutter in allem zugestimmt. Die sorgte auch dafür, dass die Stadtzeitung ein großes Foto von dem schönen Paar brachte: beide schlank und hochgewachsen, sie mit einem schlichten blonden Haarknoten, und er mit dunklen Locken und hoher, schmaler Nase. Er sehe so anders aus, der Hans, wunderte sich Anna, aber jüdisch könne es bei dieser Nase ja nicht sein. „Er gehört eben zur süddeutschen, dinarischen Rasse“, erklärte die Landrätin, „aber die ist trotzdem mit uns nordischen Menschen eng verwandt.“
Agnes, neben Hans vorn auf der Kirchenbank, kämpfte mit einer Müdigkeit, die sich wie ein großer Wattebausch auf sie legte. Keinen Moment lang hatte sie Aufregung gespürt, noch nicht einmal, als sie vor dem Altar stand und Hans ihr feierlich den Ring über ihren Finger streifte. Stattdessen das Gefühl, als ob das alles gar nicht ihr gelte. Durch eines der hohen Fenster fiel ein breiter Sonnenstrahl in den Kirchenraum und warf einen hellen Streifen zwischen die Familienangehörigen in der ersten Reihe und dem Geistlichen auf der Kanzel. Gebannt starrte Agnes auf die zwei weißen Stoffzungen, die von der sonst schwarzen Hemdbrust des Pfarrers sich ihr entgegenreckten. Damals, als ein Gebet ihr das Leben rettete, hatte sie merkwürdigerweise den Glauben an den lieben Gott verloren. Eines Nachts hatte sie Hans von der schlimmen Geschichte erzählt, der sie darauf sehr zärtlich streichelte, aber immer noch nicht merkte, dass ihr etwas zu ihrem Glück fehlte. Obwohl er doch das dicke Buch über die Vollkommene Ehe ganz durchgelesen hatte, wo genau beschrieben ist, wie der Mann seine Frau zum Orgasmus bringt. Natürlich liebte sie ihn, ihren Hans, und das, was fehlte, würde bestimmt noch kommen. Dass sie keine Jungfrau mehr war, hatte er allerdings gemerkt und wollte genau wissen, wie das passiert war, und sie hat ihm ihre Jugendliebe aus der Schulzeit gebeichtet. In den Dünen und im Badehäuschen hätten sie sich nachts heimlich getroffen. Da habe sie das Entsetzliche aus ihrer Kindheit vergessen können. Warum sie denn nicht geheiratet hätten? „Ach, plötzlich wurde Rudolf in ein Internat nach Süddeutschland geschickt und hat dort seine spätere Frau kennengelernt. Außerdem wollte mein Vater nicht, dass die Landratstochter einen Bauernlümmel heiratet.“
Es stimmte nicht, dass Clara die Feuerwehr gerufen hatte. Nein, eine Freundin hatte das getan, nachdem sie gefragt hatte, ob sie bereit sei, an einen Ort zu gehen, wo man ihr helfen würde. Clara hatte nur so weit verstanden, dass man es irgendwie gut mit ihr meinte. Vor genau zwei Tagen war sie wie durch eine Wand gegangen, sie war durchgedreht. Diesen schrecklichen Moment hatte sie genau gespürt. Sie erriet plötzlich, was ihr Freund von ihr erwartete: Sie solle Verrücktsein spielen. Ihr neuer Freund war ein Tontechniker, zwanzig Jahre älter als sie, verheiratet, aber lebte von seiner Frau und den vier Kindern getrennt. Clara verbrachte die meiste Zeit bei ihm in seiner Wohnung. „Aber wenn die Familie nach mir ruft“, hatte er plötzlich erklärt, „werde ich natürlich zu ihr zurückkehren.“ Das jederzeit drohende Verlassenwerden löste entsetzliche Angst in ihr aus.
„Nun spiel man nicht verrückt!“, lautete ein Satz, den Clara in ihrer Kindheit oft vom Vater zu hören bekam. „Spiel nicht verrückt!“ Als ob es Menschen gäbe, die wirklich verrückt sind, und Menschen, die das Verrücktsein nur vortäuschen. Und jetzt erwarteten alle das Verrücktspielen von ihr. „Aber das könnt ihr nicht von mir verlangen!“, schrie sie verzweifelt in die Totenstille des Zimmers hinein. „Das ist unmenschlich!“ Dann aber tat sie doch, was alle von ihr erwarteten. Sie begann verrücktzuspielen. Schluchzend, laut redend, verriet sie ihre verwirrten Gedanken. Dabei schaltete sie gehorsam das Tonband, das neben dem großen Doppelbett stand, auf Aufnahme, so wie es der Mann verlangt hatte. Und irgendwann blieb nur noch das surrende Geräusch vom Ende der Tonbandspule in ihrem Ohr, Stunden, Tage, ewig.
Als der Mann abends von der Arbeit nach Hause kam, freute er sich nicht, dass Clara jetzt verrückt war, sondern wurde sehr böse. Er könne keine Verantwortung für ihren Zustand übernehmen, drohte er. Aber nachts schlief er mit ihr, obwohl er doch wusste, dass sie keinen Körper mehr besaß. Unheimliche Worte kamen aus seinem Mund. Er sei ein mächtiger Gott, und gemeinsam würden sie die Welt beherrschen. Clara hielt ihn für den Teufel. Ich muss den Teufel lieben und ein Kind von ihm bekommen, dachte sie verzweifelt, und sie spürte nicht mehr, ob sie ein Mann oder eine Frau war.
Beim Frühstück am nächsten Morgen, als der Teufel den Gasherd anzündete, brüllten und drohten die Flammen. Alles war Drohung. Jedes Nahrungsmittel hatte eine unheimliche Bedeutung, die Clara auf Leben und Tod erraten musste. Würde sie sterben, wenn sie falsch riet? Da lag ein Käse, der hieß „Vaters Sorte“. Musste sie von ihm essen? Oder war es bei Todesstrafe verboten? Sie wusste es nicht und aß vorsichtshalber gar nichts. Bevor der Mann zur Arbeit ging, zog er ein rosa Hemd an. Sie bat ihn, ein anderes, ein blaues anzuziehen. Er wurde zornig. Und sie sah, dass er eine böse, alte Frau war, mit aufgedunsenem Gesicht und dickem Busen. Bevor er ging, sagte er noch, dass ein Freund oder eine Freundin käme, da sie in ihrem Zustand nicht allein bleiben dürfe.
Die Freundin kam bald, aber Clara war sich nicht sicher, ob sie es wirklich sei oder ob sie nicht der Freund in der Verkleidung der Freundin sei. Nach einer Weile glaubte sie jedoch, dass es die Freundin sei. Es entstand beinahe ein normales Gespräch mit Frage und Antwort, und die Zeit verging. Plötzlich schreckte Clara hoch. Es war Mittagszeit. Ihr Mann ging jetzt zu Tisch, und sie musste doch gleichzeitig mit ihm essen und hätte es nun fast versäumt. Hastig würgte sie etwas Essbares herunter. Trotzdem blieb die Angst, nicht gleichzeitig mit ihm Mahlzeit gehalten zu haben, und sie fürchtete die Strafe. Ihr kam die Idee einer Sühne. Sie nahm ein Handtuch, legte es sich über die Haare, wie der Schleier auf den Madonnenbildern, und wusch, über das Waschbecken gebeugt, ihr tränenüberströmtes Gesicht unter dem fließenden Wasser. Die Freundin beobachtete sie unverwandt und fragte, warum sie das tue. Clara, durch diese konkrete Frage erleichtert, versuchte der Freundin alles zu erklären. Aber da sie nicht sicher war, ob ihre Freundin alles verstand, wuchs ihre Angst erneut. Das Auf- und Abschwellen der Angst war das einzige Gefühl, das ihr übrig geblieben war.
Der Mann kam von der Arbeit nach Hause, und die Freundin ging fort. Claras Angst wuchs und wuchs. Sie fühlte, wie eine Lähmung ihre Beine hochstieg. Sie erinnerte sich schlagartig, gehört zu haben, dass auch Einbildung zur Lähmung führen könne. Und sie erinnerte sich, wie ihre Schwester Karina vom Schulunterricht nach Hause gebracht wurde, weil deren Beine plötzlich gefühllos waren. Das war, wie viel später festgestellt wurde, der Beginn von Karinas Krankheit Multiple Sklerose. Clara, fünf Jahre jünger als die Schwester, war damals acht Jahre alt. Um die tödliche Lähmung aufzuhalten, begann Clara jetzt, unentwegt mit den Beinen zu strampeln. Dabei überkam sie das Gefühl, in einem Hohlraum festzustecken. Ich bewege mich wie ein Kind im Mutterleib, dachte sie.
Diese unentwegte Tretbewegung, das unaufhörliche Bewegen der Beine auch im Sitzen, hatte die dreizehnjährige Clara bei Helena gesehen, ihrer vierzehn Jahre älteren Halbschwester. Helena war damals in das Elternhaus zurückgekehrt als völlig apathische, mit den Beinen unentwegt zuckende Person. Die Schwester hatte nach einem Nervenzusammenbruch mehrere Monate in einer Heilanstalt verbracht, wo man die verschiedensten Medikamente an ihr ausprobierte. Schizophrenie lautete die Diagnose, geerbt von ihrem Vater Hans Mesmer.
Helena war ihre Lieblingsschwester. Wenn diese, Dorfschullehrerin in der Nähe von Lüneburg, zu Besuch kam, wurde es laut und lustig bei den sonst stummen Mahlzeiten. Geschichten zum Totlachen erzählte sie, unbekümmert um das frostige Gesicht ihres Stiefvaters, Heinz Meiners. Die große Schwester hatte der kleinen Schwester immer viel Aufmerksamkeit geschenkt, während Karina sie nie mitspielen ließ, sondern sie bloß zum Waldrand lockte, um dann unter lautem Gelächter mit ihren Freunden hinter den Bäumen zu verschwinden. Einmal kitzelte Helena die kleine Schwester unter der Dusche so doll, dass die Zehnjährige sich fast totlachte. Und die große Schwester versprach ihr, sobald sie es wüsste, ihr genau zu erzählen, wie das ist, wenn Mann und Frau miteinander schlafen. Clara, die noch als Schulkind heimlich Daumen lutschte, fürchtete, nie heiraten zu dürfen. Denn dann würde sie ja mit dem Mann in einem Bett schlafen müssen, und wie sollte sie da ihr Daumenlutschen verbergen.
Clara, in der Wohnung des Tontechnikers, strampelte unentwegt mit den Beinen, um die tödliche Lähmung aufzuhalten und vielleicht auch, weil es zum Verrücktsein dazugehörte. Sie wollte nie mehr einschlafen, aus Furcht, sie werde dann sterben. Seitdem sie durchgedreht war, kam es in ihrem Kopf nicht mehr zur Ruhe. Unaufhörlich reihten sich Gedanken aneinander. Der Mann befahl ihr, an eine leere, weiße Wand zu denken. Das schaffte sie nicht.
Das Feuerwehrauto brachte Clara in das nahegelegene Krankenhaus. Dort war eine freundliche Ärztin, eine Kinderärztin, aber sie war nicht zuständig für das neunzehnjährige, stumme Mädchen, das unentwegt strampelte. Dann wurde Clara mit einem Taxi in die Universitätsklinik gefahren. Dort gab man ihr sofort viele Tabletten. Die schluckte sie ohne Widerstand, war sie doch erleichtert, dass sie nicht diese schreckliche Spritze erhielt, von der die Mutter erzählt hatte. Die Spritze ins Rückenmark, die Helena bei der Einlieferung in die Nervenklinik bekam und bei der sie so schauerlich geschrien haben soll.
Kapitel 2
Die Wohnung von Agnes und Hans Mesmer, im zweiten Stock eines gutbürgerlichen Pankower Mietshauses in der Kavalierstraße gelegen, besaß drei Zimmer. Das Arbeitszimmer und der Salon, dessen Balkon zur Straße ging, lagen hintereinander, durch eine Schiebetür getrennt. Daneben befand sich, mit dem Salon durch eine Flügeltür verbunden, das sogenannte Berliner Zimmer, ein riesiges, dunkles Durchgangszimmer. Von diesem Zimmer, von einem einzigen Fenster nur spärlich erhellt, führte ein kleiner Flur nach hinten zur Küche, während das Badezimmer am Eingangsflur lag, gleich neben der Haustür.
Das Berliner Zimmer diente dem jungen Paar zunächst als Schlaf- und als Esszimmer. Ob es einer Ehe bekömmlich sei, vom Bett immer auf den Esstisch zu schauen, äußerte die Landrätin, berüchtigt für ihre ironischen Bemerkungen. Dieser Satz hatte zur Folge, dass der Esstisch mit den Stühlen in den Salon kam und die Ehebetten nun vereinsamt in dem großen Raum standen. Mit bunten Kissen und Decken versuchte Agnes, den beiden aneinandergeschobenen Betten das Aussehen eines Sofas zu geben. Auf die Wand hinter den Kopfenden der Betten nagelte sie das Hochzeitsgeschenk ihrer Schwiegermutter, einen ochsenblutfarbenen orientalischen Wandteppich, dessen metallisch glänzende Kettfäden unten in dicken Knoten zusammengefasst waren. Der Teppich stamme noch aus ihrem Elternhaus, hatte Martha Mesmer betont, deren Vater im Orienthandel tätig gewesen war. Ein einziges Bild hing in dem großen Raum, ein Hitler-Bild. Das hatte ihnen jemand zur Hochzeit geschenkt. Ob es einer Ehe bekömmlich ist, dachte Agnes, vom Bett immer auf den Führer zu blicken? „Wo hängen wir das Bild bloß auf?“, hatte Hans nach der Hochzeit überlegt. Als sie Klo vorschlug, schaute ihr Mann entsetzt. „Pass bloß auf, dass das niemand hört.“
Auf dem zum Sofa gewandelten Ehebett, auf das das Tageslicht vom einzigen Fenster fiel, lag die schwangere Agnes stundenlang und las, am liebsten französische Romane. Eigentlich hatte sie nach dem Abitur, das sie als Klassenbeste ablegte, Sprachen studieren wollen. Aber Karl Körners hochfliegende Pläne für seine begabte älteste Tochter schwanden mit dem Niedergang seiner Karriere und seiner Zwangsversetzung nach Ostpreußen. So erlernte Agnes, wie so viele junge Mädchen, den Beruf der Säuglingsschwester in einem Heim der NS-Frauenschaft bei Königsberg. Die Heimleiterin, eine geschlechtslos wirkende Person mit stets blütenweißer Kittelschürze, entdeckte bei der Landratstochter eine Begabung für gestörte Kinder. Stundenlang sperrte sie Agnes mit den armen Würmchen ein, die nicht essen wollten und nur um sich spuckten. „So dienst du unserem Führer am besten.“
Es waren Agnes’ erotische Ausstrahlung und ihr spielerisches Wesen, die ihr die Heimleiterin nicht verzieh. Denn die nordische Frau, wie sie Agnes äußerlich verkörperte, sollte doch eine rohe Skulptur sein, die erst als Gefährtin des nordischen Mannes Konturen erhält. Leidenschaft und Spieltrieb ist der nordischen Rasse fremd, das ist allein die Art der hitzigen, unsteten mediterranen Rasse, der Franzosen, Italiener und Spanier, die alle Negerblut in sich tragen. Das lernte Agnes an den Schulungsabenden der NS-Frauenschaft. Die rassenkundlichen Vorträge gefielen ihr, fügten sich doch endlich manche Gedanken zu einem Ganzen, die ihr schon lange durch den Kopf gingen.
Beim stundenlangen Lesen im Berliner Zimmer störte Agnes zunehmend die Leere des großen Raumes. Ohne auf das Kind in ihrem Bauch Rücksicht zu nehmen, begann sie, energisch die Möbel zu verrücken. Aus Hans’ Arbeitszimmer zerrte sie einen niedrigen Tisch sowie einen schweren Ledersessel herüber. Den hatte die Mutter ihnen zur Hochzeit geschenkt, ein Erbstück von ihrem Vater August Schürner, Inhaber einer Lederwarenfabrik in Hannover, die im Weltkrieg, wo beinahe ebenso viele deutsche Pferde wie deutsche Soldaten umkamen, mit Sattlerwaren reich geworden war.
Mit dem neuen Arrangement des Zimmers war Agnes endlich zufrieden. Es erlaubte eine gewisse körperliche Abwechslung beim Lesen. Saß sie in dem Polstersessel, konnte sie sogar gleichzeitig ihre Füße an einem Bettende abstützen. Ohne Kommentar nahm Hans die neue Ordnung hin. Wenn er im Bett lag und Agnes noch im Sessel las, durfte er ihre nackten, langen Beine bewundern.
„Ich habe uns aus der Firma ein Buch auf Englisch mitgebracht“, sagte Hans eines Abends begeistert. „Es handelt von einem berühmten französischen Forscherpaar, Madame Marie Curie und ihrem Mann.“ Warum es dann nicht auf Französisch sei, wollte Agnes wissen. Aber ihrem Mann war das Englische lieber, das er viel besser beherrschte als das Französische. Dr. Hans Mesmer, der als Wissenschaftler bei der Firma Siemens & Halske im Physikalischen Labor arbeitete, hatte gerade in der internationalen Fachzeitschrift Nature einen Artikel veröffentlicht, der in Fachkreisen Aufsehen erregte: „Widerstandsänderung und Magnetisierung am Curiepunkt.“ Dort stellte er eine neue Theorie auf zum Verhältnis von elektrischem Widerstand und magnetischer Energie.
Anstatt gemeinsam das englische Buch zu beginnen, sah das Ehepaar an diesem Abend jedoch die Unterlagen durch, die das Gesundheitsamt für die Bewilligung des Ehestandsdarlehens verlangte.
„Eigentlich haben wir ja schon alles zusammen“, meinte Agnes mit einem flüchtigen Blick auf die vielen Bögen mit dem Adler und dem Hakenkreuz. „Und dass wir erbgesund sind, hat uns doch der Hausarzt meiner Eltern schon bescheinigt.“
„Das reicht nicht“, seufzte Hans. „Es muss ein Arzt vom städtischen Gesundheitsamt sein. Und wir müssen vor allem noch den Fragebogen ausfüllen.“ Sorgfältig gingen sie nun das Formular durch: Krankheiten, Operationen, und zwar bei Eltern, Großeltern und Geschwistern, gegebenenfalls auch die Todesursachen. Hier kamen Hans die Tränen. Denn vor sechs Jahren hatte Helena, seine Schwester, sich das Leben genommen. Das wollte Hans jetzt notieren.
„Um Himmels willen!“, rief Agnes erschrocken. „Bist du verrückt geworden? Selbstmord gilt doch als Zeichen von Geisteskrankheit.“ Wieso sich die Schwester eigentlich umgebracht habe?
„Sie liebte einen älteren, verheirateten Mann.“
„Wenn das alle bei Liebeskummer täten!“, murmelte Agnes und war froh, dass ihr Mann diesen Satz offenbar nicht gehört hatte. Wie die Schwester sich umgebracht habe, wollte sie noch wissen. Einfach so mir nichts dir nichts ins Wasser gegangen? Beim Baden ertrunken, ja ein Badeunfall, das könne man unbesorgt hinschreiben.
Am nächsten Morgen gingen sie zum Gesundheitsamt Pankow. Dort warteten im Flur viele Paare, einige Frauen mit dicken Bäuchen.
„Aber wir sind die schönsten“, flüsterte Agnes zufrieden ihrem Mann zu.
Der junge Arzt, dessen glatt gescheitelten blonden Haare bereits etwas spärlich wurden, saß hinter einem mächtigen Schreibtisch aus Eichenholz, auf dem sich die vielen ausgefüllten Formulare akkurat stapelten. Durchdringend musterte er das junge Paar, überflog den ausgefüllten Fragebogen und sagte schließlich zu Agnes: „Sie werden uns einen prächtigen nordischen Knaben gebären.“ Mit sachlichem Wohlgefallen umfasste der Arzt mit seinen Blicken Agnes’ Erscheinung.
„Sie hingegen haben einen deutlich dinarischen Einschlag“, wandte er sich dann an Hans. „Der hohe Nasenrücken, der schmale, lange asthenische Körper. Aber so übel ist die dinarische Rasse nun auch wieder nicht. Wie würde der deutsche Volkskörper sonst jetzt die vielen Österreicher verdauen?“ Nach einer Vergewisserung, dass Hans als kleiner Junge blond gewesen sei, und einer Bemerkung über die Gefährlichkeit des Badens entließ der Arzt die Mesmers schon nach wenigen Minuten.
Am Abend des 6. September 1938 kam das Kind zur Welt. Selbst als die Wehen immer heftiger wurden, blieb Agnes in das Buch vertieft, das sie seit Tagen mit wachsender Begeisterung las: Simplicius Simplicissimus. Geschrieben von einem Augenzeugen des Dreißigjährigen Krieges, berichtete es von entsetzlichen Gräueltaten. Totlachen beispielsweise war eine beliebte Foltermethode. Den gefesselten Gefangenen wurde immer wieder Salz auf die nackten Fußsohlen gestreut, das man so lange von Ziegen ablecken ließ, bis die Männer buchstäblich zu Tode gekitzelt wurden. An dieser Stelle der Lektüre setzten kräftige Wehen ein, die Agnes beim besten Willen nicht mehr ignorieren konnte. Schleunigst wurde wieder die Hebamme geholt, die nach einem Blick auf die konzentriert lesende Schwangere gerade erst fortgegangen war. Denn wer noch so versunken lesen kann, wird nicht so bald gebären, hatte sich die Hebamme gedacht.
Das Neugeborene, ein Mädchen, wurde nach Hans’ toter Schwester auf den Namen Helena getauft. Agnes wäre ein zeitgemäßer Name lieber gewesen, Gundula beispielsweise oder zumindest Hilda, aber Hans ließ sich nicht umstimmen. Frau Körner, telegrafisch benachrichtigt und sofort aus Allenstein angereist, warf einen scharfen Blick auf den unerwartet bräunlichen und mit ungewöhnlich markanter Nase versehenen Säugling, um ihn fortan „Zwerg Nase“ zu nennen. „Du warst so ein hübsches Baby“, bemerkte sie vorwurfsvoll zu ihrer Tochter. Agnes, die doch stolz auf ihr Baby war, wagte zu sagen: „Sieht sie nicht aus wie eine normannische Prinzessin?“ Drei Wochen blieb die Landrätin in Pankow und schwelgte in Einkäufen: einem Stubenwagen mit rosafarbenem Steckkissen, Unmengen an winzigen rosa Jäckchen, Höschen und Kleidchen. „Damit man überhaupt sieht, dass es ein Mädchen ist.“
Agnes übte den Mutterberuf aus, wie sie es als Säuglingsschwester gelernt hatte. Pünktlich alle vier Stunden, wenn der Minutenzeiger auf die Zwölf rückte, stillte sie ihr Kind. Brüllte es zwischendurch vor Hunger, blieb sie eisern, mit Blick auf die Wanduhr im Berliner Zimmer. „Das stärkt die Lungen“, erklärte sie ihrem Mann, dem das verzweifelte Kind leidtat. Wenn es dann aber Zeit war, stillte Agnes mit größter Hingabe, im Ledersessel ruhend, die Beine gegen ein Bettende gestemmt. Zwerg Nase aber, vom vielen Weinen erschöpft, gelang es nie, den mütterlichen Segen auszuschöpfen, sondern schlief bereits nach wenigen Minuten ein. Dann griff Agnes, den schlafenden Säugling noch an der entblößten Brust, nach ihrem Roman und verbrachte auf diese Weise gemütliche Stunden.
„Der Säugling ist unterernährt“, stellte die Hebamme vom Gesundheitsamt nach drei Wochen fest. „Sie müssen zufüttern und dem Kind zusätzlich Flaschenmilch geben, die Muttermilch allein reicht offenbar nicht aus.“
Nur widerstrebend bereitete Agnes die Fläschchen mit dem übel riechenden Trockenpulver zu. Sie fühlte sich um etwas betrogen, und Zwerg Nase war schuld. Dank der leichter aufzunehmenden Flaschennahrung erholte sich das Kind rasch. Wenn Hans abends nach Hause kam, nahm er die kleine Helena sofort auf den Arm und sprach zärtlich mit ihr.
Am 4. November reiste Agnes mit dem Säugling zu ihrer Schulfreundin Erna Boysen an die Nordsee, nach Niebüll im Kreis Südtondern, wo einst die Landratsfamilie gelebt hatte. Ob es ohne sie überhaupt gehen würde, hatte sie ihren Mann gefragt und ihm genauestens das Zubereiten von zwei warmen Mahlzeiten erläutert: Bauernfrühstück, gebratene Kartoffeln mit Zwiebeln und verquirlten Eiern sowie Bismarckhering mit Pellkartoffeln. Auch einen leicht angebrannten Linseneintopf, den er ruhig mehrere Tage aufwärmen könne, hinterließ sie ihrem Mann.
Obwohl Niebüll ein kleines Nest war, gab es eine direkte Zugverbindung von Berlin dorthin. Denn Niebüll lag auf der Strecke zur Endstation Westerland auf Sylt, jenem Inselstädtchen, das dank des Hindenburgdammes zu einem beliebten Sommerkurort der Hamburger und auch der Berliner aufgestiegen war.
Nur wenige Reisende waren mitten in der Woche unterwegs. Ab Hamburg-Dammtor saß außer Agnes nur noch eine etwa gleichaltrige Dame im Abteil. Die strickte unermüdlich an einem großen, bunten Pullover und ließ ihr Strickzeug erst sinken, als Agnes mit ihr eine Unterhaltung begann. Sie würde so gerne Kinder haben, bekannte die hübsche junge Frau im Laufe des Gesprächs, aber offenbar sei sie unfruchtbar.
„Ich bin vielleicht schon wieder schwanger“, erklärte Agnes stolz, und sogleich bereute sie ihre Taktlosigkeit. Verlegen streichelte sie den Säugling, der warm eingewickelt auf ihren Knien schlief.
„Aber dann bringen Sie mir Glück!“, rief die junge Frau erfreut. „Schwangerschaft ist ansteckend, heißt es!“
„Das ist doch nur Aberglaube.“ Agnes schüttelte abwehrend den Kopf.
„Aberglaube kann so schlecht nicht sein. Wenn die Menschen viele Jahrhunderte an etwas glauben, dann muss es doch auch genützt haben.“ Nach einer kleinen Pause fügte die junge Frau hinzu: „Mein Vater ist Deutscher, aber meine Mutter Dänin, und ich bin mit einem Dänen verheiratet. In unserem Land gibt es viele alte Bräuche zur Heilung von Unfruchtbarkeit.“
„Ach, Sie sind eigentlich Dänin?“ Agnes wurde jetzt richtig neugierig. Der Vater hatte immer so schlecht von den Dänen gesprochen, während diese Person ihr gleich sympathisch gewesen war. „Und was sind das für Bräuche?“
„Einer besteht darin“, sagte die Dänin lachend, „dass die Unfruchtbare beide Hände auf den Bauch einer Schwangeren legt.“
Agnes lachte ebenfalls. „Wenn Sie meinen, dass meiner schon zählt – bitte schön.“ Ernsthaft und konzentriert legte die Fremde ihre gepflegten, schmalen Hände auf Agnes’ Bauch. „Sie haben wunderschöne Hände“, murmelte Agnes. Ihre eigenen kleinen, rundlichen Hände, die so gar nicht zu ihrer schlanken, hochgewachsenen Gestalt passten, gefielen ihr überhaupt nicht.
„Danke schön“, antwortete die junge Frau und zog langsam ihre Hände fort. „Das sagt mein Mann auch.“
„Vielleicht sollten Ihr Mann und Sie“, Agnes zögerte und suchte nach Worten, „äh, ich meine, etwas machen, was die Befruchtungsaussichten günstiger macht.“ Und da die Dänin gar nicht geniert zu sein schien, empfahl sie ihr das Buch von Van de Velde über die Vollkommene Ehe. „Sie lesen ja sicher Deutsch, oder?“
„Aber sicher, das hab’ ich noch nicht verlernt, obwohl ich seit meiner Heirat in Dänemark lebe. Ich bin doch zur Hälfte deutsch und genauso arisch wie Sie. Artverwandt, sagt man jetzt bei Ihnen.“
Kurz vor Niebüll tauschten die beiden Frauen ihre Adressen aus. „Kommen Sie uns einmal in Aarhus besuchen“, sagte die Dänin. „Ich bin ja auch neugierig“, erwiderte Agnes fröhlich, „ob an dem Aberglauben etwas dran ist.“
Der Zug hielt am Niebüller Bahnhof, einem kleinen Backsteingebäude mit verblühten Geranien vor den Fenstern. Sogleich eilte der Bahnhofsvorsteher herbei, um Agnes die schwere Zugtür zu öffnen. Er nahm ihren kleinen Koffer entgegen und schickte sich an, Mutter und Kind das Trittbrett hinunterzuhelfen. Aber Agnes winkte ab mit einer leutseligen Geste und blieb wartend in der Zugtür stehen. Denn sie hatte Ernas Mann entdeckt, der auf sie zueilte.
„Da sind ja unsere Berliner Damen!“ Mit diesen Worten hob Karsten Boysen Agnes mitsamt dem Säugling auf den Bahnsteig hinunter. Boysen war ein riesiger, massiger Mann, jedoch nicht ohne eine gewisse Eleganz. „Das Mädchen kommt ganz nach dem Vater“, stellte er mit einem kurzen Blick auf das kleine, wache Gesicht unter dem rosa Mützchen fest. „Brüllt es die ganze Nacht?“ Das ist so seine Art, dachte Agnes, man weiß bei ihm nie, ob er es nett oder böse meint.
Statt einer Antwort begnügte sie sich mit einem freundlichen Lächeln und ließ sich durch den kleinen Bahnhofsraum führen. Erst jetzt bemerkte sie, dass Ernas Mann das Parteiabzeichen deutlich sichtbar am Mantelaufschlag trug.
„Deine Dekoration ist neu, Karsten“, entschlüpfte es ihr wider Willen.
„Aber sie steht mir doch ausgezeichnet, oder?“, antwortete er spöttisch. „So, das hier ist auch neu.“ Er zeigte auf einen schwarzen Mercedes, der direkt vor dem Bahnhof parkte. „Als Führer des Bauernverbandes von Niebüll und Klanxbüll steht mir nun ein Dienstwagen zu.“
Die wenigen Kilometer schnurgrader Landstraße zum Hof der Boysens, dem Marschenhof, legte man wegen des lauten Automotors zunächst schweigend zurück. „Wie geht es Erna und den Jungen?“, ergriff Agnes schließlich das Wort.
„Bestens, bestens“, rief Boysen. „Überhaupt geht es uns gut, weil der Preis der Schafwolle gestiegen ist, seitdem Deutschland, dem Führer sei Dank, ein autarkes Land geworden ist.“
„Ja, dem Führer sei Dank“, wiederholte Agnes mechanisch. Dass Karsten ein so überzeugter Nationalsozialist geworden war, hatte ihr Erna verschwiegen. Ihr Mann habe der Partei beitreten müssen, hatte die Freundin nur geschrieben, weil das der Vorsitz des Bauernverbandes mit sich bringe.
Abrupt bog der Wagen nach links ab, und jetzt war der Blick auf den Marschenhof frei, einer der größten Höfe im Alten Christian-Albrechts-Koog. Die Boysens betrieben Schafzucht, wie alle Bauern auf dem eingedeichten Land. Die wenigen Felder dienten der Selbstversorgung.
Vor dem Wohnhaus, wo das Auto jetzt hielt, lag eine breite, gepflegte Kiesfläche mit einem Blumenrondell in der Mitte. Das Dach aus Reet, mit dickem, akkurat geschnittenem Saum, ruhte wie eine dicke Pelzmütze auf dem Gebäude. An den Hausmauern aus Backstein rankten Kletterrosen empor, die noch die letzten roten Blüten trugen. Rechts erstreckte sich, im rechten Winkel abgehend, das lange, weiß getünchte, auf der Innenseite fensterlose Stallgebäude. Links lag der Garten mit Blumenbeeten, die an die Kiesfläche grenzten, während hinter dem Haus die Nutzpflanzen wuchsen, Beerensträucher, Bohnen- und Erbsenstauden, Salat, Kohl und Mohrrüben. Hohe Bäume schützten das Anwesen vor dem ständigen Westwind.
Erna Boysen erwartete ihren Mann und die Freundin am Hauseingang. Die kräftige Frau mit dem schweren, rötlich blonden Haarkranz berührte mit dem Kopf fast den Türrahmen. Um einige Zentimeter überragte das Ehepaar Boysen alle seine Mitmenschen, und auch ihre drei kleinen Jungen waren für ihr Alter schon sehr groß, sodass man die Boysenfamilie gern „das Riesengeschlecht“ nannte.
„Herzlich willkommen auf dem Marschenhof!“ Erna drückte Agnes und das Kind liebevoll an ihren großen Busen. „Ich bin wohl wieder schwanger“, konnte Agnes sich nicht enthalten, der Freundin zuzuflüstern. „Mein armes Mädchen, lässt er dir denn auch keine Ruhe?“ Die beiden Frauen tauschten einen verschwörerischen Blick aus.
Eine halbe Stunde später saßen alle an der großen Tafel im Esszimmer. Hier war die Wohlhabenheit eines über viele Generationen eingesessenen Bauerngeschlechts zu spüren. Auf einer der beiden Schmalseiten des großen Raumes hing in einem von Altersrissen geäderten Goldrahmen die Reproduktion eines Gemäldes von Canaletto, das Venedig mit dem Dogenpalast zeigte. Die gegenüberliegende Wand bedeckte eine hohe Vitrine, in der ein mit kleinen Rosen bemaltes Meißner Service stand, zusammen mit zart gemustertem, bläulich schimmerndem chinesischen Porzellan, das Erbe eines kinderlosen Onkels, der zur See gefahren war. Nur selten wurde das chinesische Porzellan aus dem Schrank geholt, zuletzt bei der Taufe des jüngsten, nun vierjährigen Sohnes. Die drei Jungen, jeweils im Abstand von zwei Jahren geboren, schauten gebannt zu, wie Agnes, elegant in ihrem taillierten, rostfarbenen Reisekostüm, große Mengen an Pellkartoffeln, grünen Bohnen und Klopsen verschlang. Karstens jüngerer Bruder Arno, ein achtzehnjähriger Riese, der auf dem Hof mithalf, wagte aus lauter Verlegenheit nicht, Agnes anzuschauen. Als der Säugling zu weinen begann, war es freilich Arno, der ihn sofort auf den Arm nahm und sacht schaukelte.
Das Essen verlief in heiterer Atmosphäre. Karsten Boysen konnte galant und witzig sein, wenn er wollte. Diesen Abend wollte er, und seine Frau schaute ihn immer wieder bewundernd an. Boysen hatte höher hinausgewollt, hatte begonnen, Jura zu studieren. Aber als der ältere Bruder schließlich seiner schweren Kriegsverletzung erlag, musste der jüngere Bruder den Hof übernehmen.
Bei Ernas Beerenlikör angelangt, schlug Karsten vor, am Sonntag die Harksons auf dem Neudeichhof zum Kaffee zu besuchen. Dabei warf er Agnes einen anzüglichen Blick zu. „Die Kleine wird müde von der Reise sein“, murmelte Agnes verlegen. „Ich bleibe gern hier und kümmere mich um die Jungen.“
„Aber wem wird denn da bange sein!“, rief Erna und drückte aufmunternd die Hand der Freundin. Denn Rudolf Harkson war jene Jugendliebe, mit der die siebzehnjährige Agnes nachts am Strand gelegen hatte.
Am nächsten Morgen wachte Agnes ungewöhnlich früh auf. Nach einem raschen Blick auf das Kind, das neben ihr in einem Gitterbettchen schlief, schob sie die Vorhänge leicht beiseite. Die Herbstsonne begann hinter den Wiesen aufzugehen. Geräuschlos zog Agnes einen langen warmen Rock über ihr Nachthemd, warf eine Strickjacke über und schlüpfte in ihre Schuhe.
Sie trat auf den Wohnungsflur hinaus, zögerte einen Moment und wandte sich dann in Richtung Stallgebäude, das sich an das andere Ende des langen Flures anschloss. Leise öffnete sie die dicke, schwere Holztür, die den Stall zum Wohngebäude abriegelte. Im Stall, der sie mit einem Schwall von Wärme empfing, standen einige Kühe und Schweine. Die Schafe waren zu dieser Jahreszeit noch draußen, erst wenn im Winter der Boden gefror, kamen sie nachts in den Stall. Agnes sog den warmen Tiergeruch ein, freute sich über das leise Grunzen der Schweine und das sachte Malmen der Kühe. Neben einem weiß getünchten Stützpfosten befand sich eine leere Stallbox. Sie ging hinein, schwang sich auf die Futterkrippe und lehnte sich an die Wand. Durch ihren Rock drang die Kühle des Steines, aber statt zu frieren, fühlte sie sich gewärmt.
Da hörte sie plötzlich Schritte, und sie sah die schwere Gestalt Karstens auf sich zukommen. „Moin, Moin. Bleib ruhig sitzen“, sagte er mit rauer Stimme, räusperte sich und trat dicht an sie heran.
Agnes rutschte unruhig beiseite. „Der Likör deiner Frau hat es in sich“, murmelte sie.
„Ja, die Wirkung hält lange an“, erwiderte Karsten heiser. „Aber sie will keine Kinder mehr. Sie dreht sich weg nachts im Bett.“
„Ich bin wahrscheinlich wieder schwanger“, sagte sie unvermittelt und bereute den Satz sofort.
Er lachte. „Wie lange wird es noch dauern, bis du dich wegdrehst von deinem Mann?“ Und mit behutsamen, aber gezielten Bewegungen schob er ihr langsam den Rock hoch.
„Um Himmels willen, was machst du da!“, flüsterte sie. „Das ist Unrecht.“
„Was ist Unrecht?“, raunte er und streichelte ihre Schenkel, bis sich seine Hände langsam unter ihr Gesäß schoben.
„Du schnaufst wie ein Stier“, lachte sie und fühlte sich auf einmal schwerelos, prall und glitzernd. „Aber du darfst mich jetzt nicht küssen“, seufzte sie, „sonst ersticke ich.“
„Was darf ich denn?“, fragte er leise und rieb sich mit immer schnelleren, kräftigen Bewegungen an ihr. „Alles“, flüsterte sie, die weit geöffneten Augen starr auf den wenige Meter entfernten weißen Pfosten gerichtet.
In ihr Zimmer zurückgekehrt, hätte Agnes am liebsten laut gesungen. Hatte sie Unrecht getan? Nein, sie hatte sich nur etwas geholt, was ihr schon lange zustand. Mit einer unaussprechlichen Lust. Ich habe mich mit einem Stier gepaart, und das im Schweinestall, dachte sie vergnügt. Als sie sich über der Waschschüssel wusch, fuhr sie mit dem Finger in ihre Scheide und leckte ihn ab.
Vom Plätschern des Wassers war das Kind wach geworden. Agnes nahm es aus dem Gitterbettchen und gab ihm die Brust. Danach wusch sie es mit demselben Wasser, in dem sie sich zuvor gewaschen hatte. Als ob ich es mit Sperma taufe, sinnierte sie. Aus der Küche hörte sie das Klappern der Töpfe. Nur nicht zögern, befahl sie sich. Mit raschen Schritten ging sie in die Küche. Erna empfing die Freundin mit einem herzlichen Lächeln, liebkoste den Säugling und erkundigte sich nach der Nacht.
„Ich hab’ wunderbar geschlafen bei euch.“ Und Agnes setzte sich, ohne die Miene zu verziehen, an den Küchentisch zwischen Arno und Karsten, der mit großem Appetit seinen Haferbrei verschlang und sie nur mit einem flüchtigen Blick streifte.
Als Clara im Krankenhaus aufwachte, war sie erstaunt, nicht tot zu sein. Sie versuchte, die Augen aufzuschlagen, aber es ging nicht. „Ich bin blind“, dachte sie, „und wenn ich doch die Augenlider öffne, tötet mich der Schmerz.“ Als es ihr schließlich gelang, die Augen zu öffnen, hatte sie das Gefühl, ihre Augenlider würden zerrissen. Später wurde ihr klar, woher der Schmerz kam. Zwei Tage lang hatte sie ununterbrochen geschlafen, und die Wimpern waren vom Sandmännchen völlig zugeklebt.
Jetzt nahm sie die Männer im weißen Kittel wahr, die ihr Bett umstanden. „Suchen Sie sich einen aus“, hörte sie eine Stimme sagen. Aber die Männer machten ihr alle Angst. Bei dem einen waren ihr die braunen Augen unheimlich, bei einem anderen der Bart. Vorsichtig ging sie die sechs Gesichter der Reihe nach durch. Es blieb nur einer übrig, dessen Gesicht ihr keine Furcht einflößte. Er hatte blaue Augen und eine graublonde Igelfrisur. Er erinnerte sie an einen Freund, der gestorben war. Vielleicht war er ja der Freund, der gar nicht tot war? Indem sie diesen Mann auswählte, hoffte sie, den Toten wieder lebendig zu machen. So wurde der Blauäugige mit der Igelfrisur – sie will ihn Fritz nennen – ihr Arzt in der Klinik und später auch draußen.
Clara befand sich in der geschlossenen Abteilung der Universitätspsychiatrie. Das Zimmer teilte sie mit einer älteren Frau und einem gleichaltrigen, stummen Mädchen, die beide nie aufstanden. Bei der apathischen Frau war sie sich nicht sicher, ob es Agnes, ihre Mutter, war, und das machte ihr große Angst. Das Mädchen, dessen Bett neben Claras stand, war völlig ausgemergelt, mit einem Kopf wie ein Totenschädel. Es wurde von den Schwestern gefüttert. Als es mit heftigen Gesten bedeutete, es wolle von Clara gefüttert werden, tat die das gern, sie war froh, helfen zu können. Aber mitten in der Nacht kroch das Mädchen zu ihr ins Bett und klammerte sich mit unheimlicher Kraft an sie. Schuldbewusst läutete Clara schließlich nach der Nachtschwester, die sie von dem nun entsetzlich schreienden Mädchen befreite.
Am nächsten Tag wurde sie in ein Zimmer mit drei sehr alten Frauen verlegt. Die Frauen sprachen kein Wort miteinander. Jedoch in der Nacht hörte sie eine der Alten flehentlich rufen: „Hört bitte auf zu schnarchen!“ Auch Clara schnarchte. Die Tabletten ließen ihren sonst während des Schlafens geschlossenen Mund weit offen stehen, und morgens war das Kopfkissen durch und durch mit Speichel getränkt. Das war eine Wirkung der Tabletten. Der Chemie gelang es zwar, den Körper ruhigzustellen, aber nicht, die Phantasiewelt zu unterdrücken. Die wurde nur etwas schwächer, farbloser und passte sich der neuen Umgebung an. Jetzt hielt Clara den Tontechniker, der sie täglich besuchte, nicht mehr für den nächtlichen Teufel, stattdessen hielt sie die alte Krankenschwester mit dem bösen Lächeln, die ihr jeden Morgen Blut abzapfte, für eine Abgesandte des Teufels. Trotzdem wehrte sie sich nicht gegen die unheimliche Frau, da sie irgendwie verstand, dass jeder Widerstand als Krankheitszeichen ausgelegt und mit noch mehr Tabletten bestraft würde.
Clara begriff nun, an welchem Ort man sie deponiert hatte, dem Ort, den alle fürchteten: das Irrenhaus. Daraus zog sie, begabt mit einem ausgeprägten Sinn für Logik, den Schluss, dass jedes Wort, das aus ihrem Munde käme, als verrückt gelten würde. Daher beschloss sie, kein einziges Wort zu sagen. Wie beim Verhör, wo jede Aussage des Angeklagten gegen ihn verwendbar ist.
So stellte sie keine einzige Fragen und behielt für sich, was ihr unheimlich oder rätselhaft war. „Frag nicht so viel“, wurde Parzival als ritterliche Verhaltensregel mitgegeben, als er zum Abenteuer auszog. „Frag nicht so viel“, wurde Clara als Kind von ihrem Vater gerügt. Nachahmen ohne nachzudenken sollte ein Kind. Kinder hatten unsichtbar zu sein, um die Erwachsenen nicht zu stören. Parzival hatte im entscheidenden Moment nicht zu fragen gewagt und wurde dann zum Umherirren verflucht.
Am Ende des langen Flures, neben der verschlossenen Tür, hing ein Schild mit der Aufschrift „Patienten, die allein in den Garten gehen dürfen, müssen sich vorher bei der Schwester abmelden“. Clara war neugierig auf diesen Garten, sie vermutete, er sei das Paradies. In ihrer Kindheit war der große, verwilderte Garten ihr Paradies gewesen, und am Gartenzaun hörte die Welt auf. Mittendrin stand ihr Schaukelbaum. Der Vater hatte ihr ein Schaukelbrett zurechtgeschnitzt, ein Brett mit jeweils einer langen Kerbe unten an der Schmalseite. Das Brett, das sie immer beim Vater abholen musste, konnte sie auf das Seil legen, das als eine große Schlaufe von einem waagerechten Ast herabhing. Von der Schaukel aus blickte Clara auf einen verlassenen Anbau mit zwei blinden Fenstern, die Garage. Daneben stand der große Walnussbaum. Aus den Nussschalen bastelte sie zusammen mit ihren drei großen Schwestern zu Weihnachten vergoldete Schiffchen, in denen winzige Püppchen saßen.
In der Nähe der Garage standen auch zwei Wäschepfosten. Wenn keine Wäsche auf der Leine hing, bekam Clara dort bei Sonnenschein und warmem Wetter ein Zelt gebaut. Zwei große, graue Wolldecken wurden an ihrem einen Ende mit Wäscheklammern an der Leine festgemacht, während die beiden anderen Enden so mit Steinen am Boden befestigt wurden, dass ein schmales Zelt entstand, in dem sie spielen konnte. Dort stellte die Mutter dem Kind eine Blechschüssel mit Wasser hin. Überall im Garten wuchs Löwenzahn, den Clara pflücken durfte und dann in das graue Zelt trug. Mit einem stumpfen Messer ritzte sie vorsichtig die Stängel kreuzweise ein und beobachtete fasziniert, wie dicke Tropfen milchiger Flüssigkeit hervorquollen. Löwenzahnmilch. Die aufgeschnittenen Stängel warf sie in die Wasserschüssel und schaute gebannt zu, wie diese sich zu vier zierlichen Locken aufrollten. In dieser Welt, mutterseelenallein und mit einem Experiment beschäftigt, war das vierjährige Kind wunschlos glücklich.
Doch Clara in der Klinik gehörte nicht zu den Patienten, die in den Garten gehen durften, um das Paradies kennenzulernen. Aber vielleicht war sie ja auch bereits im Paradies, eine Vermutung, die ihr kam, als sie frühmorgens durch das geschlossene Zimmerfenster die Vögel zwitschern hörte. Und jeden Morgen das Erstaunen, die Nacht überlebt zu haben. Denn eigentlich stand die Welt ja still.
Durch das Flurfenster konnte man das Dach des gegenüberliegenden Hauses sehen. Dort bewegten sich Männer in blauen Anzügen. Clara hatte entsetzliche Angst, dass die Männer abstürzen würden und dass sie dann schuld an ihrem Tod sei. Da öffnete sie ausnahmsweise den Mund, um diesen entsetzlichen Gedanken einer älteren Krankenschwester zu verraten, die zwar alle Patienten wie kleine Kinder behandelte, aber wenigstens mit echter Herzlichkeit. Doch die Schwester verstand sie nicht. Das war das einzige Mal, dass Clara versuchte, sich durch Sprechen von ihren tödlichen Schuldgefühlen zu entlasten.