
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Magellan Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Es ist nicht gerade Liebe auf den ersten Blick, als Jonas und Nika aufeinandertreffen. Denn Jonas erwischt Nika, als sie bei ihm einbricht. Nicht, weil sie etwas gegen ihn persönlich hat, sondern weil das ihr Job ist. Nika gehört zu einem Familienclan, der sich auf Wohnungseinbrüche spezialisiert hat. Wenn sie nicht liefert, machen die anderen Druck. Doch Nika und Jonas begegnen sich wieder. Zufällig. Und Jonas zeigt ihr, dass das Leben nicht nur aus Sackgassen besteht. Aber einfach aussteigen ist nicht. Plötzlich schwebt nicht nur Nika, sondern auch Jonas in größter Gefahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
ANTJE LESER
LUFTSCHLÖSSER
sind schwer zu knacken
Inhalt
JONAS
NIKA
NIKA
JONAS
NIKA
JONAS
NIKA
NIKA
JONAS
JONAS
NIKA
NIKA
JONAS
NIKA
NIKA
JONAS
NIKA
JONAS
NIKA
NIKA
NIKA
JONAS
NIKA
JONAS
JONAS
NIKA
NIKA
JONAS
JONAS
JONAS
NIKA
NIKA
JONAS
JONAS
VALENTINA
VALENTINA
JONAS
KAPITEL 1
JONAS
Ich war noch nie verliebt. Also noch nie so richtig, jedenfalls. Klar, im Kindergarten, da war ich mal unsterblich in Nele verknallt. Sie hatte mir ihre Milch-Schnitte geschenkt, worauf ich beschloss, sie später zu heiraten. Als ich ihr meine Entscheidung mitteilte, zeigte sie mir den Vogel. Ich war tief gekränkt.
Nein, im Ernst. Was ich meine, ist richtiges Verliebtsein. Das, was zwischen zwei Menschen abgeht, wenn bei ihnen die Chemie stimmt. Dieses Gefühl, dass man zusammengehört. Dass man füreinander da ist. Zumindest für eine Weile. Und auch – oder gerade wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist. Ich glaube, in meinem Jahrgang war ich der Einzige, der nicht mit einschlägigen Erfahrungen aufwarten konnte. Sollte mir das Sorgen machen?
Ich hatte gerade die elfte Klasse hinter mir, und wenn es nach meiner Mum ging, sollte ich mir ohnehin lieber erst mal überlegen, was ich nach dem Abi machen wollte. Für Mädchen hätte ich dann später immer noch Zeit. Oder für Jungs. Was das betraf, war meine Mum völlig cool. »Wieso gehst du nicht ein Jahr ins Ausland? Vielleicht zu Achim? Der kann dir bestimmt was organisieren.«
Achim, so hieß mein Dad. Er arbeitete bei der GIZ, der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Vor zwei Jahren hatte er ein Projekt angenommen, bei dem es um die Gewinnung von Trinkwasser in Grenada ging. Zuerst hatte ich dabei an Spanien gedacht. Das wäre ja noch ganz okay gewesen. Doch dann hatte ich herausgefunden, dass das ein Karibikstaat war, mit lauter so kleinen Pupsinseln. Ich hatte immer gedacht, dass die dort genug Wasser hätten. Aber nix da! Bei denen regnete es so wenig, dass das Grundwasser richtig knapp war. Außerdem sorgte der Klimawandel dafür, dass der Meeresspiegel immer weiter anstieg und das Wasser ins Landesinnere drückte. Damit versalzten die Brunnen. Mein Dad hatte also alle Hände voll zu tun, und er hatte es gar nicht verstanden, dass meine Mum und ich nicht sofort begeistert »Ja« gebrüllt hatten, als er den Vorschlag machte, mit ihm gemeinsam in die Karibik zu ziehen. Zwischen meinen Eltern hatte es ein paarmal böse gerumpelt. Aber irgendwann hatte er dann doch kapiert, dass wir beide nicht mitkämen. Ich nicht, weil ich nicht auf irgend so einer dämlichen Winzinsel in eine noch dämlichere Schule wollte. Und meine Mum nicht, weil sie ihren Job an der Uni nicht aufgeben wollte. Am Ende kriegten sich alle wieder ein. Mein Dad zog aus und meine Mum besuchte ihn während der vorlesungsfreien Zeit. Mir genügte WhatsApp. »Was soll ich denn da? Ich segle nicht, ich tauche nicht, und Schnorcheln ist was für Leute, die zu blöd zum Tauchen sind.«
»Ich meinte ja auch ›Arbeiten‹, nicht Urlaub.«
»Mum! Hydrologie interessiert mich nicht. Außerdem krieg ich Hautkrebs, wenn ich dahin fliege.« Vermutlich war das nicht mal übertrieben. Meiner Mum hatte ich es zu verdanken, dass ich aussah wie ein irischer Leprechaun: Sommersprossen und Kupferkrause. Überall fiel ich damit auf. In der Grundschule damals hieß ich bei allen nur noch »Pumuckl«, und in der Siebten wurde ich dermaßen gemobbt, dass ich sogar die Schule wechselte. Seit ich in der Elften war, ging es. Jetzt nannten mich die Mädels »Ginger« und fanden meine Locken »megasüß«. Zu mehr hatte es allerdings bisher nicht gereicht.
»Oder wie wäre es mit Jura?« Meine Mum ließ nicht locker. Sie ließ niemals locker. Und mit Jura kannte sie sich aus. Sie hatte eine Stelle als Dozentin an der juristischen Fakultät. Ich konnte mir kaum etwas Langweiligeres vorstellen.
»Nein, Mum! Ende der Diskussion.« Eltern-Vorschläge musste man schon aus Prinzip abblocken. Ich war siebzehn, und das Einzige, was mich momentan wirklich antörnte, war Musik. Ich wollte Songs schreiben, programmieren, Loops mixen und Leute zum Ausrasten bringen. Jede freie Minute verbrachte ich am Keyboard, probierte Sounds, kombinierte Beats, sang Texte ein. Meine Stimme war jetzt nicht die Bombe, aber ich traf die Töne, und vielleicht würde ich ja mal einen Sänger auftun. Oder eine Sängerin. Oder gleich eine ganze Band! Mit fettem Schlagzeug und einer geilen E-Gitarre! Aber bis dahin sang ich die Spuren eben selbst ein. Dazu hatte ich mir mein eigenes Tonstudio zusammengezimmert. In unserer Bude gab es nämlich ein ausgedientes Gästeklo unterm Dach, und ich konnte meine Mum tatsächlich überzeugen, dass keiner außer mir es nutzte. »Wenn du es auch putzt«, hatte sie schließlich nachgegeben. Ich nannte es Flush. »Ich bin im Flush« hieß auf gut Deutsch: Ich bin dann mal weg. Lasst mich bloß in Ruhe.
Diesen Sommer hing ich irgendwie in der Luft. Meine Mum war vor zwei Tagen zu meinem Dad in die Karibik abgereist, und ich hatte immer noch keine Ahnung, was ich mit den letzten Sommerferien meines Lebens anfangen sollte. Keiner hatte Zeit und zum Wegfahren stimmte die Kohle nicht.
Immerhin durfte ich demnächst einem DJ bei einem seiner Gigs über die Schulter sehen. Ein Kumpel hatte mir den Kontakt vermittelt, und ich hatte mir bereits vorgenommen, ein paar meiner eigenen Songs mitzubringen. Ich brannte darauf zu erfahren, wie sie beim Volk ankamen.
An diesem Morgen war ich erst um fünf Uhr früh nach Hause gekommen. Hundemüde und immer noch benebelt vom Bier und den Shots, hatte ich mich sofort in meine Koje verdrückt und war auf der Stelle eingeschlafen. In den Ferien sah und hörte ich vor zwölf Uhr nichts und niemanden.
Doch diesmal war es anders. Irgendetwas weckte mich gegen neun. Noch im Halbschlaf spürte ich, dass etwas anders war als sonst. Ich blinzelte, öffnete die Augen. Spitzte die Ohren. Da waren die alltäglichen Geräusche des Vormittags: vorbeifahrende Autos, Stimmen auf der Straße, Vögel. Doch da war noch etwas anderes. Ein Geräusch, als würde sich jemand bemühen, besonders leise zu sein. Ich lauschte angestrengt. Kein Zweifel, da war jemand im Haus. Schlich durch die Zimmer. Zog Schubladen auf. Öffnete Schränke. Schließlich hörte ich Schritte auf der Holztreppe. Sie kamen die Stufen herauf, näherten sich, verharrten kurz, liefen weiter.
Ich dachte, jetzt wäre exakt der Augenblick, die Polizei zu alarmieren. Doch bei meiner Rückkehr heute Morgen hatte ich mein Handy in der Küche an die Ladestation gehängt. Und das Festnetztelefon befand sich im Arbeitszimmer meiner Eltern nebenan. Shit!
Ich verkroch mich unter meiner Bettdecke und stellte mich tot. Während mein Herz gegen meine Rippen wummerte und ich schon Angst hatte, man könne das hören, überlegte ich fieberhaft, wie ich mich verhalten sollte, falls jemand gleich in mein Zimmer platzte. So defensiv wie möglich, natürlich. Alles rausrücken: Geld, Laptop, Playstation – scheißegal! Hauptsache, die Typen hauten ab, ohne mich vorher abzumurksen!
Langsam wurde mir ziemlich heiß unter meiner Bettdecke. Ich lupfte sie eine Handbreit und bemerkte gerade noch, wie eine kleine Gestalt, schlank und drahtig und höchstens eins fünfzig, ins Arbeitszimmer meiner Eltern huschte.
Allein!
Der Typ war allein!
Plötzlich kam mein Mut zurück. Ich glitt aus dem Bett und schlich an der Wand entlang in den Flur. Eine Gestalt in Jeans und Beanie wühlte gerade in der Schreibtischschublade meiner Mum.
»Hey!«, brüllte ich. Der Dieb fuhr herum, wollte schon an mir vorbeiflitzen. Doch ich stellte mich ihm wie ein Torwart in den Weg und packte im richtigen Augenblick zu. Er zappelte und schlug um sich und wir gingen beide zu Boden. Jetzt erst merkte ich, dass der Einbrecher gar kein Kerl war! An den entsprechenden Stellen war er kurvig. Zumindest kurviger als ein Junge. Unter dem dünnen Beanie lugten lange nussbraune Haare hervor.
»Was soll das werden?«, schrie ich, während sie sich unter mir wand. Sie antwortete nicht, keuchte nur unter meinem Gewicht und versuchte, mich zu beißen.
»Wie bist du hier reingekommen?«, brüllte ich und tackerte sie mit beiden Händen am Boden fest. Schwer atmend funkelte sie mich aus tiefgrünen Augen an. Alter! Noch nie in meinem Leben hatte ich so ein Grün gesehen. Ich meine, es war nicht so ein Blaugrün, bei dem alle immer gleich ausrasten, oder so ein Goldgrün wie bei einer Katze. Nein, es war mehr ein Schlammgrün, wie wenn man in einem See schwimmt, der voller Algen ist.
»Wie heißt du?«, fragte ich. Doch sie gab keine Antwort. Vielleicht verstand sie mich auch nicht. »What’s your name? … Comment tu t’appelles? … Äh … como … te llamas?«, versuchte ich es weiter. Keine Reaktion. Nur dieses tiefgrüne Starren.
»Okay, das ist mir zu blöd!«, knurrte ich. Ich zerrte sie auf die Füße und verdrehte ihr den Arm auf dem Rücken.
Sie schrie vor Schmerz auf. »Arschloch!«, fauchte sie in astreinem Deutsch. Ihre Stimme war erstaunlich tief und ein bisschen heiser.
Ich schleifte sie zum Schreibtisch und nahm den Hörer von der Station. Während ich noch überlegte, was ich der Polizei sagen sollte, trat sie mir mit ihren rabenschwarzen Doc Martens auf meine nackten Zehen. Ich schrie auf und ließ ihren Arm los. Sie nutzte ihren Vorteil und stürmte Hals über Kopf die Treppen runter.
Ich warf den Hörer weg und setzte ihr nach. Als ich unten ankam, war sie schon bei der Haustür, riss sie auf und spurtete über die gekieste Einfahrt Richtung Straße. Schnell war sie. Verdammt schnell! Und ich barfuß. Doch das war mir in dem Moment egal. Ich war so sauer, dass ich den Split gar nicht bemerkte.
Sie rannte die Straße runter bis zur nächsten Ecke, dann verschwand sie aus meinem Blickfeld. Ich wollte hinterher, doch da rumpelte der Briefträger mit seinem Fahrrad über den Bordstein. Ich schlug einen Haken und wäre fast vor ein Auto gelaufen. Der Fahrer stieg in die Eisen und hupte. Ich riss entschuldigend die Hände hoch und schlug einen weiteren Haken. Als ich ebenfalls um die Ecke bog, war sie verschwunden.
Ich stoppte ab und blickte mich suchend um. Außer einer jungen Frau mit Kinderwagen war niemand zu sehen. Die Frau warf mir einen irritierten Blick zu und beschleunigte ihren Schritt. Erst jetzt wurde mir klar, dass ich hier in Boxershorts und barfuß herumstand. Das Mädchen war wie vom Erdboden verschluckt. Frustriert machte ich kehrt.
Zum Glück stand die Haustür noch sperrangelweit offen. An einen Schlüssel hatte ich in der Eile natürlich nicht gedacht. Ich verpasste der Tür einen Tritt, worauf sie donnernd ins Schloss fiel. Auf halbem Weg in die Küche blieb ich stehen und überlegte. Hatte das Biest die Haustür aufgebrochen? Ich öffnete die Tür noch einmal und besah mir das Türschloss. Es war völlig in Ordnung. Keine Kratzer, keine Splitter, nichts. Sie musste eine Scheckkarte oder einen Draht benutzt haben. Das Haus meiner Eltern war alt, Anfang letztes Jahrhundert oder so, mit einer hölzernen Haustür. Im oberen Viertel gab es ein kleines ovales Fenster. Da war sie aber ganz sicher nicht durchgekrochen.
Ich öffnete die Tür zur Gästetoilette und warf einen Blick auf das Fenster. Fehlanzeige. Es war geschlossen und die Scheibe war auch noch drin. Vielleicht der Keller? Ich hechtete die Treppe runter, doch auch hier war alles wie sonst.
Hatte ich am Ende die Haustür offen gelassen, als ich heute Morgen nach Hause gekommen war? »So besoffen kann man gar nicht sein«, brummte ich und betrat die Küche, um etwas zu trinken. Dabei fiel mein Blick auf die Stelle, an der ich mein Handy zurückgelassen hatte. Es war nicht mehr da. Und das Ladekabel war ebenfalls weg.
»Scheiße!«, stöhnte ich. Das Handy war keine drei Wochen alt! Es war kackteuer gewesen! Doch mal abgesehen davon: Wenn sie es geschickt anstellte, hatte sie Zugriff auf sämtliche meiner Daten, inklusive Facebook- und Instagram-Seite, und konnte dort in meinem Namen irgendeinen Schwachsinn verbreiten. Sie konnte auch alle Fotos und Filme sehen, die ich gemacht hatte. Und das Schlimmste: Auf meinem Handy hatte ich meine komplette Musik abgespeichert! Sämtliche Songs, die ich selbst geschrieben hatte, meine Ideen, einfach alles! Natürlich hatte ich noch ein Back-up auf meinem Computer. Aber ich wollte selbst entscheiden, wer meine Songs hören durfte und wer nicht. Und dieses Miststück war ganz sicher nicht dabei.
Wutschnaubend stampfte ich die Treppe hoch. Ich würde mir mein Handy zurückholen. Am besten jetzt gleich. Ich startete meinen Computer und öffnete die App für den Ortungsdienst. Es dauerte einen Augenblick, bis die Karte geladen war. Ungeduldig kratzte ich über das Mousepad. Schließlich entdeckte ich einen blinkenden Punkt, der mir anzeigte, wo sich mein iPhone gerade befand. Offensichtlich hatte das Biest einen Bus oder die Straßenbahn genommen, denn der Punkt bewegte sich ziemlich flott vorwärts. Mittlerweile war sie in der Altstadt. In unmittelbarer Nähe zum Marktplatz.
Einen kurzen Augenblick überlegte ich, ob ich ihr einen richtig fiesen Ton senden oder die Kamera aktivieren und ein Foto von ihr schießen sollte, das ich auf sämtlichen Netzwerken posten würde. Diese Bitch hat mein Handy geklaut! oder so. Doch dann ließ ich es bleiben. Es war kindisch. Außerdem würde ich auf diese Art mein iPhone auch nicht zurückbekommen.
Ich konnte natürlich zur Polizei gehen. Aber bis die in die Gänge käme, wäre das Biest bestimmt schon über alle Berge. Nein, ich würde es mir selbst zurückholen. Wenn es nicht klappte, konnte ich hinterher immer noch Anzeige erstatten.
Zum Glück hatte meine Mum ihr Smartphone zu Hause gelassen. Sie nahm es nie mit in die Ferien, aus Angst, die Uni könnte aus irgendeinem Grund anrufen und ihr die Urlaubsstimmung vermiesen. Ich zog es aus ihrer Schreibtischschublade und schaltete es an. Jetzt würde ich mein eigenes iPhone auch unterwegs verfolgen können. Und es diesem Miststück bei erster Gelegenheit wieder abluchsen.
Während ich mich anzog und mein Bike aus der Garage zerrte, verfolgte ich den kleinen blinkenden Punkt auf dem Display. Sie war immer noch in der Altstadt. Doch jetzt bewegte sich der Punkt langsamer.
Na warte!, dachte ich und schwang mich auf den Sattel. Mit einer gehörigen Portion Adrenalin in den Adern machte ich mich auf den Weg in die Stadt.
NIKA
»Was soll die Scheiße?! Ihr habt gesagt, die sind im Urlaub!«, schrie ich Igor und Pavel an. Zum Glück war der Spinner zu langsam gewesen. Er hatte nicht mitbekommen, dass ich in Igors Auto gestiegen war. Ich rappelte mich vom Rücksitz hoch und fauchte Igors Augen im Rückspiegel an. »Der Typ hat mir fast den Arm gebrochen!«
»Hast du ihn mitgebracht?«, fragte Igor ungerührt.
»Was?« Typisch!, dachte ich. Ihn interessierte wieder mal nur das eine. »Nein, Mann! Wie hätte ich den denn so schnell finden sollen?«
»Dann musst du noch mal rein. Stjepan will die Karre. Und ich hab versprochen, dass du lieferst.«
»Spinnst du? Der Kerl hat mich doch gesehen.« Ich war ja wohl nicht lebensmüde!
»Na und? Dann sorg einfach dafür, dass er dich das nächste Mal nicht sieht.«
Igors Stimme klang ruhig. Zu ruhig. Es war gefährlich, ihn zu reizen.
Trotzdem tat ich es. »Dann geh eben selbst da rein, wenn du Stjepan das Auto versprochen hast. Idiot!«
Igor trat so heftig auf die Bremse, dass ich fast durch die Frontscheibe geflogen wäre. Er fuhr zu mir herum und funkelte mich an. »Pass mal auf, Nika. Du wirst tun, was ich sage, sonst wird es dir später leidtun. Kapiert?«
Ich verdrehte genervt die Augen. Was glaubte der eigentlich? Ich war doch nicht seine Sklavin.
In diesem Moment fuhr Igors Hand blitzschnell an meine Kehle. Ich versuchte zurückzuweichen, aber er packte nur noch fester zu. Seine Finger krallten sich unter meinen Ohrläppchen in die Haut.
»Ob du kapiert hast?«, zischte er und zerrte mich zu sich heran. Ich klemmte mit den Schultern zwischen den beiden Vordersitzen und konnte weder vor noch zurück. Sein Atem stank nach Zigaretten. Ich biss die Zähne fest zusammen und hielt die Luft an.
Früher hatte Igor mir Angst eingejagt. Er hatte mich oft verprügelt, wenn wir zusammen unterwegs waren und es mit der Beute nicht so recht geklappt hatte. Wenn Stjepan Stress machte, war Igor immer bereit, mir die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und Stjepan glaubte ihm meistens.
»Komm, Igor, lass sie«, schaltete sich Pavel dazwischen. »Das mit dem Auto, das klappt schon noch. Wir probieren es die Tage einfach noch mal.«
Igor ignorierte ihn. Sein Blick fixierte mich. Doch immerhin lockerte er seinen Griff, sodass ich mich befreien konnte. Ich ließ mich nach hinten fallen und schnappte nach Luft. Dieser Wichser! Was glaubte der eigentlich?
Schweigend fuhren wir weiter stadteinwärts. Es gab da noch zwei Adressen, die ich klarmachen sollte, bevor ich Igor loswerden würde. Unauffällig legte ich die Hände um meinen Brustkorb und tastete nach dem Handy, das ich vorhin mitgenommen hatte. Jetzt steckte es unter meinem rechten Arm in meinem Sport-BH. Hoffentlich klingelte es nicht plötzlich! Ich musste es unbedingt noch abschalten. Igor und Pavel würden es mir sofort abnehmen und verticken. Doch ich wollte ein Mal etwas für mich haben.
»Zweiter Stock«, riss Pavel mich aus meinen Gedanken. »In der Wohnung unten ist eine Zahnarztpraxis. Um reinzukommen, spiel die Patientennummer. Die Wohnung unterm Dach steht leer, die musst du nicht checken. Alles klar?«
Ich nickte und stieg aus dem Auto. Der Himmel hatte sich bedeckt und Wind war aufgekommen. Bestimmt würde es bald regnen. Ich lief die Straße entlang auf das Haus zu. Es war ein Eckhaus, und genau wie Pavel es beschrieben hatte, befand sich unten eine Zahnarztpraxis.
Ich klingelte bei Dr. Martin. Fast im gleichen Augenblick ertönte ein Summer und die Tür ging auf. Ich betrat den Hausflur und orientierte mich rasch: ein sauber gewischter Steinfußboden mit bunten Ornamenten. Frisch getünchte Wände. Eine weiße Stuckdecke mit fetten Engeln. Eine breite Holztreppe, die im Dämmerlicht matt schimmerte. Rechts die Praxis. Keine Wurfsendungen oder Flyer, die achtlos herumlagen. Keine abgestellten Fahrräder. Kein Kinderwagen. Kein Müll.
Ich hob den Kopf und sog die Luft im Treppenhaus ein. Jedes Haus hatte seinen ganz eigenen Geruch. Dieses hier roch nach sauberer Wäsche und altem, frisch gewachstem Holz. Außerdem nach Desinfektionsmittel, was ganz sicher mit der Zahnarztpraxis zusammenhing. Es roch nach einem geregelten Leben. Nach Sauberkeit, Ordnung und nach Geld. Genau wie Pavel es vermutet hatte.
Pavel war unser Scout. Er kundschaftete die Gegend aus, beobachtete die Menschen und fand heraus, wo sie wohnten, wann sie zur Arbeit gingen und welche Autos sie fuhren. Dann erstattete er Igor Bericht. Der besprach sich mit Stjepan und dieser gab grünes Licht, sobald er einen Abnehmer gefunden hatte. Manche Autos wurden direkt hinter der Grenze in ihre Einzelteile zerlegt. Andere als Ganzes verhökert. Und manche, die besonders schicken, gingen direkt an unseren Big Boss.
Ich fummelte das Handy aus meinem BH und schaltete es ab. Dann folgte ich den knarzenden Stufen nach oben. Die Wohnungstür im ersten Stock war weiß lackiert und hatte einen geriffelten Glaseinsatz, durch den ich nichts erkennen konnte. Vor der Tür lag eine Fußmatte. »Welcome« stand darauf. Nicht dass das für mich gegolten hätte. Ich war hier nicht willkommen.
Versuchsweise drückte ich auf den Klingelknopf. Hinter der Tür schrillte es auf. Einmal. Zweimal. Nichts. Also warf ich einen letzten Blick über die Schulter, dann zog ich den Flipper aus meiner Jeans. Ich hatte ihn aus einer leeren Shampooflasche gebastelt. Ein Streifen Plastik, elastisch und stabil genug, um ihn auf Höhe der Türklinke in den Türspalt zu schieben und den Schließkolben nach innen drücken zu können. Bei diesen alten Wohnungstüren klappte das meistens.
Es klickte leise und schon schwang die Tür auf. Sorgfältig streifte ich meine Schuhe an der Fußmatte ab und betrat die Wohnung. Im Fernsehen hinterließen Einbrecher immer ein Mordschaos. Doch Stjepan hatte mir eingebläut, wie wichtig es war, dass die Leute erst spät erkannten, dass jemand Fremdes in ihrer Wohnung gewesen war. Je länger diese Erkenntnis zum Durchsickern brauchte, desto mehr Abstand hatte man zwischen sich und die Bewohner gebracht.
Ich zog die Wohnungstür hinter mir zu und blickte mich um. Ein Hauch von Parfum kitzelte meine Nase. Es stammte aus einem kleinen blauen Flakon, das auf einem gläsernen Board stand. Ich schnupperte an dem Fläschchen. Es roch gut, etwas schwer vielleicht, aber hey – was soll’s? Während ich mich damit einnebelte, fiel mein Blick in den Spiegel, der über dem Board hing: Mein Gesicht passte irgendwie nicht zu dem Parfum. Buschige Augenbrauen, pickelige Stirn, wirre Haare ohne Schnitt. Als ich das letzte Mal mit Lidstrich nach Hause kam, hatte Stjepan mir eine geknallt. Schminke war nicht. Damit mir die Polizei mein Alter abnahm. Strafmündig war man erst mit vierzehn, also achtete Stjepan darauf, dass ich jünger aussah. Damit ich schnell wieder freikam, falls die Bullen mich erwischten. Denn Stjepan zählte auf mich. In den Ausweisen, die er mir besorgte, stand, dass ich zwölf sei. Und dass ich Ylva hieß. Manchmal auch Christina oder Liliana. Hin und wieder musste ich selbst nachsehen. Meine Eltern hatten mich »Nika« genannt. Nika, die Siegerin. Meine Eltern waren tot. Das hatte ich für mich so entschieden.
Ich steckte das Parfum trotzdem ein und ließ meinen Blick durch die Diele schweifen. Alles war picobello aufgeräumt. In dem verspiegelten Garderobenschrank hingen ordentlich ein paar Wintermäntel nebeneinander und die Schuhe auf einem Brett darunter waren nach Farben sortiert. Auf einem Sideboard entdeckte ich mehrere gerahmte Fotos. Ein Paar wie aus einem Werbespot für Parship, glücklich lächelnd, sie im Hochzeitskleid, er im Smoking. Silberrahmen. Daneben Bilder vom Skifahren. Bilder auf einem Segelboot. Schlüsselbrett? Fehlanzeige.
Der Parkettboden unter meinen Füßen knarzte leise, als ich durch den langen Flur schlich. Gegenüber der Eingangstür lag die Küche. Aus Erfahrung wusste ich, dass ich dort nichts Interessantes finden würde. Silberbesteck horteten die Leute lieber in Extraschubladen im Wohnzimmer. Und so, wie ich die Bewohner dieser Bude einschätzte, bewahrten sie auch kein Bargeld in der Küchenschublade auf.
Im Vorbeigehen erhaschte ich einen Blick ins Wohnzimmer: halbrunder Erker mit schwarzem Flügel, aufgeklappt und auf Hochglanz poliert. Teuer, aber nicht zu transportieren. Dann schon eher das Gemälde an der Wand über dem Ledersofa oder die coole Flachbildglotze. Ich schoss von beidem ein Foto. Falls Stjepan Interesse hatte, würden meine Cousins später noch mal vorbeikommen und die Wohnung im großen Stil checken.
Rechts eine etwas schmalere Tür mit Lüftungsschlitzen. Ich stieß die Tür auf. Das Gästeklo. Der aufdringliche Geruch von Duftstäbchen stieg mir in die Nase. Sie steckten in einer schlanken Vase auf einem Glasboard. Daneben ein paar Gästehandtücher. Handcreme, Haarspray. Ich probierte beides aus. Die Handcreme roch megagut nach Rose und ich steckte sie ein. Das Spray war Mist. Meine Haare verklebten und stanken wie die Pest. Egal, ich musste weiter.
Gegenüber das Arbeitszimmer. Nicht besonders groß, aber hell, was an den beiden hohen Sprossenfenstern lag, die zur Straße hinausgingen. Dazwischen ein Schreibtisch aus dunklem Holz. Es war ein antikes Teil mit schwerer Marmorplatte, darauf ein paar Stifte, ein Notizbuch und ein riesiger Bildschirm mit dem markanten Äpfelchen. Auch davon machte ich ein Foto.
Die erste Schreibtischschublade klemmte, doch nach einigem Rütteln konnte ich sie aufziehen: Eine kleine Ledermappe mit zwei Kreditkarten wanderte in meinen Rucksack. In der zweiten entdeckte ich dann, wonach ich eigentlich suchte: einen Autoschlüssel. Es war einer dieser Funkschlüssel, die in einem rechteckigen Kunststoffgehäuse steckten. Man musste ihn nur in das Fahrzeug legen und auf den Startknopf unter dem Lenkrad drücken und schon sprang der Motor an. Die Fahrzeugpapiere steckten meist unter der Sonnenblende. Bei einer Verkehrskontrolle konnte man notfalls sagen, dass das Auto geliehen sei. Natürlich funktionierte das nur, solange der Wagen nicht als gestohlen gemeldet wurde. Daher musste einer von den Jungs auch sofort aufbrechen. Ich musste mich beeilen.
Ein paar meiner Cousins knackten die Autos mit einem Funkwellenverlängerer. Für diese Methode mussten sie nicht einmal in die Häuser hinein. Es genügte, wenn sie sich dicht vor die Haustür stellten. Die meisten Leute hängten ihre Autoschlüssel an ein Schlüsselbrett direkt neben der Haustür. Man musste die Funkwellen nur orten und ein Stück verlängern, bis das Auto das Signal erkannte und die Türen entriegelte. Ein weiteres Signal und der Wagen sprang an. Er lief so lange, bis der Tank leer war – komplett ohne Schlüssel. Das Ganze klappte allerdings nur, wenn das Auto direkt vor der Haustür geparkt war. In der Stadt standen die Fahrzeuge meist auf Anwohnerparkplätzen irgendwo in der Straße. Ein Funkwellenverlängerer brachte da gar nichts. In so einem Fall kam ich ins Spiel. In meiner Familie war ich Champion im Homejacking.
Ich steckte den Schlüssel in meine Jeans und untersuchte die letzte Schublade. Dort stieß ich auf einen Reisepass, ausgestellt auf den Namen Mirjam Reinert. Er war noch vier Jahre gültig, also nahm ich ihn ebenfalls an mich. Über Pässe freute Stjepan sich immer ganz besonders. Wie erwartet fand ich kein Bargeld. Vermutlich hatte Frau Reinert ein gut gefülltes Konto auf der Bank und zahlte immer nur mit ihrer Kreditkarte. Aber vielleicht würde ich etwas Schmuck finden. Mit ziemlicher Sicherheit im Schlafzimmer und mit noch mehr Glück auch einen Tresor. Den würden Igor und Pavel dann mit noch ein paar anderen bei Gelegenheit abholen.
Ich warf einen Blick auf meine Uhr. Acht Minuten waren vergangen. Bis jetzt lag ich gut in der Zeit. Doch ich wollte keinen Ärger mit Igor riskieren. Schon gar nicht nach unserem Krach von eben. Mein Cousin war schon immer aufbrausend gewesen, aber seit ich ihn letztens habe abblitzen lassen, war es besonders schlimm. Vielleicht hätte ich ihm nicht auch noch eine scheuern sollen. Obwohl – er hatte es verdient. Keiner durfte mich einfach so anbaggern. Und schon gar nicht Igor! Jedenfalls behandelte er mich seitdem nicht nur wie Dreck, sondern spielte sich auch noch als mein Boss auf. Dabei waren wir ein Team. Schon seit Jahren.
Die Tür zum Schlafzimmer war angelehnt. Ich stieß sie vorsichtig auf – und bekam den Schreck meines Lebens. Auf dem frisch gemachten Bett lag die fetteste Katze, die ich je gesehen hatte. Sie starrte mich aus grünen Augen an, während ihr Schwanz gereizt hin und her zuckte. Ihr schwarzes Fell war lang und wuschelig und um den Hals trug sie ein Halsband mit einem kleinen silbernen Glöckchen.
Ich stieß die Luft aus und wandte mich ab. Katzen waren kein Problem. Sie bellten nicht und verteidigten auch keine Wohnungen. Da waren Hunde eine ganz andere Nummer. Seit mich einer mal gebissen hatte, machte ich einen großen Bogen um Hundewohnungen.
Unter dem Blick der Katze zog ich Schubladen auf und wühlte mich durch Unterwäsche, Seidenstrümpfe und Nachthemden, doch ich fand nichts Interessantes. An der Wand gegenüber des Betts stieß ich auf eine altmodische Schminkkommode aus rötlichem Holz mit ovalem Spiegel und geschliffener Glasplatte. Darauf ein Glasschälchen mit Perlensteckern und einer goldenen Armbanduhr. In den drei Schubfächern links und rechts vom Spiegel stöberte ich zwei Broschen mit Elfenbeingesichtern, eine Samtdose mit einer Perlenkette, einige Ohrringe und mehrere Goldringe mit Glitzersteinen auf. Nicht schlecht, dachte ich und kramte in meinem Rucksack, bis ich die Coladose fand. Sie sah täuschend echt aus, war aber in Wirklichkeit ein kleiner Safe, der sich schon oft bewährt hatte. Ich schraubte ihn auf und versenkte meine Beute in seinem Inneren. Einen Tresor fand ich nicht.
So langsam wurde es Zeit. Mehr als dreizehn Minuten brauchte ich selten für eine Wohnung. Außerdem warteten Igor und Pavel auf den Autoschlüssel.
In der Küche warf ich einen schnellen Blick in den Kühlschrank. Er war bis zum Anschlag gefüllt mit leckerem Zeug. Neben einer Käse- und Wursttüte lachte mich vor allem eine goldgelbe Honigmelone an. Schade, dass ich die nicht mitnehmen konnte, denn als Snack für zwischendurch war eine Melone ziemlich unpraktisch. Am Ende entschied ich mich für eine Tafel Nuss-Nugat-Schokolade. Nicht unbedingt meine Lieblingssorte, aber ich hatte noch nicht gefrühstückt und so schnell würde ich auch nichts bekommen. Also steckte ich sie ein.
Ich kehrte in die Diele zurück und legte mein Ohr an die Wohnungstür. Im Treppenhaus war alles still. Vorsichtig drückte ich die Klinke herunter und spähte hinaus. Da niemand zu sehen war, schlüpfte ich aus der Wohnung und zog die Tür leise hinter mir zu.
Hat mich gefreut, Frau Reinert!, dachte ich und lief die Treppe hinunter. Gleich darauf fiel die schwere Eingangstür hinter mir ins Schloss.
NIKA
Draußen empfing mich der Duft der Großstadt an einem schwülen Sommertag. Ich mochte diese Jahreszeit, und besonders aufregend fand ich, dass jede Stadt ihren ganz eigenen Geruch hatte. Genau wie die Häuser und Wohnungen, die ich auscheckte, nur dass dieser Geruch vielschichtiger war. Gewaltiger. Seit ich mit knapp sechs Jahren nach Deutschland gekommen war, hatte ich schon viele dieser Gerüche kennengelernt, denn Stjepan sorgte dafür, dass wir nie lange an einem Ort blieben. Oft waren es nur ein paar Tage, dann reisten wir schon zur nächsten Station.
Zufrieden schulterte ich meinen Rucksack und machte mich auf den Weg Richtung Treffpunkt. Den Rucksack hatte ich letzte Woche bei Kaufhof mitgehen lassen. Er war cool, außerdem hatte er mehrere Innentaschen mit Reißverschlüssen, in denen ich mein Werkzeug verstauen konnte. Stjepan mochte es nicht, wenn ich es im Rucksack mit mir herumtrug. Er hatte mir eingeschärft, dass ich es in meinen BH oder ins Höschen stecken sollte. Das wäre sicherer bei einer Razzia, meinte er. Aber Stjepan konnte mich mal. Er hatte keine Ahnung, wie unbequem es war, wenn man den ganzen Tag mit einem Schraubenzieher im BH herumlief!
Im Gehen holte ich mein Handy aus der Tasche. Nicht das schicke von dem Typen, der mich vorhin erwischt hatte, sondern mein eigenes. Das von Tchibo. Pavel hatte es mir gegeben und er ersetzte es regelmäßig durch ein neues. Es zeigte zwanzig nach zwölf und den Eingang eines Anrufs an. Vermutlich hatte Igor sich gemeldet. Bestimmt wartete er irgendwo ungeduldig auf den Schlüssel. Ich tippte auf die Nummer. Igor ging fast unmittelbar ran.
»Wo bleibst du?«, bellte er.
»Wo seid ihr?«, antwortete ich mit einer Gegenfrage. Er konnte mir gar nichts. Solange ich die Schlüssel organisierte, stand Stjepan hinter mir. Und Stjepan war nun mal auch Igors Boss.
»Gleiche Straße, Hausnummer 56«, knurrte er. »Beweg deinen Arsch!«
»Blödmann«, brummte ich und steckte das Handy weg. Richtig, dort hinten erkannte ich Igors Karre, eingezwängt zwischen einem SUV und einem weißen Lieferwagen. Und wo war die Reinert-Karre? Ich tastete nach dem Autoschlüssel in meiner Jackentasche und drückte immer wieder auf die Fernbedienung. Nichts passierte. Doch kurz bevor ich Igors Wagen erreichte, blinkte es drei Autos vor mir kurz auf. Ein silberner Audi. Bingo! Genau wie Pavel es gesagt hatte.
Ich lief an dem Wagen vorbei und warf einen unauffälligen Blick durch das Seitenfenster. Navigationssystem in der Mittelkonsole, Ledersitze. Mehr konnte ich im Vorbeigehen nicht erkennen. Aber die Karre sah teuer aus. Bestimmt hatte Stjepan schon einen entsprechenden Abnehmer im Auge.
Plötzlich packte mich jemand von hinten an der Schulter. Ich fuhr herum. Rote Haare, Sommersprossen. Der Typ aus dem Haus heute Morgen! Wie zum Teufel hatte der mich gefunden? »Hey!«, blaffte ich ihn an, während ich seine Hand abstreifte.
Er war ungefähr einen Kopf größer und vielleicht ein, höchstens zwei Jahre älter als ich. Und obwohl ich eigentlich nicht auf Jungs mit roten Haaren stand, fand ich schon, dass er ziemlich gut aussah. Auch wenn er jetzt natürlich ein Shirt und Jeans trug. Er war groß und schlank und hatte total süße Locken, in denen ich gerne mal herumgewuschelt hätte. Aber im Augenblick war das wohl eher nicht angebracht.
»Mein Handy«, sagte er und ich hörte die unterdrückte Wut in seiner Stimme. Auffordernd streckte er seine Hand aus.
»Spinnst du?«, fauchte ich und versuchte, mich an ihm vorbeizuschieben. Doch er packte meinen Arm. »Mann, verpiss dich!«
»Du hast mein Handy geklaut«, knurrte er, diesmal etwas lauter. »Los, her damit!«
»Hallo? Wovon redest du? Lass mich in Ruhe!« Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Igors Autotür aufschwang.
»Von meinem Handy, das du mir vor knapp drei Stunden geklaut hast«, schnauzte der Typ und packte meinen Arm fester. »Bei mir zu Hause, in meiner eigenen Bude!«
Ich begann zu schreien. Ich wusste genau, wie die Szene auf andere wirken musste: Ein Kerl macht sich an ein Mädchen heran. Sie wehrt sich, er wird aufdringlich, sie beginnt zu kreischen. Er hatte keine Chance. Um diese Zeit waren so viele Leute unterwegs. Irgendeiner würde mir bestimmt gleich helfen. Igor und Pavel stiegen aus. Beinah gleichzeitig schlossen sie die Wagentüren und kamen langsam auf uns zu. Da der Typ mit dem Rücken zu den beiden stand, bemerkte er sie nicht.
»Okay, dann hol ich jetzt die Polizei«, sagte er und zog ein anderes Handy aus der Tasche.
In diesem Moment legte Igor ihm die Hand auf die Schulter. Als der Kerl herumwirbelte, schoss Igors Faust nach vorne und krachte dem Roten mitten ins Gesicht. Der Typ ließ meinen Arm los und taumelte rückwärts. Seine Nase blutete heftig. Er riss die Hände hoch, um einen weiteren Schlag abzuwehren. Blut quoll zwischen seinen Fingern durch.
Mein Magen rebellierte. Ich rannte zum Auto und verzog mich auf den Rücksitz. Ich wollte nicht sehen, wie Pavel und Igor ihn fertigmachten. Ich hasste diese Machonummer! Trotzdem musste ich immer wieder hinschauen. Kein Mensch kam ihm zu Hilfe. Auch nicht, als der Typ zu Boden ging und sich zusammenkrümmte, während meine Cousins abwechselnd auf ihn eintraten. Wenn die so weitermachen, bringen sie ihn um, schoss es mir durch den Kopf. Doch zum Glück kamen die beiden kurz darauf zum Auto zurück. »Und?«, fragte Igor ungeduldig und ohne den Vorfall von eben zu erwähnen. »Hast du ihn?«
Mit klammen Fingern kramte ich den Autoschlüssel hervor. »Ein Audi«, sagte ich. »Silbermetallic.«
»Geil!« Ein Grinsen huschte über Igors Gesicht. Im nächsten Moment hatte er auch schon sein Handy am Ohr. »Stjepan? Ja, ich bin’s. Wir haben ihn. … Heinrich-Heine-Straße. … Ja, Pavel übernimmt das … Ja, jetzt gleich … Sechs Stunden. Gleicher Ort, wie letztes Mal? Okay, bis dann … « Er steckte sein Handy weg und nahm mir den Schlüssel ab. Vermutlich würde er selbst gerne eine Runde mit der Karre drehen, doch heute war Pavel dran. »Hier«, sagte er und übergab Pavel den Schlüssel. »Der Rastplatz hinter der Grenze.«
Pavel stieg aus und klopfte zum Gruß kurz auf das Autodach. Dann schlenderte er an dem Jungen vorbei, der immer noch zusammengekrümmt am Boden lag, stieg in den Audi und startete den Motor.
Igor fuhr ebenfalls los. Durch die Heckscheibe sah ich, wie der Rote sich langsam aufrappelte. Eine Oma mit Hund wechselte die Straßenseite, als sie ihn bemerkte. Immerhin lebte er!
JONAS
Ich saß in einem Aquarium. Zumindest sah es so aus. Ein großer Glaskubus, von oben mit kaltem Neonlicht beleuchtet. Eine Klimaanlage summte.
Die Einrichtung eher sparsam, vermutlich damit man besser wischen konnte. Falls einer alles vollblutete. Oder kotzte. Grauer Linoleumboden. Ein Abfalleimer. Ein Waschbecken mit Spiegel. Ein Spender mit Desinfektionsmittel. Eine Reihe Stühle, alle kinomäßig auf zwei Bildschirme ausgerichtet.
Auf dem ersten lief NTV ohne Ton. Irgendeine Schießerei in einem amerikanischen Verwaltungsgebäude. Zwölf Tote. Darunter die Börsendaten. Das Wetter. Immer wieder im Wechsel. Auf dem zweiten blinkten in quälend langen Abständen Zahlen auf: U507 – C3. U512 – C2. U509 – C4. Mir wurde schlecht, wenn ich zu lange hinsah. Trotzdem musste ich. Ich wollte meine Zahl nicht verpassen.
Drei Stunden waren bereits vergangen. Die Informationen über den Anschlag hatten sich schon viermal wiederholt, aber meine Nummer war immer noch nicht aufgerufen worden.
U518. Den Zettel hatte ich am Empfang gezogen. Dort wo mich der Pförtner hingeschickt hatte, nachdem er kurz von seiner Zeitung aufgeblickt hatte. »Den Gang runter und dann rechts«, hatte er aus seiner Glaskabine genuschelt.
Die Frau in babyblauer Krankenschwesterkleidung war da schon ein wenig gesprächiger. Sie werkelte hinter einem Stehpult und sah auf. »Schlägerei?«, fragte sie mit Blick auf meine Nase. Ich nickte und hoffte, sie würde jetzt nicht weiterfragen. Ich hatte keine Lust, ihr die ganze Story mit dem Einbruch und den beiden Rambos zu erzählen. Am Ende würde sie die Polizei benachrichtigen und ich hätte einen Haufen Stress an der Backe.
»Sonst irgendwelche Beschwerden?«
Ich griff nach meiner rechten Seite und verzog das Gesicht. »Hier«, ächzte ich. »Meine Rippen …«
»Rippen, Brustkorb? Tut’s auch beim Atmen weh?«
Ich nickte und sie machte sich eine Notiz. »Dann bräuchte ich jetzt noch deine Versichertenkarte.«
Würde sie mich sonst wieder wegschicken? Ich fragte lieber nicht nach, sondern kramte in meinem Portemonnaie. Ein Wunder, dass ich es überhaupt eingesteckt hatte.
Sie checkte die Karte und übergab mir den Zettel mit besagter Nummer. »Nimm noch einen Augenblick dahinten Platz. Du wirst dann aufgerufen.«
Einen Augenblick – was immer das heißen mochte. Ich schlurfte zu dem Aquarium und ließ mich stöhnend auf einen Stuhl in der zweiten Reihe sinken. Mir war kotzübel. Der Geschmack von Blut klebte auf meiner Zunge. Ich sollte wohl froh sein, dass die Typen keine Waffen dabeigehabt hatten. Trotzdem: Einen Augenblick hatte ich gedacht, die machen mich platt. Vor allem, als sie auf mich eingetreten hatten. Wenigstens hatten sie mir keinen Finger gebrochen. Keyboardspielen würde noch gehen.
Die Stühle waren hart und unbequem, und ich wusste nicht, wie ich mich hinsetzen sollte. Unruhig rutschte ich auf meinem Plastiksitz herum. Um mich abzulenken, blickte ich mich im Raum um. Außer mir gab es noch einen fetten Alten im Feinripp-Unterhemd, Jogginghose und Sandalen. Außerdem eine ältere Frau mit Kopftuch und deren jüngere Begleitung. Sie unterhielten sich leise in einer Sprache, die ich nicht verstand. Arabisch vielleicht. Ab und zu hörte ich deutsche Begriffe wie »Mittagsschlaf« oder »Kindergarten« heraus.
Wieso war die Situation dermaßen aus dem Ruder gelaufen? Und wo waren die Typen so plötzlich hergekommen? Irgendwie mussten die zufällig in einem der geparkten Autos gewartet haben. Vielleicht hatten sie Mittagspause gemacht. Und dann hatten die gedacht, dass ich das Mädchen belästigen wollte. Sie waren ausgestiegen, um ihr zu helfen. Ich unterdrückte ein Schnauben. Ich und Mädchen antanzen – was für ein Witz! Ich wurde ja schon nervös, wenn mich eine nach der Uhrzeit fragte.
Moment.
War sie nicht bei denen ins Auto gestiegen? Das hatte ich am Rande noch mitbekommen. Man steigt doch nicht einfach bei Typen ins Auto, die man vorher noch nie gesehen hat! Oder hatten die sich gekannt?
U506 – C2. Ging das hier rückwärts oder was? Wie notfällig musste man sein, um schneller dranzukommen? Mein Schädel brummte. Damit er nicht platzte, beugte ich mich vor und hielt ihn mit beiden Händen fest. Dabei wurde mir schlecht. Meine Nase begann wieder zu bluten. Ich presste zwei Finger gegen meinen Nasenflügel und stand auf. Während ich ein Papiertuch aus dem Spender riss, fiel mein Blick in den Spiegel über dem Waschbecken.
Mann, war ich das?! Ich sah aus wie ein Zombie! Mein linkes Auge war zugeschwollen, mein Shirt voller Blut.
Ich presste das Tuch an meine Nase und wankte zurück auf meinen Platz. Die Nase pochte und der Druck auf meinen Schädel nahm sekündlich zu.
Wenn hier nicht bald was passierte, würde ich denen Grund zum Wischen geben. Zum Glück war das Elisabethenstift nur ein paar Häuserblocks entfernt gewesen. Sonst hätte ich mich nicht hierhergeschleppt. Apropos – wo war eigentlich mein Fahrrad? Das hatte ich ja total vergessen!
U516 – C4. Der Alte erhob sich und schlurfte nach draußen. Das Summen der Klimaanlage machte mich fertig. Außerdem war mir kalt. Ich zitterte wie blöd. Wie peinlich, wenn ich jetzt hier auch noch kollabierte!
Wieso hatte mir keiner geholfen? War da nicht diese Frau mit dem Hund gewesen? Die musste das doch mitgekriegt haben! Wenigstens die Polizei hätte sie rufen können. Aber sie war auf einmal weg gewesen.
Überhaupt – ich kriegte das Ganze immer noch nicht so ganz auf die Kette. Mal angenommen, die Typen hatten das Mädchen gekannt und im Auto auf sie gewartet, während sie – ja was eigentlich? Was hatte sie in dem Haus gemacht, aus dem sie kurz zuvor gekommen war? Sie war ja wohl kaum beim Zahnarzt gewesen! Vielleicht – oh Mann! –, vielleicht war sie da ja auch eingestiegen. So wie bei mir! Und die Typen hatten unten Schmiere gestanden!
U518 – C3. Das war ich! Endlich. Ich sprang auf, und der Raum begann, sich um mich zu drehen. Ich griff nach der nächsten Stuhllehne.
»Alles gut?«, fragte das Mädchen, das die ältere Frau begleitete.
»Geht schon«, murmelte ich und stolperte zum Ausgang.
C3 war ein Behandlungszimmer. Es lag hinter einer Schiebetür und sah aus wie die Pathologie in einem schlechten Tatort: weiß gekachelt und mit viel Edelstahl.
Ein Arzt, etwa Mitte dreißig, saß hinter seinem Schreibtisch und starrte auf den Bildschirm vor mir. »Setz dich«, sagte er, ohne mich anzusehen. »Bist du auf die Nase gefallen oder gab es eine direkte Gewalteinwirkung?«
»Ja«, antwortete ich. Er sah irritiert zu mir auf. »Also Letzteres«, schob ich nach. Meine Nase war mittlerweile so zugeschwollen, dass es klang, als hätte ich die Erkältung meines Lebens.
Der Doc erhob sich und kam um den Schreibtisch herum. Dabei streifte er sich ein paar Latexhandschuhe über. Mir brach der Schweiß aus. Ich bin kein Held, was Schmerzen betrifft. Oder Blut. War ich noch nie. Ich meine, ich werde nicht bewusstlos oder so. Glaub ich zumindest. Aber mir wurde immer gleich schlecht.
»Das wird jetzt etwas wehtun«, sagte der Arzt und betastete mein Nasenbein. Es knirschte, als er mit einer Art Zange meine Nase von innen beäugte.
»Das sollten wir röntgen«, murmelte er. »Wie ist es mit Luftholen?«
Ich gab einen undefinierbaren Laut von mir.
»Also eher nicht. Wie sieht es mit dem Brustbereich aus? Mach mal den Oberkörper frei.«
Stöhnend schälte ich mich aus meinem versifften T-Shirt. Meine Rippen schmerzten wie Hölle und ich bekam kaum Luft. Misstrauisch beobachtete ich, wie der Arzt meine Brust und den Bauchraum abtastete.
»Das sollten wir ebenfalls röntgen«, bemerkte der Doc schließlich und kehrte zu seinem Schreibtisch zurück. »Und einen Ultraschall machen wir auch – zur Sicherheit. Melde dich vorne im Wartebereich zum Röntgen an. Danach sehen wir uns noch mal.«
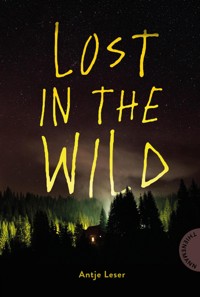
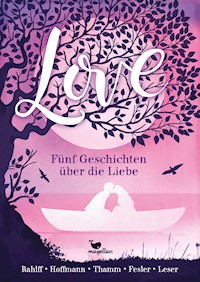
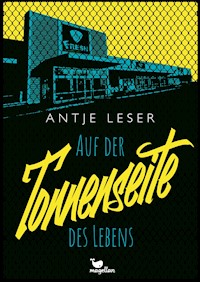











![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














