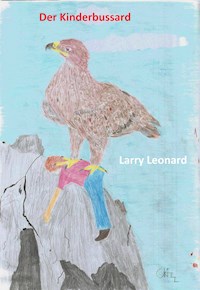1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Welt in der wir leben beherbergt viele Gefahren. Zwielichtige Gestalten und unheimliche Tiere tummeln sich in unseren Wäldern. Wesen, die uns mit Furcht erfüllen und unsere Phantasie beflügeln. Diese Geschichte erzählt von einem solchen Wesen. Einem Wesen, das mitten unter uns lebt. Es scheint ein Mensch zu sein. Es sieht auch so aus und es verhält sich wie ein Mensch. Wie ein ganz gewöhnlicher Mensch. Wie Sie und ich. Es geht seiner alltäglichen Arbeit nach, isst, plaudert, lacht, ja, manchmal weint es sogar. Man erkennt das Monster, das in ihm wohnt nicht. Erst des Nachts zeigt es sich. Denn wenn die Dunkelheit heran kommt geht es nicht schlafen. Es bleibt wach. Wacher als am Tag. Mit den letzten Sonnenstrahlen beginnt es seine Umgebung zu beobachten. Genau zu beobachten. Es achtet auf jede Veränderung, jede Bewegung. Auf alles. Auch das leiseste Geräusch entgeht ihm nicht. Seine Sinne schärfen sich, seine Kraft wächst und bei Eintritt der Nacht ist es kein Mensch mehr. Es ist ein Tier, eine Katze, ein Luchs. Ein majestätischer Luchs mit wunderschönem Fell, langen Tatzen, spitzen Zähnen und unbändiger Kraft. Jetzt hat es Hunger. Großen Hunger. Es will fressen. Es muss fressen. Es sucht nach Fressen. Es findet welches. Immer. ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Luguanodon
TitelseiteKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18ImpressumLuguanodon
Die Welt in der wir leben beherbergt viele Gefahren. Zwielichtige Gestalten und unheimliche Tiere tummeln sich in unseren Wäldern. Wesen, die uns mit Furcht erfüllen und unsere Phantasie beflügeln. Diese Geschichte erzählt von einem solchen Wesen. Einem Wesen, das mitten unter uns lebt. Es scheint ein Mensch zu sein. Es sieht auch so aus und es verhält sich wie ein Mensch. Wie ein ganz gewöhnlicher Mensch. Wie Sie und ich. Es geht seiner alltäglichen Arbeit nach, isst, plaudert, lacht, ja, manchmal weint es sogar. Man erkennt das Monster, das in ihm wohnt nicht. Erst des Nachts zeigt es sich. Denn wenn die Dunkelheit heran kommt geht es nicht schlafen. Es bleibt wach. Wacher als am Tag. Mit den letzten Sonnenstrahlen beginnt es seine Umgebung zu beobachten. Genau zu beobachten. Es achtet auf jede Veränderung, jede Bewegung. Auf alles. Auch das leiseste Geräusch entgeht ihm nicht. Seine Sinne schärfen sich, seine Kraft wächst und bei Eintritt der Nacht ist es kein Mensch mehr. Es ist ein Tier, eine Katze, ein Luchs. Ein majestätischer Luchs mit wunderschönem Fell, langen Tatzen, spitzen Zähnen und unbändiger Kraft. Jetzt hat es Hunger. Großen Hunger. Es will fressen. Es muss fressen. Es sucht nach Fressen. Es findet welches. Immer. Es kann ein unachtsames Reh sein, das durch den Wald streift, ein flinker Hase, der durchs Gebüsch hoppelt oder auch nur eine kleine Maus, die im Gras herumhuscht. Aber auch, eben gerade auch, ein Mensch. Essen. Fleisch. Egal welches. Egal was. Ist ein Opfer ausgemacht schleicht es sich an. Ganz langsam. Ganz leise. Unbemerkt. Geduckt schwebt es über den Boden, nutzt dabei jede Deckung. Bis es ganz nahe ist. Ganz, ganz nahe. Dann springt es vor und reißt seine Beute. Das Opfer hat keine Möglichkeit zu entkommen. Jetzt nicht mehr. Zu spät. Es beißt in die Kehle und hält fest. Tödlich fest. Es wartet bis das letzte Todeszucken erloschen ist. Dann kann es beginnen seinen Hunger zu stillen. Seinen unendlichen Hunger, der jede Nacht aufs Neue wieder kommt. Mit den ersten Sonnenstrahlen kehrt es zurück an seinen angestammten Platz. Zu den Menschen. Zu uns. Dort lebt es sein Leben weiter. Es ist kein Luchs mehr. Es ist wieder Mensch. Was in der Nacht war hat es vergessen. Es scheint nie passiert. Verlorene Erinnerung.
Es gibt einen Namen für dieses Wesen, das halb Mensch, halb Luchs ist. Es heißt Luguanodon.
Kapitel 1
„Abend Flo. Das Übliche?“
Flo, ein alter, schwächlicher Mann mit glattem, weißem Haar und Vollbart schaute verschlafen auf. Er hatte sich gerade an den Tresen seiner Stammkneipe gesetzt, wie er es an beinahe jedem Tag seines derzeitigen Lebens zu tuen pflegte.
„Oh, ja sicher. Das Übliche.“, brabbelte er.
„Bitte sehr.“
Der Kneipenwirt, ein Mann in jungen Jahren stellte Flo ein gefülltes Bierglas hin.
„Danke.“, brummte Flo.
Er nahm das Glas entgegen und setzte es vor sich ab. Der Wirt ging sich derweil um die restliche Kundschaft kümmern. Es war ein ruhiger Tag ohne Stress oder guten Besuch. Nach ein paar Minuten waren alle versorgt und er kehrte an die Schenke zurück vor der Flo saß. Der hielt seinen Kopf gesenkt und betrachtete sein volles Bierglas. Er hatte nicht einen Schluck genommen. Sein Blick war leer, sein Gesicht ausdruckslos, seine braunen Augen müde.
„Alles in Ordnung mit dir?“, fragte der junge Mann. „Du siehst niedergeschlagen aus. Irgendwie müde.“
Flo seufzte. Dann fragte er:
„Edi. Wie lange kennen wir uns schon?“
Edi dachte kurz nach, dann antwortete er: „Fast drei Jahre. Da hab ich hier angefangen.“
„Ja, ja richtig. Ich erinnere mich. Auch schon so lange. Wie doch die Zeit vergeht.“
„Besonders wenn fast jeden Tag in der Kneipe verbirgt, was?“, schnurrte Flo lächelnd.
„Weißt du warum ich immer hier bin? Fast jeden Tag?“
„Ehm. Weil ich gutes Bier habe.“, sagte Edi mit einem Schmunzeln auf dem Gesicht.
Flo lächelte nicht.
„Ich wohne schon seit lange Zeit in diesem Dorf.“, erklärte er verschnupft. „Länger als du auf der Welt bist. Ich bin ein alter Mann. Meine Freunde sind tot und in nicht allzu ferner Zeit werd auch ich tot sein.“
„Das tut mir Leid.“, bekannte Edi.
„Muss es nicht. Es ist der Lauf der Zeit. Du denkst vielleicht ich bin hier weil ich Gesellschaft suche. Weil ich in meinen alten Jahren nicht allein sein will. Vielleicht hast du nicht ganz Unrecht. Aber nein, aber nein das stimmt nicht ganz. Der eigentliche Grund warum ich immer hier bin ist, dass ich dir etwas erzählen muss. Ich komme jeden Tag mit dem Gedanken hierher irgendwem eine Geschichte zu erzählen. Nur hab ich mich nie getraut.“
„Nicht getraut?“, fragte Edi verwirrt.
„Es ist nicht einfach eine Geschichte. Es ist meine Geschichte. Mein Leben. Nicht sehr spektakulär. Nur eine Sache…“ Er stockte. „Weißt du da ist eine Sache...“ Er schluckte schwer. „Diese Sache, die ich nicht vergessen kann.“
„Was meinst du?“
„Da war ein Erlebnis, das mich nie losgelassen hat. Und jetzt am Ende meines Lebens muss ich es loswerden um mir klar zu werden, dass ich es nicht nur geträumt habe. Weißt du wie ich meine?“
Edi wusste nicht, wie Flo meinte.
„Erzähl.“, sagte er auffordernd.
Flo atmete tief ein und aus. Er nahm einen tiefen Schluck aus seinem Glas. Dann fing er zu erzählen an:
„Ich bin hier nicht geboren, weißt du. Ich bin hier hergezogen im April 1874. Davor war ich noch in Augsburg, hab in der Stadt gelebt. Ich arbeitete dort als Gerichtsmediziner. War nicht gerade der Beruf meiner Träume, aber nach meinem Studium war ich mehr als froh über diese Anstellung. Immerhin hatte ich erträgliche Arbeitsbedingungen bei durchschnittlicher Bezahlung. Wenn ich mich an die Verhältnisse in den Fabriken der Stadt zurück erinnere, in denen ich kurzzeitig arbeiten musste, war es geradezu der Himmel auf Erden.“
Flo schwallte vor sich hin.
„Ich bin durch mein Studium das erste Mal nach Augsburg gekommen. Ich hab Medizin studiert. Das war es, was immer mein Traum gewesen war. Mich als Doktor um die Lebenden zu kümmern nicht um die Toten. Tja, das Leben spielt seine eigene Musik und vieles kommt nicht so wie man es sich erhofft.“, brabbelte er in Gedanken versunken.
Dann hatte er offenbar bemerkt, dass er wirr sprach, stoppte kurz, kratzte sich am Kopf und fuhr fort:
„Aber der Reihe nach: Ich entstammte einer mittelständischen Familie. Mein Vater war Schmied. Er verdiente seine Kröten damit Pferde zu beschlagen oder Werkzeuge wie Messer, Sensen und Pflugeisen herzustellen. Er war ein beliebter Schmied. Das muss ich sagen. Er redete und flachste viel, weshalb ein jeder gern zu ihm ging. Er verstand es seine eigene Einstellung so an seine Kunden anzupassen, dass sowohl Kaufmann als auch Bauersmann Gefallen an ihm fand. Wenn der Bauer zu ihm kam schimpfte er darüber, dass die Pacht für Land unverschämt hoch sei der Zeiten und den Großgrundbesitzer lobte er für seinen uneigennützigen Pachtpreis und grummelte warum sich die Bauern denn immer beschweren mussten. Kurz: Er wusste, wie sich ein redlicher Geschäftsmann zu verhalten hatte. Ja so war er.“, plapperte Flo und schüttelte den Kopf, ein leichtes Schmunzeln im Gesicht. „Selbst vor der besseren Gesellschaft machte seine Umgänglichkeit nicht halt. Er traf sich mit Adeligen und Großunternehmern. Sie setzten sich in Gasthäusern zusammen, wo er versuchte sich mit ihnen über politische und wirtschaftliche Themen zu unterhalten. Er hatte keine Ahnung, was er von sich gab, aber genau das, sein Unwissen fanden viele amüsant und daher wurde er unter der feinen Gesellschaft schnell bekannt. Das verhalf ihm zu Verträgen mit einem wohlhabenden Postkutschenunternehmen, wodurch er so viel Geld verdiente, dass er sich fortan immerhin zum oberen Stand der Arbeitsklasse zählen konnte. Er erstand ein Haus aus steinernem Fundament, das an Größe und Ausstattung die Häuser der meisten anderen Schmieden übertraf. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Ich hab meine ganze Kindheit darin verbracht. Gott ist das lange her.“
Und es folgte ein zweites Kopfschütteln.
„Trotz alledem: Das Geld reichte gerade so um mich zum Studieren zu schicken. Der Fortbestand des Unternehmens war bereits durch meinen älteren Bruder gesichert und da es mein Wunsch war Arzt zu werden und ich die Schule mit besten Noten durchlaufen hatte, beschloss man mir diesen Wunsch trotz der hohen Kosten zu ermöglichen. Man ging davon aus, dass sich die Investition lohnen würde. Ich schrieb mich also in Augsburg als Medizinstudent ein und mein Vater leistete die erste Anzahlung. Fortan war ich damit beschäftigt, mir eine Wohnung zu suchen, was bei Leibe leichter gesagt als getan war. Ich schlenderte tagelang durch Gassen, Gasthäuser, Marktplätze und fragte Tausende nach einer Unterkunft. Ohne Erfolg. Die Wohnlage war verdammt schwierig, um nicht eigentlich unmöglich zu sagen und meine finanziellen Mittel trugen auch nicht zur Entspannung der Lage bei. Sicher, die meisten Studenten stammten aus wohlhabenden Familien. Aus Besitzerfamilien und Adelshäusern. Sie waren in der Lage sich eine ordentliche Unterkunft zu sichern. Wie bereits erwähnt war ich keiner dieser Sorte und so war es einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass ich doch noch eine Bleibe fand, in der ich mit meinem baldigen Freund Anthony Nicks zusammen lebte.“
Jetzt nahm er einen tiefen Schluck aus seinem Bierglas.
„Ich muss zugeben als ich Anthony das erste Mal begegnete hatte ich schon etwas Angst vor ihm. Ich war mal wieder in einem Gasthaus und fragte einen bärtigen, gut beleibten Wirt nach einer Schlafgelegenheit für die nächsten paar Jahre. Er machte mir natürlich, wie alle es machten, umgehend klar, dass er seine Pritschen lieber tageweise vermieten wollte und dass es ihm missfiele, wenn so ein Zitat: „Schwächling wie ich.“ in seinem Haus herumschwirre. Es gehe oft hoch her und er wolle nicht schuld sein, falls mir der Schädel ein geschlagen werde.
Ich hab die Gaststube verlassen und schleppte mich niedergeschlagen weiter, irgendeinen Weg entlang. Ich dachte schon daran alles hinzuwerfen. Ich wollte nach Hause gehen und meinem Vater sagen, dass alles eine dumme Idee gewesen wäre, dass ich doch lieber Handwerker sein wollte, dass ich mich getäuscht hatte, als plötzlich:
„Du wills Medizin studieren?“
Ich erschrak. Eine tiefe, leicht röchelnde Stimme hatte mich aus meinen Gedanken gerissen. Jemand stand hinter mir. Ich drehte mich zu ihm um und da stand er: Anthony. Er war ein etwa vierzig Jahre alter Mann mit mächtig breiten Schultern. Sein haarloser Kopf war umgeben von rundlichen, dicken Backen, die wiederum mit einem kurzen Stoppelbart besetzt waren. Seine Statur war unheimlich bullig. Wahrscheinlich besaß er dreimal so viel Muskelmasse wie ich. Dazu hatte er einen kleinen Bierbauch. Man müsste sagen er sah aus als wäre er ein Räuber, der sich aus irgendeinem Grund auf freier Straße befand und nicht im Gefängnis.
„J,ja.“, stotterte ich unsicher.
„Wenn du das fertig machs, dann bist du´n Doktor, oder?“
Er hatte etwas Furcht erregendes an sich. Sein Gesicht war mir zugewandt, aber seine blauen Augen schienen ins Nichts zu starren. Es war als wäre ich gar nicht da und als ob er mit dem leeren Raum sprechen würde.
„Äh ja, richtig.“, antwortete ich verängstigt und ich glaub ich habe schon ein wenig gezittert.
„Ich hab mal ne Doktor geseh´n. Da war immer so´n Gehilfe bei ihm, der´m immer das Werkzeug gereicht hat, n´paar Verbände angelegt hat und so. Kriegst du dann auch so´n Gehilfe?“
Ich war irritiert. Auf die Frage wusste ich keine wirkliche Antwort.
„Ich denke schon, ja.“, sagte ich ohne mir sicher zu sein.
„Kannst du dir den selber aussuchen?“, bellte er heiser und ich stotterte:
„I..I..I.ch weiß nicht?“
Sein Blick wurde jetzt noch starrer, wie er eh schon war. Sein schmaler Mund stand offen, sodass man seine häufigen Zahnlücken erkennen konnte. Die Zähne, die ihm noch nicht ausgefallen waren waren gelb oder braun. Er schien nachzudenken.
Nach einer Weile fragte er: „Wieso weiß du das nicht?“
„Ich weiß es einfach nicht.“, antwortete ich fast unhörbar, weil mir die Worte im Hals stecken geblieben waren.
Anthony starrte mich immer noch desorientiert an. Eine Zeit lang standen wir einander stumm gegenüber und wussten wohl beide nicht, was wir jetzt sagen sollten. Dann durchbrach Anthony das Schweigen:
„Wenn du wills kannst du bei mir wohnen.“
Das wirkte. Ich war vollkommen überrumpelt. Eigentlich wollte ich mit diesem Kerl nicht unter einem Dach wohnen, aber er hatte mir soeben eine Möglichkeit eröffnet meinen Traum zu erfüllen. Und ich war mir eigentlich sicher, dass es die Einzige bleiben würde. Nun musste ich entscheiden, wollte ich studieren oder nach Hause gehen. Viel Zeit zum Nachdenken hatte ich nicht und ohne es recht abwägen zu können sagte ich schlicht:
„Gut.“, und damit entschied ich mich für meinen Traum und auch für Anthony, auch wenn mir bei dem Gedanke ihn ständig in meiner Nähe zu haben ganz und gar nicht wohl war.
Wir beschlossen zu seiner Wohnung zu gehen. Wir liefen stumm nebeneinander. Ich beobachtete ihn schüchtern aus dem Augenwinkel. Auf seiner Glatze saß eine dunkelbraune Ballonmütze. Dazu trug er einfache Kleidung: eine blaue Hosen und ein weißes, aber sehr schmutziges Hemd, das nicht ganz zugeknüpft war. Insgesamt war seine Kleidung recht schmutzig. Seine Schuhe waren aus Holz und klackten beim Gehen.
Anthony war schon allein durch sein Äußeres ein Mann, der aus der Menge herausstach. Noch auffälliger, aber, war seine Gangart. Sie passte überhaupt nicht zu so einem starken Mann. Er schlurfte mehr am Boden entlang, als dass er ging. Leicht gekrümmt, den Blick starr auf den Boden gerichtet schleppte er sich übers Pflaster. Dabei wackelte sein ganzer Oberkörper im selben Takt wie er die Schritte setzte. Es verschlimmerte meine Furcht vor ihm und je länger ich neben ihm herlief, desto mehr bereute ich meine Entscheidung ihm so ohne weiteres zugesagt zu haben, aber das sollte sich bald legen.
Nachdem wir ein ganzes Stück mit beklommenem Schweigen gegangen waren fing Anthony irgendwann an von sich zu erzählen. Er war Bauarbeiter. Er arbeitete für gewöhnlich sechs Tage die Woche mit zwölf bis dreizehn, ja manchmal vierzehn, Stunden am Tag. Dabei musste er sehr harte Arbeit verrichten und oft und viel schleppen oder tragen. Das erklärte warum er so ungewöhnlich ging. Alles Folgen seiner überharten Arbeit. Er lebte ein gefährliches Leben. Jedes Jahr kamen Arbeiter auf Baustellen zu Tode, weil sie von herabfallenden Gegenständen erschlagen wurden oder weil sie, oft war Alkohol im Spiel, vom Gerüst fielen und Ähnliches. Auch Anthony hatte eine Vorliebe für gutes Bier und Gasthäuser und er kannte die meisten Kneipen der Stadt, die er, nicht gerade selten, besuchte.
An seinen Schuhen lag ihm sehr viel. Er erzählte mir, dass es sich dabei um die einzigen Erinnerungsstücke aus seiner Heimat handelte, die er vor langer Zeit aus Irland mitgebracht hatte. Er hatte sogar seinen Namen und seine Adresse eingravieren lassen falls sie mal verloren gingen. Obwohl es sehr zweifelhaft war, dass man sie ihm dann auch tatsächlich bringen würde und noch viel zweifelhafter, dass er sie jemals verlieren könnte, aber gut. Er war vor gut zehn Jahren nach Deutschland gekommen. Damals, 1849, herrschte Hungersnot in Irland und um dem Hungertod zu entfliehen schlich er sich aufs nächstbeste Schiff, dass Galway, das ist ne Hafenstadt in Irland, verließ. Als blinder Passagier kam er dann durch Zufall in Hamburg an. Dort begann er als Bauhelfer zu arbeiten. Es war die am besten bezahlte Arbeit für einen Mann der noch nicht mal die deutsche Sprache beherrscht, aber wie ich schon sagte man macht sie nicht lange. Die körperliche Erschöpfung ist zu groß. Irgendwann hatte man ihm gesagt, im Süden gebe es bessere Arbeit, also war er nach Augsburg gekommen, oder besser gewandert, um dort sein Glück zu versuchen, was aber auch keine wirkliche Verbesserung mit sich brachte. Nun dass alles erzählte er mir auf dem Weg zu seiner Wohnung. Ich kann mich nicht erinnern ihn je mehr reden gehört zu haben. Er bemühte sich redlich mir die Furcht zu nehmen. Das konnte ich ihm anmerken.
Als wir an seiner Wohnung ankamen, kannte ich also beinahe seine ganze Lebensgeschichte, während er von mir rein gar nichts wusste. Er lebte im Dachgeschoss einer Mietskaserne. Man musste Treppen hochlaufen um zur Wohnung zu gelangen. Ich fragte ihn, ob es nicht eine andere Wohnung gäbe, die seinen Rücken weniger belasten würde, aber darauf meinte er nur, dass er andernfalls in eine Kellerwohnung ziehen müsste. Die seinen verschimmelt und nass. So hätte er immerhin frische Luft. Er öffnete seine Wohnungstür und zeigte mir sein enges, kleines Heim. Die Einrichtung war schlicht. Zwei kleine Fenster, die den hölzernen, düsteren Raum zumindest etwas erhellten, dazu ein Bett, ein vollgepacktes Wandregal und ein kleiner Holztisch mit Stuhl. Das war sämtliches Mobiliar. Ein Kerzenständer stand auf dem Tisch, mit dem man die Nacht erhellen konnte und den ich in meiner Studienzeit beinahe durchgehend in Betrieb nahm. Das Regal an der Wand war größtenteils mit Essensvorräten gefüllt, daneben waren auch ein paar Gläsern, Tellern und Besteck hineingestellt. In einer Ecke des Raums gab es noch eine größere Schüssel voll Wasser, die man mit Kübeln vom Brunnen nachfüllen musste und eine kleinere, leere Schüssel. Die große sorgte fürs Trinkwasser, die Kleine benutzte man, wenn man sich oder Essen wusch, weil es ja nicht allzu oft vorkam. Zu guter Letzt waren ein paar Haken in die Wand geschlagen. Sie waren behängt mit einem Haufen, oft verschlissener, Kleidung. Diese war faltig und größtenteils schmutzig. Das war Alles. Alles was Anthony besaß, abgesehen von seinem selbstgeschnitzten Gehstock vielleicht, den er aber sehr selten benutzte.
„Hab leider kein zweites Bett.“, sagte er bedröppelt.
„Das ist kein Problem.“, versicherte ich. „Da kann ich mir eins besorgen. Wie viel muss ich denn als Miete bezahlen?“
Das war bisher noch überhaupt nicht angesprochen worden, was mich sehr verwunderlich gestimmt hatte und mich schon den ganzen Weg hierher begleitet hatte. Wieso lud mich dieser Mann so offenherzig in seine Wohnung ein, ohne auch nur ein Wort über Bezahlung zu verlieren? Jetzt in seiner Wohnung musste ich endlich nachfragen. Anthony reagierte zurückhaltend. Er zierte sich, kratzte sich am Kopf. Dann sagte er verschlossen, fast schon ängstlich:
„Weißt du ich dacht ich könnt später mal dein Gehilfe werd´n. Der die Verbände anlegt und so. Bin nicht mehr der Jüngste, weißt de. Dafür kannste bei mir umsonst leben.“
Jetzt wurde mir einiges klar. Die Rückenschmerzen, das schwere Schnaufen von Anthony wenn er mehr als ein paar Meter ging, seine müden, ausgelaugten Augen. Er war an einem Punkt angelangt, an dem er realisierte, dass er keine Möglichkeit hatte noch lange arbeiten, noch lange Geld zu verdienen. Er musste schnell an einfachere Arbeit kommen. Sonst würde er bald als Bettler auf der Straße leben und von da an ist der Tod nicht allzu weit.
Nach kurzem Überlegen gab ich ein schlichtes: „Also gut, abgemacht.“ von mir.
Es schien mir ein Abkommen zu beiderseitigem Vorteil zu sein. Ich hatte eine Wohnung und Anthony eine Arbeit, die sein Rücken schont. Dass ich nicht wusste, ob ich überhaupt eine Stelle als Arzt bekommen würde und auch nicht wusste, ob ich dann einen Assistenten zugeteilt bekommen würde, geschweige denn ob die Möglichkeit bestand diesen auszusuchen verschwieg ich und Anthony fragte auch nicht weiter danach. Er wollte lieber mit der Illusion leben eines Tages aus seinem elendigen Leben herauskommen, als genauer informiert zu sein oder, aber er war kein Mann, der sich viele Gedanken machte. Wohl von beidem ein Bisschen. Wie auch immer.
Kapitel 2
Das Studium konnte beginnen. Ich besuchte die Vorlesungen, machte meine Notizen und lernte oft stundenlang in Anthonys Wohnung. Manchmal büffelte ich bis tief in die Nacht hinein. Ich lag auf meiner Matte im Kerzenlicht und las in meinen Unterlagen. Anthony schaute mir auf seinem Schlafplatz liegend zu. Meist kam er erst kurz vor oder bereits nach Sonnenuntergang heim, aber wenn ich ihn fragte, ob ich die Kerze ausmachen sollte damit er schlafen kann meinte er immer: „Schau das de´n gutes Studium machst. Schau das de´n gutes Studium machst.“
Wie oft hat er mir das gesagt? Sechs Mal die Woche. Mindestens. Ja, ja, so war er. Wo war ich stehen geblieben?“, fragte Flo, der sich in seinem Gemurmel verloren hatte.
„Beim Studium.“, erinnerte Edi.
„Ach, ja genau. Jedenfalls, bei all seiner Schufterei reichte sein Geld gerade mal für die Miete und sein Essen, obgleich man sagen muss, dass Alkohol einen nicht unerheblichen Teil davon ausmachte. Mein Essen musste ich selbst bezahlen, aber das konnte ich jetzt ja, da ich mir die Miete sparte. Wir verstanden uns immer besser und wurden zu echten Freunden. Ich würde sagen Anthony war einer meiner besten Freunde. Im Winter war es so kalt in der Wohnung, dass wir uns zusammen in ein Bett kauerten um uns gegenseitig zu wärmen. Das schweißt zusammen. Im Sommer war es dagegen so heiß, dass wir uns häufig auf den harten, dafür kühlen Holzboden legten um nicht zu vergehen, aber das war nicht weiter schlimm. Den Umständen entsprechend lief alles perfekt. Ich wollte und konnte lernen und das Studium machte mir Spaß. Am Interessantesten war es, wenn unser Dozent eine Leiche sezierte. Man sah den komplexen Aufbau eines Menschen bestehend aus all seinen Facetten. Die Organen, Geweben und Knochen. Das war extrem faszinierend. Wie alles perfekt zusammenpasst damit wir am Leben erhalten werden. Ich weiß viele Menschen fürchten sich davor oder es widert sie an, aber ich konnte gar nie genug davon bekommen. Ich wollte immer mehr Menschen von Innen sehen.
Trotzdem war mein Studium nicht immer schön. Ich war nicht gerade beliebt bei meinen Mitstudenten. Sie kamen alle aus höheren Familien und betrachteten mich als störenden Emporkömmling, der ihnen den Studienplatz streitig macht. Sie waren der Meinung, dass ich wegen meiner niederen Stellung kein Recht dazu hätte. Als klar wurden, dass meine Noten gut waren, zog ich allmählich den Hass all derjenigen auf mich, die kurz davor waren abbrechen zu müssen. Auch die hatten Druck von ihren Eltern. Wenn der Sohn aus angesehenem Hause scheitert, schadet das dem Ansehen der gesamten Familie. Ihm wird klar gemacht, dass das Nichtbestehen nicht geduldet wird. Dabei gehören Prügeleinheiten zum Handwerkszeug. Die gepeinigten Kinder suchen sich dann einen Sündenbock für ihre missliche Lage: Mich.
Einmal als ich spät am Abend auf dem Heimweg war, die Straßen waren bereits fast menschenleer, wurde mir von einer Gruppe Studenten aufgelauert. Sie umstellten und verprügelten mich. Nachdem sie mir meine blutige Nase und Lippe geschlagen hatten, warfen sie mich in irgendeine Gasse. Damals waren Straßen noch viel dreckiger als heute. Überall lag und hing der Geruch von Fäulnis und Scheiße. Da lag ich dann im größten Dreck, hatte Schmerzen am ganzen Körper und der ekeligen Gestank von Kot und Urin hing in meiner Nase. Meine Bücher waren ebenfalls total verdreckt und teilweise unbrauchbar geworden. Ich schlich nach Hause und öffnete die Tür. Anthony saß auf dem Stuhl und sah mich wie ich auf der Türschwelle stand, Hemd und Hose durchnässt und dreckig mein Gesicht benetzt von Tränen und Blut. Er richtete sich stöhnend auf. Er stöhnte immer wenn er sich von einer Sitzgelegenheit erhob.
„Wer war das?“, fragte er mich bestürzt.
Ich erzählte ihm was vorgefallen war. Er hörte aufmerksam zu. Als ich fertig war sagte er:
„Komm mit!“, und ging die Treppe hinunter, aus der Tür in die dunkle Stadt hinaus.
Ich folgte ihm durch die jetzt stockdunklen Gassen.
Er schien sein Ziel genau zu kennen, denn er lief zügig und brauchte sich nicht umzuschauen. Wir waren eine ganze Weile unterwegs. Dann stoppte er plötzlich. Wir standen vor einem kleinen Fluss.
„Zieh dich aus und wasch dich.“, sagte er auffordernd.
Ich tat wie geheißen und begann mich meiner Kleidung zu entledigen. Ich warf sie auf den Boden. Anthony hob sie wieder auf und fing an sie zu waschen. Wir standen nebeneinander, sprachen kein Wort. Er schrubbte meine Kleidung und ich mich selbst.
Nach einer Weile sagte er:
„Bin fertig. Morgen kannst es wieder anziehen. Wird wahrscheinlich noch´n bisschen nass sein.“
„Danke“, sagte ich.
„Schon gut.“, antwortete er kurz.
Dann gingen wir wieder heim. Er vor mir weg. Ich meine Kleider im Arm und frierend hinter ihm her. Ich war froh, dass er da war. Ich fühlte mich wieder frei. Für einen kurzen Moment vergaß ich was passiert war.
Wir waren wieder stumm geworden. Anthony war insgesamt ein sehr schweigsamer Mann. Die Zeit, die ich ihn kannte redeten wir eher wenig miteinander. Die längste Unterhaltung, die wir je geführt hatten war, als ich ihn das erste Mal zu seiner Wohnung begleitete.
Daheim angekommen gingen wir schlafen. Ich hüllte mich in meine dünne Decke und versuchte einzuschlafen. Die Kälte hinderte mich daran. Ich wälzte mich nur unruhig und zitterte ein wenig. Ich beobachte Anthony. Auch er schlief unruhig. Er drehte sich ständig hin und her. Dabei atmete er schwer und stöhnte ab und an. Ich glaube, es tat ihm kaum weniger weh, was mir zugestoßen war.
Die nächsten Tage an der Uni verliefen wieder deutlich ruhiger. Die Aktion hatte die Wut meiner Peiniger offenbar für ein paar Tage gedämpft. Aber eben nicht für immer. Vier Wochen später geschah das Selbe wieder. Es war spät am Tag. Ich war auf dem Heimweg, fast da, konnte das Fenster unseres kleinen Dachzimmers schon sehen. Ich bog in eine kleine Seitenstraße ein, in der ich schon von einer fünf-köpfigen Meute erwartet wurde. Ein paar Mitstudenten und deren Freunde. Ich wollte sofort umkehren und verschwinden, doch es war zu spät. Die Meute hatte sich schon rund um mich versammelt. Sie umzingelten mich und zerrten mich in eine der verdreckten Gassen. Dort begannen sie auf mich einzuprügeln. Ich kassierte einen schmerzhaften Schlag auf das Jochbein. Dann einen weiteren in die Magengrube, der mich auf die Knie sinken ließ. Ich spannte meine Bauchmuskeln an, atmete angestrengt aus, hob den Kopf an und ließ ihn schweifen. Ich suchte verzweifelt nach einer Lücke in ihrem Kreis. Eine schwache Stelle, die ich durchstoßen konnte um zu verschwinden. Während mein Blick so im Kreis wanderte, erblickte ich eine bullige Gestalt, die die Gasse empor gerannt kam. Ihr Kopf war hochrot und sie hatte etwas in der Hand.
„Bam!“
Ich hatte einen weiteren Stoß in die Rippen bekommen. Ich beugte mich vornüber um leichter durchzuatmen. Als ich mich wieder aufrichten konnte, sah ich die Gestalt direkt neben mir. Es war Anthony. Er hatte einen der Schläger gepackt. Mit der einer Hand hielt er ihn fest, mit der anderen gab er ihm einen Haken mit einer kleinen Holzkeule. Dann ließ er den armen Kerl auf den Boden fallen und er landete mit dem Gesicht voraus im Dreck. Ich schaute mich um. Die anderen standen ruhig da. Sie waren stumm vor Schreck. Mit offenen Mündern starrten sie einander an, unfähig auch nur einen klaren Gedanken zu fassen. Als Anthony anfing den Zweiten zu vermöbeln, kam sehr schnell Bewegung in die Meute. Von Panik gepackt stoben sie wild auseinander und hetzten die Gasse entlang.
„Ihr versifften Bastarde! Geht mir aus´n Augen ihr verwöhnten Ratten!“, brüllte Anthony in seiner gewohnten, für jene die ihn nicht kannten angsteinflößenden, Röchelstimme hinter ihnen her.