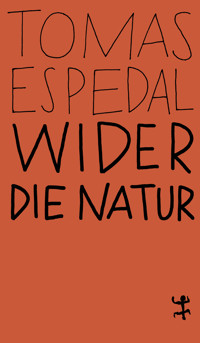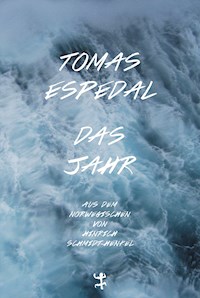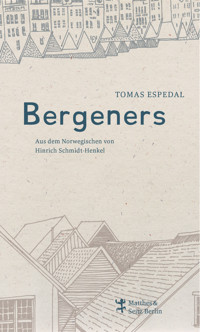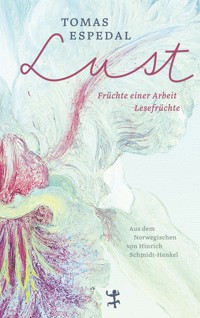
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Wie wird man ein Schriftsteller? Ist es möglich, das Schreiben zum Beruf zu machen? Kann man davon leben? Und was für ein Leben wird das sein? In seinem jüngsten Buch Lust verbindet Tomas Espedal Autobiografie und Bildungsroman und geht dieser Frage nach vierzig Jahren des Schreiben nach. Dabei verwebt er Leben und Literatur auf bezwingende Weise miteinander. Der Doppeldeutigkeit des Titels wird er dabei auf mehr als eine Weise gerecht: Lust ist ein Roman über das Lesen und das Schreiben. Über das Vergessen und das Erinnern. Über Reisen und Liebesaffären. Über die Bedeutung des Ortes für das Schreiben. Über Städte. Über Kopenhagen und das Leben der Schriftsteller. Über die Suche nach den idealen Schreiborten und Arbeitszeiten. Über das Schreiben in der Nacht. Über das Schreiben mit der Hand. Über Freundschaften. Und nicht zuletzt über Geld und gute und schlechte Wirtschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TOMAS ESPEDAL
LUST
Früchte einer ArbeitLesefrüchte
Aus dem
Norwegischen
von Hinrich
Schmidt-Henkel
Matthes & Seitz Berlin
Inhalt
Früchte einer Arbeit
I
II
III
Lesefrüchte
I
II
III
Früchte einer Arbeit
Entsinne ich mich recht, so war
mein Leben einstmals ein Gelage, da
öffneten sich alle Herzen, da
flossen alle Weine.
ARTHUR RIMBAUD
I
Wir sterben mehrmals im Laufe eines Lebens. Bereits indem wir geboren werden, im Augenblick der Geburt selbst, tritt der Tod in unser Leben ein: zunächst ein kleiner Tod, nicht größer als ein Säugling, ein kleiner, schöner Tod, der parallel mit dem Kind wachsen und ein größerer Tod werden wird, ein wachsender Schatten, eine wachsende Frucht, sie wächst und reift in uns und nimmt die umgekehrte Form des Lebens an, die Form eines Abszesses, fast eines Eigelbs, wir wissen ja nicht genau, wie der Tod, den wir in uns tragen, aussieht, doch mehrmals im Laufe eines Lebens wird er berührt werden und in uns zum Leben kommen als etwas Fruchtbares und Lebendiges, zum ersten Mal bereits dann, wenn wir das Licht des Tages erblicken, und zum zweiten Mal, vielleicht, wenn wir unserer Mutter aus den Händen genommen und dem Vater übergeben werden.
Es gibt einen inneren Tod und einen äußeren Tod, sie führen ihr Leben parallel zueinander, ohne dass wir von den beiden Leben Kenntnis hätten, die einander berühren und uns begleiten, solange wir leben, erst in einem gewissen Alter, sagen wir mit rund siebenundfünfzig, an einem Tag wie diesem, wenn wir aufwachen und es müde sind aufzuwachen, an so einem Tag, der gern ein schöner Tag sein kann, ja, ein Junitag, an dem es sich anfühlt, als beginne das Leben erneut, wieder einmal mit Wärme und dem Salzgeruch, der vom Meer herantreibt, und dem milden Sommerwind, der den in Blüte stehenden Wald mitbringt, ja, genau an so einem Tag entdeckst du, wie das äußere und das innere Leben zusammenfallen, der äußere und der innere Tod, in einem Wunsch zu sterben.
Du hast das Leben, das dir zugedacht war, gelebt, so gut du es konntest, und in diesem Wunsch nach einem Ende wird ein Neuanfang geboren; du wirst dem Tod entgegengehen, als wäre er etwas Neues, eine neue Jahreszeit, eine neue Dunkelheit, das Gegenstück eines Sommers, den du noch nicht erlebt hast.
Wir werden im Winter geboren und sterben im Sommer, so sieht in meiner Familie der Kalender aus.
Ich kam an einem Sonntag zur Welt, am Sonntag, den zwölften November, neunzehnhunderteinundsechzig, im Haukeland-Krankenhaus in Bergen. Wir mögen uns zwar an die Geburt nicht erinnern, doch das Krankenhaus vergessen wir nie, es wohnt in uns als unser erstes Zuhause, ein Ort, an dem wir Wohlbehagen verspüren und zu dem wir gerne zurückkehren; die weißen Wände, das Bett mit seinen Metallbeschlägen, die sauberen Laken, die hellen Kittel der Krankenschwestern, die Linoleumböden und das Geräusch von fließendem Wasser, von Kindergeschrei und Kirchenglocken, all das führt sein heimliches und unvergessliches Leben in dem Kinderkörper, der erwachsen werden wird mit einer unheilbaren Sehnsucht nach Krankheit und Tod.
Das Kind wurde geboren. Es war nicht leicht. Es brauchte dazu einen Vater und eine Mutter und deren Eltern und wiederum deren Eltern, eine lange Reihe von Gesichtern, die niemand mehr vor sich sehen konnte, die aber doch in Form einer Nase oder eines verschleierten, trägen Ausdrucks in den Augen wieder aufgetaucht sind, in einem Gesichtsausdruck, der als etwas Fremdes und zugleich Wiedererkennbares in dem Kind herangewachsen ist, etwas Abwesendes, Misstrauen, in der Haut zusammengefaltet über dem, das er war; ein Gesicht, das mit der Zeit verändert wurde, langsam, in einem Spiegelbild, das nicht er sein konnte, das aber doch das Gesicht war, das er tragen musste.
Es war keine leichte Geburt. Dem Kind ging es gut im Dunkeln. Er schlief und wachte mit dem Herzschlag der Mutter, diesem regelmäßigen, rhythmischen Pochen, das später dafür sorgen sollte, dass er sich auf Schiffsreisen und langen Zugfahrten so sicher fühlte: so weit weg von der Mutter wie möglich. Das Kind wollte sich im Bauch der Mutter nicht drehen, es schlief, den Kopf nach oben, näher zum Herzen und dem sicheren, pulsierenden Laut des Lebens; er wollte den Kopf in diesem wohligen Innenraum nicht nach unten drehen, er mochte keine Veränderungen. Widerwillig wurde er gedreht. Von unsichtbaren Händen. Sie pressten seinen Kopf zwangsweise nach unten, er saß im Unterleib der Mutter fest. Er wollte schreien, aber er hatte den Mund voller Wasser. Er strampelte und schlug um sich, er kämpfte, aussichtslos, die Schläge und Tritte wirkten gegen seine Absicht, jetzt waren stärkere Kräfte am Werk, die ihn nach unten drückten. Musste er abwärts? Er wollte hinauf, wurde hinuntergezwungen. Etwas öffnete sich. Er ahnte Licht. So war es also zu sterben. Er wurde widerwillig ans Licht gezerrt. Erst war da nur ein dünner weißer Streifen, der sich verbreitete und zu einem schmalen Kreis von blendendem Licht wurde, der ihn vollständig verschluckte, und jetzt konnte er endlich schreien.
Man zieht den kleinen Körper aus der Mutter heraus, durchtrennt die Schnur, die ihn mit ihr verbindet, und trägt das Kind zu einem Tisch, wo es gewaschen wird. Das Kind wird getrocknet. Man hüllt es in Stoff. Erst wird ihm ein dünner Baumwollstoff um die Beine gewickelt und als strammes Futteral über die Leibesmitte, den Bauch, die Brust, bis das Kind zu einer Puppe gemacht ist. Dann ein dicker Stoff über die Baumwollschicht, eine viereckige Decke wird um den Körper gewickelt, bis er unbeweglich ist. In dieser Zwangsjacke bist du Kind.
Kind unter Kindern in einem Schlafsaal, so verlassen und schön. Tageslicht und Neonlicht. Licht von Lampen und Gesichtern. Die weißen Schwestern kommen und gehen. Manchmal wirst du weggerollt und einer Mutter an die Brust gelegt. Wer ist sie? Ein Geruch. Weiche Haut, eine Brust. Die Mutterstimme. Die ersten Wörter, Klanggeräusche, hell und dunkel, gedämpft von Weinen, unterbrochen von Seufzen. Ist sie unglücklich? Auch die Vaterstimme ist zu hören. Du hörst, dass ein Name genannt wird, mehrere Namen, man versucht sich mit Namen, und einer dieser Namen wird deiner sein.
Du kannst dich noch nicht gegen diesen Namen wehren, den sie in ihrer Familie finden, die deine Familie ist. Du nimmst den Namen entgegen. Du antwortest darauf. Zunächst mit Geräuschen, Bewegungen, du drehst dich von den Namen weg. Aber der Name wird einem Kind angeheftet, so wie man Buchstaben in Säuglingskleidung stickt. Man wählt eine Farbe für das Kind und das Kind wird blau und man knüpft eine Sprache an die Farbe: man kleidet das Kind in Blau und das Kind verschwindet in Stoff und in Sprache, der Sprache, in der es heranwachsen soll.
Ein kolossales Kind. So klein, dass es für Mutter wie Vater zu groß wurde. Das Kind füllte ihre Leben mit Weinen und Bedürfnissen und einer Anwesenheit, sie wussten nicht, wie sich davon losreißen. Schlaflose Nächte, halbwache Tage mit dem Kind, das größer wurde und sie kleiner machte; sie redeten jetzt in einer Babysprache. Sie lallten und lullten, sie flüsterten und wisperten, sie gingen auf Zehenspitzen durch die Wohnung und gehorchten einer Stille, die das Kind schlafend halten sollte. Aber das Kind wollte nicht schlafen. Sogar im Schlaf war das Kind wach, so wirkte es; wann sollten die Eltern Ruhe finden, was sollte aus ihren Bewegungen werden, dem wenigen, das sie an Freiheit hatten, wie sollten sie sie selber sein, ein Paar, sie hatten keine Zeit mehr füreinander, keine Kraft und nicht Wachheit genug für anderes, als einander zu ermatten, sie waren Eltern geworden, sie waren Eltern eines Kindes, das zwischen sie geraten war, sie waren getrennt in einen Vater und eine Mutter.
Es war, als verschwinde die Mutter in diesem Kind, als wäre das Kind eine Katze, die an ihren Eltern zehrte, die Zuhause und Möbel, Stühle und Tische aufaß, das Kind wuchs heran und verschluckte eine ganze Welt, ihre Welt, es war kein Platz noch Zeit mehr für etwas anderes als das Kind: ein Kinderbett, Kinderkleider und Spiele, Kinderessen und ein neuer Geruch in den Zimmern, der Kindergeruch. Der Geruch von Unfreiheit. Von Schlaflosigkeit und Müdigkeit, der Geruch von Kindheit, er füllte die Wohnung.
Zum zweiten Mal starb das Kind in der großen Vierzimmerwohnung in der Vestre Torggate. Es war ein kalter, feuchter November, wurde erzählt, in einer kalten, zugigen Wohnung, die dafür sorgte, dass das Neugeborene eine beidseitige Lungenentzündung bekam, während zugleich bei der Mutter die Milch versiegte wegen des kalten Bodens, der kalten Zimmer, wegen des Luftzugs von Fenstern und Türen. Bei der Mutter versiegte die Milch, wurde erzählt, und das unterernährte Kind bekam eine Entzündung auf beiden Lungenflügeln, es war neugeboren und bereit zu sterben.
Sehr viel später wurde mir klar, dass meine Mutter das Kind nicht stillen wollte. Sie hegte eine große Furcht vor Kleingetier und allem, was auf allen vieren läuft. Sie hatte Angst vor Hunden und Katzen, vor Vögeln und Fliegen, vor allem, was durch die Luft flog. Allem, was am Boden kroch. Die Natur und das, was sich an der Natur nährte, das wuchs und die Lebenskraft aus seinem Ursprung sog, all das verursachte ihr Übelkeit. Sie verabscheute die Natur in derselben Weise, wie sie ihre eigene Unfreiheit hasste, und die Natur war frei, genauso wie die Natur dreckig war, wie eine Katze dreckig war, oder ein Hund, aber auch ein Säugling, diese Angst vor Kindern, diese Furcht vor der Natur und Kleingetier, wiederholte sich mit meiner Schwester, die auch nicht gestillt wurde, mit dem Ergebnis, dass wir beide, meine Schwester und ich, in unserer Kindheit die meiste Zeit über krank waren.
Und wir liebten unsere Mutter, so wie alle abgewiesenen Kinder ihre Mütter lieben.
Und die Mutter war eine gute Mutter, denn sie war eine schwierige Mutter, eine gute Mutter, denn sie war eine abwesende Mutter.
Denn was wäre aus dem Jungen geworden, wenn die Mutter nah gewesen wäre, wenn sich die Mutter den Jungen an die Brust gedrückt hätte, es hätte ihn zerstört, das ist sicher.
Was wäre aus dem Jungen geworden, wenn die Mutter zu Hause geblieben wäre, in der Nähe des Jungen, wenn sie ihre Arbeit gekündigt hätte, um zu Hause bei dem Kind zu sein, jeden einzelnen Tag, von Morgen bis Abend, Monate und Jahre lang, es hätte ihn zerstört.
Er hätte das tägliche Zusammensein mit einer missmutigen Mutter nicht ertragen. Einer Mutter, die er liebte, so wie alle Kinder ihre Mütter lieben, rückhaltlos, wie ein Tier, die ersten Monate und Jahre ihrer Lebenszeit, selbst wenn die Mutter unglücklich ist, und vielleicht besonders dann, ja, das Kind verliebt sich ins Unglück.
Aber der Junge hatte Glück. Er wurde weggegeben. Bereits drei Monate, nachdem das Kind geboren wurde und den Tod überlebte, der ihm als Geschenk mitgegeben worden war, den Tod, der das Kind stark und lebenshungrig machen sollte, wurde es der Mutter seines Vaters überlassen.
Frühmorgens jeden Tag nahm Elly Alice den Bus aus der Michael Krohns Gate in die Vestre Torggate, um das Kind zu hüten, während die Eltern arbeiteten und Geld für das neue Leben in einer Wohnung beschafften, die nach neuen Möbeln verlangte und nach all diesen Dingen, die eine Vierzimmerwohnung füllen müssen, die ein Leben füllen müssen, die eine Familie mit einem anspruchsvollen Kind am Leben halten müssen.
An jedem einzelnen Arbeitstag, sieben Jahre lang, kam die junge Großmutter, die ihre Arbeit in einem Blumenladen gekündigt hatte, in die Wohnung, um Kindermädchen für den kleinen Jungen zu spielen, der sich in sie verliebte.
Mutter und Vater verließen die Wohnung frühmorgens und gingen beide zu ihrer Arbeit: Sie als Sekretärin in einem Krankenhaus, er als Angestellter einer Textilfabrik, und jetzt hatten das Kind und die Großmutter die Wohnung und den Tag für sich. Ich erinnere mich an nichts aus den ersten Monaten, den ersten Jahren, auch nicht an die Wohnung; darum muss es eine Wohnstube gewesen sein. Eine große, kalte Wohnstube, sparsam möbliert mit einem Esstisch und Stühlen, einem Teppich und schweren Vorhängen. Man wollte die Kälte aussperren, und mit der Kälte verschwand auch das Licht; man machte Lampen an, man machte Öfen an, mit Paraffin und Erdöl befeuerte Öfen, die der frischen Luft die Luft nahmen, Öfen, die im Zwielicht der Wohnstube krankhaft vor sich hin rußten. Im Winter sperrte man zwei Zimmer ab, die Winterwohnung bestand aus Wohnstube und Küche, einem Bad und dem Schlafzimmer; es war nicht möglich, sich an etwas anderes zu erinnern als an die Kälte.
Die Kälte in den Zimmern, die Wärme der Großmutter. Sie kam morgens, übernahm das Kind und hüllte es in warme Kleidung, vielleicht steckte sie das Kind unter ihren Pelzmantel, an die warme Haut, und trug das Kind wie einen Auswuchs des Frauenleibes; sie waren unzertrennlich, sie und er.
Das Kind verliebte sich in die Großmutter, eine Liebe, die andauerte, bis sie starb, da war er neunzehn Jahre alt und besuchte sie jeden Mittwoch in der kleinen Wohnung in der Michael Krohns Gate, wo sie immer noch wohnte: Sie saß in der Küche in einem vergilbten weißen Nachthemd, einen dickeren Morgenmantel lose über dem Nachthemd; halb geöffnet, nicht zugeknöpft über der Haut, der faltigen, hellen, sommersprossigen. Ihre Locken waren silbergrau geworden und stumpf, sie hatte etwas Wildes an sich, eine altmodische Wildheit, fast wie Irresein, sie redete unvorsichtig und frei, rauchte eine Zigarette, trank etwas Kaffee und redete ununterbrochen in einem Strom von Vergangenheit und Gegenwart; sie war eine Erzählerin, und er hörte sie gern erzählen, er liebte die alte Frau, die erzählte, sie sagte: Aksel, Alfred, Eivind, nein Tomas (als müsste sie den Namen heraufbeschwören, nicht aus einem Gesicht, aus einer Nähe, sondern aus einer Abwesenheit, denen, die nicht hier waren und die sie jetzt jederzeit in einer einzigen Person hervorbringen konnte, die all die Männer repräsentierte, die sie geliebt hatte, vielleicht ähnelten wir einander auch, und es spielte im Grunde keine Rolle, welchen Namen sie uns gab; aus den Namen entstand eine Geschichte, ihre Geschichte, und es war eine Geschichte von der Liebe, die uns alle mit einschloss; ihren Bruder, ihren Mann, ihren Sohn und Enkel), heute bist du der Älteste und ich denke oft, du müsstest dich besser um deinen Vater kümmern. Er radelt auf einem Dreirad herum. Es kann jederzeit vom Kurs abkommen, einen Abhang runtersausen, eine unfreiwillige Kurve beschreiben und in einen Bus oder Lkw hineinfahren. Ich habe dir das Dreirad zum vierten Geburtstag geschenkt und du bist auf der Suche nach einer Tankstelle in der Stube herumgefahren. Die Wohnung in der Vestre Torggate hatte viele Zimmer und Straßen, es gab dort einen Tunnel und zwei Brücken, du rastest die Teppichstraße hinunter und bogst scharf rechts zur Küchenbrücke ab, und in der Küche gab es eine kleine Tür in ein sogenanntes Mädchenzimmer; dort war ja kein Mädchen, aber wir stellten uns vor, dass sie da drinnen in einem Bett lag, erwürgt und mit einer Haut so weiß wie Lilien; ein armes 12-jähriges Mädchen, das auf dich aufpassen sollte als Aufpasserin; wir erwürgten sie und rollten sie in einen Teppich, bevor wir sie ins Bett legten, einen Schal überm Gesicht; aus der Küche fuhrst du nach links und kamst in die Stube gesaust, wo ich an den Zapfsäulen bereitstand.
Volltanken!, riefst du vom Fahrersitz.
Ja bitte! Das macht acht Kronen und vierzig Öre.
Hier bezahlen wir mit Nüssen, sagtest du und gabst mir neun Walnüsse. Stimmt so, sagtest du und fuhrst auf der Schlafstraße zum Schlafzimmer, sie verlief entlang verschneiter Hänge aus Kissen und Bettdecken, ich dachte, du wärst zum Bett unterwegs, aber dann bogst du zum Badezimmerplatz ab. Es war Zeit für ein Bad. Ich füllte die Badewanne mit warmem Wasser, und du konntest in der Wanne sitzen bleiben, bis deine Haut rosa und so weich war wie eine Qualle. Ich hatte das Gefühl, jedes Mal, wenn ich dich in die Badewanne setzte, wärst du zurück bei deiner Mutter. Du warst im Mutterwasser. Du musstest aus der Badewanne herausgezogen werden. Du schriest. Du rangst um Luft. Du weintest und schluchztest. Wie alt bist du jetzt? Ich trocknete dich ab und trug dich ins Bett. Du musstest mitten am Tag ausruhen. Eine Stunde, mindestens, jeden Tag, meinte deine Mutter. Sie wollte gern bestimmen. Aber es gab immer etwas, das über sie bestimmte: die Pflicht. Die Arbeit. Der Vater. Ihr Mann. Ihr Sohn. Ihr alle, die ihr mit eurer Entscheidungsfähigkeit über sie bestimmt. Über mich. Über alle Frauen. So ist das, Tomas!
Sie zündete sich eine Zigarette an. Sie paffte nur, inhalierte nicht. So raucht auch mein Vater. Meine Mutter sog den Tabakrauch ein, in die Lungen hinein und weiter in ihr Allerinnerstes, wo auch die Träume lebten; sie rauchte und träumte sich weg. Zweiundsechzig Jahre alt, starb sie an Lungenkrebs. Sie wollte leben, sie wollte endlich frei sein, von der Pflicht, von der Arbeit; sie war nur noch ein Jahr von der Rente entfernt, von diesem Alter, von dem sie dachte, dann könne sie endlich jung sein; dann könne sie endlich reisen, erträumte Städte in Italien und England aufsuchen. Aber sie kam nicht weiter als bis ins städtische Krankenhaus, nicht besonders weit von der Abteilung entfernt, in der sie ihre beiden Kinder zur Welt gebracht hatte, und vom Fenster ihres Krankenzimmers aus konnte sie auf den Friedhof blicken, auf dem sie begraben werden sollte.
Ich erinnere mich nicht an die Wohnung in der Vestre Torggate, aber es gibt sie irgendwo in der Erinnerung, aufgezeichnet wie ein Bild oder Bilder, denn auf einmal sehe ich sie ganz klar, nicht direkt, sondern indirekt, wie als ich zum ersten Mal Vilhelm Hammershøis Gemälde von seiner Wohnung in der Strandgade 30 sah und sofort mir selbst gegenüber ausbrach: So war sie!
So war die Wohnung in der Vestre Torggate; weiße Türen, leere Zimmer.
Dreiundfünfzig Jahre, nachdem wir aus der Wohnung ausgezogen waren, erkannte ich sie in Hammershøis Gemälden unmittelbar wieder. Ich musste mich auf einen der Lederpuffs im großen Saal des Museums Ordrupgaard außerhalb von Kopenhagen setzen, und von dort wurde ich unmittelbar zurückversetzt, wie in einer Art Erinnerungsflug, über flache Auen und hohe Berge, über mehrere große Landschaften und noch größere Zeiträume, dorthin, wo ich herkam; in die Einsamkeit in einer Wohnung.
Was ich wiedererkannte, waren zuvorderst die weißen Türen; diese halb geöffneten oder halb geschlossenen Türen zwischen den Zimmern, die Doppeltüren zwischen Stube und Esszimmer, die Türen zum Schlafzimmer und die Küchentür; Türen, die sich auf neue Türen öffneten, als bestünde die Wohnung aus nichts als Türen und Fenstern, eine Wohnung aus Licht, aus verschiedenen Lichttönen und Lichtschattierungen, Lichtfiguren, vom Staub hervorgerufen, so sah ich auch meine Eltern, nicht als Schatten, sondern als Figuren, die kamen und gingen, eine kurze Zeit beleuchtet wie Staub, bevor sie verschwanden, durch Türen hinaus und hinein. Das waren die Türen zu den abgesperrten Zimmern, Zimmern, die nicht geöffnet werden konnten, und das Kind wusste nicht, was sich darin verbarg; es konnte alles sein von gestapelten Möbeln oder unerwünschter Kleidung oder Gegenständen, und es mochte eine heimliche Familie sein, die dort lebte, in ihren Zimmern, eine kleine Familie, höchstwahrscheinlich genauso eine wie die, in der er lebte, mit kleinen Geräuschen und Bewegungen in großen, leeren Zimmern.
Als das Kind vier Jahre alt war, zog die kleine Familie aus der Wohnung in der Vestre Torggate in eine moderne Wohnblockwohnung im Skyttervei, zehnter Stock. Meine Mutter war schwanger. Sie litt unter Höhenangst. Sie verabscheute diese Wohnung im Skyttervei spontan, sie war auf allen Seiten, darüber und darunter, rechts und links, von gleichen Wohnungen umgeben, bewohnt von Sozialhilfeempfängern und weniger wohlhabenden Familien, und meine Mutter bewegte sich unfreiwillig zugleich nach oben und dafür im gesellschaftlichen Ansehen nach unten. Sie hatte sich vom Versprechen einer wärmeren Wohnung verlocken lassen, dem Versprechen eines leichteren Lebens in einer modernen Wohnung mit Zentralheizung und Linoleumboden, einer neuen Küche, eines Bades mit Badewanne und Fußbodenheizung, heller Stuben und Schlafzimmer, eines Balkons mit Aussicht, eines Fahrstuhls und Kindergartens, Parkplatzes und Supermarkts, eines kurzen Schulwegs und Arbeitsweges; sie hatte sich vom Gedanken an ein besseres Leben verführen lassen und sah sich jetzt in einer Wohnblockwohnung in einem Wohnblockviertel mit Menschen gefangen, die sie verachtete. Sie hoffte, es wäre vorübergehend. Wir sollten in dem Wohnblock dreizehn Jahre lang wohnen. Meine Mutter war von verfeinerter Lebensart, elegant, sie hatte in einem schönen Zuhause eine bürgerliche Kindheit und Jugend verbracht. Sie hatte sich in einen Jungen aus der Arbeiterklasse verliebt. Er war nicht ohne Ehrgeiz, doch der Ehrgeiz war nicht groß genug, er stimmte nicht mit ihrem überein; sie wünschte sich ein Leben in einem Einfamilienhaus mit Garten und wohlhabende Nachbarn. Jede Woche wieder pisste jemand in den Fahrstuhl. Der Fahrstuhl roch nach Urin und Erbrochenem, gemischt mit dem Geruch von billigem Parfüm und Schweiß; sie musste mehrmals täglich für zehn Stockwerke in diesem Fahrstuhl stehen, hinab und hinauf, oft mit Leuten, die sie nicht mochte, vielleicht schloss sie die Augen und hielt sich die Nase zu, sie war eine Person, die ihre Meinungen deutlich kundtat. Was dachte sie? Oft wurde Benzin in die Briefkästen gefüllt, die in Reihen im Hauseingang hingen, und dann wurde die Post angezündet. An die Fahrstuhltüren wurden Schimpfwörter und Geschlechtsteile gemalt. Auf dem Parkplatz wurden die Reifen zerstochen. In die Wohnungen wurde eingebrochen. Sirenen und Blaulicht herrschten auf den Straßen, Krankenwagen, Polizeiwagen, Feuerwehrwagen, mehrmals kam es vor, dass jemand das trockene Gras im Wald um die Wohnblöcke herum anzündete; Waldbrände, Prügeleien, Selbstmorde, Familientragödien, das war alles nicht ungewöhnlich. Lange war das Kind vor all dem geschützt, isoliert und in eine Wohnung eingesperrt. In der Höhe. Mit seiner Großmutter. Später sollte er ein Teil der Straße werden, des Straßenlebens im Skyttervei, und abermals später – nach vielen Lehrjahren – war er es, der sich prügelte und in Wohnungen einbrach und von der Polizei oder dem Krankenwagen abgeholt wurde.
Die Wohnung war jederzeit voller Blumen, Pfingstrosen, Tulpen, Chrysanthemen im Frühling, Lilien im Sommer, manchmal auch Nelken und Rosen, weiße, gelbe, rosa Rosen in Vasen, und stets Orchideen auf den Fensterbrettern; sie flatterten mit den Flügeln wie Schmetterlinge, die mit Nadeln an den Fensterscheiben befestigt waren und an dem blauen Licht des Himmels direkt hinter der Balkontür, die nie geöffnet wurde, im Sommer nicht, und ebenso wenig im Winter, wenn die Luft in der Stube schwer war vom Geruch der Zwiebelblumen und Amaryllis.
Wie schön sie sind, diese Wohnblockviertel am Stadtrand, so von der Natur abgeschirmt; sechs niedrige Blöcke und ein Hochhaus, um den Parkplatz herum angeordnet. Ein Fußballplatz, ein Supermarkt und ein Kindergarten, den das Kind jeden Tag sieht wie einen zoologischen Garten mit hinter Zäunen gehaltenen Kindern, an dem er und die Großmutter Hand in Hand auf dem Weg zum Geschäft vorbeigehen, wo sie Milch und Zigaretten kaufen.
Das Kind, jetzt in einen der Anzüge gekleidet, die die Mutter abends in der Wohnstube näht, hinter der Nähmaschine, wo sie Stoffe zuschneidet, die sie zusammennähen und am Kind anbringen wird.
Wie man ein Alter an einem Kind anbringt und ihm Zigarettenrauch in die jungen Lungen bläst, damit der Junge wächst.
Er wuchs. Er wollte kleiner werden und nicht größer, am liebsten wollte er verschwinden, heranwachsen und welken. Den Kopf beugen. Sich zum Boden krümmen. Langsam zu einer Blume werden: Anemone. Glockenblume. Butterblume. Klee. Kresse. Gänseblümchen. Löwenzahn, und verschwinden, vielleicht im Juni, vielleicht im Mai.
Anzug an. Die Zweikindermutter. Schwarzes Haar, blaue Augen. Geschminkt, zurechtgemacht. Ein Duft von künstlichen Blumen. Nina Ricci, Chanel, Balmain. All diese Parfüms, die ihm Kopfweh verursachten: ein Ring aus Schmerzen über der Stirn. Sie roch nach Abstand. All diese Perücken, die dafür sorgten, dass er sie nicht wiedererkannte. Blond. Rothaarig. Brünett. Kurzes Haar oder langes, hochgesteckt. Ohrringe. Schmuck. Falscher. Unechte Steine, goldfarbene Halsketten, Armringe, Ringe. Sie war gefangen. Er wusste es nicht, aber sie war an Händen und Füßen gefesselt; unsichtbare Schnüre, um den Leib geschnürt unter den Kleidungsstücken, die sie verbargen; silbern bestickte Westen, Rüschenblusen, breite Gürtel, eine schöne Gefangenschaft: Jetzt gehen wir aus! Sie nahm seine Hand und zog ihn widerwillig zur Tür, in den Hausflur, in den Fahrstuhl, all die Stockwerke von der Wohnung in der Höhe hinunter, neunter, achter, siebenter Stock und bis ins Erdgeschoss, wo sie rasch zur Ausgangstür ging und den Wohnblock verließ, zum Parkplatz ging und sich ins Auto setzte, sie hinter dem Steuer, er auf dem Rücksitz, sie zündete sich eine Zigarette an und startete den Motor, er sagte, so leise er nur konnte: Fahr mich in die Stadt!
Was hast du gesagt? Wie sie ihn im Spiegel betrachtete. Feindselig. Misstrauisch. War sie es oder er, der fremd war? Sie fragte: Wie alt wirst du heute? Es war sein Geburtstag, sie wollten zu einer Feier. Bei ihren Eltern. Familienbesuch. Großeltern, Tanten und Onkel, eine Schwester. Irgendwann ein Vater. Geschenke. Und sicher die eine oder andere Strafe. Wenn du die Gabel nicht richtig hältst. Wenn du dir die Serviette nicht um den Hals bindest. Wenn du mit den Beinen baumelst. Wenn du dich nicht deinem Alter gemäß benimmst: ein verkleideter kleiner Herr. Ich werde sechs, sagte er und schob sich die Mütze über die Augen, bis es im Auto dunkel wurde.
Zum dritten Mal starb das Kind, als es mit der Schule anfing. An dem einen Tag war er allein mit seiner Großmutter väterlicherseits, am nächsten Tag wurde er aus seinem Zuhause weggeschickt, um mit siebenundzwanzig Kleintieren zusammengesperrt zu werden, die jedes hinter seinem Pult angenagelt dasaßen. Dieser grässliche Klang von flüsternden Stimmen, die wie Insekten hinter einer Fensterscheibe oder in einer Flasche summten, die Sonne schien in ein Vakuum, in dem man kaum Luft bekam. Am ersten Schultag wurde er hinter seinem Pult ohnmächtig.
Das Kind saß hinter einem anderen Kind mit langem gebundenem Haar. Stundenlang konnte er dasitzen und auf dieses Haar blicken, so stramm gefasst, gefasst von welchen Händen? Hat sie eine strenge Mutter, so wie wir alle strenge Mütter haben, die so hart mit unserem Haar arbeiten, die unser Haar flechten und schneiden mit Klingen und Scheren, damit wir aussehen wie ordentliche Kinder, fast ohne Haare, fast ohne Kindheit.
Aber dieses Haar war anders, so lang und zu einem Pferdeschwanz gebunden, es hing über den Rücken, ein Haarschwanz, morgens kalt von Silbertönen, und wärmer, fast sonnengelb später am Tage, Farben, die langsam dunkler wurden und den Jungen mit der Angst erfüllten, der Schultag könnte bald vorbei sein.
Eine Verliebtheit in Haare. Das Haar wuchs in derselben Weise, wie an der Brust Brüste wuchsen und der Rücken breiter wurde über der Leibesmitte, die schmaler wurde in den eng sitzenden Jeans, die vom Haar und dem Pullover durch einen dünnen Streifen weißer Haut getrennt wurde, die er jeden Tag anstarrte, jede Stunde, mehrere Jahre lang, bis zu dem Tag, da sie sich hinter ihr Schulpult setzte mit abgeschnittenen Haaren.
Der Pferdeschwanz war weg. Das schöne Haar war ab.
Die Mutter hatte gesehen, dass das Kind ein Mädchen wurde, dass das Mädchen eine Sexualität bekam, eine Schönheit, die den Jungen auffiel, und jetzt schnitt sie ihrer Tochter das Haar, schnitt den Haarschwanz ab und schickte das Mädchen als Jungen zur Schule.
Und auf einmal saß er hinter einem Mädchen, das einem Jungen ähnelte. Das veränderte die Verliebtheit, verstärkte sie, machte sie erregender, anders; dieser Jungennacken an einem Mädchenkörper.
»Laila Skudal und ihre schreckliche Mutter.«
Das war der Titel seines allerersten Schulaufsatzes, den er mit einem Brief der Lehrerin an seine Eltern zurückbekam, die sich bereits über die Veranlagung des Jungen und seine Biografie Sorgen machten.
Ursprünglich hätte er in eine andere Klasse gehen sollen, die sogenannte Skyttervei-Klasse, doch als er dort reingesteckt wurde, ging sein Vater zum Rektor der Grundschule und verlangte, dass der Junge in eine andere Klasse käme, in eine bessere Klasse, und auf diese Weise landete er in der Klasse mit Kindern aus Eikeviken und Biskopshavn. Einfamilienhäuserkindern. Und Laila S war ein Einfamilienhauskind. In aller Stille trug sie diese großen, hellen Zimmer in sich, mit Gardinen und alten Möbeln, in dem jungen Körper, der in dem engen Klassenzimmer saß und fern wirkte.
Ohne die langen Haare war sie weniger unnahbar, gefährlicher, vielleicht, wie ein Kamerad; sie trafen sich nach der Schule auf einem Spielplatz in der Nähe der Wohnblocks, wo er wohnte, saßen beide je auf einer Schaukel, schwangen vor und zurück zwischen Kindheit und Jugend. Eines Tages sagte sie auf diesem Spielplatz: Ich mag dich, aber meine Eltern erlauben mir nicht, dich zu treffen. Warum nicht? Weil du im Skyttervei wohnst, sagte sie.
Er spürte, wie sich ihre Worte in ihm einbrannten, irgendwo in der Brust, es tat weh, wie eine innere Brandmarke, es stand SKYTTERVEI eingebrannt unter seiner Haut.
Und was bedeutete das, Skyttervei?
Skyttervei bedeutete Schlägereien und Krach, Drogen und Alkohol, Einbrüche und andere Kriminalität, Jugendamt und Sozialhilfeempfänger, enge Wohnungen und Gewalt.
Der Skyttervei, das waren die Wiers-Brüder und die Heldals-Brüder und die Langedals-Brüder und die Olsen-Brüder und die Jakobsen-Brüder und die Hansen-Brüder und der Snadd und der Bøbb und Finnemann und Lilliken und der Freddie und Suff-Olsen und eine ganze Straße voller Jungen und Mädchen, die mit ihrem Verhalten und ihrer Freiheit die Familien in den Vierteln um die Wohnblocks herum erschreckten. Den Einfamilienhäuservierteln. All diese schönen Häuser, die verschlossen und still entlang des Felshangs lagen, mit Aussicht über Stadt und Meer.
In einem dieser Häuser wohnten Laila Skudal und ihre Familie. Viel später, als er Schriftsteller geworden war, eine gewisse Anerkennung genoss, er hatte in eine bessere Familie eingeheiratet, jedenfalls in eine, die meinte, sie sei eine bessere Familie, begegnete er durch diese eingebildet gute Familie Leila Skudal und ihrer schrecklichen Mutter erneut, sie waren mit seiner Schwiegerfamilie befreundet, und die Leila-Mutter, die sagte: Nein, wie nett, dich wiederzusehen, weißt du, wir sind so stolz auf dich, nein, wirklich nett, du hast es wirklich gut gemacht.
Ja, was dachte er da?
Ich muss mich scheiden lassen, dachte er. Ich muss weit wegkommen, aus dieser Ehe, aus diesen Familien, aus dieser Falschheit, die zu meiner geworden ist.
An jenem Junitag auf dem Spielplatz, als das neunjährige Mädchen, in das er verliebt war, ihm sagte, sie dürfe ihn nicht mehr treffen, da verspürte er zum ersten Mal Hass. Nicht auf Laila S, sondern auf ihre Eltern.
Er war gedemütigt, aber die Demütigung geriet zu seinem Vorteil, er entging Laila S und ihrer schrecklichen Familie. Und dank dieser Lektion in Gedemütigtwerden hielt er sich lange Zeit von allen schrecklichen Familien fern, obwohl er später denselben ersten Verliebtheitsfehler wieder begehen sollte, er verliebte sich und heiratete einen Snob.
Er wohnte gern im Skyttervei. Er gewöhnte sich nach und nach daran, verprügelt zu werden, und er lernte zurückzuschlagen. Beim ersten Mal, dass er sich prügelte, verspürte er den Rausch, den es bereitet, einen am Boden liegenden Jungen zu schlagen. Das Hochhaus, in dem er wohnte, wurde in regelmäßigen Abständen von den Jungs aus den niedrigen Wohnblocks angegriffen, sie bildeten eine Bande und trieben sich gruppenweise auf der Straße herum, jetzt wollten sie das Gelände, das zum Hochhaus gehörte, erobern, und es brauchte nur ein paar Signale und viele Pfiffe, da hatte sich eine Gegenbande auf dem Platz hinter dem Hochhaus versammelt; ein Parkplatz mit Heizungsraum und einem Kiesweg in die Berge und den Wald hinter den Blöcken hinauf, das war der Fluchtweg zu verschiedenen Verstecken bei Hütten und Bäumen. Dieser Platz hinter dem Haus war das ideale Kampfgelände, und da stand er auf einmal Auge in Auge mit einem Jungen, der älter war als er, größer, einem hellhaarigen Jungen mit einem breiten Gesicht, tiefen, stechenden Augen, einem Grinsen statt einem Mund, einem Gesicht, das er sofort nicht leiden konnte, und bis heute, wenn selten einmal dieser Mann, der in die Straße seiner Kindheit zurückgezogen ist, mit seinem Hund und dem unerträglichen Grinsen an ihm vorbeigeht, verspürte er Lust zuzuschlagen so wie er damals zugeschlagen hatte, mit aller Kraft, voller Angst, auf dem Platz hinter dem Haus, in das breite Gesicht, so oft, schnell und hart, bis der Junge auf den Asphalt fiel und da liegen blieb, die Hände vor dem Mund. Da spürte er den Rausch. Nur wenige Tage später wurde ein älterer Bruder geschickt, der Rache nehmen sollte, das war die Regel; wenn du einen Jungen verkloppst, der Brüder hat, dann kommt der älteste Bruder und übt Vergeltung, und diesmal versuchte er abzuhauen, er rannte den Kiesweg hinter dem Hochhaus in die Berge hoch, wurde aber auf halber Strecke von dem ältesten Bruder eingeholt, der einen Stein aufhob und ihm damit dicht über dem linken Auge ins Gesicht schlug; diesmal war er damit an der Reihe, dass ihn der Krankenwagen abholte. Ihm fehlte ein älterer Bruder. Ihm fehlte ein Bruder, aber er hatte seinen Vater, und dieser Trumpf stach sämtliche älteren Brüder; der Vater war Boxer gewesen, und wenn der Junge ungerechtfertigt geprügelt oder besonders schwer verletzt wurde, dann nahm er sich der Sache an, dann suchte der Vater die Väter der Brüderfamilie auf; ich weiß nicht, was er da sagte oder tat, aber danach wurde der Junge von den älteren Jungen in Ruhe gelassen und musste sich damit begnügen, sich mit Gleichaltrigen zu prügeln.
Sein Vater hatte ihm das Boxen beigebracht. Schon als der Junge sechs Jahre alt war, holte der Vater nach ihm aus, spielerische Schläge, die zeigten, wie der Junge eines Tages getroffen werden würde, dann irgendwann leichtere Schläge mit der flachen Hand, die ihn im Gesicht oder Bauch trafen, wieder später härtere Schläge, die er entweder parierte, oder von denen er im Gesicht und Bauch getroffen wurde, rasche, kleine Finten mit der Linken auf Höhe des Zwerchfells und eine Rechte ins Gesicht; er parierte sie und schlug zurück, zielte auf den Vater, der in der Wohnstube herumtänzelte und unschlagbar war, das ärgerte den Jungen, und er übte heimlich Schattenboxen, trainierte auf eigene Faust in seinem Jungenzimmer, machte Liegestütze und Situps, ahmte die Tanzfiguren des Vaters nach, seine Fußarbeit, die Art, wie der Vater Oberkörper und Kopf schwingen ließ, und eines Tages schlug er seinen Vater so hart in den Solarplexus, dass das Spiel vorbei war, sie boxten.
Sie boxten und der Vater vergaß sich, vergaß, dass er Vater war, vergaß den schrecklichen Altersunterschied, und für ein paar Minuten waren Vater und Sohn gleich alt, sie folgten einander hin und her im Wohnzimmer, tanzten und schlugen so hart und treffsicher, wie sie konnten, der Junge war schneller als sein Vater, niedriger, leichter, er hatte schnellere Füße und Bewegungen, aber schwächere Schläge, und der Vater ließ sich von dem Jungen treffen, um seine Stärke zu beweisen, um zu demonstrieren, dass er die Schläge einstecken konnte und den Schmerz liebte, er liebte und duldete, dass es wehtat; und das, sagte er, indem er seine Deckung vernachlässigte und sich den Schlägen öffnete, ist die wichtigste Eigenschaft des Boxers, dass er etwas einstecken kann, dass er keine Angst kriegt, die Angst ist dein schlimmster Gegner, sagte er, dann frieren die Bewegungen ein und deine Kraft verlässt dich und du wirst steif und wirst ausgeknockt, sagte er und schlug so hart zu, dass der Junge erschrak und Angst bekam: Er liebte seinen Vater in diesen Augenblicken der Angst; auch der Junge liebte es, geschlagen zu werden, es lag eine eigene Wärme in den Schlägen, die wehtat und wohltat, eine berauschende Erregung, der Anfang einer Raserei, einer Niederlage, einer schwindelnden Demütigung, wenn du fällst und es dunkel wird und du verschwindest.
Der Vater vergaß, dass er Vater war, und setzte eine Kombination von Schlägen ein, die den Sohn zu Boden schickten. Niedergeschlagen, ausgeknockt. Das erste Mal, wenn du fällst, das erste Mal, wenn du von einem Gegner zu Boden gesandt wirst, spürst du, wie restlos demütigend es ist zu verlieren, und du beschließt, dass das nie wieder passieren wird und du dein Äußerstes tun wirst, um ein Sieger zu werden; und eines Tages wirst du dich genötigt sehen, auf die eine oder andere Weise deinen Vater zu überwältigen, deinen schwierigsten Gegner, du bist genötigt, ihn in Kraft und Geschick und Freiheit zu übertreffen, eines Tages musst du über dich selbst entscheiden und vielleicht auch über ihn und deine Mutter und alle Familienerwartungen und Familienbegrenzungen; wenn nicht, bleibst du auf ewig ein Sohn und Verlierer.
Er liebte die Wohnblocks und die Treppenhäuser, die zahllosen Türen mit Namensschildern; Olsen, Hansen, Nilsen, Jensen, Mikkelsen, aber auch, unerwartet, Fersum und Sæveraas, er lief die Treppen in den zehnten Stock rauf und runter, traute sich noch nicht, den Aufzug zu nehmen, zwischen diesen Namen gefangen zu stehen, die im Fahrstuhl Gesichter und Körper bekamen, die im Fahrstuhl rochen, sie rochen nach Schweiß und Arbeit, und noch schlimmer, sie rochen nach billigem Parfüm, nach diesen lächerlichen, aufgetakelten, übergeschminkten Frauen, die alleine im Skyttervei wohnten, sie rochen nach etwas Misslungenem und Traurigem, sie rochen nach Einsamkeit, nein, lieber nahm er die Treppen, lief an den Türen vorbei, lernte die Namen, zuerst im Hochhaus und nach und nach auch in den anderen Häusern, wohin er Expeditionen unternahm, diese Reisen in fremde Wohnblocks hatten etwas Exotisches an sich, ungefährlich waren sie auch nicht: Was hast du hier zu suchen? Ich will Hein besuchen, er wohnt im Dritten, Mathiesen. Aha, du wohnst in Nummer 33. Ja. Jetzt bist du in Nummer 13, Kleiner, hier bist du nicht zu Hause.
Er liebte die Wohnungen, die sowohl gleich als auch verschieden waren; dieselben kleinen Zimmer, auf so viele verschiedene Weisen eingerichtet, neue oder abgetretene Teppiche, grellfarbige Gardinen, exotische Lampen, Schildkröten und Meerschweinchen, Wellensittiche und Katzen, Hamster und Aquarienfische (Haustierhaltung war in der Siedlung verboten), Topfpflanzen und Blumen, die starken Gerüche, die aus den Wohnungen drangen, wenn man läutete, der Geruch nach Haaren und Wäsche und Armut, und manchmal nach Wohlstand und Papier, wie in den Wohnungen, die der Handelshochschule oder dem Krankenhaus Neevengården gehörten, hier roch es nach Büchern. Ein Bücherregal erblickte er zum ersten Mal im dritten Stock des Hochhauses. Hier wohnte Familie Iversen, eine Familie aus dem Osten des Landes, der Vater arbeitete in der Norwegischen Handelshochschule, die Mutter im Krankenhaus, und in dieser Familie fand er seinen besten Freund, einen dünnen, hoch aufgeschossenen Jungen, der Østlandsdialekt redete, wie seine Eltern auch. Vegard Iversen hatte einen ganz anderen Körper und eine andere Sensibilität als die Kinder, unter denen sie im Skyttervei lebten, ein anderes Gesicht, freundlicher, einen empfindsamen Mund, große, etwas müde Augen, es wohnte eine Ruhe in seinem Blick und Körper, in den Bewegungen, in seiner Gangart, und in seinen Händen, die oft auf einem Buch ruhten. Vegard las Bücher. In der Wohnung, in der er wohnte, gab es Bücherregale, Wand um Wand voller Bücher, sie rahmten die Wohnstube ein und das Arbeitszimmer des Vaters, in dem ein Schreibtisch stand. Es schwebten eine Stille und Ruhe über der Wohnung und den Büchern, die sie füllten; und dieses Arbeitszimmer, in das der Vater sich zurückzog, vielleicht erinnerte es ihn an die Einsamkeit, nach der er suchte, und die er nur in kurzen Momenten fand, in einem Kleiderschrank oder hinter einer Tür, an den wenigen Orten, an denen er sich verstecken und allein sein konnte, weg von allem. Es war seine Gewohnheit, sich zu verstecken. Er schloss sich ins Badezimmer ein und löschte das Licht. Setzte sich in den Kleiderschrank seiner Mutter und machte die Augen zu. Legte sich unters Bett. Eine Stelle im Wald finden und liegen bleiben. Auf einen Baum klettern und sitzen bleiben. Durch die Straßen gehen und allein sein. Jetzt hatte er einen Gleichgesinnten gefunden, einen Freund. Hast du Tom Sawyer und Huckleberry Finn gelesen? Nein. Hast du 20.000 Meilen unter dem Meer gelesen? Nein. Hast du Die Schatzinsel nicht gelesen? Nein, hatte er nicht. Er hatte noch kein einziges Buch gelesen, und vorgelesen hatte man ihm auch nicht. Er kam nicht aus einer Familie, in der man Bücher las. Und warum sollte er Bücher lesen? Er hatte schon Albträume von den Büchern, die sie in der Schule lasen; er träumte von Abraham, der seinen Sohn opferte, von Jakob, der mit dem Engel rang, von Jesus, der ans Kreuz genagelt wurde. Handelten nicht alle Bücher vom Tod? Wenn er an den Tod dachte, erlitt er Ohnmachtsanfälle. Dann fiel er auf den Badezimmerboden, und nachts im Bett bekam er Panikattacken; er kämpfte einen heimlichen Kampf gegen den Tod und wollte nicht noch mehr an ihn erinnert werden, als es ohnehin schon der Fall war, er wollte nicht in noch mehr Büchern vom Tod lesen. Und jemanden lesen zu sehen, erschreckte ihn. Er sah Vegards Vater mit einem Buch auf dem Sofa liegen, das war ein beunruhigender Anblick. War der Lesende nicht schon tot, er wirkte so weit entfernt, an einem anderen Ort, vielleicht war er bei den Toten? Wo war der Lesende? Man sprach ihn an, er antwortete nicht. Er lag da auf dem Sofa und war verschwunden.
Es sollten viele Jahre vergehen, bevor er ein Buch öffnete. Ich weiß nicht mehr, welches Buch das war, aber mit ungefähr siebzehn las er Der Tod in Venedig von Thomas Mann. Warum las er ausgerechnet dieses Buch? Weil das Buch den Tod im Titel hatte? Er entdeckte das Buch im Regal bei der Familie seiner Freundin. Nahm er das Buch heraus, weil es von einem Thomas geschrieben war? Thomas Mann. Wählte er das Buch, weil es Zeit war, erwachsen zu werden, ein Mann zu werden? Er las die Novelle innerhalb von zwei Nächten. Seine Freundin lag neben ihm im Bett und schlief. Er las heimlich. Er las im schwachen Schein der Nachttischlampe. »Denn die Schönheit, Phaidros, merke das wohl! nur die Schönheit ist göttlich und sichtbar zugleich.« Er las weinend. Wie konnte es nur sein, dass er sich in dem alten Mann von Aschenbach und seiner Liebe zu einem Jugendlichen wiedererkannte, der Liebe zur Schönheit, die zu seinem Untergang führen sollte, zu seinem Tod. Vorsichtig zog er die Bettdecke von seiner Freundin herunter. Er hatte noch nie etwas so Schönes gesehen wie ihren Körper, wie ihr Gesicht, und er wusste, dass er sie verlassen würde. Er fühlte sich in ihrer Familie nicht wohl, so wollte er nicht leben, in einem großen Haus mit einer neuen Familie und neuen Familiengewohnheiten, neuen Regeln und neuen Formen von Falschheit, von Pflicht und Zwang, er wollte frei sein. Was bedeutete das? Das wusste er nicht, aber er wusste, was Unfreiheit war, er lebte darin. Er war gezwungen, zur Schule zu gehen, mit Vater und Mutter und Schwester zu leben, Hausaufgaben zu machen, Fußball zu spielen, früh aufzustehen, zu festen Zeiten zu Abend zu essen und das Ganze zu wiederholen, Tag um Tag, war das alles, was das Leben zu bieten hatte, war das alles? Gustav von Aschenbach hatte etwas an sich, das ihm die Lust zu reisen eingab, all das zu verlassen, dem Leben näherzukommen, was bedeutete, dass er dem Tod näherkommen musste, das verstand er aus dem Buch, das er las; er konnte, er durfte keine Angst vor dem Tod haben. Er durfte keine Angst vor dem Leben haben, das lernte er aus dem Buch, das er las. Er musste seine Furcht vor dem Tod überwinden.
Zum vierten Mal starb er, da war er zwölf, und seine Eltern waren bei einer Party in einem von den niedrigen Wohnblocks, sie hatten einen Zettel mit einer Telefonnummer auf den Telefontisch gelegt, falls er Angst bekommen sollte, was häufig der Fall war, es kam vor, dass er nachts von Träumen geweckt wurde und durch die Wohnung zum Schlafzimmer der Eltern rannte, wo er seine Zitter- und Weinkrämpfe erlitt, an der Schwelle zur Ohnmacht, bis er zwischen Mutter und Vater ins Bett gelegt wurde. Er schämte sich. Ein zwölfjähriger Junge im Bett der Eltern, das war beschämend, aber er wurde den Gedanken an den Tod einfach nicht los, der Gedanke wohnte in ihm, so schien es, und er wuchs mit den Jahren, nahm immer größeren Platz in ihm ein, und er kämpfte gegen diese Gewissheit, dass der Tod ihn eines Tages ganz und gar ausfüllen würde, genauso groß wie er würde und bis in seine Finger und Beine hineinwachsen würde, in das Innerste hinein und in das Äußerste hinaus von allem, das er war; und dann käme die Dunkelheit.
Das schwache Licht in ihm würde erstickt werden. Das zerbrechliche Leben in ihm würde verlöschen, wie wenn das Licht in seinem Jungenzimmer gelöscht wurde, wo er im Bett bereit lag, mit einer Taschenlampe. Wenn es ganz dunkel würde, so würde er sterben, da war er sicher.
Jetzt waren seine Eltern bei der Party, und sie hatten vergessen, in seinem Zimmer das Fenster zu schließen. Konnte er das Fenster nicht selbst schließen? Nein, das wagte er nicht. Er hatte gelernt, sich zu prügeln, er hatte ein Mädchen geküsst, aber das Fenster in seinem Jungenzimmer zu schließen, das wagte er nicht. Das Fenster stand einen Spalt offen, es war offen. Und da sie im zehnten Stock wohnten und das Fenster seines Jungenzimmers zur Rückseite des Wohnblocks hinausging, blickte er, tagsüber, direkt in den Wald auf dem Felskamm gleich hinter dem Fenster; und nachts, wenn das Fenster nicht geschlossen war, hörte er den Wald, er hörte den Wind in den Bäumen sausen, und er hörte die Vögel reden, er hörte die Eule heulen, und er hörte den Tod rufen; es war etwas vor dem Fenster, das nach etwas in ihm rief, das versuchte zu wecken, was in ihm wohnte, was in ihm schlief: Und jetzt erwacht der Tod, sobald ich einschlafe, da war er sicher.
Er lag schlaflos im Bett. Aber irgendwann muss er eingeschlafen sein, denn jetzt wachte er auf und war tot. Er war steif und starr, an Armen und Beinen vollständig gelähmt, er konnte die Hände nicht bewegen und ebenso wenig den Kopf, er war unbeweglich, und sein Atem drohte ihn zu verlassen. Dann wurde es dunkel. Er stürzte durch einen Spalt im Bett und fiel durch einen schwarzen Schacht, in dem bisweilen kurz Lichter aufglommen, als ob er in einen umgekehrten Himmel stürzen würde, von Sternen erleuchtet, tiefer und immer tiefer hinab, bis er sich selbst schreien hörte. War er angelangt, war er dorthin gekommen, wo alles anfing, vor der Geburt, war das der Tod?
Nein, er rief nein. Nein, nein, schrie er.
Und dieses Nein muss kräftiger gewesen sein als jedwedes Ja, denn es füllte seine Lunge mit Luft und Kraft, genug, um die Hände zu bewegen, und sie flogen, gewissermaßen mechanisch, oder wie die Hände einer Marionette, zu einem Gebet zusammen, er faltete die Hände.
Gott, hilf mir, hörte er sich selbst sagen. Er glaubte an keinen Gott, oder vielleicht doch: Er stand aus dem Bett auf. Wer war dieser unsichtbare Vater oder Mutter, der oder die ihm aus dem Bett half, ihn stützte, während er losging, und ihm Kraft und Mut genug eingab, das Fenster zu schließen und in den Flur zu laufen, wo er den Hörer abnahm und die Nummer wählte, die auf dem Zettel stand?
Was sollte er mit der Furcht tun, mit der Angst, die er da ausbrütete, sie war zu einem natürlichen Teil seiner selbst geworden, wie es auch der Tod war; er hatte Angst vor dem Tod und er hatte Angst vor Gott, vielleicht wäre die Lösung gewesen zu sterben? Dann würde all das Schwierige aufhören, es würde verschwinden, das war sicher. Er bräuchte nur das Fenster seines Jungenzimmers zu öffnen, sich auf das Fensterbrett zu stemmen, wie wenn man über einen Zaun klettert, und sich fallen zu lassen, auf der anderen Seite fallen zu lassen? Es waren zehn Stockwerke. Asphalt und Autos auf dem Parkplatz. Ein zerschmetterter Körper, ein roter Fleck. Wie der Saft einer Blutapfelsine. Einmal hatte er das Fenster aufgemacht und eine Apfelsine fallen lassen, einfach um sie fallen zu sehen. Zu sehen, wie es sein mochte, zerschmettert zu werden. Hören. Das Geräusch. Es würde anders sein, größer, grausamer, vielleicht würde er schreien? Vielleicht würde er bereuen? Und jemand würde ihn sehen – oder das, was nach dem Sturz noch übrig war, nein, nach dem Sprung, dem freiwilligen Sprung aus dem Fenster – wie er da unter dem Wohnblock am Boden lag. Man würde an die Fenster stürzen. Man würde herbeigerannt kommen. Man würde sich um ihn herum versammeln, ihn forttragen. Nein, das wollte er nicht. Wenn er schon sterben musste, dann wollte er auch verschwinden. Oder er wollte sterben und als ein anderer wieder auferstehen. Das war ein befreiender Gedanke. Er konnte verschwinden und zurückkommen als ein anderer.
Gleich nachdem er konfirmiert war, nur wenige Wochen, nachdem er bei der Familienfeier das Geld entgegengenommen hatte, nach der Veranstaltung in der Kirche, ging er allein hinunter zum Pfarrbüro in der Kirche von Biskopshavn, um aus der Staatskirche auszutreten. Er hatte sechstausend Kronen auf einem Bankkonto. Mit diesem Konfirmationsgeld, oder diesem Judaslohn, wollte er abhauen, wegreisen. Er saß im Büro von Pfarrer Freuchen und sah, wie der Geistliche ein Lineal unter seinem Namen im Kirchenbuch legte, um dann zwei Bleistiftstriche durch den Namen und das Geburtsdatum zu ziehen. Warum mit dem Bleistift, und nicht mit dem Kugelschreiber? Bist du dir bei dieser seltsamen Entscheidung sicher, du bist gerade erst konfirmiert worden, sagte Freuchen und blickte vom Kirchenbuch auf. Und wegen der schwachen, ausradierbaren Bleistiftstriche fühlte sich der Konfirmand seiner Sache umso sicherer, ja, sagte er mit allzu lauter Stimme, um gewissermaßen die schwachen Bleistiftstriche zu übertönen, ja, gerade wegen des Konfirmationsunterrichts trete ich aus der Kirche aus. Aber du hast dich konfirmieren lassen, sagte Freuchen. Ja, ich brauche das Geld, sagte er und stand auf, um zu gehen. Ich bin verpflichtet, deine Eltern darüber in Kenntnis zu setzen, sagte Freuchen. Selbstverständlich, in Ordnung, ich bin nicht mehr hier, wenn du anrufst, sagte er. Und wo bist du dann, wenn ich fragen darf? Auf dem Weg nach Rom, sagte er und verließ das Büro.
Er war schon früh ein selbstgewisser junger Mann. Selbstbezogen, hieß es, eigenmächtig, hörte er, ein Egoist, sagten sie häufig, sowohl der Vater als auch die Mutter. Na gut. Dann war er das also. Mochten sie das nicht? Sollte er etwas sein, das er nicht war? Ja, das wollten sie wohl, sie wollten ihm das Haar kurz schneiden, sein Gesicht wegwaschen, die Wörter in seinem Mund formen und wiedergekäute Gedanken in seinen kleinen Kopf stecken, so wie man Münzen in einen Automaten steckt oder alte Kleidung in eine Schublade stopft. Sie wollten ihm schöne, ordentliche Sachen anziehen und ihn auf irgendeine Hochschule schicken, wo er sich einen guten Namen erwerben könnte. Er verstand sie gut, er liebte seine Eltern, sie wollten sein Bestes. Aber er wollte etwas anderes. Er wollte Zigaretten rauchen. Er wollte nach London. Er wollte in einem Salon mit alten Möbeln stehen und bewundert werden. Woher hatte er diese Ideen? Waren sie in ihm wie von alters her vorhanden, vielleicht hatte er ein Leben vor diesem gelebt; wahrscheinlich in einem Schloss mit Garten und Park und weiten Wiesen, die sich zu Wäldern hin wellten, in denen wilde Tiere lebten. Er lag oft im Bett und stellte sich solche Dinge vor, es war wohl ein Zeichen dafür, dass er kränklich und nervös war, es geschah immer kurz bevor er seine Anfälle bekam, kurz bevor er Fieber bekam, und jetzt wollte er die Dienerschaft rufen. Sie standen bereits vor der Tür, der Kammerdiener und das Kindermädchen, bereit, zu seiner Rettung zu eilen mit kalten Stoffservietten und heißen Getränken mit Honig und Alkohol. Er brauchte nur zu rufen. Und der Hund, er hieß Pilot, würde durch den Türspalt schlüpfen und sich im Bett über seine Beine legen. Man würde ihm vorlesen. Man würde einen Arzt hinzuziehen. Schlimmstenfalls, wenn er wirklich krank war, würde man nach seiner Mutter senden; dieser hochgewachsenen, blassen Frau mit aufgestecktem schwarzem Haar und kalten Ohrringen. Er konnte ihren Rock über die mit Teppichen belegten Böden rascheln hören. Er konnte das Prasseln des Regens hören. Es wurde geseufzt und geflüstert. Er hörte die Vögel von den Bäumen vor dem Schlafzimmerfenster auffliegen. Er konnte die Jagdhörner den Morgennebel aufreißen hören, wie wenn das Geräusch von plötzlich aufgezogenen Gardinen die Träume verjagt und die ursprünglichen Möbel in einem Jungenzimmer wieder in ihr Recht einsetzt; er lag im Bett in einem Wohnblock.
Er lag in dem schmalen Bett in dem kleinen Zimmer im zehnten Stock, dessen eine Wand an den Fahrstuhlschacht grenzte, sodass er die Kabel den Fahrstuhl mit demselben schweren Geräusch hinaufziehen und herablassen hörte, als würde ein Sarg ins Grab gelassen; eines Tages würde er aus dem Bett aufstehen und dieses Zimmer verlassen, diesen Kraftplatz in der Höhe, nicht mehr lange: Er war konfirmiert worden und hatte Geld entgegengenommen.
Er träumte von Rom. Er war nie in Rom gewesen, und dennoch zeichneten seine Träume eine Stadt mit breiten Kopfsteinpflasterstraßen und weiten, offenen Plätzen, mit Springbrunnen, Treppen, Statuen, Kirchen und marmorweißen Villen auf den Anhöhen um die Stadt herum, um die der Fluss Kurven beschrieb; er konnte am Fluss entlanggehen, eine Brücke überqueren, und dort begegnete er einer Gestalt in alter Kleidung, fast einer Tracht, einem älteren Mann mit einem undeutlichen, unter einer Kapuze verborgenen Gesicht, der Alte blieb stehen und sagte etwas, das er nicht verstehen konnte, als Einziges hörte er das Wort Rom heraus.
Und was bedeutet Rom?
Für ihn war dieses Wort Rom gleichbedeutend mit einem anderen Leben. Einem reicheren, gefährlicheren, schwierigeren Leben. Rom bedeutete vielleicht Zuhause? Seinen eigenen Ort finden. Sein eigenes Leben. Was wusste er? Und genau diese Ungewissheit trieb ihn an, ließ ihn seinen Pass fälschen; er machte aus der 1 in seinem Geburtsjahr eine 0, und so war er mithilfe eines Kugelschreibers 1960 geboren, er war sechzehn Jahre alt. Mit fünfzehn Jahren saß er im Nachtzug nach Oslo. Er hatte seine Wäsche in einen Sack gepackt, seinen Eltern wie immer gute Nacht gesagt, war so leise, wie er nur konnte, aus der Wohnungstür geschlüpft und in den Fahrstuhl gestiegen und war zur Bushaltestelle bei der Handelshochschule gelaufen. Es war ein lichter Abend im Mai. Ein schwacher Halbmond am milchweißen Himmel, der über den Bäumen mit ihrem jungen Laub dunkelte, ein Frühlingsgeruch, ein Geruch von Anfang, er spürte den Anfang in seinem Körper wie ein Erblühen, eine unruhige Blüte, die ihre Kronblätter direkt unter der Brust öffnete, fast tat es ihm unter der Haut weh; ungeduldig hüpfte er auf und ab, während er auf den Bus wartete, und da kam er endlich. Wie seltsam, das Wort Jugendlicher sagen zu sollen, vielleicht zum letzten Mal. Ein Fahrschein, Jugendlicher, sagte er zum Busfahrer, und er war jetzt erwachsen, es war nur noch eine Nachtreise davon entfernt.
Der Nachtzug nach Oslo, es war das erste Mal: Er saß am Fenster, in Fahrtrichtung, wollte all das Neue sehen, das mit voller Kraft und Geschwindigkeit auf ihn eindrang; die Bahnstationen, Arna, Trengereid, Vaksdal, Dale, die bekannten Namen schossen auf ihn zu wie Angriffe von fremden Orten, nur von vereinzelten Häusern und Fenstern in einer Landschaft von Felsen und blühenden Wiesen beleuchtet, es war, als würde die Einsamkeit der Orte in seine eigene hinüberfließen und sie endlos und ohne Haltepunkte werden lassen, ein Fluss, ein Baum, ein Haus, er sah das mit einer Wehmut, die er noch nie verspürt hatte, und die Stille, die aus den verdunkelten Häusern hinaussprang, dem schwarzen Fluss, den schattenartigen Bäumen, sprach zu ihm und es klang für ihn wie eine Aufforderung umzukehren, aber er protestierte, er schüttelte den Kopf und schlug sich mehrfach mit der Hand gegen die Schläfe, um diese Stimme wegzuschlagen, die ihn zurücklocken wollte. Diese falsche, feige Stimme, wo kam sie her? War es die Stimme der Eltern, war es die Stimme der Vernunft, war es seine eigene kindliche Stimme, die fester in ihm steckte als das, was ihn erwartete? Nein, er wollte voran und nicht zurück, und jetzt kletterte der Zug durch Tunnel und Täler, hinauf zu den Weiten und schneebedeckten Bergen; er sah nichts anderes mehr als dieses endlose Weiß, das ihn frösteln ließ, er fror, er zitterte, er vermisste bereits sein Bett und sein Jungenzimmer, er wollte nach Hause, doch der Zug raste davon, rollte voran, jetzt in der falschen Richtung.
Er wachte erschöpft in Oslo auf. Es gab Kräfte in ihm, die in einander entgegengesetzten Richtungen drängten, nach Hause und fort, er wollte beides. Er wollte so vieles, und vielleicht war er nicht stark genug, nicht reif genug, nicht groß genug, um all die Träume und Sehnsüchte in sich aufzunehmen, die ihn erfüllten; er hätte einen größeren, robusteren Körper und ein älteres Gesicht gebraucht, ein abgenutztes Gesicht, das besser zu dieser Reise woandershin passen würde.
Er stieg aus dem Zug und ging in die Stadt, es war ein Morgen und kalt, was sollte er mit sich anfangen? Er wollte weiter nach Kopenhagen, er musste einfach zurück zum Bahnhof, den Zug finden und hineinspringen und der Reise dorthin folgen, wohin er gewollt hatte. Er durchstreifte ein paar Stunden lang die Straßen, beobachtete, wie die Stadt erwachte mit diesem Strom von Menschen, die in Gebäude und Büros hineingingen und aus ihnen herauskamen. Man ging zu einer Arbeit. Das war der Sinn von allem. Man konnte sich Sekretärin oder Rechtsanwalt nennen, Buchhändler oder Angestellte, und das war alles. Er war eine Störung in all dem, er und die Obdachlosen auf den Bürgersteigen, die Richtungslosen, die die Straßen entlanggingen, all jene, die nicht wussten, wohin mit sich, wohin sie unterwegs waren, was sie tun sollten? Er verstand jetzt, in diesen Morgenstunden in Oslo, dass man aus allem hinausfallen konnte, dass man zugrundegehen konnte. Er ging an einem Mann vorbei, der auf einem Rucksack vor einem Schaufenster saß, ein Stück Karton zwischen den Beinen: Ich habe Hunger und kein Zuhause, stand da mit rotem Filzstift, und der Bettler hatte die Hände gefaltet, er betete um Geld. Er selbst hatte sein Geld in der Hosentasche, zu einer Rolle gedreht. Es würde zu Ende gehen. Man musste Geld verdienen. Man musste eine Ausbildung absolvieren. Man musste eine Anstellung finden. Man musste ein Einkommen haben, eine Wohnstatt, das begriff er schon nach wenigen Stunden in Oslo; er zog einen Hundertkronenschein aus der Hosentasche, faltete ihn auf, ging zurück zu dem Bettler und legte ihm den Schein in den Pappbecher.
Sollte er nach Hause fahren?
Nein, der Bettler hatte ihn angespornt; auch er konnte draußen schlafen, auch er wollte arm sein, auch er war stark genug, um Widrigkeiten und Niederlagen zu ertragen. Wäre er das nicht, könnte er ebenso gut aufgeben, ja, das Leben aufgeben, hier und jetzt, er könnte sein Leben denen geben, die zu Türen ein und aus gingen, ein und aus in Studien und Berufe, Familienleben und Pflicht, Wohnblocks und Reihenhäuser, Einfamilienhäuser und Autos, Wochenendhäuser und Garagen; er wollte das nicht. Ins Geschäft rein und raus, er ging an Buchläden vorbei, an Uhrmachern, Goldschmieden, Modeläden, Möbelläden, Kaufhäusern, Schuhen, Handschuhen, Gürteln, Küchenutensilien, Eisenwaren, Weißwaren, Lampen und Gardinen, Silberbesteck und Porzellanzeug, Blumenvasen und Kerzenleuchtern, Bodenteppichen und Badezimmerzubehör; was sollte er mit all dem? Man sollte arbeiten, um sich diese Dinge anzuschaffen, um sie zu besitzen. Die Dinge sollten ihn an die Arbeit und den Alltag binden, das war die Funktion der Dinge, man band sich an sie. Man wurde von den Dingen gebunden. Man wurde von der Arbeit gebunden, die nötig war, um die Dinge zu besitzen, dachte er in Oslo. Es brauchte nicht mehr, als durch eine Zugreise ein klein wenig von zu Hause entfernt zu werden, schon wurden die Gedanken schärfer. Eine Reise intensiviert die Gefühle und schärft die Gedanken, dachte er in Oslo, und so erhielt diese Reise plötzlich ihre Rechtfertigung; er reiste, um zu lernen, er reiste, um zu sehen. Hatte er nicht schon mehr dadurch gelernt, ein paar Stunden durch die Straßen von Oslo zu gehen, als in neun Jahren Schulbesuch? Was er wirklich brauchte, war etwas zu essen und zu trinken. Er brauchte einen Schlafsack, vielleicht eine Matte, und schon war er frei. Jedenfalls für ein paar Wochen. Er war frei, solange das Geld reichte, er konnte tun, was er wollte, reisen, wohin er wollte.
Er beschloss, Notizbuch und Stift zu kaufen. Er wollte niederschreiben, was er dachte. Er wollte notieren, was er sah. Er wusste es noch nicht, aber dies waren die ersten Vorbereitungen zum Schreiben. Wann wird man ein Schriftsteller? Wo kommen die Ideen her und wann wird es ernst damit, zu einer Bestimmung? Man weiß es nicht und dennoch gibt es einen Anfang; und sein Anfang war diese Reise nach Oslo: Man geht in einen Buchladen, kauft einen Stift und ein Notizbuch.
Er saß im Zug nach Kopenhagen, am Fenster, klappte das kleine Tischchen an der Rückenlehne vor sich herunter, legte das Notizbuch auf den Tisch, holte den Kugelschreiber hervor, notierte Tag und Datum; und so begann er zu schreiben.