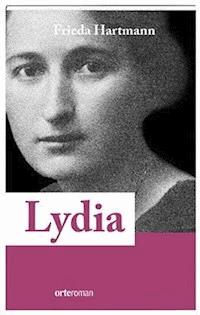
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Orte Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gross und blond soll der Liebste sein, und den ersten Kuss will sie ihm erst am Verlobungstag geben - das nimmt sich die junge hübsche Lydia vor. Ihren Idealen treu zu bleiben, trägt ihr Erniedrigung und Schande ein sowie den Ruf, hochmütig und stolz zu sein. Das Glück, das sie durchaus auch erlebt, erweist sich als trügerisch. Trotz der Verzweiflung hält sie immer wieder an der Hoffnung auf ein anständiges Leben fest. Ihr Wunsch erfüllt sich schliesslich anders, als sie je gedacht. Ein Reprint des bewegenden Heimatromans mit Happy End aus dem Toggenburg. Die Erstausgabe von "Lydia" ist 1938 erschienen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frieda Hartmann
Lydia
Frieda Hartmann
Lydia
Roman
Mit einem Nachwort von
Hansruedi Kugler
orte Verlag
© 2016, orte Verlag, CH-9103 Schwellbrunn
Reprint des 1938 im Verlag H. Feuz, Bern, erschienenen Romans.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Radio und Fernsehen,
fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und
auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
Satz: orte Verlag, Schwellbrunn
ISBN 978-3-85830-195-6
ISBN eBook: 978-3-85830-196-3
www.orteverlag.ch
eBook-Herstellung und Auslieferung: HEROLD Auslieferung Service GmbHwww.herold-va.de
1
«Schwizerländli ist jo chli,
aber schöner chönt’s nöd si.»
So klang eine jugendliche Mädchenstimme durch die laue, von Blütenduft erfüllte Frühlingsluft und vermischte sich mit dem hellen, melodischen Klang der grossen und kleinen Herdenglocken. Mitten in Gras und Blumen lag die kleine Sängerin, die Hände unterm Kopf verschränkt, in einem ausgewaschenen hellen Kattunkleidchen und gleicher Schürze. Freilich, sie hatte gut singen, die braune Hirtin, denn nichts beschwerte ihr junges Herz. Gar friedlich weideten die schweren, braunen Kühe, und auch die lebhaften roten Toggenburger Ziegen liess sich das saftige Futter schmecken. Wolkenlos blaute der Himmel über ihr, und in der Ferne grüssten die Berge, ein wundervolles Panorama: Säntis, Stockberg, Schindelberg, die Churfirsten, die Speerkette. Drunten im Tal, eingebettet in liebliches Grün, lagen die Dörfer und Weiler, und wie eine silbrige Riesenschlange durchzog die Thur das Tal; bis hinauf zu den tannenumkränzten Bergeslehnen lagen die Bauerngehöfte zerstreut, gross und breit die einen, klein und niedrig die andern. Tiefer Friede lag über der ganzen Gegend; manch abgehetzter Städter hätte die sorglose Hirtin um das Bild, das sich ihren Augen bot, beneidet.
Ein wohlgenährtes Geisslein näherte sich dem nahen Grünhag, stellte sich auf die Hinterbeine und naschte von den jungen Brombeer- und Haselstauden. Vorsichtig sah es sich nach allen Seiten um, dann zwängte es den Kopf zwischen zwei Stecken, in der festen Absicht, dem Nachbarn einen Besuch abzustatten. Aber diese Handlung ging leider nicht ohne Lärm vor sich, und mit einem Ruck richtete sich die Geisshirtin auf.
«Halt, was gibt’s denn dort!», schalt sie Züsel, die Ziege. «Was machst wieder, komm schnell, komm! Ho, Geissli, Gizgizgiz!»
Das ertappte Geisslein bewegte unruhig den kurzen Schwanz. «Mäh!», machte es kläglich und schuldbewusst, «mäh, mäh!» Das Mädchen griff in die Schürzentasche und hielt eine Handvoll Salz hin. «Komm, Züseli, komm!», schmeichelte es, «schau, was ich hier Gutes habe.» Mit ein paar Sprüngen war das Geisslein neben ihr, um sich den Leckerbissen zu sichern; aber schon war ein ganzes Rudel bei dem Mädchen; jedes wollte zunächst sein, und die kleine Hirtin hatte Mühe, ihren Platz zu behaupten. Aufgebracht, mit ein paar kräftigen Kläpsen jagte sie die drängende Gesellschaft fort. «Ihr dummen Viecher», schimpfte sie, «glaubt ihr denn, ich habe einen ganzen Zentner Salz im Sack. Ob ich wohl noch alle habe?», und sie fing an zu zählen, eifrig mit dem Finger zeigend, «ein, zwei, drei, vier – zwölf, ja, ich habe heute Vormittag nie mehr gehabt. Wo wohl Anny mit ihren Geissen hockt?» Friedlich zerstreuten sich die Geissen wieder, das Mädchen zog ein kleines Sackmesser aus der Tasche, schnitt sich am Hag eine Rute und zeichnete schöne, gleichmässige Ringe in die saftige Rinde. Ein spitzbübisches Lächeln erschien auf ihren Lippen, dann sang sie mit schmetternder Stimme:
«Dert obe uf em Bergli,
da stoht e bruni Heidelidum;
dert obe uf em Bergli,
da stoht e bruni Chue.»
Mitten in den klangvollen Jodel hinein rief eine ängstliche Stimme: «Lydia, Lydia!»
Auf einer Anhöhe stand ein Mädchen, ziemlich in der gleichen Grösse wie die Angerufene, blond und rund, während Lydia braun und schmal war. Unwillig über die Störung wandte Lydia den Kopf. «Was ist?» – «Hilf mir doch, die Geissen sind mir zur Elsbeth», kam’s weinerlich zurück.
«Hättest halt besser aufpassen sollen», entgegnete Lydia schnippisch, «meinst gewiss, ich hole sie dir, damit mich die Elsbeth wieder wacker anschnauzen kann.» Im selben Augenblick ertönte von der Scheune her ein kurzer, scharfer Pfiff.
«Jesses, der Vater», entfuhr es den beiden Mädchen, und schon erscholl eine herrische Stimme: «Wollt ihr sofort die Geissen holen, oder muss ich euch Beine machen?» – «Komm, wir gehen unter dem Hügel durch», schlug Lydia vor, «da sieht uns der Vater nicht», und im Hui setzten sich zwei Paar nackte Beine in Bewegung, und Schürzenzipfel und Zöpfe flogen. Beim Lattenzaun, der die beiden Güter trennte, angelangt, hielten sie atemlos inne und spähten umher. «Wo sind jetzt die Geissen?»
Anny zog die Schwester durch den Gatter. «Schau, dort neben dem Haus ist der Cäsar, die Geissen sind gewiss hinter dem Haus.»
«Wohl, das wird wieder gut», jammerte Lydia, «die Elsbeth wird wohl – heiliger Bim-Bam, dort ist sie ja, schau, wie sie dreinschaut, sie ist sauwild; wenn wir nur umkehren dürften.»
Doch das Umkehren verging den beiden, denn die gefürchtete Nachbarin drohte, sofort zum Vater zu gehen, wenn sie nicht augenblicklich die Geissen holten und in Zukunft besser hüteten. Mit hochroten Köpfen schossen die beiden davon und trieben die Missetäter heimwärts. «Der Bock ist ja noch da», rief die aufgebrachte Frau.
«Der kommt dann schon, lasst ihn nur machen», rief Lydia über die Achsel zurück; sie wusste gut genug, warum sie ihn machen liess.
«Ja, das wäre noch schöner», räsonierte die dicke, kleine Frau, sie kannte zwar die Grillen von Cäsar, aber fort musste er trotzdem, und das sofort.
Wohl wagte sie sich nicht zu nahe an den stolzen Ziegenvater heran; ein paar Meter von ihm entfernt schlug sie mit dem mächtigen Stock auf den Boden: «Sch, sch, sch, du freches Stinktier, mach, dass du fort kommst!»
Der Ziegenbock, ein Rassentier seines Stammes, hielt es unter seiner Würde, auf diese Aufforderung zu reagieren, ruhig frass er weiter, aber doch nicht, ohne vorsichtig nach seiner Widersacherin zu schielen.
Kampfesmutig wagte die Frau einen weitern Vorstoss; sie hob den langen Stecken, um dreinzuschlagen; ein kurzes, zorniges Meckern, der gewaltige Bock schob sich auf die Hinterfüsse, und die erschreckte Frau suchte mit erstaunlicher Schnelligkeit Schutz hinter einem Baum. Aber der Bock war zu empört, um gleich von seiner Friedensstörerin abzulassen; zwei-, dreimal wiederholte er das gleiche Manöver, immer um den Baum herum, und Lydia, die das sah, bekam nun doch Angst. Schnell lief sie zurück. «Komm, Cäsar, komm!» Sie stellte sich fast unmittelbar vor den erzürnten Bock und lenkte so seine Aufmerksamkeit auf sich.
Freilich ging es auch bei ihr nicht ohne Kampf ab; aber sie war flink, eine rasche Drehung, ein kräftiger Hieb auf den Rücken des widerspenstigen Tieres, dann ein kurzes, zorniges Meckern, und mit mächtigen Sprüngen und fliegender Mähne jagte er seinen Weibern nach.
«Die Elsbeth wird wohl in Zukunft den Bock in Ruhe lassen», kicherte Lydia, als sie die Schwester erreicht hatte, «ich bin fast zerplatzt vor Lachen, die kann noch springen, wenn’s pressiert.» «Komm, wir jagen die Geissen unter dem Hügel durch in die untere Wiese», schlug Anny vor, «dann hüten wir beieinander.» Als sie an den Platz kamen, wo Lydia vor einer Viertelstunde so gemütlich gesessen, war keine einzige Geiss mehr zu sehen, und die Kühe weideten friedlich wie zuvor.
«So, da siehst du’s», – Lydia war dem Weinen nahe –, «alles ist fort, und du bist, schuld.» – «Ich helf’ dir ja», beschwichtigte Anny.
«Ja, sieh, hier im Hag haben sie wieder ein Loch gemacht.» Still und vorsichtig, damit es vom zweiten Nachbarn nicht auch noch Rüffel absetzte, trieben sie die naschhaften Tiere zurück, und bald sassen die geplagten Hirtinnen einträchtig bei der ruhig weidenden Herde.
«Du, Lydia, was hast du vorhin für ein Lied gesungen?» – «Ah, du meinst ‹Dert obe uf em Bergli›; das hat mich gestern nach der Kinderlehre die Trine gelehrt; gelt, es ist schön; komm, ich sing den zweiten Vers; den ersten wirst wohl gehört haben», und sie hub an:
«Und wenn sie d’Schwizer melched,
so lueged d’Schwobe Heidelidum,
und wenn sie d’Schwizer melched,
so lueged d’Schwobe zue.»
«Das ist schön und lustig, der Jodel gefällt mir gar gut», lobte Anny, und sie fingen wieder von vorne an. Nachher probierte Lydia sogar aufs Geratewohl die zweite Stimme, und beide fanden, es töne überaus prächtig, und die Kühe und Geissen, die satt und friedlich käuend im Gras lagen, schienen dazu zu nicken. «Bim, bum» machten die grossen und kleinen Glocken, im nahen Baum zwitscherte ein Vogel, vom Dorfe her klangen die Mittagsglocken, und unablässig schmetterten die beiden Mädchen ihr «Diriaho» in den strahlenden Frühlingstag hinein.
Eine Stunde später sass die ganze Familie des Hof-Mattes, so hiess der Vater der beiden Hirtinnen landauf und -ab, beim Mittagessen. Oben am Tisch sass der Bauer in kurzärmeligem weissem Hemd und Zwilchhose, kaum mittelgross, mit klugem, energischem Gesicht. Energisch und entschlossen war auch der Blick der grauen Augen, denen so leicht nichts entging, was sie sehen sollten. An seiner Seite sass die Bäuerin, die allzeit treue und besorgte Mutter der grossen Familie, klein, rund und rotwangig, mit einem Gesicht voll Liebe und Herzensgüte. Lydia sass neben dem Vater, dies war das Recht des jeweiligen Jüngsten seit Anbeginn, voraussichtlich sollte sie dies auch am längsten behalten. Anna hatte den Platz neben der Mutter; dann kamen dem Alter nach die andern Söhne und Töchter. Freilich, alle waren nie daheim, die Ältesten hatten schon einen eigenen Hausstand gegründet, längst war der Mattes Grossvater.
Kaum 22 Jahre alt, hatte er das Heimwesen von seinem Vater geerbt, seine junge, arbeitsame Frau heimgeführt. Ein gerüttelt und geschüttelt Mass voll Arbeit ward der arbeitsamen kleinen Frau zuteil. Die Kinder kamen eins ums andere, dazu der grosse Hof. Der Mattes war, wenigstens in jungen Jahren, durchaus nicht immer derjenige, der die ungeheure Arbeitslast erkannte, die auf seiner Frau ruhte. Bis zur letzten Stunde schaffte die nimmermüde Frau, dann legte sie sich hin, und wenn in der alten Wiege wieder ein Kleines schrie, lächelte sie froh: «Gottlob, ’s ist wieder vorbei; ja, wenn sie nur allemal gesund und alle Glieder gerade haben; sie werden ja auch wieder gross und können schaffen helfen.» Fragte einer den Bauern: «Du, Mattes, wie hoch willst eigentlich?», dann lächelte er sein karges, trockenes Lächeln und meinte: «Muss Geissbuben haben. Die andern werden alle Jahr grösser, und ich brauche sie anderswo, zum Geissen und Kühe Hüten sind sie bald gross genug.»
Ja, die Geissen, die waren dem Hof-Mattes sein Steckenpferd. Mochten seine Buben und Mädel schimpfen, mochten seine Nachbarn, mit denen man sonst auf bestem Fusse stand, räsonieren und reklamieren, alles half nichts, ein Rudel Geissen von der besten Rasse wollte der Mattes haben neben seinem Stall voll Kühen; sein Hof ohne Geissen, das wäre ja gar nicht mehr der Matteshof.
Beim Essen wurde wenig gesprochen; der Bauer gab einige Befehle für den Nachmittag und wollte über dies und jenes Auskunft haben, dann wandte er sich an Otto, seinen jüngsten Sohn, und Lydia. «Ihr könnt dann morgen mit den Rindern und Geissen in den Berg.» Ganz ruhig sagte er dies, als sei weiter nichts dabei, und doch war’s Lydia, als wollte ihr vor Schreck der Atem vergehen. Noch eben hatte sie die langen Fäden bewundert, die ihre Käsknöpfli zogen, aber sie kam mit der Gabel nicht mehr weiter. Auf halbem Wege hielt sie inne und sah den Vater mit entsetzten Augen an. «Ich? …», fragte sie, und es verschlug ihr fast die Stimme vor Angst und Schrecken. Der Vater sagte weiter kein Wort; er schien ihre Not nicht zu bemerken, aber als ihr verängstigter Blick die Mutter suchte, sah diese sie an, warnend, aber auch mitleidig und begütigend.
Lydia hatte plötzlich keinen Hunger mehr, und doch hatte sie vorhin fest im Sinne gehabt, noch einen ganzen Teller voll zu schöpfen. Mit grosser Mühe würgte sie die paar Gabeln voll hinunter; ihr war, als stecke ein grosser Brocken im Hals, der weder hinauf noch hinunter wollte. – Als erste verliess sie den Tisch, und als die Mutter einige Zeit später in die Küche kam, stand sie am Fenster und weinte.
Sachte strich die Mutter über den braunen Mädchenscheitel: «Musst nicht weinen, Kind, kannst es halt nicht ändern.»
«Warum kann denn nicht Anny gehen, sie ist doch älter als ich», schluchzte das Mädchen.
«Wir können Anny hier nicht entbehren.»
«Ich kann grad so gut schaffen wie sie, ich weiss schon, Anny schickt ihr halt nicht, weil sie sich immer fürchtet; aber mich fragt ihr halt nicht», trotzte Lydia.
«Vater hätte viel zu tun, wenn er alle fragen wollte, was ihnen beliebe, lass dir nur nichts anmerken, sonst gibt’s dann noch ein Donnerwetter; überhaupt», fügte sie dann begütigend hinzu, «ist die Sache gar nicht so gefährlich, wie du tust, das Vieh könnt ihr den ganzen Tag auf der Weide lassen, schaffen müsst ihr ja auch nicht streng, und zu essen geb ich euch gut und genug mit, und weisst», lächelte sie gütig, «nächste Woche wird das Säuli geschlachtet, da gibt’s dann Blutwürste, und einen ganz grossen Braten könnt ihr dann auch machen.»
Aber alles verfing nichts bei dem Mädchen, ganz erbärmlich schluchzte es auf: «Aber ich fürchte mich, Mutter, ich fürcht mich ganz schrecklich; im Berghaus hat es Geister, und ich darf nachts nicht droben schlafen, ganz sicher nicht.»
Die Mutter, die sich am Herde zu schaffen machte, wandte sich rasch um. «Was sagst?» – «Geister hat’s droben, der Laui-Joseph hat’s gesagt, ganz sicher hat’s Geister.»
«Jesses auch, um Himmels willen, was bringst du da für einen Blödsinn», die Mutter lachte hell auf. «Geister gibt’s ja gar keine, weder im Berg noch sonst wo.» – «Aber der Laui-Joseph hat’s doch gesagt; sein Grossvater hat einmal dort gewohnt, der habe es oft rumoren gehört.» – «Jetzt hör mal endlich auf mit dem dummen Quatsch, ich bin jetzt 50 Jahre alt, habe aber noch nie etwas von Geistern gespürt, und bin schon Tage und Wochen im Berg droben gewesen; hoffentlich glaubst du mir mehr als dem alten Plauderi.»
Lydia antwortete nichts, sie hörte den Vater gegen die Küchentüre zuschreiten und machte sich schleunigst aus dem Staube. «’S ist mir schon gar nicht recht, dass die beiden Gofen allein in den Berg müssen», bemerkte die Mutter besorgt, «denk, es sind noch Kinder, der Otto dreizehn und die Lydia zehn Jahre alt, und die zu etwa zwanzig Rindern; wenn’s was gäbe mit dem Vieh oder gar mit dem Feuer.»
«Ich kann die Grössern nicht entbehren; sie können ja aufpassen», fertigte der Bauer die besorgte Mutter kurz ab. Als er hinter das Haus kam, sass Lydia auf einer Beige Haglatten und weinte bitterlich. «Was hast?», fragte der Vater kurz. – «Ich geh nicht gern in den Berg», schluchzte Lydia verzweifelt.
«’S wird dich wohl niemand fressen», kam’s schon im Fortgehen zurück, und alsbald war der Bauer um die Ecke verschwunden.
Von neuem gab sich Lydia ihrem Herzeleid hin, als sie Otto mit einem ziemlich derben Puff aufschreckte. «Warum plärrst so?»
«Weil ich in den Berg muss.»
«Ich muss auch gehen, und tu nicht so dumm, das ist doch nichts Schreckliches.»
«Aber ich fürcht’ mich vor den Geistern, weisst, der Laui-Joseph hat’s doch erzählt, es geistert droben.»
«Bist eine dumme Gans, glaubst dem alten Waschweib allen Blödsinn; es gibt keine Geister, ganz sicher und heilig nicht.»
Zaghaft, mit einem Hoffnungsschimmer hob die kleine Geisshirtin das verweinte Gesichtchen. Wenn der Otto sagte sicher und heilig, war schon etwas dran; sie zankte sich ja oft mit ihm; aber heimlich hatte sie doch Respekt vor dem klugen Buben.
«Mir ist schon allerhand eingefallen, was wir treiben wollen», sagte Otto eifrig, und die beiden streckten die Köpfe zusammen und tuschelten und lachten heimlich. Otto war ein findiger Kopf und Lydia seine getreue Helferin, wenigstens da, wo es galt, unnützes Zeug und Dummheiten zu machen.
Schon zeitig war es auf dem Matteshof lebendig. Stillschweigend wurde das Morgenessen eingenommen. Otto packte wacker ein, während Lydia kaum einen Bissen hinunterbrachte. Die zuversichtliche Stimmung von gestern war wie weggeblasen. Wohl hatte sie mit der Mutter Erlaubnis allerlei eingepackt, um die Stube in dem alten Haus etwas heimeliger zu machen; aber all das tröstete sie wenig. Heute war Dienstag, und bis zum Sonntag sollte sie die Mutter nicht mehr sehen, dies war das schwerste von allem.
Rinder, Kälber, Geissen und Schafe, alles war aus den Ställen getrieben. Das war ein Durcheinander, ein Muhen, Meckern und Blöken, ein Gumpen und Beineln. Die alte Geiss rief kläglich nach ihrem Jungen, das sich gestern Abend ein Bein verstaucht hatte und nun daheim bleiben musste, und das schwarze Schaf hatte seine beiden Lämmer verloren, lief wie besessen zurück zur Scheune, und zwei-, dreimal ringsherum, trotzdem die beiden Jungen bei der Herde waren und schrecklich blökten.
In all den Lärm hinein ertönte die Stimme des Mattes, kurz, laut und herrisch, dass es einem General Ehre gemacht hätte. Endlich war alles auf der eingezäunten Strasse. Wortlos, die grossen Braunaugen voller Tränen, reichte Lydia der Mutter die Hand.
«Sei tapfer, Kind», mahnte die Mutter gütig, «wein nicht, sonst sieht’s der Vater, und gelt, ihr tragt mir Sorg zum Feuer. So und jetzt geh schnell, behüt euch der Herrgott!» Damit wandte sich die Mutter um und ging dem Hause zu. Lydia aber folgte schweren Herzens der übermütigen Herde.
«Wie viel Holz, glaubst, dass es braucht, bis der Braten weich ist?», fragte Otto, der Rindersenn, seinen Handbuben, die Lydia. Lydia stand an dem alten Herd in der russigen Küche und briet ein prächtiges Stück Schweinefleisch goldgelb. Die kleine Köchin überlegte einen Augenblick, dann meinte sie bedächtig: «Schon sicher zwei Zainen voll. Weisst, es wäre doch schad, wenn der Braten nicht lind genug würde, schau doch, wie schön gelb er wird.»
«Ich wollte, es wär’ schon Mittag», nickte Otto geschäftig, «mir wässert schon der Mund danach», und er warf Klotz um Klotz in den grossen Ofen. «So, ich glaube, es tut’s jetzt.»
«Wirf lieber noch ein paar hinein», riet Lydia, «weisst, es ist ein alter Ofen, und die brauchen viel Holz. So, ich stelle den Braten in das Stubenrohr, und jetzt gehen wir auf die Weide und lesen Steine auf, damit wir Hunger kriegen.»
Friedlich graste die Herde auf der nahen Weide. Voll Eifer trugen die beiden Steine an einen Haufen. «Ja, die grossen hätten wir jetzt, dies wäre noch schnell gegangen, aber was machen wir mit den kleinen?», fragte Lydia. «Nimm sie in die Schürze!», schlug der praktische Bruder vor. «Was wollen wir sonst machen?» – «Aber wenn sie kaputt geht?» Otto lachte: «’S wär’ nicht viel hin, um die ist’s, mein’, nicht schade, um so einen ausgewaschenen Lumpen.» Also wurde die Schürze mit viel Eifer immer wieder voll gemacht, schon ein ordentliches Stück war gesäubert; aber, o weh, die Schürze kriegte ein Loch, das grösser und grösser wurde, und zuletzt war’s rein unmöglich, noch etwas darin zu transportieren. «Mutter wird schön schimpfen, wenn sie es sieht», meinte Lydia bekümmert. Doch Otto machte: «Sei froh, dass sie kaputt ist»; und als sich Lydias besorgtes Gesichtchen nicht aufheitern wollte, schlug er vor: «Komm, wir wollen mal nach dem Braten sehen, es ist bald Zeit zum Essen.»
«Ja, wenn nur unser Braten genug Wasser hat, vielleicht hätten wir mal nachsehen sollen», mit diesen Worten eilten die beiden dem Hause zu.
«Herrje, wie ist das eine Hitze», schrie Lydia auf, als sie die Stubentüre öffnete, «wie in einem Bratofen»; und sie eilte zum Fenster und riss einen ganzen Fensterflügel auf.
«Unser Braten, ich glaub, der hat warm genug gehabt», mit diesen Worten riss Otto die alte gusseiserne Ofentüre auf, die ganz rot vor Hitze war. Entsetzt wich er zurück; aus dem Ofenrohr schlug ihm eine glühende Hitze entgegen.
«Hier, nimm den alten Lismer und wind ihn um die Hände», riet Lydia, «wir müssen den Braten herausnehmen, sonst geht er kaputt.»
«Wenn er nicht schon ist», keuchte Otto, indem er mit Todesverachtung das alte Email-Kacheli herausfischte.
Besorgt und neugierig hob Lydia den Deckel, eine Flamme schlug den beiden daraus entgegen, ein zweistimmiger entsetzter Aufschrei; im nächsten Augenblick lief Otto zum Fenster und schleuderte das gefährliche Kacheli in weitem Bogen zum Fenster hinaus. Bleich und zitternd vor Schreck blieben sie am Fenster stehen. «Wo ist wohl der Braten?» fragte Lydia zaghaft. «Komm wir holen ihn, alles wird wohl nicht fort sein, man sieht’s von hier aus nur nicht recht», beruhigte Otto; aber ach, einen Augenblick später standen die beiden vor den spärlichen Überbleibseln ihres herrlichen Mittagessens, zwei halbverkohlte Beinlein, sonst nichts. Zerknirscht, mit den Tränen kämpfend, setzten sie sich vor das Haus, mit einem Stück trockenen Brotes, nicht einmal Milch wärmten sie. «Z’leid nicht!», trotzte Otto. «Was wollen wir nun anfangen?», fragte Lydia, als sie das Stück Brot mit einigen stillen Tränen heruntergeschluckt hatte. – – – «Ja so, du schläfst; hast eigentlich recht. Wenn man nur trockenes Brot hat, mag man halt nicht schaffen.» – Mit einem abgrundtiefen Seufzer zog sie die Schürze untern Kopf und schlief wenige Minuten später tief und fest.
Erst als einige schwere Regentropfen ihnen ins Gesicht schlugen, wachten die beiden auf und flüchteten ins Haus.
«Jetzt können wir doch sicher keine Steine mehr auflesen, meine Schürze ist kaputt, und regnen tut’s auch noch, was wollen wir nun machen?»
«Du, weisst was mir geträumt hat?», fragte Otto. «Wie soll ich das wissen?»
«Mir hat geträumt, ich sei ein Kurgast im Rietbad, weisst, dort in der Quelle oben bin ich in einer Hängematte gelegen, und hab ein schönes Buch gelesen und geschaukelt, fein war’s.»
«Was ist denn eine Hängematte?»
«Herrjeh, hast du dies denn noch nie gesehen?», und so anschaulich als möglich schilderte er ihr die Sache. «Könnten wir die hier nicht auch machen?», fragte Lydia unternehmungslustig. «Wir haben ja kein Netz.»
«Aber unser Leintuch, das wär doch stark genug.» «Draussen regnet’s ja.»
«Kann man’s denn nicht in der Stube auch machen?» «Dummes Ding, man muss doch Bäume haben, vier Bäume.»
Lydia sah wehleidig zum Fenster hinaus. Wenn die Sonne schien und sie im Freien sein konnte, ging es ja ganz gut, aber wenn es trüb und regnerisch war, kam das Heimweh nach der Mutter, und wohl auch ein wenig die Gespensterfurcht.
Otto rannte in die Stube: «Du, Lydia, wir nehmen doch ein Leintuch und machen einfach vier Löcher in die Decke, das gibt eine prächtige Hängematte.»
Lydia war gleich Feuer und Flamme. – «Ich habe in der Grümpelkammer einen grossen, alten Bohrer gesehen, mit dem geht’s schon.» Mit glühenden Wangen machten sich beide an die Arbeit. Daran, was der Vater zu der Sache sagen würde, dachte keines von beiden.
«Wenn wir nur genug Schnüre oder Stricke haben.» Otto zog einige solche Sachen aus dem Hosensack, schüttelte den Kopf: «’S langt nicht.»
«An der Gadenwand hängt noch ein Heuseil vom letzten Jahr.»
Wie ein Wirbelwind stob das Mädchen davon und zerschnitt es ohne Bedenken in vier Teile. – «Du, schau, das wird fein, grad recht in der Länge, aber das Loch ist noch zu klein, ich bring’s nicht durch.
«Nimmst halt das Sackmesser und machst es grösser», gebot Otto. Gesagt, getan, und gegen Abend hing die schönste Sänfte an der Decke. Nur einmal konnte jedes probieren, dann war’s leider Zeit zum Eintreiben, aber morgen war ja auch noch ein Tag.
«Das war ein gelungener Einfall», lobte Otto, doch Lydia durchfuhr es plötzlich heiss. «Wenn Vater kommt und die Löcher sieht und das kaputte Seil!»
«Abah», machte der Bub leichthin, «morgen ist Markt, da kommt er nicht, nachher nehmen wir’s wieder weg, Vater wird dann nicht gerade zuerst nach der Decke gucken.»
Bequem ausgestreckt, die Hände unterm Kopf verschlungen, lag Otto in der neuerstellten Sänfte. Lydia sass daneben auf einem alten wackligen Stuhl und sorgte dafür, dass die Sänfte wacker in Schwung kam, und in schönster Eintracht und Harmonie sangen sie zweistimmig das Lied:
«Wie fein und lieblich, wenn unter Brüdern,
wenn unter Schwestern, die Eintracht wohnt.»
Da, mitten im zweiten Vers, brach Lydia jäh ab und sprang mit allen Zeichen des Entsetzens vom Stuhle auf: «Der Vater!» Ein verzweifelter Blick nach der Tür, der Vater war schon im Gang, jetzt öffnete er die Türe, es gab kein Entrinnen mehr. Ein Sprung auf die Bank, ein Gump zum offenen Fenster hinaus und wohlbehalten landete der kleine Flüchtling auf dem Erdboden. Ohne sich nur eine Sekunde zu besinnen, rannte sie dem nahen Walde zu, wo sie sich keuchend unter das schützende Dach einer grossen Wettertanne warf. Dass das Schicksal den armen Bruder erreichte, war ihr schon während der Flucht klar geworden, denn wie die Posaunen des jüngsten Gerichts klang sein klägliches Heulen an ihr Ohr. Der Vater hatte den armen Sünder denn auch wirklich erwischt. Im Bestreben, so schnell als möglich aus seiner Hängematte zu kommen, stolperte Otto beim Hinabspringen, und ehe er das Fenster gleichfalls erreichte, hatten ihn des Vaters Hände erfasst. Der hatte sofort die ganze Sachlage erkannt.
«Du Lausbub, du fauler Strick», schimpfte er aufs höchste erbost, den Buben wie eine junge Katze hin und her schüttelnd, «nicht einmal den Stall habt ihr gemacht, Steine habt ihr auch keine aufgelesen, dazu macht ihr in die Decke noch solche Löcher, und – Himmeldonnerwetter – das Seil, das schöne Seil habt ihr auch kaputt gemacht.» Es gab sogar noch Schläge; wenn der Mattes Prügel gab, traf er gut.
«So, ich glaube, du hast jetzt für deine Dummheiten», damit liess der Vater seinen Buben los, «aber dem Gof würden auch noch ein paar Tätsch gehören. So, und jetzt fahr sofort ab mit dem Zeug da», und er gab dem zerknirschten Sennen noch eine ganze Reihe Befehle, «und wenn es nicht gemacht ist, bis ich wieder komme, und das Vieh im Dreck ist, dann schaut, wie’s euch geht», so schloss er seine väterliche Strafpredigt.
Mit klopfendem Herzen sah Lydia den Vater aus dem Hause treten. Der sah sich um, als ob er sie suchte. Sprungbereit, atemlos wartete sie, bis sie sah, welche Richtung er einschlug. Sie wäre ohne Besinnen durch dick und dünn geflohen, gleichviel wohin, nur nicht in seine Hände. Erleichtert atmete sie auf. Gott Lob und Dank, er schlug den Weg nach dem Dorfe ein, jetzt stieg er den Hügel hinunter, jetzt sah sie nur noch seinen rotbraunen Sammethut, und nun war auch dieser verschwunden. Auf allen Vieren kroch sie unter der Tanne hervor und reckte und streckte die steif gewordenen Glieder. Was wohl Otto machte? Otto stand am Fenster und wandte sich beim Eintritt der Schwester halb um.
«Hat’s weh getan; hat er dich fest geschlagen?» frug sie mitleidig.
«Aff du, musst noch fragen», fuhr er sie an, «du hast gut lachen.»
«Ich lach doch gar nicht», verteidigte sich das Mädchen, dann ging sie in die Küche, das Mittagessen zu kochen; sie begriff des Bruders Zorn vollkommen.
Nach dem Mittagessen brachten sie endlich die Ställe in Ordnung, das heisst Lydia musste alles allein besorgen. Otto sass in der Tenne auf der Leiter und hielt sich den Kopf. Obschon sie die schwere Arbeit kaum bewältigen konnte, tat sie es doch ohne Murren, denn immer noch lag ihr Ottos klägliches Heulen in den Ohren.
Später mussten auf des Vaters Befehl die Äste einer gefällten Tanne von der Weide nach dem Hause geschafft werden; einmal half Otto, dann war er plötzlich spurlos verschwunden. Unterdessen schaffte das Mädchen weiter, band mit einem Strick vier bis fünf Äste zusammen, um schneller fertig zu werden. Wie kleine Bächlein rann der Schweiss über das erhitzte Gesichtlein; aber sie schaffte es doch, und wenn der Groll über den Bruder in ihr aufsteigen wollte, dachte sie an die Schläge, die er gekriegt, während sie im Schutze der alten Tanne lag, und endlich, endlich waren auch die letzten Äste wohlversorgt vor dem Hause.
Eben bog Otto um die Ecke und hielt einen grossen Strauss Frauenschuh in die Höhe. «Schau da, so schöne grosse, einige sogar doppelt.» Als Lydia ihm erklärte, es seien alle Äste hier, schenkte er ihr gnädig den halben Strauss, und der Friede war wiederhergestellt. Am Abend aber, als das Vieh wohlversorgt in den Ställen war, wurde halt doch wieder geschaukelt.
*
Nun gingen die gefürchteten vier Wochen schon dem Ende entgegen. Lydia war herzlich froh darüber; denn immer quälte sie das Heimweh nach der lieben Mutter, und ganz geheilt von der Geisterfurcht war sie eben doch nicht. – Immer krachte und knackte es in dem alten Hause. Bei dem kleinsten Luftzug klopfte da ein Laden, dort ein loses Brett, und bei jedem noch so natürlichen Geräusch schrak sie zusammen, wenn sie allein im Hause war. Immer schossen ihr die gruseligen Geistergeschichten des alten Joseph durch den Sinn. Musste Otto einmal ins Dorf, hielt sie sich nie länger als nötig im Hause auf, war’s Sonnenschein, setzte sie sich unweit des Hauses ins Gras, sang oder träumte vor sich hin, bei Regenwetter, und ob’s noch so kalt und unfreundlich war, kauerte sie sich in irgendeinen geschützten Winkel vor dem Hause, tausendmal lieber, als allein in der warmen Stube zu bleiben. – So war’s ja auch kein Wunder, wenn sie sich heimsehnte. So unerschrocken und draufgängerisch sie sonst war, in dieser Beziehung war sie ein richtiges Hasenherz, sie schämte sich auch dessen und liess weder dem Bruder noch der Mutter gegenüber jemals etwas verlauten. Aber heimlich zählte sie die Stunden, bis sie ihr unfreiwilliges Handbubenamt ablegen konnte.
Zwei Tage vor der Abfahrt erlebten die beiden nochmals ein kleines Abenteuer. Ganz unvermutet stiessen sie auf der Weide auf einen Beerenplatz. Zwischen Steingeröll und Disteln hervor lachten ihnen die köstlichsten Erdbeeren entgegen. Lydia schrie laut auf vor Freude, es waren die ersten Früchte in diesem Jahr, und schnell wurden sie in die Nastücher gepflückt. «Du, das gibt ein feines Mittagessen», jubelte das Mädchen, «weisst, wir zerstossen die Beeren und geben Zucker dazu, mit Brot und Butter schmeckt es dann fein.»
«’S ist schon gut, dass wir sie nicht zuerst braten müssen, weisst, wie haben wir uns auf den Braten gefreut, und zuletzt gab’s trockenes Brot», lachte Otto.
Er stand am Herd und passte auf die Milch auf, Lydia sass an der Fensterbank und zerdrückte mit einem Löffel die Beeren in einer kleinen Schüssel. Plötzlich fuhr sie wie elektrisiert empor. «Heiliges Gewitter! der Vater kommt.» – «Wo?» – «Ganz nahe dem Haus, Jesses, was mach ich jetzt mit den Beeren, die müssen fort, sonst meint der Vater, wir tun nichts als Beerensuchen.»
«Fahr ab damit», befahl Otto hastig, «aber sofort!» Lydia wusste in ihrer fürchterlichen Aufregung nicht wo aus noch ein, schob sie ins Ofenrohr, riss sie wieder heraus, dann in den Küchenkasten.
«Aber nein, da kann der Vater sie sehen», herrschte Otto sie an.
«Ja, aber wohin denn?», fragte Lydia verzweifelt, denn schon kam der Vater gegen die Haustür, jetzt war er im Gang.
«Fahr doch ab!» Otto stampfte zornig und blies dann mit vollen Backen in die übervolle Milchpfanne hinein.
Lydia flitzte zur Tür hinaus, eben in dem Moment, als der Vater zur andern hereinkam, ein kurzer, bedauernder Blick traf den Inhalt der kleinen Schüssel, und wupps flog alles miteinander in den Jauchekasten. Gottlob, da unten würde der Vater die Beeren nicht sehen, und so harmlos als möglich trat sie einen Augenblick später in die Küche. Der Vater ging bald wieder. Diesmal war es ohne Schelten abgelaufen. Den eben aufgetragenen Kaffee schlug er aus, gab einige Befehle und entfernte sich.
«Wo hast du die Beeren?», fragte Otto, als der Vater ausser Hörweite war.
Lydia wurde rot und war dem Weinen nahe.
«Ich habe sie in den Jauchekasten geschmissen.»
Otto war erst sprachlos, dann überhäufte er sie mit Schmeichelnamen, doch Lydia wehrte sich energisch. «Du hättest es ganz sicher nicht besser gemacht, hast ja immer nur befohlen: ‹Fahr ab, fahr ab, es ist gleich wohin›, hättest mir ja raten können, wenn du gescheiter gewesen wärest.»
Wenig fehlte und die beiden wären sich in die Haare gefahren, daheim wär’s sicher nicht so glatt abgelaufen, hier aber waren sie zu sehr aufeinander angewiesen. «Wo hast du denn das Beckeli?», wollte Otto wissen.
«Das liegt halt auch drunten, es ist mir aus der Hand geschlipft», gestand Lydia kleinlaut.
«Guten Appetit!», sagte Otto und spuckte auf den Boden, die beiden sahen sich an und lachten, lachten, lachten, und das einfache Mittagessen schmeckte ihnen auch ohne Erdbeeren.
2
Wieder blühte der alte Kirschbaum hinter dem Hause, schon zum achten Mal seit Lydias Hirtenzeit, und auf der Wiese weideten die Kühe und Ziegen; aber statt der beiden Mädchen sass ein Bub dabei, den der Mattes auf den Hof genommen. Sonst schien die Zeit wenig geändert zu haben, die Ziegen waren naschhaft und wandersüchtig wie ehedem, und der kleine Geissbub hatte einen heillosen Respekt vor der Nachbarin, die noch jeden Frühling und Herbst die Geissen zum Kuckuck wünschte.
Trat man aber in die grosse, helle Stube, gewahrte man sofort eine Veränderung. Da, wo früher die Diplome für gute Viehzucht und Alpwirtschaft gehangen, hing jetzt das Bild der verstorbenen Mutter. Ja, sie war tot, die gütige, unscheinbare Frau, seit sechs Jahren schon. Im Hochsommer hatte sie sich hingelegt, nachdem sie schon lange so müde und matt gewesen war. «Mein Herz ist nicht mehr in Ordnung; ich muss einmal zum Arzt»; und zum erstenmal in ihrem Leben ging sie zum Doktor. Grosse Herzschwäche hatte die Diagnose des Arztes gelautet, nichts, gar nichts mehr schaffen, ruhen sollte sie. «Ruhen, ich? Nichts mehr schaffen? Zusehen, wie die andern jetzt im Hochsommer schinden und schaffen müssen? Nein, Herr Doktor, das kann ich nicht, es wird schon noch gehen.» Aber es ging nicht mehr. Niemand wollte dies glauben, nicht der Gatte, nicht die Kinder, am wenigsten aber sie selbst, die bis jetzt immer und immer nur an ihre Familie gedacht und für sie gelebt. Der Gedanke, dass die Mutter von ihnen gehen könnte, schien allen einfach unfassbar, und doch rückte das Ende mit jedem Tag, mit jeder Stunde näher, und keines konnte sich dieser fürchterlichen Wahrheit verschliessen.





























