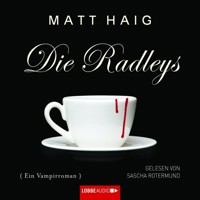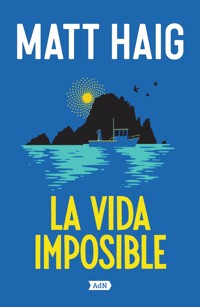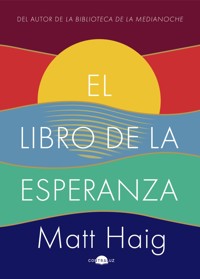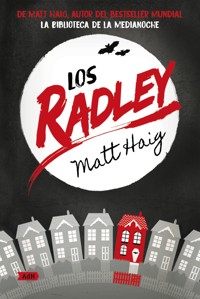9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Sind Sie schon durchgedreht oder arbeiten Sie noch daran? Wir leben in einem Zeitalter der Ängste und der überdrehten Schnelligkeit. Man könnte meinen, unsere gesamte Lebensweise wäre darauf ausgerichtet, uns ins Unglück zu stürzen. Der Life-Overload hat uns fest im Griff. Aber: Können wir etwas dagegen tun? Matt Haig beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie die lärmende Außenwelt unser Denken beherrscht und wie wir uns zur Wehr setzen können. Es geht um große und kleine Dinge, um Weltpolitik, Gesundheit, Smartphones, Social Media, Sucht, Vernetzung. Ein Buch, das uns alle angeht und das uns unserer eigentlichen Aufgabe wieder ein wenig näherbringt: dem Menschsein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
»Wenn Wahnsinn zur Normalität wird, können wir nur gesund bleiben, indem wir den Mut aufbringen, anders zu sein. Wir selbst zu sein.«
Wir leben in einem Zeitalter der Ängste und der überdrehten Schnelligkeit. Der Life-Overload hat uns fest im Griff. Aber vielleicht können wir ja etwas dagegen tun?
Matt Haig beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie die lärmende Außenwelt unser Denken beherrscht und wie wir uns zur Wehr setzen können. Es geht um große und um kleine Dinge, um Weltpolitik, Schlaf, Gesundheit, Smartphones, Social Media, Sucht und Vernetzung.
Ein Buch, das uns alle angeht und das uns vielleicht unserer eigentlichen Kernaufgabe wieder ein wenig näherbringt: dem Menschsein.
Matt Haig
MACH MAL HALBLANG
ANMERKUNGEN ZU UNSEREM NERVÖSEN PLANETEN
Deutsch von Sophie Zeitz
Für Andrea
Irgendwie habe ich das Gefühl,
wir sind nicht mehr in Kansas, Toto.
Dorothy in Der Zauberer von Oz
1 GESTRESST IN EINER GESTRESSTEN WELT
Ein Gespräch, vor etwa einem Jahr
Ich war gestresst.
Ich lief im Wohnzimmer auf und ab und regte mich über eine Meinungsverschiedenheit im Internet auf. Andrea sah mir dabei zu. Glaube ich. Genau weiß ich es nicht, weil ich wie gebannt auf mein Display starrte.
»Matt? Matt?«
»Hm. Was?«
»Was machst du da?«, fragte sie in dem leicht verzweifelten Tonfall, der sich im Lauf einer Ehe einstellt. Zumindest im Lauf einer Ehe mit mir.
»Nichts.«
»Seit über einer Stunde starrst du auf dein Telefon. Du läufst im Kreis herum und rempelst gegen die Möbel.«
Ich spürte eine Enge in der Brust. Mein Herz raste. Kampf oder Flucht. Ich fühlte mich in die Ecke getrieben und bedroht von einer Person im Internet, die 12000 Kilometer entfernt war und der ich niemals begegnen würde. Trotzdem schaffte sie es, mir das Wochenende zu versauen. »Ich muss nur was richtigstellen.«
»Matt, leg das Telefon weg.«
»Ich muss nur…«
Das Problem bei Neurosen ist, dass viele der Dinge, die dir im Moment vermeintlich guttun, dir auf lange Sicht schaden. Du verausgabst dich, wenn du eigentlich tief durchatmen müsstest.
»Matt!«
Als wir eine Stunde später im Auto saßen, sah mich Andrea, die am Steuer war, von der Seite an. Ich starrte zwar gerade nicht auf mein Handy, aber ich hielt es umklammert wie ein Kranker den Krückstock oder eine Nonne den Rosenkranz.
»Matt, geht es dir gut?«
»Ja. Warum?«
»Du siehst fertig aus. Du siehst aus, wie du aussiehst, wenn…«
Sie biss sich auf die Zunge. Sie wollte das Wort »Depression« nicht aussprechen, aber ich wusste, dass sie daran dachte. Außerdem spürte ich es selbst. Noch waren die Angst und die Depression nicht da, aber sie waren im Anzug. Im stickigen Auto konnte ich die Erinnerung daran fast mit Händen greifen.
»Mir geht’s gut«, log ich. »Wirklich, mir geht’s gut…«
Keine Woche später lag ich zu Hause auf dem Sofa und durchlebte die elfte Episode meiner Erkrankung, deren medizinische Bezeichnung »Depression und Angststörung gemischt« lautet.
Abschalten
Ich hatte Angst. Ich konnte nichts dagegen tun. Das Leitmotiv einer Angststörung ist eben Angst.
Die Attacken wurden immer häufiger. Ich hatte Angst, was noch mit mir passieren würde. Es schien, als gäbe es keine Obergrenze für meine Verzweiflung.
Ich versuchte mich abzulenken. Aus Erfahrung wusste ich, dass Alkohol Gift war. Also griff ich zu anderen Mitteln, die mir früher geholfen hatten. Dinge, die im Alltag oft zu kurz kamen. Ich achtete auf meine Ernährung. Ich machte Yoga. Ich versuchte zu meditieren. Ich legte mich auf den Rücken, Hand auf dem Bauch, atmete tief ein und aus, konzentrierte mich auf den Staccato-Rhythmus meines Atems.
Aber alles fiel mir schwer. Selbst die Entscheidung, was ich morgens anziehen sollte, konnte mich zum Weinen bringen. Es half auch nicht, dass ich das alles früher schon erlebt hatte. Halsweh tut auch nicht weniger weh, wenn man es schon mal hatte.
Ich versuchte zu lesen, aber ich konnte mich nicht konzentrieren.
Ich hörte Podcasts.
Ich sah Filme auf Netflix.
Ich besuchte soziale Netzwerke.
Ich versuchte, meine Arbeit in den Griff zu bekommen, indem ich alle unbeantworteten E-Mails beantwortete.
Morgens nach dem Aufwachen griff ich als Erstes zum Telefon, in der verzweifelten Hoffnung, mich von mir abzulenken.
Spoiler-Warnung: Es funktionierte nicht.
Es ging mir immer schlechter. Die meisten »Ablenkungen« trieben mich nur zu weiteren Ablenkungen. Um T.S. Eliots Vier Quartette zu zitieren: Ich war »durch Ablenkungen von der Ablenkung abgelenkt«.
Voller Unbehagen starrte ich eine unbeantwortete E-Mail an, aber es war mir unmöglich zu antworten. Auf Twitter, der digitalen Ablenkung meiner Wahl, wurde das Unbehagen noch stärker. Das Scrollen durch die Timeline fühlte sich an, als würde ich den Schorf von einer Wunde kratzen.
Ich las Nachrichtenseiten – eine weitere Ablenkung –, doch ich konnte die Nachrichten nicht ertragen. Das Wissen um all die Not auf der Welt half mir nicht, meine Krise in die richtige Perspektive zu rücken, sondern vermittelte mir nur das Gefühl eigener Unzulänglichkeit. Weil ich unter meiner abstrakten Not zusammenbrach, während auf der Welt so viel konkrete Not herrschte. Meine Verzweiflung wuchs.
Irgendwann beschloss ich, das einzig Sinnvolle zu tun.
Ich schaltete ab.
Ich verordnete mir Nachrichten-Abstinenz. Ein paar Tage lang würde ich keine sozialen Medien besuchen. In meinem E-Mail-Programm stellte ich die Abwesenheitsnotiz ein. Ich sah nicht fern. Schaute keine Musikvideos. Las keine Zeitschriften. (Während meines ersten Zusammenbruchs vor vielen Jahren hatten selbst Zeitschriftenfotos eine Art visuelles Echo in meinem Gehirn erzeugt und meine Gedanken beim Einschlafen mit grellen, fieberhaften Bildern verstopft.)
Wenn ich abends ins Bett ging, ließ ich das Handy im Wohnzimmer. Ich versuchte, mehr Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Auf dem Nachttisch hatten sich Kabel, Geräte und Bücher aufgetürmt, die ich gar nicht las – ich räumte auf und packte alles weg.
Ich versuchte, so viel wie möglich zu Hause im Dunkeln zu liegen, so wie man es bei Migräne tut. Seit ich mit Anfang zwanzig krank wurde, damals mit akuten Suizidgedanken, wusste ich, dass eine Besserung nur durch eine konsequente Neugestaltung meines Lebens möglich war.
Verzicht.
Wie der Minimalismus-Verfechter Fumio Sasaki sagt: »Weniger macht glücklich.« Bei meiner ersten Panikattacke hatte ich nur auf Alkohol, starken Kaffee und Zigaretten verzichtet. Jetzt, Jahre später, wurde mir klar, dass eine allgemeinere Überlastung das Problem war.
Ein Life Overload. Eine Überlastung des Lebens.
Und ganz sicher eine technologische Überlastung. Die einzige Technologie, von der ich während meiner jetzigen Genesung Gebrauch machte (abgesehen von Herd und Auto), waren gedimmte YouTube-Yoga-Videos.
Die Depression verschwand nicht über Nacht. Natürlich nicht.
Im Gegensatz zum Smartphone gibt es bei Depressionen keinen Ausschaltknopf.
Aber es ging mir zumindest nicht immer schlechter. Mein Zustand stabilisierte sich. Und nach ein paar Tagen wurde ich ruhiger.
Der vertraute Weg der Besserung begann früher. Und der Verzicht auf Reizmittel – nicht nur auf Alkohol und Koffein, sondern auch auf Geräte und Medien – war Teil der Genesung.
Kurz gesagt, ich begann mich wieder frei zu fühlen.
Wie es zu diesem Buch kam
Den meisten von uns ist bewusst, dass manche Aspekte der modernen Welt schädlich für unsere körperliche Gesundheit sind. Dass der Fortschritt Gefahren birgt. Straßenverkehr, Rauchen, Smog, Stubenhocken, Pizza-Service, Radioaktivität, das vierte Glas Rotwein, sie alle stellen Risiken dar.
Selbst die Arbeit am Laptop ist gefährlich. Man sitzt den ganzen Tag und holt sich schnell ein RSI-Syndrom, den sogenannten Mausarm. Und von einem Optiker hörte ich einmal, meine Bindehautentzündung und verstopften Tränendrüsen kämen vom langen Starren auf den Bildschirm. Wenn wir am Computer sitzen, zwinkern wir anscheinend zu wenig.
Und da unsere körperliche und unsere geistige Gesundheit zusammengehören, gilt vielleicht das Gleiche für unsere Psyche: Kann es nicht sein, dass gewisse Aspekte der modernen Welt Risiken für unsere psychische Gesundheit bergen?
Und zwar nicht nur die Technik, sondern auch die Werte unserer Zeit. Werte, die uns antreiben, immer mehr zu wollen, als wir haben. Arbeit höher zu bewerten als Spiel. Unsere Schattenseiten mit den Sonnenseiten anderer zu vergleichen. Immer das Gefühl zu haben, uns fehlte etwas.
Und während es mir Tag für Tag besser ging, kam mir die Idee zu einem Buch – zu diesem Buch.
Schon in Ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben hatte ich über meine psychischen Probleme geschrieben. Doch meine Frage lautete diesmal nicht »Warum soll ich weiterleben?«, sondern »Wie können wir in einer verrückten Welt leben, ohne selbst verrückt zu werden?«.
Nachrichten von einem nervösen Planeten
Als ich mit den Recherchen begann, stieß ich auf unzählige reißerische Schlagzeilen einer reißerischen Zeit. Natürlich sind Nachrichten fast schon per se darauf angelegt, uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Wären sie zu unserer Beruhigung da, wären es keine Nachrichten, sondern Yoga. Oder Hundewelpen. Gleichzeitig entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, wenn Nachrichtenagenturen mit Berichten über Ängste Angst verbreiten.
Hier einige Beispiele:
Stress und soziale Medien schüren psychische Probleme bei Mädchen. (Guardian)
Chronische Einsamkeit ist die Seuche unserer Zeit. (Forbes)
Facebook »kann unglücklich machen«, so Facebook. (Sky News)
»Enormer Anstieg« von Selbstverletzungen unter Teenagern. (BBC)
73 Prozent aller Angestellten leiden unter Stress am Arbeitsplatz. (Australian)
Ständige Konfrontation mit perfekten Promi-Körpern schuld an Essstörungen. (Guardian)
Campus-Selbstmord und die Last des Perfektionismus. (New York Times)
Stress am Arbeitsplatz erreicht Höchstwerte. (Radio New Zealand)
Werden Roboter unseren Kindern die Jobs wegnehmen? (New York Times)
Seit Trump nehmen Stress und Aggressionen an US-amerikanischen Highschools zu. (Washington Post)
Hongkongs Kinder werden auf Erfolg, nicht auf Glück getrimmt. (South China Morning Post)
Stress: Um Leistungsdruck zu bewältigen, nehmen immer mehr Menschen Drogen. (El País)
Aufgebot von Therapeuten soll Angststörungs-Epidemie an Schulen eindämmen. (Telegraph)
»Unsere Gehirne können infiltriert werden«: Tech-Insider befürchten Smartphone-Dystopie. (Guardian)
Macht das Internet ADHD-krank? (Washington Post)
Immer mehr Teenager leiden an Ängsten und Depressionen. (Economist)
Instagram ist die schädlichste Social-Media-App für die Psyche junger Menschen. (CNN)
Was ist der Grund für die weltweit rasant steigenden Selbstmordraten? (Alternet)
Wie gesagt, es ist fast komisch, wie Berichte über die Krise zur Krise beitragen, indem sie das Unbehagen verstärken.
Deswegen ist es auch nicht mein Ziel, festzustellen, wie schrecklich alles ist und dass jede Hilfe ohnehin zu spät kommen wird, denn das erledigen schon Twitter und die Nachrichten. Das Ziel ist auch nicht, darzulegen, dass die heutigen Probleme schlimmer sind als alle früheren. In vielen Bereichen hat sich unser Leben messbar verbessert. In den letzten dreißig Jahren ist laut der Weltbank die Zahl der Menschen, die in extremer Armut leben, weltweit um über eine Milliarde gesunken. Durch Impfungen werden Millionen von Kinderleben gerettet. »Das Schlimmste, was einem geschehen kann, ist, ein Kind zu verlieren«, so der Journalist Nicholas Kristof in der New York Times, »und das Risiko dafür hat sich seit 1990 um die Hälfte verringert.« Bei aller Gewalt, Intoleranz und wirtschaftlichen Ungerechtigkeit, die unsere Spezies auszeichnet, gibt es auf der Welt auch viel Grund zu Hoffnung und Zuversicht.
Doch jede Zeit hält ihre eigenen komplexen Herausforderungen bereit. Vieles ist besser geworden. Aber nicht alles. Es gibt Ungerechtigkeiten. Und es gibt neue Probleme. Viele Menschen leiden unter Ängsten, fühlen sich unzulänglich oder sind sogar suizidgefährdet, obwohl sie – in materieller Hinsicht – besser dastehen als je zuvor.
Aus schmerzlicher Erfahrung weiß ich, dass der gängige Ansatz – auf Errungenschaften wie Gesundheit, Bildung, Durchschnittseinkommen hinzuweisen – nicht funktioniert. Es ist, als höbe man den Zeigefinger und ermahnte einen depressiven Menschen, sich am Riemen zu reißen, schließlich sei doch niemand gestorben. Deswegen soll dieses Buch ein Plädoyer dafür sein, dass das, was wir fühlen, genauso wichtig ist wie das, was wir haben. Unser psychisches Wohlbefinden ist genauso viel wert wie unser körperliches Wohlbefinden – es ist ein Teil davon. In dieser Hinsicht läuft jedoch etwas schief.
Wenn das moderne Leben uns unglücklich macht, können wir uns nicht einfach damit trösten, dass es uns doch so gut geht wie nie zuvor. Unser Unglück ist real. Und unglücklich zu sein, während man ständig erklärt bekommt, was für ein Glück man doch eigentlich habe, ist noch schlimmer.
Ich möchte die deprimierenden Schlagzeilen in die richtige Perspektive rücken und Wege aufzeigen, wie wir uns in einer Welt voller potentieller Panik vor der Panik schützen können. Denn egal wie viele Vorteile wir heute genießen, unsere Psyche bleibt verwundbar. Erwiesenermaßen nehmen heute viele seelische Leiden zu, und wenn uns unser geistiges Wohlbefinden wichtig ist, müssen wir dringend einen Blick auf diese Veränderung werfen.
Was psychische Probleme nicht sind:
Ein Kult.
Eine Modeerscheinung.
Eine Marotte.
Ein Promi-Trend.
Das Ergebnis der wachsenden öffentlichen Wahrnehmung von psychischen Problemen.
Etwas, worüber es einem leichtfällt zu sprechen.
Die gleichen wie eh und je.
Yin und Yang
Es ist eine Geschichte mit zwei Seiten.
Es ist wahr, dass die meisten von uns in der entwickelten Welt vieles haben, wofür wir dankbar sein können. Die höhere Lebenserwartung, der Rückgang der Kindersterblichkeit, die Lebensmittelversorgung, das Dach über dem Kopf, ein Leben ohne Krieg. Viele unserer Grundbedürfnisse sind gestillt. Die meisten von uns leben in relativer Sicherheit, mit einem warmen Bett und Essen auf dem Tisch.
Aber kann es sein, dass die Lösung einiger Probleme andere ausgelöst hat? Haben manche Errungenschaften vielleicht sogar neue Probleme hervorgebracht? Ganz bestimmt.
Zuweilen drängt sich der Gedanke auf, dass wir das Problem des Mangels gelöst und durch das Problem des Überflusses ersetzt haben.
Wo wir hinsehen, versuchen Menschen, ihren Lebensstil zu verändern, indem sie Dinge weglassen. Diäten sind nur das offensichtlichste Beispiel für die neue Mode des Verzichts, aber man denke auch an den Trend, ganze Monate der Abstinenz oder dem Veganismus zu widmen, und die wachsende Sehnsucht nach »digitaler Entgiftung«. Verstärkte Achtsamkeit, Meditation und minimalistischer Lebensstil sind eine sichtbare Reaktion auf unsere überfrachtete Kultur. Das Yin zu dem hektischen Yang des 21. Jahrhunderts.
Zusammenbruch
Als ich meine jüngste Angstattacke hinter mir hatte, kamen mir Zweifel.
Vielleicht war das Projekt eine blöde Idee.
Ich war mir nicht mehr sicher, ob es gut wäre, mich ausführlich mit Problemen zu befassen. Aber dann erinnerte ich mich, dass gerade das Nicht-Aussprechen von Problemen problematisch ist. Es ist das In-sich-Hineinfressen, das dazu führt, dass Menschen in Büros und Klassenzimmern zusammenbrechen. Es ist das Schweigen, das Suchtkliniken und Krankenhäuser füllt und die Suizidraten ansteigen lässt. Also kam ich zu dem Schluss, dass es wichtig ist, etwas über diese Dinge zu wissen. Ich will Gründe aufzeigen, positiv zu denken, und Wege, glücklich zu sein, aber dazu müssen wir die Sachlage genauer betrachten.
Mich interessiert zum Beispiel, woher meine Angst vor Verlangsamung kommt – als säße ich in Speed am Steuer des Busses, der explodieren wird, sobald das Tempo unter 60 km/h sinkt. Und ich will herausfinden, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen meinem persönlichen Tempo und dem Tempo der Welt.
Dabei sind meine Motive simpel und teilweise egoistisch. Ich fürchte mich vor dem, was mit meiner Psyche geschehen kann, denn ich weiß, was ihr schon geschehen ist. Ich weiß auch, dass mein Lebensstil mit schuld daran war, als ich mit Mitte zwanzig krank wurde. Zu viel Alkohol, zu wenig Schlaf, der Ehrgeiz, etwas zu sein, das ich nicht war, der gesellschaftliche Druck im Ganzen. Ich will nie dorthin zurück. Deswegen muss ich wachsam sein, mich nicht nur in Acht nehmen davor, wo Stress hinführen kann, sondern auch davor, wo er herkommt. Kann es sein, dass ich mich manchmal wie am Rand des Nervenzusammenbruchs fühle, weil die Welt am Rand des Nervenzusammenbruchs ist?
Zusammenbruch ist ein schwammiger Begriff, der in der Medizin kaum noch verwendet wird, aber wir wissen alle mehr oder weniger, was gemeint ist. Das Bedeutungsspektrum im Wörterbuch reicht von »Betriebsstörung« bis zu »Zerrüttung«.
Und wir müssen nicht lange suchen, um die Warnzeichen eines Zusammenbruchs zu erkennen, der nicht nur bei uns selbst bevorsteht, sondern auch in unserer Umwelt. Vielleicht klingt es melodramatisch, zu sagen, dass unser Planet kurz vor dem Zusammenbruch stehen könnte. Aber wir wissen zweifelsfrei, dass die Welt sich verändert, in technologischer, in ökologischer, in politischer Hinsicht. Und zwar schnell. Aus diesem Grund müssen wir heute mehr denn je darauf achten, wie wir mit der Welt umgehen – damit wir nicht unter ihr zusammenbrechen.
Das Leben ist schön (aber)
Das Leben ist schön.
Auch das moderne Leben. Vielleicht das moderne Leben besonders. Wir sind verwöhnt von einer Milliarde flüchtiger Zaubertricks. Wir können zu einem Gerät greifen und mit Menschen auf der anderen Seite der Erdkugel sprechen. Wenn wir eine Reise planen, können wir das Urteil Wildfremder zu Rate ziehen, die letzte Woche im Hotel unserer Wahl übernachtet haben. Wir können uns Satellitenbilder von jeder Straße in Timbuktu ansehen. Wenn wir krank sind, können wir uns vom Arzt Antibiotika gegen Infektionen verschreiben lassen, die uns früher umgebracht hätten. Im Supermarkt bekommen wir Drachenfrüchte aus Vietnam und Wein aus Chile. Wenn uns etwas nicht gefällt, was ein Politiker sagt oder tut, war es nie leichter, das frei zu äußern. Wir haben Zugriff auf mehr Informationen, mehr Filme, mehr Bücher – mehr von allem – als jemals zuvor.
Der Microsoft-Slogan aus den 90er Jahren »Wohin willst du heute gehen?« war noch eine rhetorische Frage. Im digitalen Zeitalter lautet die Antwort: Überallhin. Kierkegaard nannte Angst das »Schwindelgefühl der Freiheit«, aber die Entscheidungsfreiheit, die wir heute haben, ist ein Rausch.
Allerdings haben wir zwar unendlich viele Möglichkeiten, aber nicht unendlich viel Zeit. Wir können nicht alles machen, was wir machen könnten. Wir können nicht jedes Leben leben, jeden Film sehen, jedes Buch lesen, jeden Ort auf dieser schönen Erde besuchen. Und um uns von der Qual der Wahl nicht lähmen zu lassen, müssen wir die Möglichkeiten filtern. Wir müssen herausfinden, was uns guttut, und den Rest sein lassen. Wir brauchen keine andere Welt. Alles, was wir brauchen, ist hier. Wenn wir nur aufhören würden zu denken, wir bräuchten alles.
Unsichtbare Haie
Das Frustrierende an unspezifischen Ängsten ist, dass sie so unspezifisch sind. Wir sind wie gelähmt vor Schrecken, obwohl keine Bedrohung in Sicht ist. Reine Hochspannung, aber keine Action. Wie Der weiße Hai ohne den Hai.
Doch häufig gibt es Haie. Metaphorische, unsichtbare Haie. Selbst wenn wir denken, dass wir uns grundlos zerquälen, gibt es Gründe genug.
»Wir brauchen ein größeres Boot«, sagt Chief Brody im Film.
Vielleicht ist genau das unser Problem. Nicht die metaphorischen Haie, sondern das metaphorische Boot. Vielleicht kämen wir besser mit der Welt zurecht, wenn wir wüssten, wo die Haie sind und was für ein Boot wir brauchen, um unangefochten durchs Leben zu schippern.
Absturz
Manchmal fühle ich mich wie ein Computer, bei dem zu viele Programme gleichzeitig laufen. Zu viele offene Fenster auf dem Desktop. In meinem Kopf dreht sich das Regenbogenrad und lähmt mich. Wenn ich nur ein paar Fenster schließen könnte, ein paar Dateien in den Papierkorb schieben könnte, wäre alles gut. Aber welches Fenster soll ich schließen, wenn alle so ungeheuer wichtig scheinen? Wie kann ich die Überfrachtung in meinem Kopf abstellen, wenn die ganze Welt überfrachtet ist?
Wir können über alles nachdenken. Und wenn wir nicht aufpassen, tun wir es irgendwann auch. Vielleicht müssen wir manchmal einfach mutig genug sein, alle Programme auszuschalten, damit wir uns selbst wieder anschalten können. Herunterfahren, um neu zu starten.
Dinge, die schneller geworden sind
Die Post.
Autos.
Leichtathleten.
Nachrichten.
Rechnerleistung.
Fotos.
Filmszenen.
Finanztransaktionen.
Reisen.
Das Wachstum der Weltbevölkerung.
Die Abholzung der Regenwälder am Amazonas.
Navigation.
Technologischer Fortschritt.
Beziehungen.
Politische Ereignisse.
Die Gedanken in unserem Kopf.
Die Rund-um-die-Uhr-Katastrophe
Sorge ist ein altmodisches kleines Wort, das ganz überschaubar klingt. Aber die Sorgen um die Zukunft – seien es die nächsten zehn Minuten oder die nächsten zehn Jahre – bilden das größte Hindernis, das mir im Weg steht, wenn ich im Moment leben und die Gegenwart genießen will.
Ich bin ein Katastrophenmensch. Meine Sorgen sind keine durchschnittlichen Alltagssorgen. Nein. Das reicht mir nicht. Meine Sorgen sind grenzenlos. Selbst wenn ich gerade keine Panikattacke habe, sind meine Ängste groß genug, um die ganze Welt zu umspannen. Ich bin immer gut darin gewesen, mir das Allerschlimmste vorzustellen und in sämtlichen Einzelheiten auszumalen.
So war es, seit ich denken kann. Wie oft war ich beim Arzt in der festen Überzeugung, bald sterben zu müssen, weil ich beim Googeln irgendeine Krankheit entdeckt hatte. Als Kind, wenn meine Mutter nach der Schule auch nur eine Minute zu spät zum Abholen kam, war ich mir sicher, dass sie bei einem schrecklichen Autounfall ums Leben gekommen sein musste. Die Tatsache, dass es nie passierte, verminderte meine Sorge nicht, dass es jederzeit passieren könnte. Denn jeder Augenblick ihrer Abwesenheit war ein Augenblick, in dem sie vielleicht schon für immer fort war.
Mein Gehirn war viel mehr damit beschäftigt, mir die Katastrophe bis ins Detail auszumalen – das Kreischen von Metall, das bläuliche Glitzern der Glassplitter auf der Straße –, als mit dem rationalen Gedanken, dass eine harmlose Erklärung viel wahrscheinlicher war. Auch heute denke ich, wenn meine Frau nicht sofort ans Telefon geht, sie wäre die Treppe hinuntergefallen oder möglicherweise einer spontanen Selbstentzündung erlegen. Außerdem mache ich mir ständig Sorgen, andere Leute vor den Kopf zu stoßen. Ich habe Angst, die Welt nur durch die Brille meiner Privilegien zu sehen. Ich mache mir Sorgen um Menschen, die unschuldig im Gefängnis sitzen. Ich mache mir Sorgen wegen der Missachtung von Menschenrechten. Ich mache mir Sorgen wegen Vorurteilen und Politik und Umweltverschmutzung, Sorgen um die Welt, die unsere Kinder von uns erben werden. Ich sorge mich um alle Spezies, die durch Menschenhand aussterben. Ich sorge mich um meinen CO2-Fußabdruck. Ich sorge mich wegen all des Leids auf der Welt, das ich nicht aktiv stoppen kann. Ich mache mir Sorgen, weil ich mich zu viel mit mir selbst beschäftige, und beschäftige mich dadurch noch mehr mit mir selbst.
Jahre, bevor ich überhaupt das erste Mal Sex hatte, war ich überzeugt, ich hätte Aids, so wirkungsvoll waren die beängstigenden Infosendungen der britischen Regierung im Fernsehen der 80er Jahre. Wenn ich etwas esse, das komisch schmeckt, sehe ich mich schon mit einer Lebensmittelvergiftung auf dem Weg ins Krankenhaus. Am Flughafen fühle ich mich immer verdächtig und benehme mich daher auch verdächtig. Jeder kleine Knubbel, jeder Fleck, jedes Muttermal könnte Krebs sein. Jede Erinnerungslücke ein frühes Stadium von Alzheimer. Und so weiter. Und das sind meine Sorgen, wenn es mir relativ gut geht. Wenn ich krank bin, schaltet mein Katastrophenmodus auf Überschall.
Wenn ich so darüber nachdenke, ist ein Hauptmerkmal meiner Angst die ständige Vorstellung, dass alles noch viel schlimmer werden könnte. Und erst vor kurzem ist mir klar geworden, welchen Anteil an diesem Gefühl unser heutiges Leben hat. Dass unser Gemütszustand – ob wir nun krank sind oder nur gestresst – bis zu einem gewissen Grad das Produkt des Zustands unserer Welt ist. Und umgekehrt. Ich möchte gern herausfinden, was an unserem nervösen Planeten es ist, das uns so zusetzt.
Es liegen Welten zwischen einem Gefühl von Stress und einer psychischen Störung, aber beide sind verwandt, wie Hunger haben und verhungern, und was für das eine schlecht ist (Nahrungsknappheit), ist für das andere auch nicht gut. Die Dinge, die mir zu schaffen machen, wenn ich leicht gestresst bin, sind dieselben Dinge, die fatal für mich sind, wenn ich krank bin. Umgekehrt folgt, dass die Lehren, die ich aus der Krankheit ziehe, auch für bessere Zeiten gelten. Schmerz ist ein guter Lehrer.
Noch ein paar mehr Dinge, die mir Sorgen machen (die Liste ist nie zu Ende)
Die Nachrichten.
Die U-Bahn.
Wenn ich U-Bahn fahre, stelle ich mir vor, was alles schiefgehen könnte. Der Zug bleibt im Tunnel stecken. Es brennt. Jemand verübt einen Terroranschlag. Ich habe einen Herzinfarkt. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, einmal hatte ich tatsächlich ein erschreckendes Erlebnis in der U-Bahn. Als ich in Paris aus der Métro stieg, war ich plötzlich von einer beißenden Tränengaswolke eingehüllt. Oben auf der Straße hatten sich Gewerkschaftsmitglieder eine Schlacht mit der Polizei geliefert, und die Polizei hatte zu nah am Métro-Eingang Tränengas versprüht. Doch das wusste ich nicht. Als ich mir den Schal vors Gesicht drückte, um überhaupt atmen zu können, glaubte ich fest an einen Terroranschlag. Allein der Gedanke war traumatisch. Wie Montaigne sagt: »Wer ein Leid fürchtet, leidet bereits unter der Furcht.«
Selbstmord.
Als ich jung war, hätte ich mich fast von einer Klippe gestürzt. Aber heute kreisen die Suizidgedanken, die mich immer noch manchmal quälen, eher um die
Angst
davor, es zu tun, als um den
Willen
dazu.
Andere gesundheitliche Ängste.
Zum Beispiel: plötzliches Herzversagen infolge einer Panikattacke (geradezu lächerlich unwahrscheinlich); eine so vernichtende Depression, dass ich mich nie wieder bewegen kann – wie ein Blick ins Gesicht der Medusa; Krebs; Herzkrankheiten (ich habe hohe Cholesterinwerte, erblich bedingt); zu früh zu sterben; zu spät zu sterben; Sterblichkeit ganz allgemein.
Aussehen.
Dass Männer nicht eitel sind, ist bloß ein alter Mythos. Ich habe mir durchaus Gedanken über mein Aussehen gemacht. Früher habe ich regelmäßig
Men’s Health
gelesen und die darin beschrieben Workouts absolviert, weil ich wie die Covermodels aussehen wollte. Ich habe mir Sorgen wegen meiner Haare gemacht – ihrer Dichte, ihres potentiellen Verlusts. Und wegen der Leberflecke in meinem Gesicht. Manchmal starrte ich sie ewig lang im Spiegel an, als könnte ich sie weghypnotisieren. Heute machen mir meine Falten zu schaffen, aber es ist viel besser geworden. Ironischerweise ist die beste Therapie gegen die Angst vor dem Altern
das Altern
.
Schuldgefühle.
Ich habe immer mal wieder Schuldgefühle gehabt, weil ich kein perfekter Sohn, Mann, Bürger, menschlicher Organismus bin. Ich habe Schuldgefühle, wenn ich zu viel arbeite – und meine Familie vernachlässige – und wenn ich nicht genug arbeite. Manchmal habe ich sogar völlig bezugslos Schuldgefühle. Manchmal sind sie nur ein Gefühl.
Unzulänglichkeit.
Ich mache mir ständig Gedanken über meine Mängel, und wie ich sie ausgleichen soll. Häufig spüre ich eine metaphorische Leere in mir, die ich in verschiedenen Phasen meines Lebens mit verschiedenen Dingen zu füllen versuchte – Alkohol, Partys, Twittern, Medikamente, Rauschmittel, Sport, Essen, Arbeit, Popularität, Reisen, Geld ausgeben, Geld verdienen, veröffentlicht werden. Was die Leere natürlich nie gefüllt hat. Die Dinge, mit denen ich das Loch füllen wollte, haben es oft nur noch größer gemacht.
Atomwaffen.
Wenn in den Nachrichten von Atomwaffen die Rede ist, was in letzter Zeit wieder häufiger vorkommt, sehe ich vor jedem Fenster Atompilze. Die Worte des US-Generals Omar Nelson Bradley von 1948 hallen in einem unheimlichen Echo in mir nach: »Wir leben in einer Welt der nuklearen Riesen und moralischen Kleinkinder. Wir wissen mehr über das Töten, als wir über das Leben wissen.«
Roboter.
Das ist nur halb ein Witz. Die Zukunft der Roboter gibt begründeten Anlass zur Sorge. Mein täglicher Akt des pro-menschlichen Widerstands ist der Boykott von Selbstbedienungskassen. Andererseits führt das Nachdenken über Roboter manchmal zu umso größerer Wertschätzung des Mysteriums, ein lebendiger Mensch zu sein.
5 Gründe, froh zu sein, dass du ein Mensch bist und kein empfindungsfähiger Roboter
William Shakespeare war kein Roboter. Emily Dickinson war kein Roboter. Auch Aristoteles nicht. Oder Euklid. Oder Picasso. Oder Mary Shelley (auch wenn sie über Roboter schrieb). Alle, die du je geliebt hast, sind kein Roboter. Für einen Menschen ist der Mensch das größte Wunder. Und wir sind Menschen.