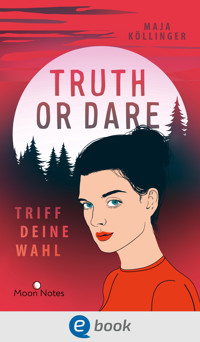Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
"Ich hätte wissen müssen, dass es keine gute Idee war, dem Kaninchen quer durch London zu folgen. Doch wer hätte denn ahnen können, dass dieses seltsame flauschig weiße Ding mit der Taschenuhr mich hierher bringen würde? Ich meine, wo bin ich hier überhaupt? Die Bäume bestehen aus Kupfer und ihre Blätter wiegen schwer wie Blei. Überall schwirren Käfer mit Flügeln aus Glas umher und am Firmament drehen sich gigantische Zahnräder, als würden sie allein diese Welt in Bewegung halten. Und dann … ist da noch Elric. Ein Junge, aus dem ich einfach nicht schlau werde und der so herz- und emotionslos scheint. Doch ich bin entschlossen, sein Geheimnis zu lüften, um zu erfahren, was der Grund für seine Gefühlskälte ist. Oh, und falls ich es noch nicht erwähnt habe: Ich bin übrigens Alice. Und wie es scheint, bin ich im Wunderland gelandet… kennst du vielleicht den Weg hinaus?"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Madness
Das Land der tickenden Herzen
Maja Köllinger
Copyright © 2017 by
Astrid Behrendt
Rheinstraße 60
51371 Leverkusen
http: www.drachenmond.de
E-Mail: [email protected]
Lektorat: D.B. Granzow
Korrektorat: Martina König
Layout: Michelle N. Weber
Umschlagdesign: Marie Graßhoff
Bildmaterial: Shutterstock
Illustrationen: Maja Köllinger
ISBN 978-3-95991-116-0
Alle Rechte vorbehalten
Für alle,
in deren Adern kein Blut,
sondern Tinte fließt
Inhalt
Es ist immer …
Prolog
1. Cocktails and Dreams
2. Der Mondmechanismus
3. Mitternachtsteestunde
4. Sie ist es
5. Der Weise
6. Undurchschaubar
7. Tickendes Herz
8. Die Überfahrt
9. Das Uhrwerk
10. Wettlauf gegen die Zeit
11. Der Zerfall
12. Schattennebel
13. Gefangen
14. Der Aufzieher
15. Der Verstand weilt nur kurzfristig unter den Verrückten
16. Ab mit ihrem Kopf
17. Für immer
Epilog
Danksagung
Es ist immer etwas Wahnsinn in der Liebe.
Es ist aber auch immer etwas Vernunft im Wahnsinn.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Prolog
Ein Moment kann dein ganzes Leben verändern …
Ein Augenblick deine Existenz zerstören …
Und eine Sekunde reicht aus, um dein Schicksal zu besiegeln.
In der Nacht des 4. Juli 2016, traf ich eine Entscheidung, die mein gesamtes Dasein beeinflussen sollte. Doch erst jetzt wird mir klar, dass mein Leben auf diesen Punkt hinausgelaufen war und ich keine andere Wahl hatte, als gegen mich selbst und meine eigene Natur anzukämpfen.
In dieser Nacht begrub ich meine Vergangenheit, meine Wünsche, Träume und Hoffnungen. Ich begrub mein altes Leben und wurde jemand Neues.
Bis heute kann ich nicht sagen, ob dieser Entschluss mein Untergang oder meine Rettung war …
1
Cocktails and Dreams
Es war Samstagabend und die Nacht hatte sich bereits wie ein Schatten über die Straßen Londons gelegt. Die Erwartung an das bevorstehende Ereignis ließ mein Herz vor Aufregung rasen. Ich würde zum ersten Mal in meinem Leben einen Szene- Club besuchen.
Den weißen Kajal beiseitelegend, warf ich einen letzten Blick in den Spiegel. Die blonden Locken fielen wild über meine Schultern und offenbarten bei jeder Bewegung einen Blick auf die lila Strähnchen, die ich mir gestern eigenhändig nachgetönt hatte. Zusammen mit dem perfekt geschwungenen Lidstrich, um den mich meine Freundinnen so oft beneideten, und der blassen Haut haftete mir etwas Zerbrechliches an – als wäre ich aus Porzellan geschaffen. Ein Blick in meine Augen belehrte mich jedoch eines Besseren. Sturheit und Trotz spiegelten sich darin und offenbarten meinen wahren Charakter.
Das bin ich. Nimm mich, wie ich bin, oder verschwinde.
Das war meine Lebensdevise. Ich wollte mich für das, was ich war, nicht schämen und hatte vor einiger Zeit beschlossen, mein inneres Wesen auch nach außen hin zur Schau zu stellen.
Ich war sowohl bunt und farbenfroh als auch blass und durchsichtig. Meine Seele entsprach der eines Rebellen, der aus den Zwängen und Normen der Gesellschaft auszubrechen versuchte und sich seinen Weg zur Selbstfindung erkämpfte. Aber zeitgleich wünschte ich mir auch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, das gemeinsame Teilen eines Lebensgefühls, die Verbundenheit einer Gemeinschaft … So war ich zum Punk geworden und hatte mich der Szene angeschlossen.
Ein drängendes Klopfen riss mich aus meinen diffusen Gedankengängen. Ich hastete eilig zu meiner Zimmertür und öffnete diese anscheinend ein wenig zu vorschnell, denn mir stolperten sogleich zwei Personen entgegen, die sich zuvor an die Tür gelehnt hatten.
Ich wich einen Schritt zurück und ruderte mit den Armen, um die Balance zu halten. Ohne das Korsett, das um meinen Oberkörper geschlungen war, wäre das nur halb so schwer gewesen. Bevor ich vollends das Gleichgewicht verlor, bekamen mich zum Glück zwei Hände zu fassen und zogen mich in eine aufrechte Position. Keinen Augenblick später stand ich meinen zwei liebsten Menschen auf diesem Planeten gegenüber.
»Oh mein Gott, Alice! Du siehst …«, kreischte Lucy mit übertrieben hoher Stimme.
»… umwerfend aus!«, beendete Katy deren unvollendeten Satz und fächelte sich mit der Handfläche Luft zu. Gleich darauf täuschte sie einen Ohnmachtsanfall vor.
Ich verdrehte bloß die Augen, bevor ich entgegnete: »Seht euch an! Neben euch verblasse ich komplett.«
Wir warfen vielsagende Blicke in die Runde und begannen zu lachen. Das war unser Ding. Während andere Teenager diesen Quatsch tatsächlich ernst meinten, machten wir uns einen Spaß daraus, dieses mädchenhafte Getue ins Lächerliche zu ziehen. Ich meine: Diesen Mist konnte doch niemand wirklich ernst nehmen. Oder?
Während Lucys Haare pink leuchteten, erstrahlten Katys in ihrer Lieblingsfarbe Blau. Wir gaben ein buntes Trio ab, das bewusst aus der anonymen grauen Masse namens Gesellschaftherausstach.
»Oh mein Gott, Lucy! Die neue Farbe ist echt der Wahnsinn!«, sagte ich und meinte es dieses Mal tatsächlich so.
»Ja, nicht wahr?«, stimmte Katy zu, während Lucys Wangen allmählich die Farbe ihrer Haare annahmen.
»Meine Mutter war nicht so begeistert, als sie bemerkt hat, dass ich die blonde Haartönung ausgetauscht habe«, gestand sie.
»Ach was!«, meinte Katy. »Die soll sich nicht so anstellen. Das Pink steht dir hervorragend, fast so gut wie mir Blau.«
Wir lachten und waren damit einstimmig ihrer Meinung.
»Können wir endlich los?« Durch meine Venen pumpte die Vorfreude, meine Finger zuckten vor Euphorie und ich war mir sicher, dass in meinen Augen ein abenteuerlustiges Funkeln zu sehen war.»Ich muss nur noch kurz meinem Vater Bescheid sagen.«
Lucy und Katy nickten. In ihren Blicken erkannte ich die gleiche Sorge, die auch in meinen schimmern musste.
Zu oft hatte er in letzter Sekunde einen Rückzieher gemacht und mir verboten, auszugehen. Seine Angst vor der Welt außerhalb seines Büros würde ich nie nachvollziehen können. Ich verstand nicht, wie er es bevorzugen konnte, tagein, tagaus hinter seinem Schreibtisch über irgendwelchen Büchern zu hocken, anstatt zu leben.
Ich war nicht wie er. Ich glaubte zu ersticken, wenn ich zu lange im Haus blieb.
Nervös klopfte ich an seine Bürotür, die aus einem mir unbekannten Grund rot gestrichen war. Vielleicht diente sie als Warnung, um nicht gestört zu werden.
Schon als Kind hatte ich lernen müssen, dass mein Vater es hasste, bei seiner Arbeit unterbrochen zu werden, weshalb ich auf Zehenspitzen schleichend und mit angehaltenem Atem einen großen Bogen um besagte Tür gemacht hatte.
Doch heute war ich nicht mehr so gehorsam.
Ich stieß die Tür auf, ohne auf sein genuscheltes Herein zu warten. Mein Vater sah auf, sein Kiefer klappte nach unten und ein verblüffter Ausdruck legte sich über sein Gesicht. Ich hatte damit gerechnet, dass er mich wie sonst auch missbilligend von Kopf bis Fuß mustern würde, aber auf seine überraschte Reaktion war ich nicht gefasst gewesen.
»Alice … Du siehst …« Erkenntnis verhärtete seine Züge und eine Sekunde später hatte er sich wieder im Griff. »… aus wie sie.«
Ich schluckte.
Auch ohne nachzufragen, wusste ich, von wem er sprach. Mutter.
Die Frau, die ihn vor 18 Jahren kurz nach meiner Geburt sitzen gelassen hatte.
Die Frau, von der es weder Bilder noch sonstige Andenken oder gar Erinnerungen gab, da mein Vater alles restlos verbrannt hatte. Es war ein Wunder, dass er mich nicht schon längst verstoßen hatte, erinnerte ich ihn doch tagtäglich an sie.
Die Frau, die mich zur Welt gebracht und danach sofort wieder vergessen hatte, als wäre ich für sie nichts weiter als eine Last gewesen, die sie neun Monate mit sich herumtragen musste. Zumindest vermutete ich das. Warum sonst würde man sein Neugeborenes sich selbst überlassen?
Ich war für sie nicht von Bedeutung.
Manchmal ertappte ich mich bei der Frage, ob sie tatsächlich jemals existiert hatte.
Kaum auszumalen, wie mein Vater sich fühlen musste. Er wurde von seiner großen Liebe verlassen. Und das Einzige, was sie hinterlassen hatte, war ich. Eine stetige Erinnerung daran, was er verloren hatte. Und das ließ er mich auch spüren.
Wer brauchte schon Vaterliebe? Vermutlich wusste meiner nicht einmal, was das war.
Ich traf meine eigenen Entscheidungen, egal ob sie ihm gefielen oder nicht. Und wenn ich ihm durch ein besonders ausgefallenes Outfit ein Grummeln, einen schwachen Protest entlocken konnte, umso besser. In diesen seltenen Momenten war ich mir zumindest sicher, dass er mich beachtete und er wusste, dass ich noch existierte.
Heute war anscheinend einer dieser seltenen Zufälle eingetreten, denn mein Vater musterte mich so eingehend, dass ich mir unweigerlich vorstellte, wie ich zurzeit auf ihn wirken musste. Eine widerspenstige Tochter mit kuriosem Modegeschmack.
Das silbrig schimmernde Korsett mit den seidigen Schnüren war ihm sicherlich zuwider. Ihm wäre es lieber gewesen, wenn ich mich unserer Gesellschaft angepasst hätte und den ganzen Tag in einer Schuluniform herumgelaufen wäre.
Doch er verlor kein Wort über mein Erscheinungsbild, was mich ziemlich enttäuschte. Schon seit Jahren redete er kaum ein Wort mit mir, kauerte hinter seinem Schreibtisch und wirkte in sich zusammengesunken. Ich wollte ihn aus seinem Kokon locken, damit er endlich mehr als ein zustimmendes Brummen oder ein paar erboste Worte von sich gab. Doch es war zwecklos: Mein Vater sollte auf ewig ein verblassendes Abbild seines früheren Ichs bleiben.
»Wir wollen jetzt los, Dad. Ich will nur schnell Bescheid geben, damit du dir keine Sorgen machst.«
Er nickte betreten und schien nachzudenken. Als er mir einen flüchtigen Blick zuwarf, sah ich Wärme in seinen Augen aufblitzen. Vielleicht hatte ich durch die Ähnlichkeit mit meiner Mutter tatsächlich etwas in ihm hervorgekitzelt. Eine Empfindung, die längst in den Abgründen seiner Seele verschollen gewesen war.
Und mit einem Mal tat er das Unfassbare: Mein Vater stand auf und umarmte mich, zwar etwas steif und ungelenk, aber das war in dieser Sekunde völlig egal. Ich hielt überrascht die Luft an. Einen Moment lang wusste ich nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen sollte. Unbeholfen schlang ich meine Arme um den schmächtigen Oberkörper meines Vaters und unterdrückte das Bedürfnis, ihn fester an mich zu ziehen. Dad zeigte nie Gefühle, er wirkte immer abwesend, nicht ganz präsent, nicht vollständig bei Sinnen, als hätte meine Mutter damals seine Seele mitgenommen.
Umarmungen gab es in meiner Kindheit, wie auch heutzutage, viel zu selten, deshalb genoss ich jede, die ich kriegen konnte, denn mir war bewusst: Es könnte immer die letzte sein. Mutter hatte mich eines gelehrt: Man konnte sich nie sicher sein, ob man sich je wiedersah.
Viel zu schnell verflog der innige Moment und mein Vater löste sich schwer seufzend. Er fasste meine Schultern und hielt mich eine Armeslänge von sich entfernt, sodass sich unsere Blicke schließlich trafen. Ich konnte unmöglich sagen, wann ich ihm zuletzt richtig in die Augen gesehen hatte.
»Kein Alkohol, keine Drogen, nicht zu Fremden ins Auto steigen …« Er ratterte eine ewig lange, scheinbar auswendig gelernte imaginäre Liste herunter. Ich nickte jeden einzelnen Punkt brav ab. Seine Stimme klang so blechern, dass die geschürten Emotionen durch die Umarmung schlagartig verpufften. Die gezwungene Art und Weise, wie mein Vater mich behandelte, ließ mich vermuten, dass er hier bloß seine Pflicht erfüllen wollte und ihm eigentlich nichts an meinem Wohlergehen lag.
»Mach bloß keinen Unsinn, hörst du? Und komm nicht zu spät zurück!« Er schenkte mir schließlich ein kleines Lächeln, das ich erleichtert erwiderte. Vertraute er mir endlich? Ich konnte es nicht fassen. Er ließ mich tatsächlich gehen, trotz all seiner Bedenken.
»Das werde ich nicht.«
Mit diesen Worten verließ ich das Arbeitszimmer und zog die Tür lautlos hinter mir zu. Katy und Lucy hatten im Flur auf mich gewartet und starrten mich abwartend an, woraufhin ich ihnen zunickte. Entwarnung.
Erleichtert atmeten beide aus und bevor mein Vater tatsächlich noch auf die Idee kommen konnte, uns einen Strich durch die Rechnung zu machen, zogen die beiden mich mit sich, während wir schleunigst die Wohnung verließen und das marode Treppenhaus hinunter sprinteten.
Als wir schließlich auf der Straße standen und uns die kalte Nachtluft um die Nase wehte, stieß ich einen Freudenschrei aus. Lucy blickte mich als Reaktion darauf bloß fragend an.
»Ich bin so aufgeregt!«, verkündete ich, während ich mit zitternden Händen die Haustür des mehrstöckigen Reihenhauses krachend ins Schloss fallen ließ.
Die Fassade war bis zum dritten Stockwerk mit Graffitis überzogen, weshalb die Farben selbst bei Nacht in giftigen Neontönen leuchteten. Ein verhüllter Künstler war gerade dabei, seinen Namenszug über die Mauer zu sprühen, und beachtete uns nicht weiter. Offenbar hatte er keine Furcht, entdeckt zu werden. Warum auch? Wir befanden uns im East End Londons und kaum einer scherte sich um ein Graffiti mehr oder weniger. Zudem war es mitten in der Nacht, die Polizei hatte bestimmt Wichtigeres zu tun, als einem Einzelgänger aufzulauern, der sich mit ein paar Sprühdosen vergnügte.
Die Dämpfe der Farben strömten durch meine Nase und benebelten mein Gehirn. Die Kombination aus Euphorie und toxischen Gasen versetzte mich in einen Rausch, der jegliche Gedanken an meinen Vater aus meinem Kopf verbannte. Ich fühlte mich schwerelos und befreit von seiner Obhut, sodass ich nicht anders konnte, als triumphierend zu grinsen.
»Ich weiß echt nicht, was du an diesen Street-Art-Künstlern so aufregend findest«, murrte Katy, während sie mich bereits weiterzog. Das Skelett, welches auf ihrem schwarzen Pullover abgebildet war, leuchtete im Dunkeln und ihre blauen Haare wippten im Gleichtakt ihrer Schritte.
»Kannst du denn nicht sehen, wie diese Menschen mit nichts weiter als einer leeren Wand, Sprühdosen und einem unaufhaltsamen Drang nach Kreativität wahre Kunstwerke erschaffen?«, hauchte ich und inhalierte gierig die kühle Nachtluft.
In der Ferne hupten Autos und schrien Menschen. Der übliche Lärm Londons. Die schrillen, disharmonischen Laute waren mir seltsam vertraut.
»Der Club macht gleich auf, wir sollten uns beeilen!«, drängte nun Lucy. Die Schnallen, die an dem Korsett und an ihren schwarzen Stiefeln angebracht waren, klapperten bei jeder Bewegung und verhallten in der Geräuschkulisse der Millionenmetropole.
Ich liebte London, besonders wenn es dunkel wurde: die abertausend Lichter, die grell erhellten Plakate, Werbebanner und Bilder, die pausenlos an mir vorbeizogen. Das Bewusstsein, in der nächtlichen Stadt nicht allein umherzustreifen, sondern sich mit unzähligen anderen Menschen auf den Weg zu machen, um die unscheinbaren Orte zu erkunden, die sich einem erst auf den zweiten Blick offenbarten.
Wir durchquerten verwinkelte Gassen und Seitenstraßen, sodass ich nach einiger Zeit vollkommen die Orientierung verlor, obwohl ich in dieser Gegend aufgewachsen war. Ich kannte immerhin unser Ziel: das Mill Mead Industrial Estate. Ein Industriegebiet, das direkt an unseren Wohnbezirk grenzte.
»Wisst ihr überhaupt, wo wir lang müssen?«, fragte ich an meine Freundinnen gerichtet.
»Voll und ganz!«
»Natürlich!«, antwortete Katy in einem verräterischen Ton.
Ich seufzte.»Ihr habt nicht den Hauch einer Ahnung, oder?«
»Nein«, erwiderten die beiden wie aus einem Mund und fingen an zu lachen. Ich schüttelte bloß meinen Kopf und grinste in mich hinein. Dafür liebte ich meine Freundinnen: Sie meisterten ihr Leben nur durch ihre Spontaneität.
»Immerhin haben wir so noch ein wenig Zeit zum Quatschen!«, meinte Katy vergnügt und wickelte sich eine Strähne ihres blauen Haares um den Zeigefinger.
»Alice, erzähl mal von dem Album dieser Newcomer-Band, das du dir letztens gekauft hast«, forderte Lucy mich auf.
Ich seufzte verträumt und begann, ihnen von den wummernden Bässen und den fantastischen Gitarrenriffs zu erzählen, die die Lieder von Aroaprägten.
»Wirklich, dieses Solo war einfach unglaublich! Ihr müsst euch unbedingt diesen Song anhören. Und die Stimme des Sängers erst! Sie ist einfach nur göttlich!«
Ich gestikulierte während des Sprechens mit meinen Armen, worüber Katy und Lucy sich lustig machten.
»Alice, hast du etwa einen neuen Schwarm? Dieser Leadsänger scheint es dir ja wirklich angetan zu haben«, gab Lucy mit zuckersüßer Stimme von sich, woraufhin ich sie spaßeshalber in die Seite knuffte.
»Erzähl mal lieber, wie es zwischen dir und Tyler läuft«, entgegnete ich, ohne auf ihre Frage einzugehen.
Tyler war der Mädchenschwarm unserer Stufe und selbst die unabhängige Lucy war seinem Charme verfallen. Sobald ich das Thema angesprochen hatte, verfiel sie in einen minutenlang andauernden Monolog über die Farbe seines haselnussbraunen Haares (obwohl sie der Meinung war, dass Neongrün ihm bestimmt viel besser stehen würde), seine stahlblauen Augen und seinen grandiosen Musikgeschmack, der identisch mit dem unseren war.
Katy stieß mich in die Seite und zog entnervt ihre Augenbrauen in die Höhe, als wollte sie damit sagen: »Was hast du nur wieder angerichtet?«
Ich warf ihr einen entschuldigenden Blick zu und versuchte mit ihr gemeinsam, die nächste halbe Stunde zu überstehen, ohne an einem plötzlich eintretenden Hirntod zu sterben, der durch Lucys Schwärmerei ausgelöst worden wäre.
»Versprich mir, dass du dich niemals in irgendeinen hirnverbrannten Jungen verlieben wirst, Alice. Noch eine von der Sorte ertrage ich nicht«, meinte sie mit einem Seitenblick zu Lucy.
Wir lachten und neckten uns, bis wir nach knapp zwei Stunden des Herumirrens an einem verlassenen Gebäude innerhalb des Industriegebiets ankamen, dessen Außenwände vor Dunkelheit geradezu trieften. Wir befanden uns auf einem ungenutzten Abschnitt des Fabrikgeländes, dessen Herzstück ein kastenförmiger Plattenbau war, der sich vor uns in den Nachthimmel bohrte. Der Kies knirschte unter unseren Schritten, als wir auf das Gebäude zugingen. Durch zerbrochenes Fensterglas strahlten Scheinwerfer und erleuchteten den leeren Parkplatz vor uns. Die Musik schlug mir schon jetzt entgegen. Sie wirkte verzerrt und von Bässen beherrscht, sodass mein Trommelfell bei den schiefen Klängen schmerzhaft dröhnte. Ein beißender Geruch stieg mir in die Nase… Urin, Erbrochenes und eindeutig: Alkohol. Ich versteifte mich, weshalb Katy und Lucy sich gezwungen sahen, stehenzubleiben. Irgendwie hatte ich mir das alles ganz anders vorgestellt.
»Was ist das hier? Ich dachte, wir besuchen einen angesagten Club!«, konfrontierte ich die beiden.
»Das hier ist der angesagteste Underground-Club der Umgebung. Zumindest solange kein Cop darauf aufmerksam wird«, merkte Katy an und rollte mit den Augen. Sie hatte mir bereits vor Tagen erklärt, dass der Underground-Club einem Wanderzirkus glich. Er tauchte dort auf, wo niemand damit rechnete, wie beispielsweise in einem verlassenen Fabrikgebäude, und verschwand nach ein paar Wochen wieder, sobald die Behörden davon Wind bekamen. Niemand bat um Erlaubnis oder gar um eine Genehmigung. Das machte den Reiz der Sache aus: das Gefühl, an etwas Verbotenem teilzuhaben.
»Nicht ganz legal, nicht wirklich ansehnlich, aber genau nach meinem Geschmack.« Lucys Stimme zitterte vor Aufregung.
»Keine Security, keine Kontrollen, keiner, der uns aufhalten könnte, ein kleines Abenteuer zu erleben!«
Die Begeisterung der beiden ging langsam auf mich über und erweckte die Euphorie in meinem Inneren von Neuem. Vielleicht war der Club gar nicht so schlecht, wie er von außen wirkte. Und der Gedanke, für diese eine Nacht tun und lassen zu können, was ich wollte, war ziemlich reizvoll.
»Na dann mal los!«, verkündete ich und trat auf den Eingang des Clubs zu, der lediglich aus einem schwarzen Vorhang bestand.
Ich schob den samtenen Stoff behutsam zur Seite und wurde sogleich in strahlend pinkfarbenes Neonlicht getaucht. Staunend ließ ich den Stoff hinter mir zurückfallen und betrachtete sprachlos die Halle.
Betonwände und Stahlträger schraubten sich endlos in die Höhe, während sich vor uns eine Halle erstreckte, in welcher sich eine breite Masse an Menschen tummelte. Das Dröhnen der elektronischen Musik hallte in meinen Ohren nach und das stechende Stroboskoplicht ließ die Menge vor mir bloß in abgehackten Sequenzen aufblitzen.
Zwischenzeitlich flogen mehrfarbige Scheinwerfer an dünnen Drahtseilen über unsere Köpfe hinweg und erleuchteten das wirre Schauspiel. Street-Art, Graffitis und bunte Neonröhren zierten die haushohen Fassaden, sodass die Kunst durch das synthetische Licht scheinbar zum Leben erweckt wurde.
Links von mir befand sich eine Bar, an deren Rückwand ein Schild prangte, welches in ineinander verschnörkelten, strahlenden Buchstaben Cocktails & Dreams verkündete.
Lucy und Katy zogen mich hinein in die Menge, weshalb ich mich viel zu schnell inmitten einer Masse aus dynamischen, schwitzenden und energiegeladenen Menschen wiederfand. Der penetrante Schweißgeruch brannte in meiner Nase und der Anblick der anderen Besucher löste für einen kurzen Moment Unwohlsein in mir aus, bis ich mir bewusst wurde, dass auch sie zur Punkszene gehörten. Ich befand mich unter Gleichgesinnten, die allesamt nichts anderes wollten, als ein wenig Spaß zu haben und die Grauzone der Gesetze auszukosten. Ich begann, mich im Takt der auf mich niederprasselnden Musik zu bewegen und im Rhythmus der Bässe zu wiegen. Meine Haare wirbelten wild um mich herum und mein Körper geriet in Ekstase.
Die Welt drehte sich und verschwamm zu einem grellen Lichtermeer. Ich geriet in einen Strudel aus Stimmen, Klängen und Farben, der mich immer tiefer hinab zog. Ich sang mit meinen Freundinnen Songpassagen mit, die jedoch von dem enormen Lautstärkepegel verschluckt wurden. Ein Echo im Stimmenmeer.
Ich fühlte mich mit den Menschen um mich herum verbunden und tat es Lucy und Katy gleich: Ich legte jegliche Hemmungen ab, indem ich rückhaltlos bei den E-Gitarren-Soli mitfeierte, die tiefen Gesänge der Backgroundsänger nachahmte und mich vollkommen in der elektrisierenden Musik verlor.
Der Geruch nach Alkohol und Rauch wurde für mich zu einem Zeichen der Ausgelassenheit, die Musik zu meiner Freiheitshymne und die Menschen um mich herum zu einem Teil von mir. Ich konnte nicht sagen, wie lange ich dort zusammen mit Lucy und Katy auf dem spröden Betonboden getanzt und mich von der Atmosphäre in ihren Bann ziehen lassen hatte.
Als ich jedoch nach geraumer Zeit meine Augen auf der Suche nach meinen Freundinnen umherschweifen ließ, fehlte jegliche Spur von ihnen. Die Feierwütigen hatten uns auseinandergetrieben, ohne dass ich davon Notiz genommen hatte. Panik beschlich mich und ich hatte mit einem Mal das Bedürfnis, aus der Meute zu fliehen.
Wo waren sie bloß?
Ich fühlte mich bedrängt, eingesperrt und im Stich gelassen, obwohl ich kurz zuvor noch das Gefühl der Zugehörigkeit und Gemeinschaft in mich aufgesogen hatte.
Ich kämpfte mich durch den Pulk, Angstschweiß bildete sich auf meinen Armen und Furcht schnürte mir die Kehle zu. Das Stroboskoplicht erzeugte tiefe Schatten, Gesichter blitzten vor mir auf, während ich durch die Menge hetzte, ohne Rücksicht zu nehmen. Vereinzelt wurden entnervte Stimmen laut, doch ich ignorierte sie. Ich musste Lucy und Katy finden.
Die Feiernden um mich herum stieß ich achtlos zur Seite. Ich bahnte mir auf diese Weise einen Weg durch den Club und hinterließ eine Schneise der Verwirrung und Empörung. Mein Herz raste, die stickige Luft raubte mir jeglichen Verstand und Verzweiflung hallte in jedem meiner gehetzten Schritte wider.
Sobald ich am Rande des Geschehens angelangt war, flüchtete ich vor den Gleichgesinnten hinter mir, hastete zu dem Vorhang, der mich von der Außenwelt trennte, und riss ihn hektisch zur Seite, sodass ich auf den Platz vor dem Gebäude hinauseilen konnte. Womöglich hatten sich Lucy und Katy eine Auszeit gegönnt und waren hier draußen zu finden.
In meinen Ohren summte der Nachhall der Musik, machte mich taub für die scheinbare Stille außerhalb der rissigen Mauern, während die Kälte an meinen Armen empor kroch und die Hitze des Clubs von meiner Haut wusch. Ich sah mich um, doch weder in der Nähe des Gebäudes noch in den Schatten der anderen Bauwerke des Industriegebiets verbargen sich zwei Mädchen mit blauen oder pinken Haaren. Hatte ich sie etwa verloren? Oder hatte ich sie bloß im Club übersehen?
Ich entließ die Luft stoßweise aus meinen Lungen und gönnte mir eine kurze Atempause. Bevor ich mich wieder in den Club begab, wollte ich wieder zu Kräften kommen. Die Panik saß mir noch in den Knochen und verhinderte, dass ich einen Schritt nach vorn tat. Keuchend stützte ich meine Hände auf den Knien ab und kniff die Augen für einige Sekunden zusammen, um zur Ruhe zu kommen. Das half ein bisschen.
Als ich mich wieder aufrichtete und meine Augen öffnete, sah ich plötzlich an der Ecke des Gebäudes etwas strahlend Weißes davonhuschen. Ich runzelte die Stirn und verharrte inmitten meiner Bewegung.
Was war das?
Sah ich etwa schon Gespenster?
Ich verfluchte meine Neugierde und dachte einen Moment lang tatsächlich darüber nach, der Gestalt zu folgen, doch ich besann mich eines Besseren und fasste den Entschluss, zunächst meine Freundinnen zu suchen.
Sobald einen Schritt in Richtung des Eingangs trat, entdeckte ich vor meinen Füßen einen Gegenstand im Kies.
Die Musik aus dem Inneren des Gebäudes drang nicht mehr bis zu meinen Gedanken vor, als ich mich auf den Boden hockte, um das Objekt an mich zu nehmen. Die Kieselsteine bohrten sich in die Haut meiner Knie und hinterließen dort rote Abdrücke. Ich fixierte das Objekt in meiner Hand und versuchte, die trommelfellzerfetzende Musik sowie den Uringestank der Umgebung auszublenden. Stattdessen nutzte ich das Licht der Scheinwerfer aus, das durch die Fenster des Gebäudes über den Platz zuckte.
Ich hatte eine vergoldete Taschenuhr gefunden, auf deren Deckel zahlreiche Gravuren und Verzierungen aufblitzten, sobald das Licht darüber hinweg strich. Als ich sie dicht vor meine Nase hielt, erkannte ich trotz der Dunkelheit um mich herum, dass sich hinter den schmalen Zeigern kein Ziffernblatt befand, weshalb man geradewegs auf die Zahnräder des Uhrwerks blicken konnte. In einem strikten Mechanismus griffen diese immer wieder ineinander und brachten damit das winzige Schmuckstück in meiner Hand zum Ticken.
Ich drehte den Zeitmesser hin und her, konnte jedoch keinen Hinweis auf den Besitzer finden. Als ich zu der Häuserecke hinüberblickte, wo zuvor die weiße Gestalt verschwunden war, erspähte ich an derselben Stelle einen Hasen, dessen Fell sich von der Schwärze der Nacht abhob. Er saß vollkommen still am Boden und schien mich zu betrachten.
Moment mal … ein Hase?
Was hatte der denn bitte in einer Millionenmetropole wie London zu suchen?
Das Tier war vollkommen erstarrt und bewegte sich nicht. Sein Blick fixierte mich, als würde es auf eine Reaktion von mir warten. Sollte ich auf es zugehen? Würde ich das Kaninchen verscheuchen?
Ich biss mir auf die Unterlippe und schaute abwiegend zwischen der Taschenuhr, den nervös zuckenden Hasenohren und dem Eingang des Underground-Clubs hin und her. Der heutige Tag war schon verrückt genug. Ich hätte mich am besten einfach umdrehen und so tun sollen, als hätte ich den Hasen nicht bemerkt, bevor ich mir weiter den Kopf darüber zerbrach. Dennoch blieb ich stehen. Die Uhr wog schwer in meiner Hand und der Blick des Hasen fesselte mich an Ort und Stelle.
Das Pflichtgefühl gegenüber meinen Freundinnen verblasste und meine Abneigung gegenüber dem Club wuchs. Ich wollte das Gebäude ungern noch einmal betreten. Bestimmt hatte ich den Unmut einiger Besucher auf mich gezogen und vermutlich würde ich Lucy und Katy nicht wiederfinden, wenn sie in der Gruppe aus Feiernden abgetaucht waren. Die Menschenmassen würden mich zerquetschen, obwohl ich zuvor ein Teil von ihnen gewesen war. Die Musik zermarterte mein Gehör und der Mief, zusammengesetzt aus Schweiß und Kippen, trieb einen Schauder über meinen Rücken. Erneut befiel mich der Drang, zu flüchten.
Ich wich einen Schritt von dem Eingang zurück und umfasste den verzierten Goldchronometer fester, dessen Kette gegen meine Beine baumelte. Ich brauchte unbedingt ein wenig Ablenkung. Vielleicht sollte ich doch einen näheren Blick auf den Hasen riskieren. Was sollte schon passieren? Im schlimmsten Fall könnte sich das Tier aus dem Staub machen.
Ohne noch eine weitere Sekunde zu verschwenden, näherte ich mich dem Hasen behutsam, um das flauschige kleine Ding nicht zu verscheuchen. Es mochte eine dumme Entscheidung sein, doch von diesem Wissen ließ ich mich nicht aufhalten.
Als ich mich der Gebäudeecke näherte, reckte das Tier den Kopf witternd in die Höhe, legte die Ohren an und hoppelte los. Sobald es mir den Rücken zukehrte, geriet ich ins Stolpern. Was zur Hölle war das denn?
Selbst ein flüchtiger Blick auf den Körper hatte ausgereicht, um zu erkennen, dass dieser Hase nicht normal war. Die hintere Hälfte des Langohrs bestand nicht aus Fell, Fleisch und Knochen, sondern aus … glänzendem Metall. Spulen und Zahnräder griffen ineinander und gaben ein leises Klicken von sich, sobald sich das Wesen bewegte. Der goldene Schein des Materials blitzte noch ein letztes Mal auf, bevor sich die Gestalt verflüchtigte.
Ich rammte meine Fersen in den Boden und starrte auf die Stelle am Boden, wo das Karnickel eben noch gehockt hatte. Was ging hier vor sich? Was war das für ein seltsames Geschöpf gewesen?
Unentschlossen starrte ich dem Tier hinterher. Mein Blick fiel schließlich auf die beständig vor sich hin tickenden Zeiger des Zeitmessers und sein Innenleben in meiner Hand. Die winzigen Zahnräder und Schrauben, die in einem strikten Mechanismus immer wieder ineinandergriffen und sich trennten, ähnelten verdächtig dem metallischen Unterleib des Kaninchens.
War es möglich, dass diese Taschenuhr … Ich musste wahnsinnig geworden sein.
Oder war es vielleicht doch möglich?
Konnte es sein, dass die beiden in Verbindung zueinander standen?
Mein Ehrgeiz wurde geweckt und ich wollte unbedingt herausfinden, was es mit dem Ganzen auf sich hatte.
»Warte!«, rief ich mit brüchiger Stimme. Meine Kehle schmerzte so sehr, als hätte jemand mit Schmirgelpapier darüber gerieben, obwohl ich lediglich ein paar Songs mitgegrölt hatte.
Mein Ausruf scheuchte das Kaninchen noch mehr auf und trieb es schneller voran, denn natürlich befolgten instinktgesteuerte Fluchttiere keine Befehle. Mir blieb also nichts anderes übrig, als meinen Gang zu beschleunigen und dem eigenartigen Hasen durch die nächtlichen Straßen des East Ends von London zu folgen.
Ich hetzte dem Tier hinterher, immer darauf bedacht, das weiße Fell nicht aus den Augen zu verlieren. Dank der Hinterläufe aus Metall, die bei jedem Hopps auf dem Boden schrappten und klackerten, hätte ich zur Not den Geräuschen nachlaufen können.
Meine hohen Schuhe erzeugten nach dem Tanzen ein schmerzerfülltes Stechen an meinen Füßen, weshalb ich sie, ohne weiter darüber nachzudenken, auszog, in die Hand nahm und dem Kaninchen in Stulpen hinterher hetzte.
Die Nachtluft ließ den Schweiß auf meiner Stirn augenblicklich erkalten, während ich atemlos durch verwinkelte Gassen und über unbefahrene Straßen rannte. Zum Glück war der Verkehr in diesem Viertel nicht so stark wie im Zentrum Londons, sonst wäre mein Vorhaben unmöglich gewesen.
Werbebanner, Leuchtreklamen und Neonschilder zogen unbeachtet an mir vorbei. Abgase erfüllten die Luft und nach und nach begann die Geräuschkulisse um mich herum anzuschwellen. Hupende Autos und quietschende Bremsen trieben mich dazu an, meinen Schritt nochmals zu beschleunigen, doch so sehr auch meine Anstrengungen wuchsen, der Abstand zwischen mir und dem weißen Kaninchen verringerte sich nicht.
Sobald ich um eine Hausecke bog, verschwand das Tier hinter der nächsten Abbiegung, überquerte gerade die Straße oder verkroch sich in einer Seitengasse. Offensichtlich versuchte das gerissene Ding, mich abzuschütteln, doch so leicht gab ich mich nicht geschlagen.
Ich war wie im Wahn und hatte nur noch Augen für das Wesen vor mir. Ich vergaß meine Umwelt vollkommen. Die rauen Pflastersteine des Bürgersteigs schabten durch die Strümpfe und scheuerten an meinen blanken Fußsohlen, während die kalte Nachtluft meine Lungen flutete und ein schmerzhaftes Stechen erzeugte. Ich hatte das Gefühl, als würde ich ertrinken, da ich unfähig war, auch nur einen tiefen Atemzug zu tun.
Schließlich gelangte ich völlig aus der Puste und mit einem beunruhigenden Bauchgefühl am schmiedeeisernen Tor des Abney Parks an.
In der Ferne konnte ich etwas weiß Leuchtendes zwischen einer Baumgruppe verschwinden sehen. Vermutlich handelte es sich dabei um das Fell des Kaninchens. Missmutig stemmte ich die Hände in die Hüften, keuchte rastlos und nahm die Kühle des Windes, das raue Gestein unter meinen Füßen und den aufziehenden Duft von Wald und Bäumen in mich auf. Ich war so an den Rauch und die Abgase dieser Stadt gewöhnt, dass ich umso erstaunter war, die Frische der Blätter, des Grases und des sich bildenden Taus zu riechen.
Unentschlossen blickte ich an dem Hindernis vor mir hoch und überlegte noch einmal, ob meine kopflose Verfolgungsjagd die Anstrengung wirklich wert war. Ich konnte mir selbst nicht erklären, wieso ich diesem seltsamen Wesen gefolgt war. Der Anblick des mechanischen Körpers hatte mich so gefesselt und für sich eingenommen, dass der Gedanke, das Tier einfach ziehen zu lassen, mindestens genauso abstrus schien, wie die Taschenuhr wegzuwerfen.
Ich schaute hinab auf den edlen Gegenstand in meiner Hand und betrachtete das Voranschreiten der Zeiger auf dem Ziffernblatt. Dieser winzige Mechanismus ähnelte auf verwirrende Art und Weise dem des Kaninchens. Inzwischen war ich mir sicher, dass die beiden miteinander in Verbindung stehen mussten. Es konnte sich unmöglich um ein normales Tier und eine alltägliche Uhr handeln.
Woher kam dieser unerklärliche Drang, der Sache auf den Grund zu gehen?
Ich zögerte keine Sekunde, stellte meine Schuhe auf dem Boden ab und schwang mich an dem Tor hoch. Meine Finger umklammerten die Eisenstangen, während meine Füße Halt an den Querbalken suchten. Kurzerhand hangelte ich mich an den metallischen Streben empor und sprang auf der anderen Seite des Tores hinunter. Leider hatte ich nicht allzu viel Übung darin, über Tore zu klettern und in Parks einzubrechen, weshalb ich trotz größter Bemühungen eine Bruchlandung auf meinem Hintern hinlegte. Mir entfuhr ein genervter Laut, während ich mein schmerzendes Steißbein rieb.
Trotz der unsanften Landung, die meine Gliedmaßen und Knochen bis ins Mark erschütterte, hatte ich es mir wesentlich schwieriger vorgestellt. Langsam rappelte ich mich auf und hielt einen Moment inne. Ich nahm sofort wahr, wie weich sich der Boden unter meinen Füßen anfühlte und wie der erfrischende Waldgeruch jede meiner angespannten Fasern zum Seufzen brachte.
Je weiter ich in den Park vordrang, desto mehr veränderte sich die Umwelt und nach einer kurzen Weile fühlte es sich nicht länger so an, als würde ich mich innerhalb Londons aufhalten. Statt Steinen befanden sich Erde und Gras unter mir und der ohrenbetäubende Lärm wurde von gigantischen Baumkronen abgeschirmt, denn hier herrschten nichts als Ruhe und Stille. Im Gegensatz zu den umherzuckenden Lichtern der Straßen umhüllte mich nun Dunkelheit.
Ich entschied mich dafür, einen Weg abseits der allgemeinen Pfade zu beschreiten, und schob Äste und Zweige zur Seite, während ich nach dem Grund für meine Anwesenheit Ausschau hielt. Meine Fingerkuppen strichen über Tau und Blätter hinweg, während ich gierig den Duft nach Beeren, Erde und Moschus in mich aufsaugte und die Stille der Natur genoss. Meine Schritte federten ungewohnt, sodass mich eine Leichtigkeit und Unbeschwertheit überfiel, die ich nicht einmal aus meiner Kindheit kannte. Ich folgte keinen Wegen, keinen Pfeilen oder Schildern, sondern bahnte mir blind meinen Weg durch den Park, ließ meine Füße, Instinkte und Intuition die Richtung weisen, während ich auf jedes verräterische Knacken und Rascheln lauschte…
Bis ich endlich inmitten einer Baumgruppe das weiße Paar Kaninchenohren ausmachte.
Sofort ging ich in Deckung, hockte mich hinter einen Brombeerstrauch und gab keinen Laut mehr von mir. Allerdings schlug mein Herz so lautstark gegen meine Rippen, dass ich befürchtete, es könnte mich in der Stille der Nacht verraten. Nachdem ich wenige Minuten hinter dem Busch verharrt hatte und sich Schweißperlen auf meiner Stirn bildeten, beschloss ich, meinen Weg fortzusetzen. Äste und Steinchen bohrten sich in meine Fußsohlen.
Möglichst leise pirschte ich mich nun von hinten an das Kaninchen heran, bis ich inmitten der Geräuschlosigkeit des Waldes plötzlich eine hohe Fistelstimme vernahm.
»Zu spät, zu spät … Immer sind diese vermaledeiten Menschen zu spät.«
Für einen Moment glaubte ich, dass es sich bei der Stimme um einen der Wächter handelte, die des Nachts im Abney Park patrouillierten, weshalb ich mich hektisch umsah und den Sichtschutz eines nahebeistehenden Baumes aufsuchte.
Ich war nichts weiter als ein umherstreifender Schatten.
Das Moos dämpfte meine Schritte und ich atmete so flach wie möglich, um bloß kein Geräusch zu erzeugen. Die Nacht hatte mich voll und ganz verschluckt, ich war so gut wie unsichtbar für jeden in meiner Umgebung.
Doch ich entdeckte kein Wachpersonal in der Nähe. Die Stimme stammte von dem Hasen selbst.
Verlor ich nun komplett den Verstand?
Ich gab mein Versteck auf, ohne nachzudenken, fuhr in die Höhe und hauchte mit kratziger Stimme: »Du kannst sprechen?«
Mit meiner Frage durchschnitt ich die Ruhe des Waldes und gab mich dem Blick des Kaninchens preis. Die an meinen Gliedern hinaufziehende Kälte erschwerte jede meiner Bewegungen, während die alles einnehmende Lautlosigkeit um mich herum dafür sorgte, dass sich kein klarer Gedanke in meinem Kopf formen konnte. Die pechschwarzen Augen des Hasen weiteten sich und nachdem ich einmal gewagt hatte, zu blinzeln, hoppelte er davon.
Nur wenige Meter entfernt war er in einem Kaninchenbau verschwunden. Ich stolperte mit zitternden Beinen zu dem Loch hinüber und ließ mich davor auf die Knie fallen, um in die Tiefe hinabzuschauen.
Das Gras strich über meine nackten Arme, was unweigerlich eine Gänsehaut erzeugte. Der Wald roch nicht länger nach Taufrische und Rinde, sondern nach nasser Erde und Baumwurzeln. Ich nahm nur noch das erdige Aroma wahr, das aus dem Kaninchenloch zu mir hinaufwehte.
Unfähigkeit schlich sich zusammen mit dem Bewusstsein, machtlos zu sein, in mein Gedächtnis.
»Ich hätte nicht gedacht, dass Kaninchenlöcher so verdammt riesig sind«, murrte ich, während ich mich an den Rand des Abgrunds setzte und die Beine über den Schlund hinweg streckte. Vorsichtig lugte ich in die Tiefe.
»Ich weiß, dass du da unten bist!«, rief ich in das Loch hinab, wobei meine Stimme mehrmals von allen Seiten zu mir zurück echote. Natürlich wusste ich, dass mir das Karnickel wohl kaum antworten würde. Doch irgendwie musste ich meinen Unmut darüber, dass mir das Tier entkommen war, deutlich machen. Ich zuckte durch den Klang meiner eigenen Stimme, die die nächtliche Stille zerriss, zusammen.
Kaum war der Nachhall verklungen, griff ich nach einem Stein, der einige Zentimeter neben meinem Arm lag. Ich streckte meine geballte Hand über dem Loch aus und ließ ihn fallen. Angestrengt lauschte ich auf den Aufprall, doch es war, als würde der Stein ewig fallen und niemals landen. Kein Laut war aus der Tiefe zu vernehmen, sodass sich in mir Beklemmung ausbreitete.
Ich sollte nicht hier sein.
Ich hätte dem Kaninchen nicht folgen dürfen …
»Zeit, zu verschwinden«, flüsterte ich mir selbst warnend zu und wollte mich gerade wieder aufrichten, als die ausgetrocknete Erde unter mir ins Rutschen kam. Meine Hände fanden keinen Halt mehr, sodass mein Rücken über den Rand des Erdlochs schürfte und meine Beine hilflos in der Luft strampelten, als ich rückwärts in die Schwärze stürzte.
Ich überschlug mich mehrmals und schrie ununterbrochen, doch meine verzweifelten Rufe wurden von niemandem erhört, was mich umso krampfhafter schreien ließ.
Wenige Sekunden später setzte sich in meinen Ohren ein hartnäckiges Ticken fest, dessen Ursprung ich zunächst nicht ausmachen konnte, bis mein nach Hilfe suchender Blick die Wände des Kaninchenbaus streifte, die mit abertausend Uhren und Ziffernblättern gesäumt waren. Ich versuchte, das monotone Geräusch auszublenden, welches sich in meinem Kopf wie ein Tinnitus festsetzte.
Der Fall dauerte ewig an, obwohl das rhythmische Schlagen der Uhren mich davon überzeugte, dass es sich bloß um wenige Sekunden handeln konnte. Der Gestank nach Moder setzte sich ebenso hartnäckig in meiner Nase fest wie die feuchte Erde unter meinen Fingernägeln. Mein Verstand erzeugte plötzlich das Bild, hier unten lebendig begraben zu sein.
Furcht krallte sich in meinem Herzen fest, sodass meine Hände in einem letzten Versuch, Halt zu finden, über die Wände des Lochs schabten. Außer dass sich einige Uhren lösten und an mir vorbei in die Tiefe sausten, erreichte ich damit nichts.
Schwarze Punkte sammelten sich am Rande meines Sichtfelds und drangen langsam in dessen Mittelpunkt vor, während auch meine anderen Sinne allmählich ihre Funktion aufgaben. Der erdige Geruch wurde fahl und stumpf, bis ich nicht einmal mehr die leichteste Duftnote wahrnahm. Auch das Ticken der Uhren wurde von Sekunde zu Sekunde immer leiser und leiser, bis schließlich nur noch gedämpfte Laute zu mir vordrangen.
Der endlose Fall ließ mich mit dem Gefühl zurück, allein zu sein. Bloß die Tränen, die schwerelos in der Luft über mir schwebten, waren Zeugen meiner Einsamkeit.
Als ich mich im Flug um meine eigene Achse drehte, drohte ich, das Bewusstsein zu verlieren. Der Schwindel setzte selbst den letzten Funken meines Verstandes außer Kraft. Doch dann entdeckte ich eine weit entfernte Lichtquelle, die das Ende des Kaninchenbaus andeutete.
Meine schmerzenden Glieder und starren Gedanken lechzten nach Erlösung, weshalb die Hoffnung auf Rettung in mir aufkeimte. Ich klammerte mich an den Rest meines Bewusstseins und ließ das Licht nicht aus den Augen, während die Schwärze über mein Sichtfeld kroch.
Aus dem kleinen Punkt wurden flutende Wellen, die mich umspülten und in ihren Bann zogen. Ich verschränkte schützend die Arme vor meinem Kopf und kniff die Augen zu, um den Aufprall abzumildern, wenn ich ihn überhaupt überleben sollte.
Während die Luft an meinen Ohren vorbeisauste, der Untergrund immer näher rückte und mir heiße Tränen über die Wangen strömten, konnte ich nur an eines denken:
Sah so etwa das Ende aus?
Ich konnte zu diesem Zeitpunkt ja nicht ahnen, dass dies erst der Beginn meines Abenteuers war.
2
Der Mondmechanismus
Das Licht um mich herum erlosch binnen weniger Sekundenbruchteile, weshalb ich den nahenden Untergrund zu spät bemerkte. Meine Knochen knackten und bei dem verzweifelten Versuch, während des harten Aufpralls Halt zu finden, ruderten meine Arme durch die Luft. Ich wollte mich irgendwie abrollen, doch stattdessen schlitterte ich mit dem Rücken über den steinigen Boden; mein ganzer Körper brannte wie Feuer. Erschöpft blieb ich auf dem Rücken liegen und kniff die Augen zusammen.
Ein schmerzhaftes Ziehen erfüllte meinen Brustkorb, während jeder Atemzug durch die aufflammenden Schmerzen erschwert wurde. Vorsichtig betastete ich meine Rippen und stöhnte bei jeder Berührung auf. Hoffentlich war nichts gebrochen, das war das absolut Letzte, was ich gebrauchen konnte.
Dennoch musste ich zugeben, dass es mich auch schlimmer hätte treffen können. Der Fall hatte endlos gewirkt, wohingegen der Aufprall geradezu harmlos gewesen war. Ich wunderte mich, warum ich überhaupt noch lebte. Eigentlich hätte mein Körper durch den Sturz am Boden zerschellen müssen.
Als ich versuchte, mich aufzurichten, hafteten meine Gliedmaßen weiterhin kraftlos am Boden, als hätte der Fall ihnen jegliche Muskelmasse entzogen. Meine Arme und Beine schienen aus Gummi zu bestehen.
Aus Angst vor dem, was mich erwartete, hielt ich meine Augen weiterhin geschlossen und riskierte es nicht, die Lider zu heben. Ich wagte nicht, zu sehen, welche weiteren Schrecken die Welt für mich bereithielt. Reichte es nicht, in einen Kaninchenbau zu stürzen und sich Knochenbrüche oder Prellungen zuzuziehen?
Nach ein paar Minuten des Herumliegens erkannte ich, dass ich auf diese Weise keinen Schritt vorwärts kam, und schickte ein Stoßgebet aus, bevor ich die Augen öffnete. Ein wenig göttliche Unterstützung konnte immerhin nie schaden, oder?
Eine kalte Brise strich über mein Gesicht und ließ meine Haare wehen. Zusammen mit dem Wind wurde ein metallischer Geruch zu mir herübergetragen, der mich die Nase rümpfen ließ. Ich blickte hinauf in den Himmel, der zu meinem Erstaunen dunkelrot gefärbt war, währender am Horizont in ein bedrohliches Schwarz überging.
Bevor ich mich jedoch weiter darüber wundern konnte, warum es unter der Erde einen Himmel gab und warum zum Teufel dieser blutrot schien, versicherte ich mich erst einmal darüber, dass ich nicht allzu schwer verletzt war. Ächzend kämpfte ich mich auf die Beine. Prüfend tastete ich meine Arme, Beine, Knöchel und Gelenke ab. An manchen Stellen spürte ich einen drückenden Schmerz, sobald ich diese berührte. Vermutlich würde ich einige blaue Flecke von meiner Landung davontragen.
Doch nicht nur das: An meinen Ellenbogen und Knien ertastete ich Blut und Hautfetzen. Diese Körperteile hatte ich mir während des Sturzes aufgeschürft. Ich musste nur kurz mit dem Finger über die Wunde streifen, um das Brennen erneut zu spüren. Zischend sog ich die Luft ein. Ein Fluch lag mir auf der Zunge, doch ich schluckte ihn wortlos hinunter. Meine Zähne knirschten und schabten übereinander, in dem verzweifelten Versuch, einen frustrierten Aufschrei zu unterdrücken.
Nachdem ich das Zittern meiner Gliedmaßen einigermaßen kontrollieren konnte, versuchte ich testweise, ein paar Schritte zu gehen. Es fiel mir erstaunlicherweise ziemlich leicht, trotz des unangenehmen Gefühls in meinem unteren Rücken und meinen Beinen. Es fühlte sich beinahe so an, als würde etwas an den Muskeln zerren und an ihnen reißen. Aber kein Knochen schien gebrochen zu sein.
Nach einigen kleinen Schritten war ich jedoch bereits am Ende meiner Kräfte und musste verschnaufen. Ich konnte meine Beine nicht komplett durchstrecken. Wahrscheinlich hatte ich mir einige nicht ganz so unbedenkliche Prellungen zugezogen.
So ein verfluchter Mist. Vielleicht war ich ja doch schon tot? Solche Schmerzen hatte ich noch nie in meinem Leben.
Nein, dafür wirkten die Schmerzen zu real. Erst als ich mir sicher war, dass ich tatsächlich noch aus einem Stück bestand und mir zumindest keine starke Verletzung zugezogen hatte, richtete ich meine Aufmerksamkeit auf die Umgebung.
Wenn ich auch vermutlich nicht tot gewesen war, die Landschaft war es sehr wohl. Sie wirkte tot.
Über mir ragte der rote Himmel auf und ansonsten war weit und breit nichts zu sehen. Keine Lebewesen, keine Pflanzen, keine Menschen.
Ich spürte nicht einmal einen winzigen Lufthauch.
Doch das Seltsamste war mit Abstand der Untergrund: Er war durchgehend mit schwarzen und weißen Steinfliesen bedeckt. Egal wie ich mich drehte und wendete, ich sah weit und breit nur Schwarz, Weiß und Rot. Es wirkte fast so, als hätte ich mich auf einem gigantischen Schachfeld verirrt. Mit zitternden Fingern bückte ich mich hinab und strich über die glatte, kalte Oberfläche des Gesteins.
Was war das für ein eigenartiger Ort?
Aus weiter Ferne ertönte das altbekannte Ticken von Uhren. Der Gestank von Eisen war so beißend, dass er mir die Luft zum Atmen nahm. Meine Organe zogen sich zusammen und ich hatte das Gefühl, von der Einsamkeit und Leere um mich herum erstickt zu werden. Beklemmung breitete sich in mir aus und ließ mich unruhig werden. Ich zupfte an meinem Rocksaum herum, da ich nicht wusste, was ich mit meinen zitternden Fingern sonst hätte tun sollen.
Das alles konnte doch unmöglich wahr sein!
Verlor ich etwa vollkommen den Verstand?
War ich bei dem Aufprall mit dem Kopf aufgeschlagen und bildete mir das alles womöglich nur ein?
»Bewahr deine Fassung, Alice!« Ich versuchte, mich selbst zu beruhigen, mir Mut zuzusprechen … erfolglos.
Mein Kopf brummte vor Gedanken, die es mir nicht ermöglichten, das einzuordnen, was vor mir lag. Die Schachebene wirkte so unendlich weit und reichte fast bis an den Horizont heran. Die rote Farbe des Himmels bedrückte mich und erinnerte mich immer mehr an stetig fließendes Blut. Bei diesem Gedanken lief ein Schauder an meiner Wirbelsäule hinab, sodass ich den Blick abwenden musste. Ich inspizierte meine Umgebung weiter und versuchte zeitgleich den aufdringlichen Kupfergeruch auszublenden. Weit entfernt erspähte ich mehrere seltsam geformte Silhouetten und fasste den Entschluss, nachzusehen, worum es sich bei den Schemen handelte.
Ob dort Hilfe zu finden war? Ich legte all meine Hoffnung darauf.
Mit unsicheren Schritten humpelte ich auf die Umrisse zu, wobei meine blanken Füße ein dumpfes Geräusch beim Auftreten erzeugten.
Dieser Ort war mir nicht geheuer. Er wirkte kalt und schrecklich einsam, sodass ich mich unweigerlich fragte, ob es hier unten irgendeine Form von Leben gab. Ein dünner Schweißfilm bedeckte meine Stirn, den ich schnell mit dem Handrücken beiseite wischte.
Je näher ich den Silhouetten kam, desto mehr Details erkannte ich und desto intensiver wurde das Ticken. Es handelte sich um pflanzenähnliche Gebilde, die Bäumen nur im Entferntesten ähnelten. Denn diese Gewächse bestanden vollständig aus glänzend poliertem Kupfer. Der aufdringliche metallische Gestank ging offensichtlich von ihnen aus und verbiss sich in meiner Nase. Ich streckte meine Hand nach einem der Stämme aus und fuhr mit meinen Fingern Dellen und Gravuren nach, die die Rinde zierten.
Verblüffend. Wirklich erstaunlich!
Die Pflanze wirkte verdammt echt. Die Kühle des Materials kroch an meinem Arm empor und ließ meine Gelenke versteifen.
Verzweiflung sprudelte durch meine Adern und wusch den Schock hinfort, der dafür gesorgt hatte, dass ich mich bis jetzt unter Kontrolle gehabt hatte. Ich wusste nicht, wo ich mich befand oder was das hier für eine Gegend war, doch ich fühlte mich fehl am Platz. In einer Umgebung, in der nichts als Kälte und Ticken vorherrschten, fühlten sich die Wärme meiner Haut und das Pochen meines Herzens wie ein unpassendes Puzzlestück an.
Ich gehörte nicht hierher.
Während mein Blick an dem Baum empor wanderte, senkte ich meine Hand. Streben rankten sich in die Höhe und erzeugten das Abbild von Ästen, die ihre Spitzen in den Himmel reckten. Ein Luftzug wehte über mich hinweg und ließ die kupfernen Blätter klirren. Als ich eines von ihnen abpflücken wollte, musste ich es sogar mit beiden Händen ergreifen und kräftig daran ziehen, da es sich kaum vom Zweig lösen ließ. Nach einem kräftigen Ruck hielt ich es schließlich in der Hand und betrachtete es näher. Ich war beeindruckt von der Feinheit, mit der die Gravuren in das Metall eingearbeitet worden waren.
Es sah so wahnsinnig echt aus…
Durch die hauchdünnen Linien entstand der Eindruck von Adern, die sich über das Äußere des Blattes zogen. Ich spürte die Rauheit des oxidierten und bereits grün angelaufenen Kupfers, als ich probeweise mit spitzen Fingern über die Oberfläche strich. Es lag schwer in meiner Hand und hatte nichts mit den Pflanzen gemeinsam, die ich von zu Hause kannte. Ich ließ es auf den Boden fallen, wo es mit einem dumpfen Laut aufprallte.
Das hier war nicht richtig, diese Welt war durch und durch falsch.
Was sollte das alles hier?
Wo war ich bloß gelandet?