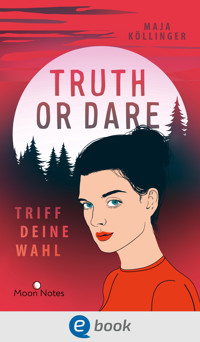8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ihr Schicksal wird fremdbestimmt. Ihre Hochzeit ist bereits in Planung. Ihre Gefühle spielen keine Rolle. Adaliz, die Nachfahrin des mächtigsten Fluchwebers im Lande, wurde dem Kronprinzen Jaro versprochen. Der schicksalhafte Verlobungsball, der ihre beiden Leben unumkehrbar miteinander verbinden soll, findet bereits in wenigen Nächten statt. Währenddessen sorgt ein Gerücht für Entsetzen im Königreich Olorá: Adaliz soll eine geheime Geliebte haben. Ausgerechnet Odette, eine einfache Bürgerliche. Das missfällt nicht nur der Königsfamilie, sondern auch Adaliz' Vater. Er zögert nicht lange, sondern webt einen Fluch aus dem Licht schimmernder Schwanenfedern und glänzender Tränen, um die beiden Liebenden endgültig voneinander zu trennen. Womit er jedoch nicht rechnet, ist der unbeugsame Wille seiner eigenen Tochter. Denn Adaliz ist bereit, für Odette zu kämpfen, auch wenn sie dafür die Zukunft des gesamten Königreichs aufs Spiel setzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Federlicht und Tränenglanz
MAJA KÖLLINGER
Copyright © 2025 by
Lektorat: Alex Parker
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout Ebook: Stephan Bellem
Buchsatz: Julian Behrendt & Astrid Behrendt
Illustrationen: Maja Köllinger
Landkarte: Magali Volkmann
Bildmaterial: Unsplash.com
Umschlag- und Farbschnittdesign:
Alexander Kopainski
Bildmaterial: Shutterstock
Druck: Booksfactory
ISBN 978-3-95991-862-6
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Playlist
1. Akt
Prolog
1. Der vereitelte Antrag
2. Verhängnisvolle Täuschung
3. Geheime Liebe
4. Der Tränensee
5. Ungebetener Gast
6. Fluchkollision
7. Erwachen des schwarzen Schwans
8. Tintenschwarzes Federkleid
9. Auf eigene Faust
10. Schwanenschwarm
2. Akt
11. Dämmerstunde
12. Der erste Flug
13. Niemals
14. Fünf Jahre zuvor
15. Geheimgänge
16. Leere Seiten
17. Geheime Schriften
18. Die Opferung des Herzens
19. Verlorene Erinnerung
20. Zerbrochenes Licht
21. Fünf Jahre zuvor
22. Entführung
23. Gebrochene Herzen
24. Abweisung
25. Verfolgungsjagd
26. Beschützerinstinkt
27. Liebe auf den ersten Blick?
28. Mitternachtstanz
29. Es beginnt
30. Gitterstäbe
31. Hoher Besuch
32. Ich liebe dich
33. Die Anprobe
34. Spiegelbild
35. Eine Verwandlung anderer Art
3. Akt
36. Marionette
37. Der große Auftritt
38. Die Auswahl
39. Ja, ich will?
40. Erlösung
41. Verräterin
4. Akt
42. Wer einander verdient
43. Benutzt
44. Maßlose Enttäuschung
45. Wiedergutmachung
46. Kampfbereit
47. Fünf Jahre zuvor
48. Unterwerfung
49. Dreizehn Jahre zuvor
50. Die Mächte der Ahnen
51. Bereit zu sterben?
52. Versenkt in der Tiefe
53. Kein Lebewohl
Epilog
Danksagung
Drachenpost
Für mich,
weil ich durch das Schreiben dieses Buches
zurück zu mir selbst gefunden habe.
Playlist
1. Akt
Tchaikovsky: Swan Lake, Op. 20, Act 1: No. 2, Waltz
The lakes – Taylor Swift
Forgotten Love – AURORA
Luminary – Joel Sunny
2. Akt
Tchaikovsky: Swan Lake, Op. 20, Act 2: No. 13d, Dance of the Swans
Willow – Taylor Swift
Echanted – Taylor Swift
Soft Universe – AURORA
Genesis – Grimes
Runaway – AURORA
BLUE – Billie Eilish
3. Akt
Tchaikovsky: Swan Lake, Op. 20, Act 2: No. 10, Scene. Moderato
Who wants to live forever – David Garrett
Who’s Afraid Of Little Old Me – Taylor Swift
Which Witch – Florence + The Machine
BITTERSUITE – Billie Eilish
To Ashes and Blood – Woodkid
4. Akt
Tchaikovsky: Swan Lake, Op. 20, Act 4: No. 29, Finale
Young And Beautiful – Lana Del Rey
Say Yes To Heaven – Lana Del Rey
1. Akt
Prolog
Die Liebe ist egoistisch. Ein Biest, das sich von niemandem bändigen lässt. Nicht einmal von der Person, in deren Brust es haust.
Die Liebe ist stur. Sie verweigert jegliche Vernunft und tut alles dafür, um ihren Willen durchzusetzen.
Die Liebe ist erbarmungslos. Eine einsame Kämpferin gegen ihre ewigen Erzfeinde: Logik und Verstand.
Ich wünschte, ich könnte behaupten, dass ich rational denke. Dass ich die Folgen meiner Taten berücksichtige. Dass ich mich nicht blind von meinen Emotionen steuern lasse.
Denn die Wahrheit ist: Ich bin egoistisch. Und verliebt.
Der vereitelte Antrag
Du schaust drein, als wärst du zum Tode verurteilt worden«, warf mir der Prinz an den Kopf. Unweigerlich zuckte mein rechter Mundwinkel in die Höhe, obwohl ich mich darum bemühte, meinen grimmigen Gesichtsausdruck beizubehalten.
»Ich würde eine Hinrichtung jederzeit bevorzugen«, erklärte ich. Mein Blick löste sich von dem haselnussbraunen Lockenschopf des Thronfolgers und schweifte stattdessen über den Marktplatz, auf der Suche nach seinen Leibwachen. Normalerweise verließen sie nur äußerst selten die Seite des Prinzen und hielten sich immer in der Nähe auf. Wahrscheinlich hatten sie sich unter das gemeine Volk gemischt, um keine Aufmerksamkeit zu erregen.
Menschenmassen schoben sich an uns vorbei und drängelten sich dicht zusammen. Männer und Frauen schunkelten Arm in Arm zu einer schwungvollen Melodie, die von einem Streicher am Rand des Platzes stammte. Dieser wippte im Takt mit seinen Fußspitzen und trug ein breites Lächeln auf den Lippen. Ich konnte nicht verhindern, dass auch meine Fußspitze leicht wippte.
Die Fassaden der Häuser um uns herum waren geschmückt mit wilden Blumen und Kräutern, die einen intensiven Duft verströmten. Das Aroma wurde lediglich von dem Geruch frischer Backwaren übertrumpft, die an jeder Hausecke feilgeboten wurden. Warmes Brot, knusprige Teigtaschen und sogar Süßspeisen, die mit kostbaren Gewürzen verfeinert worden waren. Es juckte mich in den Fingern, ebenfalls ein Stückchen des Gebäcks zu erwerben. Mein Magen knurrte auffordernd, aber ich zwang ihn zur Geduld.
Obwohl mich das Hoffest mit Euphorie und Freude erfüllen sollte, verknoteten sich meine Eingeweide beim Anblick der sorglos tanzenden Menschen. Das einfache Volk feierte den fünfzigsten Geburtstag des Königs, doch ich war aus einem ganz anderen Anlass hier. Mein Beweggrund stand genau neben mir und grinste mich schief an.
An einem Fahnenmast über seinem Kopf wehte das Wappen von Olorá, unserem Königreich. Unserer Heimat. Ich musterte die Stofffahne, auf die mit perlmuttfarbener Seide ein Schwan auf azurblauen Grund gestickt worden war. Seine Flügel breiteten sich fächerartig hinter seinem schlanken Hals und dem geschwungenen Körper aus. Dasselbe edle Motiv ließ sich auch auf dem Gewand des Prinzen wiederfinden.
»Es ist nur ein harmloses Treffen, Adaliz. Nichts weiter«, meinte Prinz Jaro und stieß mir seinen Ellenbogen in die Seite.
»Du weißt genau, dass das nicht stimmt«, knurrte ich und verschränkte die Arme vor der Brust. Auch Jaro wurde mit einem Mal schweigsam und presste die Lippen zusammen. Es ist seit Jahren dasselbe Spiel: Mein Vater, die rechte Hand des Königs, verschaffte mir ein Treffen mit dem Thronfolger in der Hoffnung, dass wir uns unsterblich ineinander verliebten und ich die nächste Königin von Olorá wurde.
Die sagenumwobene Königsfamilie herrschte bereits seit Jahrhunderten über das Waldgebiet und die nahe liegenden Seen von Olorá. In der Vergangenheit wurde unser idyllisches Reich jedoch von Kriegen und Krankheiten heimgesucht, was dazu geführt hat, dass das Territorium des Königshauses immer kleiner wurde.
Inzwischen bestand das einst große Reich nur noch aus einer eingemauerten Stadt, die sich in einen äußeren und einen inneren Ring unterteilte.
Mein Blick schweifte über die Feiernden. Wir befanden uns zurzeit im äußeren Ring der Stadt, wo das einfache Volk hauste. Hier pulsierte das Leben, weil sich so viele Menschen in den engen Gassen und Straßen tummelten. Überall um uns herum befanden sich Wohnhäuser, Werkstätten und Geschäfte, in denen die Menschen ein und aus gingen.
Der innere Ring jedoch wurde durch eine weitere Mauer von dem gewöhnlichen Volk abgeschnitten. Dahinter befand sich die Burg der königlichen Familie. Im Gegensatz zum äußeren Ring war der innere Ring überraschend still und leblos, da sich dort meist nur Jaro, seine Eltern und die Berater des Königs aufhielten.
Die beiden Welten wurden mithilfe des öffentlichen Marktplatzes miteinander verbunden, wodurch sich auch die kleine Königsfamilie oft außerhalb des inneren Ringes blicken ließ, wann immer dort gefeiert wurde. Die Menschen in Olorá liebten den König, seine Partnerin und Jaro. Die drei wurden von den meisten Menschen im Königreich geschätzt und respektiert, weil sie so nahbar waren.
Die einst große Königsfamilie war in den letzten Jahrhunderten durch die vergangenen Kriege und Krankheiten so stark zusammengeschrumpft, weshalb es sogar zu einer Art Brauch wurde, dass der jeweilige Kronprinz eine Braut aus dem gemeinen Volk oder aus den benachbarten Reichen erwählte. Durch diese arrangierten Hochzeiten wurden zahlreiche Machtkämpfe besiegelt und endlich ein Zeitalter des Friedens eingeläutet. Unser jetziger König, Jaros Vater, musste bisher keinen einzigen Tag in seinem Leben kämpfen. Stattdessen hielt er die Bevölkerung mit Festen bei Laune.
Immer wieder haben der Prinz und ich gemeinsam die legendären Stadtfeste oder Bälle besucht. Manchmal sind wir sogar gemeinsam durch den Rosengarten des Schlossgartens spaziert. Doch zu keinem Zeitpunkt habe ich auch nur die geringste Anziehung zu Jaro verspürt. Wir haben uns zwar gut verstanden und konnten miteinander scherzen, aber wir besaßen definitiv keine gemeinsame Zukunft. Egal wie sehr sich mein Vater dies erhoffte.
Der Charme des Prinzen war völlig wirkungslos bei mir. Was möglicherweise daran lag, dass eine andere Person bereits mein Herz gestohlen hatte …
»Meine Mutter veranstaltet in sieben Tagen einen weiteren Hofball«, offenbarte Jaro plötzlich. Ich hob fragend die Schultern. Ein Ball war nichts Besonderes in Olorá. Beinahe monatlich fand eine Veranstaltung statt, bei der im Thronsaal Walzer getanzt und Unmengen an Wein vergossen wurden.
Auch Stadtfeste wie das heutige waren keine Seltenheit. In Olorá wurde jede Gelegenheit genutzt, um zu feiern und die Herrscherfamilien aus den benachbarten Territorien einzuladen. Das Vergnügen der Königsfamilien und der Bevölkerung stand jederzeit an oberster Stelle, denn glückliche Menschen verursachten bekanntlich weniger Schwierigkeiten.
Ich versuchte normalerweise die Bälle und Stadtfeste zu meiden und mich davor zu drücken, weil mich mein Vater beinahe jedes Mal mit Prinz Jaro auf die Tanzfläche zwang, während er selbst jede meiner Bewegungen kritisch beäugte. Nein danke, darauf konnte ich gut verzichten.
»Sie hat mir ein Ultimatum gestellt«, raunte Jaro schließlich, damit uns keiner der Umstehenden hörte.
»Ein Ultimatum?«, wiederholte ich seine Worte ungläubig. Ein flaues Gefühl erfüllte meine Magengrube. Das klang gar nicht gut.
Jaro nickte. »Ich muss während des Balls meine Braut auswählen und öffentlich verkünden.« Der Prinz knirschte mit den Zähnen, dabei sah ich deutlich, wie seine Kiefer mahlten.
»Jaro …«
»Sag nichts. Wir wussten beide, dass dieser Tag kommen wird«, schnitt er mir das Wort ab. Er hatte recht. Solang wir einander kannten, beschwerte sich Jaro schon über seine Mutter, die Königin. Seit Jahren verlangte sie von ihm, eine passende Nachfolgerin zu finden. Zwischendurch hatte ich sogar geglaubt, dass sich mein Vater und die Königin zusammengeschlossen hatten, um Jaro und mich miteinander zu verkuppeln. Es wäre so verflucht einfach, wenn wir einander lieben würden. Das würde all unsere Probleme lösen.
»Was, wenn du niemanden auswählst?« Ich wagte es kaum, die Frage laut auszusprechen.
»Dann wird sie eine Wahl für mich treffen.« Seine Antwort war so simpel und dennoch kaum zu glauben.
»Du solltest selbst entscheiden dürfen, wen du heiratest. Jeder Bauerntölpel darf seine Braut selbst wählen, und ausgerechnet ein Prinz hat keine Wahl. Das tut sie nur, um die Krone zu sichern.«
»Und für ihre heiß ersehnten Enkel«, schob der Prinz mit einem traurigen Lächeln hinterher. Es sollte uns nicht überraschen, schließlich wurden die Ehen der Kronprinzen und -prinzessinnen schon seit jeher fremdbestimmt. Trotzdem erfüllte mich die Vorstellung, dass Jaro keine Wahl hatte, mit Unbehagen. Er war in meinen Augen eben nicht nur ein Prinz, sondern auch mein Freund. Traditionen hin oder her.
»O Jaro …« Tröstend hob ich den Arm und legte die Hand auf seine Schulter. Ich wünschte, ich könnte ihm die unsichtbare Last von den Schultern nehmen und die Sorgenfalten von seiner Stirn wischen.
»Letzte Chance, Adaliz. Willst du mich heiraten und meine Frau werden? Die zukünftige Königin von Olorá?« Jaros Stimme hatte einen heiteren Unterton, doch in seinen Worten lag eindeutig ein Hauch Ernst. Der Prinz war so verzweifelt, dass er sogar mich heiraten würde, um einer Zwangshochzeit zu entgehen. Dabei wusste er ganz genau, dass ich mein Herz bereits an eine andere verloren hatte. Eine Hochzeit würde uns beide unglücklich machen.
»Klingt verlockend, aber du kennst meine Antwort«, entgegnete ich. Sein schiefes Grinsen verrutschte. Manchmal beschlich mich das Gefühl, dass Jaro unserer Hochzeit gegenüber nicht ansatzweise so abgeneigt war wie ich. Ich wünschte, ich könnte ihm geben, was er sich erhoffte. Aber das würde bedeuten, alles aufzugeben, was ich liebte.
Wenn mein Vater von diesem Heiratsantrag und meiner Ablehnung wüsste, würde er mir vermutlich eigenhändig den Hals umdrehen. Und das war nicht einmal übertrieben.
»Es war einen Versuch wert. Scheint so, als müsste ich mich meinem Schicksal fügen«, lenkte Jaro ein. Er fuhr sich mit gespreizten Fingern durch die Locken und sammelte sich einen Moment lang, bevor er in seinem gewohnt lockeren Tonfall meinte: »Immerhin hat eine von uns noch eine Chance auf die wahre Liebe.«
Er wollte mich triezen, das war mir bewusst, aber Jaro wusste nicht, dass seine Worte einen dicken Kloß in meinem Hals erzeugten, den ich nur schwer runterschlucken konnte. Die Vorstellung, ihn unglücklich zu machen, gefiel mir genauso wenig wie ihm. Aber was hatte ich für eine Wahl?
Schon seit einer Weile nahm ich ein verräterisches Prickeln in meinem Nacken wahr. Die Härchen auf meinen Armen stellten sich auf. Ich konnte das Gefühl, beobachtet zu werden, einfach nicht abschütteln. Es begleitete mich bereits den ganzen Tag.
»Du kannst es dir ja noch mal durch den Kopf gehen lassen.«
Ich überhörte seinen Vorschlag und suchte stattdessen systematisch unsere Umgebung ab. Die Hauswände, die Menge und schließlich sogar die Stadtmauer des inneren Rings, die sich direkt hinter unserem Rücken erhob. Tatsächlich entdeckte ich knapp über uns auf der Mauer eine Person, die die Masse aus tanzenden Menschen beobachtete. Ich kniff die Augen zusammen. Handelte es sich um eine Wache?
Die Silhouette zeichnete sich vor dem strahlend blauen Himmelszelt ab. Es war keine Rüstung zu erkennen, stattdessen wehte ein dunkler Umhang im leichten Wind. Ein Augenpaar, hellgrün wie Waldmeister, blitzte auf, als der Mann den Kopf drehte und ein Sonnenstrahl auf sein Gesicht traf. Unwillkürlich zuckte ich zusammen, als meine letzten Zweifel ausgelöscht wurden. Ich kannte diese Augen. Immerhin hatte ich sie geerbt.
»Wir stehen unter Beobachtung«, zischte ich dem Prinzen zu und deutete unauffällig in Richtung Stadtmauer. Jaro folgte meinem Fingerzeig und blinzelte überrascht, als er meinen Vater erkannte.
»Ist das etwa …«
»General Rotbart.« Ich presste die Zähne so fest zusammen, dass ein unangenehmes Knirschen ertönte. Es war kaum zu glauben. Mein Vater besaß tatsächlich die Dreistigkeit, hier aufzutauchen und den Prinzen und mich zu beschatten! Seit Jahren spürte ich seinen immer enger werdenden Kontrollgriff, wann immer er in der Nähe war. Wütend ballte ich die Hände zu Fäusten und grub meine spitzen Fingernägel in die Handballen, wodurch kleine, blutige Halbmonde auf meiner Haut zurückblieben.
Hoffentlich hatte er über die Distanz hinweg nicht den Kommentar von Jaro über meine wahre Liebe aufschnappen können. Oder gar seinen scherzhaften Heiratsantrag.
»Warum ist er hier?«, fragte Jaro im Flüsterton, ohne meinen Vater aus den Augen zu lassen.
»Was glaubst du denn? Er will sichergehen, dass unserer baldigen Hochzeit nichts im Weg steht«, grummelte ich. Warum war mein Vater bloß so versessen darauf, dass ich irgendwann an Jaros Seite herrschte? Reichte es ihm nicht, die rechte Hand des Königs zu sein? Er war einer der einflussreichsten Männer unseres Landes.
»Na, dann sollten wir ihm geben, was er will«, schlug Jaro vor. Ein dämonisches Funkeln blitzte in seinen dunkelbraunen Iriden auf. Ihn schien die Beschattung meines Vaters regelrecht zu amüsieren.
»Wie meinst du das?«
»Nun ja, er ist uns immerhin bis hierher gefolgt. Wir sollten ihm eine Darbietung unserer unsterblichen Liebe liefern, findest du nicht?« Er zwinkerte mir verschwörerisch zu.
»Wie lautet dein Plan?«, fragte ich. Mit seinen Andeutungen hatte er meine Neugierde erweckt. Während mir Jaro seine Idee ins Ohr wisperte, zupfte ein Grinsen an meinen Mundwinkeln. Schließlich übertrumpfte die Rachsucht meinen Zorn.
Verhängnisvolle Täuschung
Darf ich um diesen Tanz bitten?« Der Prinz verbeugte sich tief, um mir anschließend seine Hand anzubieten. Ich starrte die geöffnete Handfläche einen Moment lang zögernd an und warf einen letzten prüfenden Blick zu der Schattengestalt auf der Stadtmauer, bevor ich steif nickte und meine Finger mit den seinen verflocht. Hoffentlich ging unser Plan auf.
Es fühlte sich seltsam an, Jaros Hand zu halten. Irgendwie unnatürlich. Meine Finger schwitzten, und sein Griff war viel zu fest. Dennoch zog er mich mitten in die Masse. Fort von der schützenden Mauer und hinein in die tanzende und singende Menge. Bestimmt beobachtete Jaros Leibwache jede seiner Bewegungen aus sicherer Entfernung, um im Fall eines Notfalls eingreifen zu können. Doch die normale Bevölkerung liebte es, mit dem Kronprinzen gemeinsam zu feiern. Bisher war es noch nie zu Übergriffen gekommen, sodass Jaro sich selbst in großen Mengen sicher fühlte. Ganz im Gegensatz zu mir.
Der Geräuschpegel stieg mit jedem Schritt rasant an. Menschen grölten in meine Ohren, andere klatschten den Takt der Musik mit, und innerhalb weniger Sekunden traten mir mindestens drei Personen auf die Füße.
»Hoch lebe der König! Hoch! Hoch! Hoch!«, schallte es aus allen Winkeln und Gassen, bevor die Krüge erhoben und auf den Herrscher Olorás angestoßen wurde. Getränke schwappten über, Tröpfchen flogen durch die Luft und zerplatzten auf meinem edlen nachtschwarzen Gewand. Angewidert rümpfte ich die Nase.
Ich hasste es zu feiern. Menschenmassen und laute Musik überforderten mich so sehr, dass ich nach einem Fest wie diesem mindestens drei Tage Ruhe und Stille zwischen meinen geliebten Bücherstapeln brauchte, um mich zu erholen. Auch in diesem Moment sehnte ich mich nach meinem durchgesessenen Lesesessel und einer Geschichte, in der ich versinken konnte. Heute war es mir allerdings nicht gestattet, vor der Realität zu fliehen.
Endlich blieb Jaro stehen. Er verharrte genau im Zentrum des Platzes und wandte sich mir zu, ohne meine Hand loszulassen. Rings um uns herum hüpften und tanzten die Bürger völlig gelöst. Einige bildeten einen Reigen, andere wiederum wiegten sich völlig frei im Rhythmus der Musik.
»Lass mich führen«, bot Jaro an, als er meinen hilflosen Blick bemerkte.
»Nur über meine Leiche«, hätte ich ihm am liebsten entgegengeschleudert, aber leider sah unser Plan vor, dass wir die Erwartungen meines Vaters erfüllten und miteinander tanzten, um in der Masse unterzutauchen. Mit einem schweren Seufzen beugte ich mich meinem Schicksal.
Jaro hob unsere verschränkten Hände an, bevor er seinen freien Arm um meine Taille schlang und mich mit einem Ruck an seine Brust zog. Jegliche Luft wurde mir aus der Lunge gepresst, und ich sah erstaunt zu ihm auf. Für einen Moment geriet mein Herz ins Stolpern, als ich in seine warmen Augen blickte. Nur einen flüchtigen Herzschlag lang konnte ich nachvollziehen, warum so viele junge Frauen für den Prinzen Olorás schwärmten. Er war nicht nur gut aussehend, sondern auch charmant.
Leider war Jaro nicht derjenige, der meinen Puls allein durch seine bloße Anwesenheit zum Rasen und meine Haut mit einer kleinen Berührung zum Prickeln brachte. Nein, das wäre zu einfach gewesen.
»Lass es uns hinter uns bringen«, zischte ich.
Er lachte. »Ich liebe dein sonniges Gemüt, Adaliz.« Sein sarkastischer Unterton war unüberhörbar. Nur eine Sekunde später festigte er den Griff um meine Hand und leitete unseren Tanz an. Es war ein simpler Walzer. Nichts Kompliziertes. Dennoch verpasste ich ein ums andere Mal meinen Einsatz, tat die falschen Schritte und trampelte Jaro immer wieder auf die Füße. Andauernd rempelten mich umstehende Menschen an und brachten mich aus dem Gleichgewicht. Es war furchtbar. Tanzten die anderen Festbesucher wirklich aus reinem Vergnügen? Ich konnte es mir kaum vorstellen.
Ich besaß das Taktgefühl einer Ente, während ich hoch konzentriert auf meine Füße starrte und versuchte, mich den fließenden Bewegungen meines Tanzpartners anzupassen. Die Musik klang in meinen Ohren krumm und schief. Ich hörte keinen Rhythmus heraus, dem ich mich anpassen konnte. Tanzen gehörte wirklich noch nie zu meinen Stärken.
»Du wirst besser«, lobte Jaro, wofür er sich einen bösen Seitenblick einfing.
»Lüg mich nicht an!«
»Ich lüge nicht. Beim letzten Ball bist du mir innerhalb der ersten Minuten mindestens zehnmal auf die Zehen getreten. Das hat sich seitdem halbiert. Hast du etwa heimlich geübt?« Sein strahlendes Lächeln strotzte vor Belustigung.
»Du bist wirklich unmöglich …«, murmelte ich lediglich, bevor ich mich wieder auf die Walzerschritte konzentrierte. Im selben Moment trat ich Jaro erneut auf die Zehenspitzen. Eventuell war das kein Versehen gewesen. Sein Lächeln verrutschte, und ich sah den Schmerz in seinen Augen aufflackern.
»Machst du das etwa absichtlich?«, fragte der Prinz mit einem drohenden Unterton. Nun war ich diejenige, die ihn angrinste. Er schüttelte daraufhin ungläubig den Kopf.
»Du bist wirklich unmöglich …«, wiederholte er meine Worte.
Auf diese Weise vertrieben wir uns die Zeit. Wir tanzten und triezten uns, während wir uns durch die Menge schoben und uns immer weiter von der Stadtmauer entfernten. Hoffentlich ging unser hastig geschmiedeter Plan auf.
In der Menschenmenge würde uns mein kontrollsüchtiger Vater nicht mehr ausmachen können, sodass ich mich in einem günstigen Augenblick von Jaro trennen und endlich zu der Person eilen konnte, nach der ich mich schon die ganze Zeit sehnte. Jaro konnte derweil untertauchen und ein wenig Freiheit genießen, bevor ihn die Pflichten als Prinz wieder einholten. Zwar wurde er immer wieder erkannt und mit überraschten Aufrufen oder freundlichen Schulterklopfern von seinen Untertanen begrüßt, aber der Anblick des feiernden Prinzen unter ihnen war allen vertraut. Jaro war immerhin ein gern und häufig gesehener Gast auf jeglichen Stadtfesten.
Auf diese Weise erlangten wir beide, wonach wir uns sehnten. Liebe. Freiheit. Einen Hauch Unabhängigkeit.
»Es war mir kein Vergnügen, mit dir zu tanzen. Ich wollte nur, dass du das weißt, bevor sich unsere Wege trennen«, piesackte Jaro mich ein letztes Mal.
»Das kann ich nur zurückgeben.« Der Prinz und ich konnten ein Schmunzeln nicht unterdrücken. Auch wenn wir kein glückliches Pärchen abgaben, so waren wir in den letzten Jahren doch ziemlich gute Freunde geworden. Ich konnte mir keine andere Person vorstellen, der ich lieber auf den Füßen rumtrampeln und Beleidigungen an den Kopf werfen würde.
»Danke. Für alles«, wisperte ich.
»Werde jetzt bloß nicht sentimental. Da vorn ist eine kleine Gasse. Das ist deine Chance«, flüsterte Jaro mir zu und nickte in Richtung eines schmalen Durchgangs zwischen zwei Häusern. Völlig selbstverständlich lenkte er uns durch die Menge, halb tanzend, halb stolpernd, immer näher an den Durchgang heran. Eine letzte Drehung, ein letzter Blick, dann löste er den Griff um meine Taille und stieß mich sanft von sich. Unsere Finger trennten sich, und für einen Moment verlor ich die Balance, weil ich so daran gewöhnt war, von Jaro gehalten zu werden.
Im letzten Moment gelang es mir, meinen Fall zu stoppen, indem ich mich an der Hauswand abstützte. Einen Atemzug lang betrachtete ich die wogende Menschenmasse vor mir und versuchte den Prinzen wiederzufinden, doch es war zwecklos. In diesem Meer aus Köpfen und Gliedmaßen war er nicht auszumachen. Hoffentlich erging es meinem Vater ebenso.
Entschlossen wandte ich mich von den Festivitäten ab und eilte durch die schmale Gasse. Fort von der lärmenden Musik und dem Stimmengewirr der Festbesucher. Weg von den ungewollten Berührungen und dem Gedränge. Die Luft wurde mit jedem Schritt klarer, etwas weniger stickig. Ich konnte endlich wieder aufatmen.
Der äußere Ring Olorás bestach durch eng beieinanderstehende Häuser, deren bunt gestrichene Fassaden wie ein bewohnter Regenbogen wirkten. Beinahe jedes Fenster war mit blühenden Blumen bestückt, sodass ein frischer Duft in der Luft lag. Kleine Kinder spielten mit Murmeln auf offener Straße, während sich Hausfrauen aus ihren Fenstern lehnten und das Geschehen interessiert beobachteten.
Royalblaue Wimpelketten spannten sich quer über die Gassen und wehten über meinem Kopf, während ich achtlos an Werkstätten und Geschäften vorbeirannte. Im Vorbeilaufen erkannte ich die mehlbeschmierte Scheibe eines Bäckers, das wackelnde Metallschild des Metzgers in Form eines Schweins sowie die offen stehende Tür einer Spelunke. Die verwirrende Geruchsmischung von frisch gebackenem Brot, geronnenem Blut und Alkohol verfolgte mich selbst dann noch, als ich das Viertel hinter mir ließ und mich in die äußeren Bezirke des Rings vorwagte.
Je weiter man sich vom inneren Ring und dem Marktplatz entfernte, desto deutlicher wurde der Unterschied zwischen den verschiedenen Bevölkerungsschichten. In der Nähe des inneren Rings lebten die wohlhabenden Berater des Königs, seine Geschäftsmänner und deren Familien. Weiter außen hatten sich die gut laufenden Werkstätten und Handwerker niedergelassen. Doch mein Ziel war der Rand des äußeren Rings. Dorthin, wo die armen Seelen Olorás ein Zuhause gefunden hatten. Diejenigen, die selbst während der Stadtfeste arbeiten mussten, um sich über Wasser zu halten. Diejenigen, die sich nicht um Dreck und Schmutz scherten. Diejenigen, die nichts mit all der Feierei, dem Reichtum und dem frivolen Leben des Königs zu tun haben wollten.
Hier waren die Fassaden nicht länger bunt. Keine Wimpel flatterten im Wind, und die Straßen waren nicht länger sauber gefegt, sondern strotzten vor Dreck.
Meine Schuhsohlen erzeugten einen klackernden Laut auf dem Kopfsteinpflaster, während ich immer schneller durch die Straßen hetzte. Hastig wich ich den anderen Menschen aus, durchquerte Vorgärten und wich im letzten Moment einer Kutsche aus, die mir entgegenbretterte.
Ich hatte mein Ziel klar vor Augen und wusste genau, wo ich hinwollte. Seit Tagen hatte ich auf den passenden Moment gewartet, um mich der Kontrolle meines Vaters zu entziehen und endlich meine große Liebe wiederzusehen. Endlich, endlich, endlich war es so weit!
Eine letzte Ecke, nur noch ein kurzer Sprint … dann war ich da. Ich bog scharf rechts ab und verlangsamte das Tempo. Meine Brust hob und senkte sich in einem unregelmäßigen Rhythmus. Das Korsett, das meinen Oberkörper umschloss, schnürte mir die Luft ab. Ich wischte mir fahrig ein paar Schweißperlen von der Stirn und warf einen letzten Blick über die Schulter, um sicherzugehen, dass ich nicht verfolgt wurde, bevor ich aus den Schatten trat.
Direkt gegenüber von mir befand sich das Schaufenster einer kleinen Schmiede. Das Glas war stellenweise fleckig und blind, dennoch konnte ich das warme Licht im Inneren des Ladens gut erkennen. Es strahlte golden und rein im Gegensatz zu der verschmutzten Umgebung des Ladens. Je mehr ich mich der Eingangstür näherte, desto stärker wurde die Wärme, die ich von der Schmiede wahrnahm. Ein kleines verschnörkeltes Metallschild verkündete, dass der Laden geöffnet war und seine Gäste willkommen hieß.
Zittrig atmete ich ein. Mein Blick glitt automatisch zurück zu dem Schaufenster, hinter dem sich Silhouetten abzeichneten. Ich konnte deutlich den Umriss einer dunklen Gestalt ausmachen, die sich flink bewegte und sich zeitgleich im Kreis zu drehen schien. Durch die Tür hindurch vernahm ich ein leises Singen. Die Stimme klang sanft und hoch. Die schwungvolle Melodie sickerte sofort tief in mein Bewusstsein. Mein Herz wummerte gleich darauf so laut, dass sein Echo für einige Sekunden den Gesang übertönte.
Sehnsüchtig betrachtete ich die herumwirbelnde Gestalt hinter dem milchigen Schaufenster. Ich hatte sie so sehr vermisst. Ihre Sanftmut. Ihren Gesang. Alles.
Ich konnte mich nicht länger zurückhalten. Lange genug hatte ich gewartet. Entschlossen legte ich die Hand um den metallischen Türgriff und stieß die Holztür auf.
Hitze schlug mir in einer dicken Wolke entgegen, Ruß und Asche wirbelten auf, und goldenes Licht tauchte mich in einen warmen Schein. Völlig selbstständig breitete sich ein Lächeln auf meinen Lippen aus, als ich die Schwelle überquerte und den Namen meiner Geliebten aussprach.
»Odette.«
Geheime Liebe
Odette wandte sich zu mir. Ihre Lederschürze bauschte sich bei der Drehbewegung auf, genauso wie ihr knielanges moosgrünes Kleid. Mein Blick glitt zu ihren weißblonden Locken, die sie in einem unordentlichen Knoten hochgesteckt hat. Ihr Haar glitzerte leicht, sobald das Sonnenlicht über den Dutt strich. Bestimmt waren das die winzigen Metallpartikel, die sich durch die Schleifarbeit in der Schmiede auf ihrem ganzen Körper verteilten.
Zuletzt nahm ich ihr Gesicht in Augenschein. Ich betrachtete die überrascht hochgezogenen Augenbrauen und den leicht offen stehenden Mund mit den verführerisch roten Lippen. Sofort bemerkte ich, wie mein Herz ins Stolpern geriet. Beim König, wie konnte man bloß so schön sein?
Ich konnte mich nicht länger zurückhalten und überbrückte die geringe Distanz zwischen uns hastig, um Odette in die Arme zu schließen.
Ohne lange darüber nachzudenken, zog ich sie fest an mich und vergrub meine Nase in ihrer Schulterbeuge. Gierig sog ich ihren rauchigen Duft ein. Odette duftete stets wie ein warmes, knisterndes Kaminfeuer. Wie sollte ich da widerstehen?
»Adaliz! Was machst du denn hier?«, keuchte Odette überrascht, doch sie zögerte keine Sekunde und erwiderte meine Umarmung. Ich spürte ihren Herzschlag an meiner Brust und stellte fest, dass er denselben schnellen Rhythmus wie meines an den Tag legte.
Odettes sanfte Berührung sandte einen wohligen Schauer über meinen Rücken. Mit einer einzigen Umarmung löste sie in mir mehr Emotionen aus, als Prinz Jaro es während unseres gesamten Tanzes geschafft hatte.
»Ich musste dich sehen«, murmelte ich und hauchte einen flüchtigen Kuss auf ihre Schulter. Federleicht und kaum spürbar. Dennoch erzitterte Odette unter meiner Berührung. »Ich habe dich vermisst.«
Meine harte Fassade zerbröckelte in Odettes Gegenwart. Jegliche Schutzmechanismen ließen mich im Stich. Der Sarkasmus und die Ablehnung, die ich gegenüber Prinz Jaro an den Tag gelegt hatte, waren völlig verschwunden. In Odettes Gegenwart brauchte ich das alles nicht. Ich konnte ganz ich selbst sein und hatte nichts zu befürchten. Sie mochte mich genau so, wie ich war. Sie war nicht wie die Menschen am Hof des Königs. Sie war echt. Authentisch. Ehrlich.
»Nicht hier, Ada«, flüsterte Odette warnend und sah sich unauffällig um. Ertappt zuckte ich zusammen, bevor ich mich ein paar Schritte von ihr distanzierte. Auch wenn sie natürlich recht hatte, verpassten ihre Worte meiner Freude einen kleinen Dämpfer.
Mir war klar, dass weder ihre Familie noch einer der anderen Bewohner Olorás von unserer geheimen Beziehung wusste. Eine Adelige und eine Bürgerliche? Das ging niemals gut. Noch dazu, wenn eine von ihnen indirekt dem Prinzen des Königreiches versprochen war. Aus diesem Grund hatten wir unsere Liebe bisher vor allen verborgen. Mit jedem vergehenden Tag fiel mir jedoch genau dies schwerer und schwerer. Der Erwartungsdruck lastete immer stärker auf mir. Alle erwarteten, dass ich den Prinzen heiratete und endlich mein Schicksal akzeptierte. Wenn man herausfand, dass ich mich in eine andere Person, noch dazu eine Frau, verliebt hatte, würde man uns exilieren. Niemand verschwendete über Jahre hinweg die Zeit einer Königsfamilie, ohne Konsequenzen zu spüren. Trotz all dieser Gefahren würde ich am liebsten dem gesamten Volk, und insbesondere meinem Vater, ins Gesicht schreien, dass ich meine eigenen Entscheidungen traf. Und mein Herz hatte sich längst für Odette entschieden.
»O nein, dein schönes Kleid …«, sagte diese nun und riss mich damit aus meinen Überlegungen. Verwirrt sah ich an mir herab und stellte fest, dass mein rotes Samtkleid mit schwarzem Ruß beschmiert war. Wahrscheinlich hatte er an Odettes Schürze geklebt, bevor ich sie umarmt hatte. Nun hing er an jeder einzelnen Faser meines Kleidungsstücks. Allerdings könnte mir diese Tatsache nicht gleichgültiger sein.
»Das war es wert«, erwiderte ich feixend. Am Hof war es beinahe eine Straftat, dreckig oder verschmutzt herumzulaufen. In der Familie von Odette gehörte es zur Tagesordnung.
Mein Blick streifte über die heutige Auslage. Polierte Hufeisen stapelten sich auf hölzernen Ablagen. Direkt daneben erkannte ich eine Vielzahl an Werkzeugen, die in kleinen Kisten gelagert wurden. Reifenteile, Nägel, Hämmer und vieles mehr. Auf einem Regal wurden fein geschliffene Messer und Klingen dargeboten. Odettes Familie war in ganz Olorá bekannt für ihre fein gearbeiteten Waffen.
Odette war jedoch mit etwas ganz anderem beschäftigt gewesen, bevor ich sie unterbrochen hatte. Offensichtlich hatte sie gerade eine Pause eingelegt. Auf dem Verkaufstresen erkannte ich nämlich eine kleine Portion gepressten Marzipans. Meine Lieblingsnascherei. Odette bemerkte meinen gierigen Blick und schnappte sich ein Stück der viereckigen Süßspeise, um es mir zu reichen.
»Als Entschädigung für das Kleid«, bot sie an.
»Ich bin eigentlich nicht wegen des Gebäcks hier«, neckte ich sie. Dennoch nahm ich die Leckerei dankend an und brach das gepresste Marzipan in der Mitte durch, um es mit ihr zu teilen. »Sondern wegen dir.«
»War das Fest so schlimm, wie du es erwartet hast? Oder warum bist du so schnell geflohen?«, wollte Odette wissen. Insgeheim mochte sie es bestimmt, dass ich lieber Zeit mit ihr verbringen wollte als mit irgendwelchen feierwütigen Fremden.
»Schlimmer«, nuschelte ich mit vollem Mund, was das Lächeln auf Odettes Lippen noch größer werden ließ. In den vergangenen Wochen hatte ich mich mehr als einmal bei ihr darüber beschwert, dass mein Vater mich dazu zwang, die Feier gemeinsam mit dem Prinzen zu besuchen. Es war vermutlich keine Überraschung, dass ich die erste Gelegenheit genutzt hatte und abgehauen war.
»Wie lange musst du noch arbeiten? Ich habe gehofft, wir könnten vielleicht zu unserem Ort gehen«, flüsterte ich, obwohl wir allein im Laden waren. Weder Kunden noch ihre Familienmitglieder waren irgendwo zu sehen. Allerdings konnte man nie vorsichtig genug sein. In Olorá besaßen die Wände Ohren.
»Heute ist wegen der Festlichkeiten kaum Betrieb. Ich frage kurz nach, ob ich vielleicht früher Feierabend machen darf. Bestimmt hat Vater nichts dagegen«, meinte Odette. Ihre Iriden glitzerten erwartungsvoll, seitdem ich unseren gemeinsamen Rückzugsort erwähnt hatte. Dunkle Wimpernkränze zierten ihr hellblaues Augenpaar, das die Farbe des Himmels perfekt imitierte. Ich konnte es kaum erwarten, zu unserem Platz zurückzukehren. Der einzige Ort in diesem verfluchten Königreich, an dem wir nicht verstecken mussten, wer wir waren.
Sie wandte sich hastig ab und öffnete eine schmale Holztür, die in den hinteren Gebäudeteil der Schmiede führte. Ich vermutete, dass sich dort hinten die Öfen und Arbeitsbereiche befanden. Odette hielt meist die Stellung als Verkäuferin, während ihre Familie im Hintergrund eifrig arbeitete und Nachschub für die Kunden lieferte.
Ich schlich näher in Richtung des Durchgangs, um zu hören, was Odette mit ihrem Vater besprach. Leider verstand ich kaum ein Wort, nur Odettes hohe Stimme und ein darauffolgendes Brummen.
»Danke, du bist der Beste!«, meinte sie plötzlich, während sich ihre Schritte schnell in meine Richtung bewegten und immer lauter wurden. Hastig trat ich zurück und tat so, als würde ich die Auslage bewundern. Odette sollte nicht wissen, dass ich versucht hatte zu lauschen.
»Sei aber vor Sonnenuntergang zurück, verstanden?«, schallte die tiefe Stimme ihres Vaters durch den Verkaufsraum, als Odette die Tür aufstieß und mir mit einem freudigen Lächeln begegnete. Ich konnte gar nicht anders, als den sorgenvollen Unterton ihres Vaters wahrzunehmen. Seine Worte klangen weich und liebend. Nicht befehlerisch.
Ein Kloß bildete sich in meinem Hals. Schnell versuchte ich ihn hinunterzuschlucken, allerdings ohne Erfolg. Hatte mein Vater jemals in solch einem Ton mit mir gesprochen? So fürsorglich? Ich konnte mich nicht daran erinnern. Da waren nur sein kontrollierendes Zischen und seine Befehle in meinem Kopf.
»Versprochen!«, antwortete Odette euphorisch, bevor sie die Tür zur Werkstatt schloss und zu mir herumwirbelte. Ihr Strahlen vertrieb die Schatten meiner dunklen Gedankenwelt. Selbst der Kloß in meinem Hals löste sich langsam auf. Ich wollte nicht länger über meinen Vater nachdenken, sondern einfach den Moment mit Odette genießen. Wir hatten schließlich nicht viel Zeit und mussten sie bestmöglich nutzen.
»Wir können sofort los, ich muss nur noch eine Kleinigkeit erledigen«, verkündete Odette, bevor sie hinter den schlichten hölzernen Tresen eilte und dahinter in einer Kiste kramte. Sekunden später zog sie einen Leinenbeutel hervor, in dem sich ein halber Laib Brot befand. Wahrscheinlich ihre Ration für den heutigen Tag. Danach schulterte sie den Beutel und sah mich erwartungsvoll an.
»Was hast du damit vor?«, fragte ich und konnte nicht verhindern, dass sich ein Hauch Neugierde in meine Stimme schlich.
Odette schüttelte leicht den Kopf, legte einen Finger an die Lippen und deutete dann mit dem Kinn in Richtung des Ausgangs. Verstanden, sie wollte hier drinnen nicht darüber reden. Ich nickte, bevor ich zur Ladentür eilte und sie für sie öffnete. Eine Adelige, die der Tochter eines Schmieds die Tür aufhielt … wenn das mein Vater sehen könnte, würde er auf der Stelle tot umfallen.
So schnell wie möglich ließen wir die Schmiede hinter uns und eilten über das Kopfsteinpflaster. Nah genug, damit sich unsere Hände ab und an wie durch Zufall streiften. Weit genug voneinander entfernt, um kein Aufsehen zu erregen. Schweigend zogen wir durch die fast menschenleeren Straßen des äußeren Rings von Olorá. Die Gebäude wurden mit jedem Schritt maroder. Der Anblick von löchrigen Dächern und schiefen Hauswänden beunruhigte mich. Die Gebäude sahen so instabil aus, dass ein Windstoß ausreichen würde, um sie einstürzen zu lassen. Vor Unbehagen zog sich mein Magen zusammen. Auch wenn hier kaum Menschen lebten und die Armut nur wenige Familien in Olorá betraf, war der Unterschied zu der Königsfamilie und den hemmungslos feiernden Bewohnern überdeutlich. Während die Oberschicht Olorás regelmäßig ihre Sorglosigkeit feierte, ging es den wenigen Menschen in der Unterschicht umso schlechter. Doch dieses Problem wurde gekonnt ignoriert, solang niemand aus dem äußeren Ring einen Aufstand anzettelte. Dem König war es wichtig, seine Untertanen mit Festen und Alkohol zu verwöhnen, um jegliche Proteste im Keim zu ersticken.
Als die Stadtmauer in Sicht kam und ich die ersten Baumwipfel erkannte, entspannte ich mich ein wenig. Meine Schultern sackten ein Stück hinab, und ich atmete tief durch. Wir hatten es fast geschafft.
Hand in Hand ließen wir die Straßen Olorás hinter uns und passierten das Stadttor, ohne einem anderen Bewohner zu begegnen. Nicht einmal eine Wache war hier draußen postiert. Bestimmt feierten sie ebenfalls den Geburtstag des Königs. Mich würde es nicht wundern, wenn sie betrunken durch die Straßen wankten, anstatt ihren Pflichten nachzugehen.
Außerhalb der Mauern, die Olorá umgaben, existierte eine andere Welt. Stille kehrte ein, und nur vereinzelt waren Menschen zu sehen. Die Natur beherrschte die Umgebung anstelle der Königsburg mit ihrer gelblichen Fassade, den hohen Spitzbögen und rot verziegelten Zinnen. Bäume, größer als die zum Himmel aufstrebenden Türme der Burg, schraubten sich in die Höhe. Jeder meiner Schritte wurde durch das weiche Geflecht aus Efeu und Moos abgefedert. Gierig sog ich die frische Waldluft in meine Lunge. Innerhalb der Stadtmauern herrschte oftmals eine überladene Atmosphäre, die von Abertausenden Gerüchen fremdbestimmt wurde. Der Geruch von frisch gekochtem Essen, der Schweißgestank der Arbeiter und die gelegentlichen Blumen am Straßenrand erzeugten eine Duftmischung, die mir oftmals Kopfschmerzen bereitete, wenn ich durch die Straßen Olorás wanderte. Doch hier draußen war es anders. Ich nahm nichts anderes wahr als den wohltuenden Duft der Kiefern und des süßen Harzes der Bäume. Die frische Luft wusch jegliche Erinnerung an die Stadt hinfort. Wenn ich könnte, würde ich jeden Tag im Wald verbringen. Gemeinsam mit Odette.
»Entschuldige, kann ich dir etwas zu essen anbieten?« Ihre Stimme riss mich aus meinen Überlegungen und katapultierte mich schlagartig zurück in die Realität. Heute drifteten meine Gedanken auffällig oft ab.
Was tat sie denn da?
Sie besaß doch selbst gerade genug, um sich über Wasser zu halten und keinen Hunger zu leiden. Trotzdem beobachtete ich, wie sich Odette auf eine Person zubewegte, die zusammengesunken an der efeubewachsenen Stadtmauer lehnte. Blinzelnd kam sie zu sich und strich sich eine Strähne ihres verfilzten Haares aus der Stirn. Mir entging nicht, wie dreckbeschmiert das Gesicht und die Hände dieses armen Menschen waren. Seine Wangen wirkten eingefallen, und die Augen lagen in tiefen Höhlen. Die Lumpen, die die Person am Leib trug, waren völlig durchlöchert. Diese Kleidung bot keinen Schutz vor dem Wetter. Weder bei Regen noch vor der Sonne.
Ein Stich durchfuhr mein Herz bei dem Anblick. Innerhalb der Stadtmauern feierten die Menschen in Saus und Braus, während hier draußen die Kranken und Verstoßenen Hunger litten. Das war ungerecht!
Odette reichte der zusammengesunkenen Person ein abgerissenes Stück des Brotes, das sie daheim eingepackt hatte, woraufhin deren dunkle Augen aufleuchteten. Sie öffnete den Mund und stotterte ein paar dankende Worte, offensichtlich völlig überrumpelt von so viel Fürsorge. Dann vergrub sie ihre Zähne in der knusprigen Kruste und biss ein großes Stück ab. Ein genüssliches Stöhnen entfuhr ihr. Ich wollte gar nicht wissen, wann dieser arme Mensch zuletzt eine Mahlzeit zu sich genommen hatte. Dem abgemagerten Zustand seines Körpers nach zu urteilen, lag diese schon viel zu lange in der Vergangenheit.
Odette drehte sich zu mir um und deutete mit einer Kopfbewegung an, dass wir weiterziehen sollten. Das war typisch für sie. Odette tat so viel Gutes, aber sie wollte nicht mehr Aufmerksamkeit als nötig dafür erhalten. Es war ihr unangenehm, im Mittelpunkt zu stehen oder gar für eine Tat bewundert zu werden.
»Dafür war das Brot also gedacht«, sagte ich leise.
»Das letzte Mal, als wir uns fortgeschlichen haben, sind mir die Ausgestoßenen vor den Stadttoren aufgefallen. Die armen Menschen bestehen nur noch aus Haut und Knochen, niemand kümmert sich um sie. Während wir jeden Tag so viel wegwerfen. Meistens komme ich aufgrund der ganzen Arbeit nicht einmal zum Essen. Deswegen habe ich mir vorgenommen, dieses Mal Brot für die Armen mitzunehmen. Sie brauchen es mehr als wir.« Odette biss sich auf die Unterlippe, sobald sie ihren Monolog beendet hatte. Sie wich meinem Blick aus.
Ihre Worte weckten mein schlechtes Gewissen. Ich fühlte mich auf einen Schlag erbärmlich. Wieso war mir nicht aufgefallen, dass es den Menschen vor den Stadttoren so schlecht ging? Warum habe ich nicht über Möglichkeiten nachgedacht, diesen Leuten zu helfen? Die Antwort auf diese Fragen war ganz einfach, aber umso schmerzhafter: Weil ich sie nicht wahrgenommen hatte. In meiner Welt musste schließlich niemand hungern. Am Hof ging es allen Menschen gut. Keiner litt unter der Armut, die die Ausgestoßenen und Kranken außerhalb der Stadt jeden Tag durchlebten. Ich hatte die Augen einfach vor diesen Zuständen verschlossen, weil für mich nur die gemeinsame Zeit mit Odette zählte. Alles andere hatte ich ausgeblendet.
Umso stolzer war ich in diesem Moment auf Odette. Sie sah die Probleme der Menschen um sich herum und versuchte etwas zu ändern. Eine Verbesserung herbeizuführen. Selbst wenn das bedeutete, sich selbst in Gefahr zu bringen oder Probleme mit ihrem Vater zu erzeugen. Bestimmt wäre dieser alles andere als begeistert, wenn er erfuhr, dass seine Tochter ihre eigenen Rationen Essen verschenkte.
»Das ist eine großartige Idee«, flüsterte ich und ergriff Odettes Hand. Mir war egal, ob jemand diese Geste beobachtete. Ich wollte, dass sie wusste, wie stolz ich auf sie war.
Odette sah ungläubig auf, ihre Augen weiteten sich. »Findest du?«
Ich nickte. Unsere Blicke verhakten sich ineinander, und eine warme Welle aus Glücksgefühlen spülte über mich hinweg. Odette war zu gut für diese Welt. Und definitiv viel zu gut für mich.
Sie war eine Inspiration.
»Warte kurz«, formte ich stumm mit den Lippen und griff in meinen Nacken. Mit flinken Fingern löste ich den Verschluss der Kette, die ich trug. Es handelte sich um ein kostbares Goldstück, in dessen Mitte ein daumengroßer Rosenquarz in Herzform eingefasst war. Ein schönes Schmuckstück, keine Frage. Leider hasste ich Schmuck wie die Pest. Ketten, Armbänder und Ringe engten mich ein. Ich verabscheute das ständige Klimpern und war jedes Mal froh darüber, wenn ich das teure Dekor ablegen konnte.
Es kam aus genau diesem Grund relativ häufig vor, dass ich meine Accessoires versehentlich verlor. Oder ganz absichtlich verschenkte. Odette liebte alles, was glitzerte und funkelte. Meine wertvollen Ketten waren bei ihr definitiv besser aufgehoben als bei mir. Ganz zum Leidwesen meines Vaters, der darauf bestand, dass ich mich täglich mit Gold und Silber schmückte.
Ich betrachtete einige Sekunden lang das Edelsteinherz in meiner Hand, bevor ich die Faust darum schloss und auf den Armen zutrat, der nur noch Augen für seine Mahlzeit hatte. Ich konnte es ihm nicht verdenken.
Langsam ging ich vor ihm in die Knie und fasste vorsichtig nach seiner Hand, die er nur widerwillig von dem Brot löste. Die Person hielt inne und starrte mich verblüfft an, als ich ihre Finger auseinanderbog und die Kette hineinlegte. Mir entging nicht, wie dünn ihre Haut war. Ich konnte jeden einzelnen Knochen und jedes Fingergelenk deutlich spüren, trotz der flüchtigen Berührung.
»Verpfände sie«, meinte ich mit Blick auf die Kette. »Davon kannst du mindestens einen Monat lang leben.«
Ungläubig weiteten sich die Augen des Menschen. Mein Herz füllte sich mit Stolz. Odette hatte mich dazu inspiriert, jemand anderem zu helfen. Und es fühlte sich überraschend gut an. Meine Freundin legte mir von hinten eine Hand auf die Schulter und übte ein wenig Druck aus. Sie unterstützte mich und stärkte mir den Rücken.
»Wie soll ich Euch jemals danken?«, flüsterte die Person.
»Gar nicht.« Ich tat nur das Geringste, um zu helfen. Ich hatte keinen Dank verdient.
»Ada, wir sollten weitergehen«, erinnerte mich Odette. Sie wirkte unruhig und sah sich immer wieder um. Widerwillig stemmte ich mich in die Höhe und ergriff ihre Hand. Doch selbst das schien sie nicht zu beruhigen.
»Was ist los?«, fragte ich verwundert, während wir uns Schritt für Schritt von der Stadtmauer entfernten.
»Fühlst du dich auch beobachtet?«, flüsterte Odette mir zu. Innerhalb eines Herzschlags wandelte sich die Stimmung. Die Unbeschwertheit verflog und wurde durch ein flaues Gefühl ersetzt. Ich folgte Odettes Beispiel und musterte unsere Umgebung aufmerksam. Mein Blick glitt über die Stadtmauer, und ich erwartete bereits, erneut die Silhouette meines Vaters am oberen Rand zu erblicken, doch es war nichts zu sehen. Das einzig Ungewöhnliche war ein Schwarm Raben, der krächzend über unseren Köpfen über den Himmel zog.
»Ich kann niemanden sehen«, antwortete ich. Trotzdem konnte ich nicht leugnen, dass sich meine Nackenhaare aufrichteten.
»Wir sollten so viel Abstand zur Stadt gewinnen wie nur möglich. Bevor uns jemand sieht«, schlug Odette vor. Stumm stimmte ich ihr mit einem Nicken zu. Wenn wir erst einmal an unserem Rückzugsort angekommen waren, würde bestimmt auch das seltsame Gefühl verfliegen.
Seite an Seite schlugen wir uns durch das Unterholz. Wir wichen von den gewöhnlichen Pfaden ab, schoben Büsche auseinander und sprangen sogar über einen schmalen Bachlauf, um an unser Ziel zu kommen. Wir folgten dem fließenden Gewässer tiefer ins Tal. Die Baumstämme standen hier dichter beieinander, sodass ihre prächtigen Kronen kaum einen Lichtstrahl zu uns durchdringen ließen. Zu keinem Zeitpunkt ließ ich Odettes Hand los. Wir wechselten kein Wort miteinander. Lediglich das Rauschen der Blätter und der Gesang einer einsamen Bachstelze begleitete uns.
Gerade als ich dachte, keine Sekunde länger schweigen zu können, entdeckte ich einen Lichtpunkt in nicht allzu weiter Ferne. Die Dunkelheit des Dickichts wich einem warmen Schein, der uns pures Glück versprach.
Unwillkürlich beschleunigten sich unsere Schritte, bis wir schließlich über gefallene Äste und Blätter stiegen, um dem verheißungsvollen Licht näher zu kommen.
Bald hatten wir es geschafft …
Der Tränensee
Der Moment, in dem wir aus dem Zwielicht des Waldes ausbrachen und ins Licht traten, fühlte sich surreal an. Der goldene Schein wusch die Kälte des düsteren Dickichts hinfort und erwärmte meine Haut.
»Wir haben es geschafft«, hauchte ich ungläubig. Jedes Mal, wenn wir diesen Ort aufsuchten, verspürte ich eine tiefe innere Ruhe. Als würden wir eine unsichtbare Barriere überqueren, die uns vom Rest Olorás trennte. Hier draußen gab es keine Königshäuser, keine kontrollierenden Väter, keine Erwartungen von anderen, sondern nur uns und die Natur.
»Endlich«, hauchte Odette neben mir erleichtert. Ihre Finger glitten von meinen, als sie sich im Kreis drehte und die Arme in Richtung der Sonne ausstreckte. In diesem Moment sah sie märchenhaft aus. Ihr Haar wirkte wie gesponnenes Gold, ihre blauen Augen strahlten wie das Himmelszelt über unseren Köpfen, und ihr Kleid bauschte sich auf wie eine Wolke, während sie eine Pirouette nach der anderen drehte.
Erst nachdem ich mehrmals geblinzelt hatte, gelang es mir, mich von ihrem Anblick zu lösen. Aufmerksam musterte ich unsere Umgebung, um ganz sicherzugehen, dass wir unter uns waren. Zum Glück konnte ich niemanden erkennen. Genau vor uns breitete sich ein See aus, der mindestens so groß war wie der Festplatz im Zentrum Olorás. Keine einzige Welle kräuselte die spiegelglatte Wasseroberfläche, obwohl ganz in der Nähe ein kleiner Schwarm Schwäne trieb. Die eleganten Tiere wandten ihre Hälse nach hinten, um den Kopf zwischen den schneeweißen Federn vergraben zu können, und verströmten dabei tiefen Frieden. Wenn außer uns noch jemand hier sein sollte, würden sich die Tiere garantiert nicht so ruhig verhalten.
Die türkise Färbung des Gewässers und das helle Gefieder der Schwäne wirkten strahlend hell im Vergleich zu den dunklen Baumkronen, die das Ufer des Sees säumten. Dieser Ort besaß einen magischen Glanz, den ich so noch nie im Königreich erlebt hatte. Deswegen zog uns der See an, er rief nach uns. Und er schenkte Odette und mir einen Schutzort, wenn wir ihn brauchten.
Schon seit Kindheitstagen hatte mir mein Vater das Märchen von der Entstehungsgeschichte des Tränensees erzählt. Jeder in Olorá kannte die Zeilen, die seit Generationen von Eltern an ihre Kinder innerhalb der Familie weitergetragen wurden.
»Zu einer Zeit, als die Erde noch nicht von uns Menschen, sondern von den Urgeistern behaust wurde, trafen Wald- und Wasserseelen aufeinander. Einige von ihnen fochten Machtkämpfe miteinander aus und rangen um die Territorien der Welt. Andere wiederum spielten miteinander, gaben und nahmen sich gegenseitig. Wieder andere spürten eine tiefere Verbindung zueinander. Eine Verbundenheit, die nur durch zwei Seelen zustande kommt, die im Kern ihres Seins eins sind. So geschah es auch an diesem Ort …
Ein Wald- und ein Wassergeist trafen genau hier aufeinander. Sie spürten, dass sie mehr miteinander verband als der Machtkampf oder das Spiel des Lebens. Sie waren zwei Geister, füreinander bestimmt und dennoch getrennt durch das Wesen ihrer gegensätzlichen Seelen.
Allerdings weigerten sich der Wald- und der Wassergeist, ihre Trennung zu akzeptieren, und so ließen sie sich an diesem Platz nieder, direkt neben dem zukünftigen Königreich Olorá. Auch wenn sie nun nebeneinander ruhten, so waren sie dennoch nie miteinander vereint.
Die Tränen des Waldgeistes nährten den See zu unseren Füßen. Die Trauer darüber, nie eine gemeinsame Seele bilden zu können, füllte das Gewässer über die Jahrhunderte hinweg mit Salz und verlieh dem See seine einzigartige türkise Färbung. Der Wassergeist fraß seine Trauer ebenfalls tief in sich hinein. Tiefer, immer tiefer, bis seine Tränen in die untersten Erdschichten vordrangen und alle Pflanzen und Tiere des Waldes mit wertvollem Wasser und Nährstoffen versorgten. Bis heute.
Auch wenn die beiden Urgeister nie miteinander vereint sein werden, haben sie dennoch einen Weg gefunden, ihre Leben miteinander zu verknüpfen.«
Die Stimme meines Vaters trug mich gedanklich weit fort. Zurück in eine Kindheit, die noch nicht von Kontrolle und Hochzeitsplänen durchdrungen war. Früher hatte ich es genossen, Zeit mit ihm zu verbringen und seinen Geschichten zu lauschen. Damals hatte ich zu ihm aufgesehen.
Mein Vater hatte immer behauptet, dass in jener Legende die Quelle unendlicher Magie verborgen lag. Unsere Vorfahren seien angeblich eng mit dem Ursprungsmythos Olorás, also den Wasser- und Erdgeistern, verknüpft gewesen. Die ersten Menschen, die sich in der Gegend niedergelassen hatten, konnten die Geister wohl so deutlich spüren, dass sie mit ihnen kommunizieren und sogar mithilfe uralter Rituale ihre Macht für sich nutzen konnten. Deswegen hatten unsere Vorfahren hier eine Siedlung aufgebaut, aus der das Königreich Olorá entstanden sein soll.
Nur leider hatten die meisten Menschen die Legende und ihren Ursprung bereits nach wenigen Jahrhunderten vergessen. Im Alltag bemerkte ich keinen Einfluss der angeblich uralten Magiequellen. Denn die Wasser- und Erdgeister sprachen schon lange nicht mehr zu den Oloránern.
Niemand hatte das Wissen über die Geister gepflegt, abgesehen von den Ahnen meines Vaters. Über Generationen hinweg wurde nicht nur die Legende innerhalb meiner Familie weitervererbt, sondern auch das Wissen rund um die magischen Rituale, mit denen man sich die Kräfte der Erde und des Wassers zunutze machen konnte. Inzwischen hütete meine Familie dieses Wissen wie einen Schatz und teilte es mit niemandem.
Mein Vater war der einzige Mann am Hof, der sich an der Magie bediente. Es hatte viele Jahre gedauert, bis er die Schriften über die Rituale entschlüsseln und für seine Zwecke einsetzen konnte. Sein Wissen und die damit einhergehende tiefe Verbindung zu den Erd- und Wassergeistern verlieh ihm eine unbestreitbare Macht. Diesen Einfluss nutzte er, um die Feinde des Königs einzuschüchtern und sich einen Platz am Hof zu verschaffen. Die Oloráner würden behaupten, dass er das Volk mit seiner Magie schützte. Ich wusste jedoch, dass das nur die halbe Wahrheit war. Denn die magischen Rituale konnten nicht nur schützen und helfen, sondern auch verfluchen. Nicht ohne Grund nannten ihn die Gegner Olorás nur Fluchweber.
Mein Vater verfügte über eine Macht und unbeschreibliches Wissen, das er mit niemandem teilen wollte. Nicht einmal mit seiner eigenen Tochter. Das Einzige, was er bereitwillig an mich weitergegeben hatte, war die Legende.
Ich schüttelte die nostalgischen Gefühle ab und versuchte mich stattdessen auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Odette stand am Ufer des Sees und tauchte gerade einen Zeh in das eiskalte Wasser.
Sie hat hoffentlich nicht bemerkt, dass ich mit meinen Gedanken ganz woanders war. Langsam trat ich an ihre Seite und legte einen Arm um ihre Taille, um sie näher an mich zu ziehen. Ihr rauchiger Duft vernebelte meine Sinne.
In Augenblicken wie diesen verglich ich unsere Situation mit dem altbekannten Märchen. Odette war in meiner Vorstellung der Wasser- und ich der Waldgeist. Wir beide wurden ebenfalls durch äußere Umstände voneinander getrennt, und unsere Liebe hatte außerhalb dieses besonderen Ortes keine Chance. Vielleicht fühlte ich mich deswegen so stark mit dem Tränensee verbunden? Weil ich die Gefühle innerhalb des uralten Märchens so gut nachempfinden konnte?
»Woran denkst du gerade?«, fragte Odette leise und wandte sich zu mir. Sie verschränkte die Hände hinter meinem Kopf und presste ihren Oberkörper enger an meinen. Sofort erhitzte sich mein Blut. Flüssiges Magma floss durch meine Adern und ließ meine Wangen erröten. Wie war es möglich, dass sie so eine starke Wirkung auf mich besaß?
»An das Märchen des Sees …«, antwortete ich. Mein Blick glitt zu Odettes Mund hinab, der sich bei meinen Worten zu einem Lächeln kräuselte. Vorsichtig lehnte ich die Stirn an ihre, sodass sich unsere Nasenspitzen berührten.
»Soll ich dir verraten, woran ich gerade denke?«, flüsterte sie. Ich schluckte schwer und rang mir ein Nicken ab. »Daran, wie gern ich dich küssen würde.«
»Was hält dich zurück?«, wisperte ich. Die gesamte Welt um uns herum rückte in den Hintergrund. Der See, die Schwäne und das Königreich in unserem Rücken spielten keine Rolle mehr. Da waren nur noch sie und ich. Ihre himmelblauen Augen und herzförmigen Lippen. Odette strich mir vorsichtig eine dunkle Haarsträhne hinters Ohr und ließ daraufhin ihre Hand an meiner Wange ruhen. Sanft hob sie meinen Kopf an, sodass sich unser Atem miteinander vermischte.
Ich konnte nicht länger warten. Ihre Nähe versetzte mich in einen Rausch, dem ich mich nicht entziehen konnte. Flatternd schloss ich die Lider, bevor ich das Kinn reckte und sie endlich küsste. Die ganze Zeit hatte ich auf diesen Moment gewartet. Seit Stunden hatte ich mich nach diesem Augenblick gesehnt.
Unsere Lippen strichen zunächst nur sanft übereinander. Es war kaum mehr als ein Lufthauch zu spüren, vergleichbar mit der Berührung eines Schmetterlingsflügels. Ein vorsichtiges Herantasten, ein stummes Versprechen nach mehr.
Odette stieß ein leises Seufzen aus, woraufhin sich mein Herz erwartungsvoll zusammenzog. Meine Selbstbeherrschung verabschiedete sich endgültig, als sie ihre Finger zu meinem Hinterkopf wandern ließ und ihren Griff festigte.
Der nächste Kuss war fordernder und leidenschaftlicher. Ich öffnete den Mund und schmeckte Odettes Lächeln auf meiner Zunge. Ein warmes Prickeln benetzte meine Lippen und verbreitete sich von dort aus in meinem gesamten Körper. Währenddessen schlug mein Puls so heftig, dass ich befürchtete, mir könnte jede Sekunde das Herz aus der Brust springen.
Mit den Händen glitt ich über Odettes Oberkörper und verharrte an ihrer Taille, damit ich sie noch enger an mich pressen konnte. In diesem Moment ließ ich alles andere los. All die Sorgen und Probleme, die in meinem Kopf lauerten. Alles, was für mich zählte, war Odette. Ihre Lippen auf den meinen. Ihre zarten Berührungen. Ihr rauchiger Duft. Ich wollte sie am liebsten nie wieder loslassen.
Leider kam immer irgendwann der Moment, in dem wir nach Luft rangen und unsere Körper sich langsam voneinander lösten. Unsere Blicke trafen sich, und ich hätte wetten können, dass meine Augen mindestens genauso sehr strahlten wie die ihren.