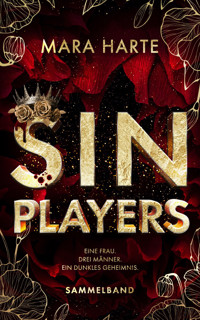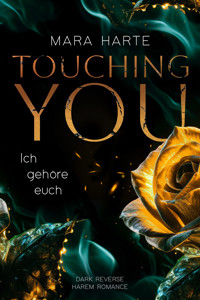7,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erlebe mit dem Sammelband zu Buch 1 und 2 der Reihe MAFIA AFFAIRS die Geschichte um Velvety Prince und ihre zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein können und doch beide ihr Herz erobern. BELOVED VILLAINS Eine Anwältin mit Idealen. Zwei Männer aus Londons Unterwelt. Und das Schicksal lässt die Würfel fallen. Velvety Prince Ich liebe meinen Job als Strafverteidigerin. Für eine große Kanzlei im Herzen Londons reise ich an viele Orte der Welt. Da bleibt nicht viel Zeit für ein Privatleben. In einem der gefährlichsten Gefängnisse der Welt treffe ich gleich auf zwei Männer, die mir den Kopf verdrehen. Sebastián Vargas Als Boss der berühmt-berüchtigten Mafia-Familie Vargas nehme ich mir, was ich will. Und ich will sie – Velvety Prince. Für eine Nacht! Was jedoch, wenn ich in dieser Nacht mein Herz verliere? Ciro Bennett Für König und Vaterland tue ich alles, was man von mir verlangt. Ich riskiere Kopf und Kragen, steige tief in kriminelle Unterwelten ab und verlasse die Frau, die ich liebe. Wer hätte gedacht, dass ich meiner Velvety ausgerechnet in Bolivien wieder über den Weg laufe? BELOVED BASTARDS Eine Anwältin mit Zweifeln. Zwei Männer mit einem Ziel. Triff eine Wahl oder gehe unter bei dem Versuch, dir alles zu nehmen! Ciro Bennett ist verschwunden. Meine große Liebe hat mich verlassen … mal wieder. Was er hinterlässt, ist ein schmerzendes, klaffendes Loch in meinem Herzen. Werde ich mich allein der Bedrohung stellen können, die immer noch wie ein Damoklesschwert über meinem Kopf schwebt? Allerdings gibt es da immer noch den anderen Mann, der heute eine große Rolle in meinem Leben spielt – Sebastián Vargas. Liebe und Verlangen sind große Motivatoren, um nichts unversucht zu lassen, Geheimnisse aufzudecken und gegen mächtige Widersacher und sogar die englische Krone ins Feld zu ziehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
MAFIA AFFAIRS
Velvety Sammelband
MARA HARTE
INHALT
BELOVED VILLAINS
Prolog
VELVETY PRINCE
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
BELOVED BASTARDS
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Bonusszene
Coming Soon
KENNST DU SCHON …?
KENNST DU SCHON …?
KENNST DU SCHON …?
KENNST DU SCHON …?
Die Autorin
SAMMELBAND
Velvety
Beloved Villains
Beloved Bastards
BELOVED VILLAINS
Eine Anwältin mit Idealen.
Zwei Männer aus Londons Unterwelt.
Und das Schicksal lässt die Würfel fallen.
PROLOG
»Erfolg fordert seinen Tribut.«
Charlotte Lukas – Fotografin, Künstlerin, Weltreisende mit Leidenschaft für ihren Job
Charlotte Lukas, Fotografin und Weltreisende, wurde innerhalb einer Sekunde bewusst, dass sie in großen Schwierigkeiten steckte, als sie in die Öffnungen von gleich drei auf sie gerichteten Pistolenläufen starrte.
Schwitzend fuhr sie sich mit dem Handrücken über die Stirn. Es war heiß im bolivianischen Dschungel. Die Nächte waren unerträglich schwül, doch die Tage waren schlimmer. Nun, das war der Preis, nicht wahr? Wer den Gipfel erklimmen will, muss durch Dreck kriechen – in ihrem Fall durch die dunkelsten Ecken des Regenwaldes im schönsten Land der Welt.
Ihr Job hatte Charlotte schon in viele abgelegene Gegenden der Erde geführt. Ihre Fotografien wurden in einer bedeutenden Galerie im tansanischen Dar es Salaam ausgestellt, sie hatte Vorträge in Braşov gehalten und die außergewöhnlichsten Bilder in Montenegro, Kanada und auf den Faroer Inseln geschossen. Aber in Bolivien … hier war alles anders. Das Licht, die Menschen, der Regenwald.
Dies hier war ihre zweite Reise in das südamerikanische Land. Im Gegensatz zu ihrem letzten Ausflug hatte es sie dieses Mal jedoch nicht in die Hochebenen der Anden um die Hauptstadt La Paz verschlagen, sondern mitten in den Amazonas-Regenwald in der Nähe von Trinidad. Nur hier fand sie passende Motive für jene Fotografien, die ein englischer Multimilliardär in Auftrag gegeben hatte. Dieser superreiche Schnösel hatte ein Faible für seltene Tierarten. An den Wänden seiner karibischen Residenz auf den Britischen Jungferninseln hingen ausgestopfte Faultiere, nahezu ausgestorbene Papageienarten, Vicuñas und andere Alpakarassen und noch vieles mehr. Und jetzt wünschte er sich Echtaufnahmen seiner Lieblinge. Eine Farce! Aber es war nicht Charlottes Aufgabe, die moralischen Aspekte der Wünsche ihrer Kunden zu interpretieren. Wenn sie gut zahlten, war sie opportunistisch genug, um keine weiteren Fragen zu stellen oder zu urteilen. Und dieser Kunde – nun ja, er zahlte unverschämt gut.
Die meisten Bilder hatte sie bereits im Kasten. Heute stand ein längerer Ausflug in die Nähe des Carrasco-Nationalparks an. Nur wenige Aufnahmen fehlten noch. Wenn alles gut ging, konnte sich Charlotte morgen auf den Weg nach La Paz machen und in ein paar Tagen das Flugzeug nach Hause besteigen.
Die Empfindungen, in Kürze wieder in Berlin zu sein, waren so vielfältig wie die Arten von Aras im Amazonasgebiet. Sie würde das bolivianische Klima nicht unbedingt vermissen, aber in Berlin war es kalt und nass. Natürlich freute sich Charlotte auf ihr Zuhause. Sie hatte ihre Mutter seit fast einem halben Jahr nicht mehr gesehen, ihren Bruder länger nicht. Aber bei der Vorstellung an die Hektik der Großstadt, die Unzufriedenheit der Menschen, das Motzen über die Regierung, das Wetter, die Preise … ach, über alles, kam Wehmut auf. In Bolivien war alles anders. Die Menschen waren netter, zufriedener. Ihre Ansprüche hingen nicht in den Wolken. Charlotte liebte die Entschleunigung, die Unbeschwertheit, die Leichtigkeit, mit der die Menschen hier das Leben bestritten.
Traurig schaute Charlotte zu ihrer Reisetasche, die fertig gepackt neben dem Bett stand. Alle wichtigen Utensilien für ihren letzten Dschungel-Trip waren in einem Rucksack. Sie warf einen letzten prüfenden Blick hinein. Die Kamera mit dem Makroobjektiv, eine Ersatzkamera, das Funktelefon, ein frisches Shirt, damit sie sich in spätestens zwei Stunden umziehen könnte, wenn das, was sie trug, durchgeschwitzt wäre, ein Lippenpflegestift und zwei Flaschen Wasser. Bingo!
Mit einer routinierten Bewegung schob Charlotte ihren langen Pferdeschwanz auf den Rücken, schwang sich den Rucksack über die Schulter und öffnete die Tür ihrer vorübergehenden Bleibe. Der Absatz ihres Stiefels knallte mit dem ersten Schritt auf die morschen Dielen der Veranda, als sie abrupt innehielt.
»Scheiße!«
Ihre Stimme erschien ihr fremd – so voller Überraschung und Angst.
Charlotte Lukas, Fotografin und Weltreisende, wurde innerhalb einer Sekunde bewusst, dass sie in großen Schwierigkeiten steckte, als sie in die Öffnungen von gleich drei auf sie gerichteten Pistolenläufen starrte.
VELVETY PRINCE
… furchtlose Anwältin, erschöpfte Reisende mit Abenteuerlust
»In der Welt ist nichts rosarot. Du kommst nicht weiter, wenn du darauf wartest, dass dir jemand die Welt zu Füßen legt. Geh raus und hol sie dir!«
Feine Sprudelbläschen perlten in dem niedrigen Glas. Der klare Gin Tonic reflektierte das Licht der Sonne. Es wirbelte umher, als ich den Trinkhalm aus Edelstahl rotieren ließ.
Auf dem Beipackzettel des Medikaments, das ich erst vor einer halben Stunde genommen hatte, wurde zwar von Alkohol abgeraten, aber ich fand, dass ich mir nach der langen Reise durchaus einen Drink verdient hatte. Mit dem Glas in der Hand stand ich vom Barhocker auf und lief ein paar Schritte zu der imposanten Glasfront des Hotels Atix, von wo aus man einen atemberaubenden Blick auf die Anden und die schneebedeckten Gipfel des Illimani hatte. Die Absätze meiner Pumps hallten an den hohen verglasten Wänden wider. Ich nahm einen Schluck des Gin Tonics und seufzte. Die Sonne ging unter und verzauberte den wolkenlosen Himmel in ein dunkles Pink.
Dann klingelte mein Telefon.
Ich seufzte schon wieder.
Eigentlich hätte ich mich dringend hinlegen und ein bisschen erholen müssen, mein Körper kam mit den Strapazen in den Höhen von La Paz schwer zurecht. Und morgen musste ich fit sein. Aber die Anzeige auf dem Display zeigte mir, dass ich keine andere Wahl hatte. Meinen Seniorpartner ließ ich nie warten. Das gehörte sich nicht. Auch nicht, wenn es in London jetzt vier Uhr in der Früh war. Wer Erfolg haben wollte, schlief nicht! Also setzte ich mein schönstes Lächeln auf und nahm den Videoanruf entgegen.
»Hallo, Geordan!«, begrüßte ich den Gründer der Kanzlei Beauchamp, Prince & Associates, in die ich mich letztes Jahr eingekauft hatte. Die Initiative war von ihm ausgegangen. Er wollte mich im Team haben. Und wie hätte ich das Angebot ablehnen können, in die größte Kanzlei in Westminster als Teilhaberin einzusteigen, in der ich schon während des Studiums gejobbt hatte?
»Bist du soweit?« Geordan wechselte nie auch nur ein einziges privates Wort mit mir. Ich als Person interessierte ihn nicht, es ging um den Job, um die Mandanten und die Höhe des Honorars. Kohle, Kundenzufriedenheit und Erfolg! Das war es, was zählte. Ich hatte nichts dagegen. Schließlich wollte ich Karriere machen.
»Vor zwei Stunden gelandet. Gerade im Hotel angekommen. Morgen früh bin ich pünktlich in San Pedro«, antwortete ich deshalb im Telegrammstil.
»Alles klar. Der Mandant will dich sprechen. Denk daran, hier geht es um alles!«
Auf eine Reaktion von mir wartete er nicht, sondern schaltete sofort Mister van Rensselaer in einem separaten Bildschirm hinzu. Der versnobte aristokratische Multimilliardär gehörte in die Top Ten meiner exzentrischsten Mandanten. Ashford van Rensselaer war nicht einfach nur reich und extravagant, er war ein Perfektionist und penibler Kontrollfreak. Aber er war eben der Kunde, der ein exorbitantes Honorar zahlte. Und ich würde weder seine Erwartungen noch die meines Partners enttäuschen.
»Miss Prince, entschuldigen Sie die Störung. Oh, Sie sind schon im Hotel, richtig?« Er stellte eine Offensichtlichkeit fest, und ich wusste, dass sie nur der Höflichkeit diente. Denn van Rensselaer wusste genau, wo ich war und dass er mich störte. Aber das war ihm egal, er wollte seine Kontrollsucht befriedigen.
Also schenkte ich ihm ein braves Nicken und lächelte weiter. Sein Anblick entlohnte mich schließlich fürs Erste. Der Multimilliardär sah umwerfend gut aus, da konnte ich ihm seine Marotten verzeihen. Makellos sitzende Frisur, edler, maßgeschneiderter Anzug, perfekt gestärkter Kragen, goldene Manschettenknöpfe, die immer dann schimmerten, wenn er seine Hand hob, um sich über sein glattrasiertes Kinn zu streichen.
Im Gegensatz zu Geordan, der übermüdet aussah und dessen Kinn den Ansatz eines Bartschattens zeigte. Er arbeitete zu viel.
Genau wie ich.
Für unseren Mandanten würde ich mir wie für jeden anderen ein Bein ausreißen – oder zwei. Noch hatte ich van Rensselaer nicht persönlich kennengelernt, denn Geordan hatte mir den Fall gegeben und am nächsten Morgen war ich aufgebrochen. Manche Aufträge erforderten eben eine mehr oder weniger überstürzte Abreise. Das war nicht selten der Fall. Als eine der erfolgreichsten Anwältinnen für Menschenrechtsangelegenheiten in Europa war unbedingtes Engagement, Flexibilität und Spontaneität ein Muss. Juristischer Beistand war in diesem Bereich oft ohne Aufschub notwendig. Ob ich mit dem feuchten Klima und der dünnen Luft in Bolivien klarkam, war nicht wichtig.
»Wie bekommt Ihnen die Höhenlage? In La Paz aus dem Flugzeug zu steigen, ist eine große Herausforderung für Ihren Körper. Sie befinden sich auf einer Höhe von fast viertausend Metern, Miss Prince. Haben Sie Medikamente, um den Auswirkungen begegnen zu können?«
Kontrollfreak durch und durch. Van Rensselaer wollte doch nur wissen, ob ich fit genug für den Auftrag war.
Natürlich hatte ich mir Medikamente besorgt, ich war schließlich keine Anfängerin.
»Danke, ja! Ich werde Miss Lukas morgen wie vereinbart aufsuchen«, sagte ich und lächelte weiter.
Wir hatten die Vorgehensweise schon besprochen. Charlotte Lukas war eine berühmte deutsche Künstlerin und Fotografin. Vor zwei Tagen war sie wegen unerlaubten Kokain-Besitzes festgenommen und in eines der berüchtigtsten Gefängnisse Südamerikas gesteckt worden. Juristische Unzulänglichkeiten lagen in diesem Fall zuhauf vor, allerdings auch gewisse Umstände, welche die Durchsetzung der prozessualen und eigentlich banalen, heute fast überall in den fortschrittlichen Ländern der Welt anerkannten Menschenrechte nicht ganz so einfach gestalteten.
»Señor Cinco wird Sie morgen um neun Uhr abholen. Ich denke, er ist eine gute Wahl. So kurzfristig konnte ich nur diesen einen Guide für Ihren Aufenthalt in San Pedro beauftragen. Also ist er auch unsere einzige Wahl. Es tut mir leid, Miss Prince, ich hätte Ihnen gern eine höhere Sicherheit zur Verfügung gestellt, aber offensichtlich befinden wir uns in einer außergewöhnlich seltenen Situation unter außergewöhnlich seltenen Umständen.«
Ja, das war nichts Neues. Im Grunde waren die Situationen, in denen ich meine Aufträge zu erfüllen hatte, immer außergewöhnlich. Diesmal jedoch handelte es sich tatsächlich um eine Seltenheit. Die deutsche Künstlerin war nach San Pedro gebracht worden, einem weltweit einzigartigen Gefängnis mitten in La Paz, der bolivianischen Hauptstadt. Ein Gefängnis ohne Wärter. Ohne Prozess. Ohne Anhörung. Ohne Rechtsbeistand.
Von den internationalen Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen, denen der bolivianische Staat zweifelsohne angehört, hatte man dort noch nie etwas gehört oder bemühte sich zumindest, sie demonstrativ zu ignorieren. Ebenso wenig von etwas wie einer Unschuldsvermutung oder rechtlichem Gehör. Es war zum Kotzen. Ein Verdächtiger galt grundsätzlich so lange als unschuldig, bis seine Schuld bewiesen war. Aber nein, nicht in Bolivien, wenn es um den Besitz von Kokain ging, seit man auf Druck der USA der internationalen Drogenkriminalität den Kampf angesagt hatte.
»Das ist kein Problem«, mischte sich Geordan ein, nickte aber sogleich in die Kamera, was hieß, dass ich weiterreden sollte.
»Sie müssen sich nicht bei mir entschuldigen, Mister van Rensselaer. Wegen dieser außergewöhnlichen Umstände haben Sie sich an mich gewandt, richtig?«
Mir war nicht nach fishing for compliments, aber ich wollte ihm nochmals verdeutlichen, dass ich sein Geld wert war. Außerdem gehörte das Säbelrasseln für Geordan unabdingbar zum Geschäft. Tu Gutes und rede darüber! Jeder muss wissen, dass wir die Besten sind! Seine Worte, nicht meine.
»Sie sind die Beste, sagte man mir.« Bei van Rensselaer war unser Slogan schon mal angekommen.
»Das ist richtig«, bestätigte ich seine Aussage und kam dann zum Wesentlichen. »Charlotte Lukas dürfte gar nicht in San Pedro sein. Dort werden normalerweise nur Männer inhaftiert, und das unter schlimmsten Bedingungen. Es wird Zeit, dass den Bolivianern endlich mal jemand den Kopf geraderückt. Ich werde mich morgen bei Ihnen melden, wenn ich zurück bin. Danke für die Organisation des Guides.«
»Ich werde Sie unterstützen, wo ich kann. Haben Sie das Geld?«
»Hab’ ich.«
Dieses Mal nickte van Rensselaer.
Offensichtlichkeiten.
Bestechungsgeld für die Wärter von Charlotte Lukas. Dreißigtausend Boliviano, umgerechnet nicht mal viertausend Pfund Sterling. Kein Grund, darüber zu reden.
»Lassen Sie mich wissen, wenn Sie mehr brauchen. An monetären Mitteln soll es nicht scheitern.«
»Danke, das ist hilfreich.« Die genannte Summe entsprach mehr als dem Zehnfachen des Monatsverdienstes eines durchschnittlichen Bolivianers. Für den Anfang war es mehr als genug, um nach San Pedro überhaupt hineinzugelangen.
»Die behördlichen Genehmigungen und die des Direktors liegen bereits vor. Es war überraschend einfach, die Formalitäten zu klären. Miss Prince’ persönliche Assistentin hat alle erforderlichen Schriftsätze innerhalb eines Vormittages besorgt.«
Warum laberte Geordan so viel? Was war nur mit ihm los, dass er mir nicht vertraute?
»Nichts anderes habe ich erwartet, Miss Prince. Sie sollten morgen unbedingt noch die deutsche Botschaft in La Paz aufsuchen. Ich kümmere mich um den Termin.«
Van Rensselaer strich erneut über sein Kinn und ich fragte mich, weshalb er so viel Aufwand betrieb. Er war der Mandant, die Durchführung des Auftrags konnte ihm egal sein. Und warum legte er sich für diese Charlotte Lukas so ins Zeug? Sie sollte für ihn nur ein paar Fotos von irgendwelchen Tieren knipsen. Mehr nicht. Oder steckte mehr dahinter?
Na ja, was wusste ich schon?!
Vielleicht führten sich passionierte Kunstliebhaber so auf, Milliardäre im Besonderen. Möglicherweise hatten die beiden auch ein Verhältnis. Und selbst wenn. Was ging es mich an? Alles, was zählte, waren die Freilassung dieser Fotografin und eine pünktliche Zahlung meines Honorars. Punkt.
Trotzdem schlotterten mir die Knie, als ich mich von unserem Mandanten und Geordan mit ein paar warmen Floskeln verabschiedete. Gefängnisse per se machten mir keine Angst. Nicht einmal die heruntergekommenen Betonställe am Arsch der Welt. Der Umgang mit abgefuckten Kerlen, die sich wie Diktatoren fühlten, gehörte zu meinem Job. Aber San Pedro war eine Nummer für sich. Die Stadt der Gefangenen hieß das Gefängnis im Volksmund, weil es ein von der Außenwelt abgeschotteter Mikrokosmos mit nur einem Gesetz war – dem Gesetz des Stärkeren. Eine eigene soziale Welt innerhalb der Mauern. Die Polizei und Justiz blieben draußen. Der Knast wurde von den Insassen geführt und selbst verwaltet. Was bedeutete, dass die Stärksten und Korruptesten und Abgebrühtesten von ihnen das Sagen hatten. Wer sie bezahlen konnte, hatte eine Chance zu überleben. Wer nicht, musste sich bemühen, ein anerkanntes Mitglied dieser außergewöhnlichen Gemeinschaft zu sein. Hinter den Mauern dieses Gefängnisses ging es nicht um Buße oder Resozialisierung, sondern um die nackte Existenz. Offiziell war das natürlich komplett anders. Es gab Schulen, Werkstätten, Büchereien und sogar Kindergärten, denn nicht selten lebten die Familien der Gefangenen ebenfalls dort. Die Frauen und Kinder konnten sich frei bewegen, das Gelände nach Belieben betreten oder verlassen. Aber das war Bullshit. Wer raus und rein durfte, wer starb oder am Leben blieb, bestimmten die Bosse in San Pedro. Schwere Jungs, die sich mit Geld, Angst und Gewalt an die Spitze der Knast-Hierarchie hochgearbeitet hatten. Sie lebten dort wie die Fürsten und finanzierten ihr pompöses Leben mit einem privaten Drogenlabor und jeder Menge Schmiergeld.
Und an denen musste ich morgen vorbei. Mit diesen Wichsern musste ich verhandeln … über das ungewisse Schicksal einer Frau, die in dieser Sekunde höchstwahrscheinlich Todesängste ausstand.
ZWEI
»Wenn dunkle Magie dich einfängt …«
Velvety Prince – toughe Anwältin, mutige Frau mit einer Schwäche für einen geheimnisvollen Mann
Hatte allein der Gedanke an dieses überdimensionale Scheißhaus meine Knie bereits schlottern lassen, übertraf die Realität meine Befürchtungen um ein Vielfaches.
San Pedro lag tatsächlich im Zentrum in der Stadt. Ein maroder Betonklotz inmitten einer im Aufschwung befindlichen, im Übrigen sehr pittoresken Millionenmetropole. Mit einem einzigen Schritt überwand man die Barriere von Urlaub in den Anden zu Chaos und Kriminalität. Ein schmaler Eingang führte durch die Mauern, dunkel und feucht verschluckte er den ankommenden Besucher. Raus aus der Zivilisation, weg von allem, was normal war, hinein in eine Welt der Anarchie und Resignation.
Van Rensselaer hatte einen Guide engagiert, einen freundlichen jungen Mann, der mir auf der Taxifahrt vom Hotel hierher freudestrahlend eine Menge touristischer Sehenswürdigkeiten präsentierte. Ob er allerdings für die Bewältigung der bevorstehenden Aufgabe geeignet war, bezweifelte ich. Mir war nicht entgangen, wie er seine flachen Hände immer wieder an den Oberschenkeln abwischte und alle paar Minuten über seine Schulter blickte. Der nette Andres Cinco war sicher die perfekte Begleitung, wenn man etwas von den indigenen Urvölkern erfahren wollte, von den spanischen Einwanderern, und wahrscheinlich könnte er die Geschichte der Koka-Pflanze und deren ambivalenter Bedeutung für die Menschen des Landes rauf und runter rezitieren. Aber konnte er auch dafür sorgen, dass wir unbeschadet nach San Pedro hineingelangten und vor allem heil und gesund wieder heraus?
Ich war eigentlich keine furchtsame Schwarzmalerin, doch jetzt nagten durchaus berechtigte Zweifel an meinen Nerven.
»Señor Cinco, warten Sie bitte!« Er wollte gerade den Eingang passieren, vor dem zahlreiche Menschen standen, unter ihnen ebenso viele bewaffnete Polizisten und Militärs.
»Nur Andres, bitte!« Er blieb stehen und wandte sich mir zu.
»Gut, Andres. Was kann schlimmstenfalls passieren? Ich meine, die werden uns doch nicht einfach dortbehalten oder … umbringen oder so?«
Verdammt! Ich klang leider so ängstlich, wie ich mich fühlte.
»Nein, nein!«
Aha! Nun, ich wünschte mir, dass seine Antwort überzeugender geklungen hätte. Entweder war er naiv oder ich neurotisch.
Andres bemerkte meine Unsicherheit. »Miss, keine Sorge! Sie haben das Geld, richtig?«
Ich ruckelte an dem Griff meiner Handtasche, die ich mit beiden Händen fest umschlang.
»Sie sind die Freundin! Verstehen Sie? Freundin!« Andres trat dicht an mich heran. »Sagen Sie denen bloß nicht, dass Charlotte Lukas Ihre Mandantin ist. Wenn die Wind davon bekommen, dass eine Menschenrechtsanwältin in ihrem Laden herumschnüffelt, kann ich für nichts garantieren. Also verplappern Sie sich bloß nicht!«
»Jaja! Natürlich. Ich bin nur eine Freundin!« Die Show hatte ich schon öfter abgeliefert. Manchmal war es besser tiefzustapeln, vor allem als Frau. Mir war klar, dass ich hier nicht die toughe Lady mimen konnte. Jedenfalls nicht gegenüber den Wachen am Eingang. Erfahrungsgemäß waren das dumme Kerle, die von Frauen nicht mehr erwarteten, als was Anständiges zu essen, einen guten Fick … und bisweilen ein paar Scheine.
Seufzend marschierte ich mit Andres zum Eingang. Die Männer in Uniform beäugten uns skeptisch, ließen ihre Knarren jedoch im Halfter. Gut so! Bis jetzt lief alles nach Plan. Auf dem Weg hierher hatte ich mit Andres besprochen, wie wir vorgehen würden. Der Plan beruhte auf meinen Erfahrungen und seinem Wissen um die Bestechlichkeit eines jeden Offiziellen in Bolivien. Er hatte behauptet, selbst Polizei und Militär wären nahezu vollständig korrupt. Na ja, auch das war leider keine regionale Besonderheit. Selbst wenn die Vorstellung erschreckend war, kam dieser Umstand mir doch gelegen. Denn solange die Menschen bestechlich waren, würden wir sie bezahlen und bekommen, was wir wollten. Ein einfacher Deal.
Die Männer vor der Mauer hatten uns nicht aufgehalten. Das war gut, sonst wären die ersten zehntausend Boliviano schon weg gewesen.
Wir passierten den Eingang. Eine düstere Schlucht in der meterdicken Mauer, die bis zu einer Schleuse führte, hinter der die fremde Galaxie begann. Dort standen sechs Wärter, deren Gespräch abrupt verstummte. Alle Augen waren auf uns … Korrektur: auf mich gerichtet. Natürlich! Zwar hatte ich mein Outfit subtil gewählt. Eine dunkelblaue, nicht zu enge Jeans, ein schwarzer Rollkragenpullover und Lederstiefel mit flachen Absätzen. Also hey, absolut nichts Extravagantes. Doch Gefängniswärter waren letztlich überall gleich. Männer eben, die in ihrem Job nur selten Frauen zu Gesicht bekamen. Und wenn, dann erfahrungsgemäß weinende Geschöpfe, besorgte Mütter oder aber aufgetakelte Gattinnen der bösen Jungs, die absolut tabu waren.
Ich gehörte in keine dieser Kategorien, weshalb mich die Kerle selbst im Kartoffelsack angestarrt hätten, als wäre ich gerade aus einem Raumschiff gestiegen. Zudem konnte ich ein Detail, was mich hier von allen anderen abhob, nicht verbergen, und zwar mein blondes Haar. Klar, ich hätte ein Kopftuch tragen können, aber so eine Verhüllung machte Wärter in der Regel nur skeptisch. Außerdem konnte ich gegen das zweite wichtige Detail definitiv nichts ausrichten. Meine Größe. Ich überragte die meisten Südamerikaner um gut einen Kopf. Kurzum: Es war kein Wunder, dass die Kerle mich mit einer Mischung aus Neugier, Misstrauen und Geilheit anstarrten.
Andres sprach mit ihnen. Ich hielt die Klappe und die Knarren der sechs Wärter im Blick. Auch sie trugen schwere Bewaffnung, als rechneten sie jederzeit mit einem Anschlag oder Ausbruch.
Ich konzentrierte mich darauf, was Andres sagte, aber ich verstand kein Wort. Es war kein Spanisch, das sie miteinander sprachen. Er hielt mir seine offene Hand entgegen, ich drückte ihm den Umschlag hinein, er gab ihn weiter, und nach nur zwei Minuten spuckte uns die Schleuse in die fremde Galaxie.
Das typische Surren ertönte. Wir traten durch ein geöffnetes Gitter, das mich daran erinnerte, in einem Gefängnis zu sein. Das war aber auch schon alles. Die Wärter folgten uns nicht, sie durften den Bereich nicht betreten. Kaum waren wir auf der anderen Seite, schwoll hinter uns lautes Stimmengewirr an.
»Quechua«, erklärte Andres ungefragt. »Eine der Amtssprachen in Bolivien. Die meisten sprechen es hier und viele bestehen darauf.«
Deshalb hatte ich nichts verstanden. Diese indigene Amtssprache unterschied sich massiv vom Spanisch der einstigen Kolonialherren. Ich konnte nachvollziehen, weshalb die südamerikanischen Ureinwohner darauf bestanden, wenngleich diese Tatsache meine Situation – oder besser gesagt die von Charlotte Lukas – keinesfalls besser machte. Kommunikation war das A und O in meinem Job. Also hoffte ich, dass wenigstens der Big Boss kein allzu eifriger Patriot war.
Vor uns tat sich ein Areal auf, das alles in allem nicht größer als ein Fußballstadion war. Es gab eine kleine Kirche, die halbwegs intakt schien. Links und rechts weitere Gebäude, deren Fassaden bröckelten und deren Fenster zum Teil eingeschlagen und mit Holzbrettern vernagelt waren. Dazwischen ungepflegte Rasenflächen, wacklige Basketballkörbe und Bänke, auf denen Menschen saßen, rauchten oder sich unterhielten. Eine Gruppe Kinder spielte lärmend mit einem abgewetzten Fußball. Über unseren Köpfen verliefen Stromkabel von einem maroden Gebäude zum anderen, dilettantisch installiert. Daneben gespannte Wäscheleinen mit Kleidung in diversen Größen. Nichts hier erinnerte an ein Gefängnis, ich kam mir vor wie in einem Armenviertel, einem typischen Ghetto abseits der City.
Mit langen Schritten überquerten wir den Innenhof. Andres lief zielstrebig auf einen dunklen Eingang zu, hinter dem eine schmale Treppe ins obere Geschoss führte. Es roch modrig, die Stufen waren abgewetzt, der folgende Flur so eng, dass wir hintereinander laufen mussten. Ich fragte mich, woher Andres den Weg so genau kannte, und revidierte meine anfängliche Meinung, dass er für dieses Abenteuer nicht taugen würde. Er zögerte nicht, durchschritt souverän die erste Tür und betrat vor mir einen Raum, der wohl das Büro des Gefängnisbosses war.
Uns empfing rege Geschäftigkeit. Zwei Schreibtische standen nebeneinander. An einem saß ein großer Mann mit grimmigem Blick und tätowiert bis an die Kinnkante. Er war noch nicht alt, höchstens Mitte zwanzig, aber zweifelsohne der Chef dieses seltsamen Etablissements. Hinter ihm ragten stählerne und an vielen Stellen rostende Aktenschränke bis unter die Decke, auf seinem Schreibtisch lagen lose Zettel verteilt, darauf eine Knarre.
Obwohl er gerade in eine hitzige Diskussion mit einigen Männern eingebunden zu sein schien, blickte er zu mir, sobald ich den Raum hinter Andres betreten hatte. Das Gespräch verstummte. Alle Geräusche verstummten. Sämtlich Augen waren auf mich gerichtet. Schon wieder.
»Die Anwältin!« Übertrieben galant erhob sich der Boss von seinem Stuhl und streckte mir die rechte Hand entgegen – Andres betont ignorierend. Er wusste also, dass ich Anwältin war. Die Freundin-Nummer konnte ich mir also schenken.
Ich nahm die Begrüßung entgegen und registrierte seine enorme Größe. Gut, dieser Mann erntete schon allein mit seiner imposanten Erscheinung den nötigen Respekt.
»Velvety Prince.«
»Ich weiß, wer Sie sind.«
Natürlich! Ein Mann wie er überließ nichts dem Zufall. Und er sprach Spanisch. Die Kommunikation funktionierte also. Prima!
»Tomas Mamani. Es ist mir eine Ehre.« Er hielt noch immer meine Hand und war sich seiner Autorität mehr als bewusst. Ein süffisantes Lächeln lag in seinem Mundwinkel.
»Ich bin hier, um mit Charlotte Lukas zu sprechen.« Sein überhebliches Auftreten überging ich und startete spontan Plan B.
Langsam glitt seine Hand aus meiner. Mamani musterte mich eine Weile und tat dann ahnungslos. »Wer soll das sein? Eine Frau mit diesem Namen gibt es hier nicht.«
Im ersten Moment wurde mir kalt. Dann erhitzte die aufsteigende Wut meine Wangen. »Señor Mamani, halten Sie mich bitte nicht für eine Närrin! Ich schlage vor, wir verschwenden hier nicht gegenseitig unsere Zeit und …«
»Jaja, schon gut.« Er lächelte immer noch.
Ein Mann der Spielchen! Super!
Während Mamani nach dem Hörer seines Telefons griff, holte ich den Umschlag aus meiner Tasche und legte ihn auf den Tisch. Darin befanden sich zehntausend Boliviano, jene Summe, die im Vorfeld vereinbart worden war. Während Mamani seine Hand auf den Umschlag legte, trat ich einen Schritt zurück und scannte den Raum. Vier weitere Männer, klein, dunkelhaarig, Einheimische. Sie alle trugen Waffen. Jetzt nur keinen Fehler machen!
Und … dann sah ich ihn. Er stand in der Ecke neben dem Fenster. Ich vergaß zu atmen. Wieso …? Das konnte nicht sein … Um mich herum drehte sich alles. Nichts existierte mehr. Kein Andres, kein Mamani, kein San Pedro, kein Scheißhaus von einem Gefängnis. Die Realität löste sich auf, wurde zu einer vagen Schwerelosigkeit, in der ich schwebte.
Magie umgab mich. Ein Zauber, gewoben zu einem Netz, das mich einfing wie einen Schmetterling.
Dieser Mann, er strahlte pure Macht aus, sinnliche, alles einnehmende Magie. Seine Anziehungskraft war ebenso außergewöhnlich wie seine Schönheit. Dunkle Wellen, etwas länger, aber perfekt frisiert. Lippen, die zum Küssen einluden. Ein akkurat gestutzter Dreitagebart auf schmalen Wangen und markantem Kiefer. Eine kantige, fast schon aristokratische Nase. Und dann diese Augen! Diabolisch funkelnd. Sie taxierten mich. Ich senkte den Blick, ließ ihn schweifen über seinen schwarzen Anzug. Maßgeschneidert. Darüber ein Mantel, darunter ein weißes Hemd, opulente Manschettenknöpfe. Wow! Nach allem, was ich über Kleidung und Designer wusste, war allein seine Krawatte teurer als das Schmiergeld, was ich gerade auf den Tisch gelegt hatte.
Wer zum Teufel war dieser Mann? Er trat aus dem Schatten und taxierte mich weiter. Seine Augen schimmerten jetzt königlich blau. Nur mit Mühe gelang es mir, mich daran zu erinnern, dass ich atmen musste. Ein Detail verschob den perfekten Anblick. Als er einen weiteren Schritt auf mich zukam, sah ich den Gehstock. Mit beiden Händen stützte er sich darauf. Ein goldener Siegelring an seinem kleinen Finger sagte mir, dass dieser Mann irgendein hohes Tier war – ein mächtiger Mann, ein durch und durch gefährlicher Mann. Und doch konnte ich nichts anderes tun, als ihn anzustarren und mir vorzustellen, wie sein Bart über die Innenseiten meiner nackten Schenkel kratzte.
Heilige Scheiße!
Es gab keine logische Erklärung für diese impulsiven Emotionen, die durch meinen Körper rasten, keinen rationalen Grund für den Tumult in meinem Kopf, keinen objektiven Auslöser für jenes Feuer, das plötzlich heiß in mir wütete, keine ungünstigere Gelegenheit für wollüstige Tagträumerei und kein erklärbares Motiv, warum ein Mann wie er an einem Ort wie diesem sein sollte.
Alles in allem eine absurde Situation und sentimentaler Mist. Das war doch verrückt, ich musste sofort aufhören, mich zu benehmen wie eine rollige Katze! Aber es gelang mir nicht. Dieser Mann zog mich in seinen Bann, als wäre ich ein Stück Metall und er ein riesiger Magnet. Jede Zelle in mir sehnte sich danach, in seinen Armen zu liegen. Nackt. Willenlos. Orgiastisch schreiend.
Bullshit!
Ja, ich war angespannt, übermüdet, erschöpft. Dieser Auftrag war alles andere als einfach, und Kontrollverlust warf mich immer aus der Bahn. Aber nichts davon erklärte mein Verhalten, meine völlig absurde Reaktion auf diesen Mann. Seine Anziehungskraft war die reinste Magie, ein dunkler Zauber, der mich mit einem Bann belegte.
»Señora … Miss …?«
Mamani meinte mich, oder? Natürlich! Ich war die einzige Frau im Raum. Er suchte meine Aufmerksamkeit. Doch die war gefesselt … von Mister Dunkel und Schön.
Keine Ahnung, wie lange ich ihn anstarrte. Nun, die Wahrheit war, dass wir uns anstarrten. Interessant! Ging es ihm genauso wie mir oder war er einfach nur genervt? Herrje! Ich brauchte zwei Sekunden, um mich zu erden und wieder in der Realität anzukommen. »Ja?«
»Das reicht nicht!« Mamani wedelte mit dem Umschlag.
»Bitte? Das ist die vereinbarte Summe …«
»Jaja, aber es reicht eben jetzt nicht mehr. ¡Dios mío! Du wolltest keine Zeit verschwenden, also akzeptiere oder verschwinde!« Von dem sich gerade noch überheblich-charmant gebenden Mann war nicht mehr viel übrig. Mamani sah gestresst aus. Wütend. Ungeduldig.
Aber ich wusste, er würde die Summe erhöhen. Das taten sie immer. Andres hatte es gesagt. Das war so sicher gewesen, wie die Tatsache, dass hier keiner herauskam, und doch konnte ich nicht umhin, kurz zu rebellieren.
»Sie dürfte nicht hier sein«, stammelte Mamani. War er doch nicht der Big Boss, sondern nur ein Lakai? Ich atmete tief ein und wollte gerade etwas erwidern, als er weitersprach. »Das hier ist eine Einrichtung für männliche Strafgefangene. Gemeldet wurde uns ein Charlie Lukas. Ein deutscher Künstler. Du wirst also verstehen, dass wir nicht sehr glücklich über die Umstände sind. Mehr Arbeit für uns. Mehr Geld. Ganz einfach! Und jetzt verschwinde oder bezahl!«
Aha! Daher wehte also der Wind. Ein Fehler in der Bürokratie, falls seine Erklärung stimmte. Kommentarlos legte ich einen weiteren Umschlag auf den Tisch. Weitere zehntausend Boliviano. Wenn er noch mehr wollte, hätte ich nur noch das, was ich für Charlotte Lukas in einem Geheimfach meiner Tasche versteckt hielt. Ich wollte sie nicht mittellos zurücklassen. So etwas tat man als guter Rechtsbeistand, wenn man einen Mandanten im Knast besuchte – man überließ ihn nicht sich selbst. Doch dieser hehre Grundsatz wäre Makulatur, wenn …
Mamani gab einem der Männer ein Zeichen und forderte ihn auf, uns zu Charlotte Lukas zu bringen. Puh! Das erleichterte Seufzen, das auf meiner Brust lag, musste ich mit Kraft unterdrücken. Ebenso den Drang, sofort aus der Tür zu stürmen.
Letzteres nicht nur, um zu verhindern, dass Mamani mir doch noch einen Strich durch die Rechnung machte, sondern vor allem, weil ich die Blicke des magischen Unbekannten auf mir spürte wie glühende Nadelstiche, die meine Haut in Brand setzten. Ich hatte immer noch das Gefühl, nicht richtig atmen zu können.
Bewusst auf meine Schritte achtend, ging ich aus dem Raum, drehte mich jedoch aller Vernunft zum Trotz an der Tür noch einmal um und erhaschte seinen Blick. In diesem Moment wusste ich, dass ich diesen Mann wiedersehen würde – und dann würde ich brennen. Lichterloh!
DREI
»Lass dich von der Größe deines Gegners nicht einschüchtern.
Zeige Krallen und stürze dich auf ihn!«
Velvety Prince – empörte Anwältin, Kämpferin für die gute Sache und gefangen von dunkler Schönheit
Früh am Vormittag bewegten sich die Tem-peraturen noch weit unten. Jetzt im Herbst schwankten sie zwischen dem Nullpunkt in der Nacht und angenehmen zwanzig Grad am Mittag. Aber gerade war es schlichtweg noch kalt … mir war kalt. Der Rollkragen lag locker um meinen Hals. Für einen Augenblick entließ ich die Henkel der Tasche meinem festen Griff und packte die Wolle meines Pullovers, um den bis übers Kinn zu ziehen.
San Pedro war in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich.
Die Stadt der Gefangenen.
Man musste sich den Namen auf der Zunge zergehen lassen, um ihn zur Gänze zu verstehen.
Wir überquerten zu dritt den großen Platz und steuerten eine der Baracken an, in denen die Gefangenen lebten. Auch hier hing nicht wirklich saubere Wäsche an kreuz und quer und von einem Dachfirst zum anderen gespannten Leinen. Löchrige Gardinen wehten aus halb geöffneten oder defekten Fenstern. Kinder waren zu sehen, Frauen sprachen vor den Häusern miteinander. Eine hielt einen Säugling im Arm, den sie ungeniert stillte. Hinter den Gittern der Schleuse, durch die wir gekommen waren, standen die Wachmänner mit ihren Gewehren und sahen zu uns herüber, würden aber niemals das Innere dieses seltsamen Gefängnisses betreten. Meine kümmerlichen Recherchen hatten ergeben, dass selbst juristische Belange innerhalb der Mauern erledigt wurden, und zwar ohne Intervention der normalen Welt da draußen. Meist unter Aufsicht und der Willkür des Gefängnisbosses, also wahrscheinlich unter der Hand von Mamani. Nur bei einem Mord wurde die staatliche Judikative einbezogen … gelegentlich.
Bevor wir die Baracke betraten, drehte ich mich noch einmal um und blickte zurück zu dem Gebäude, aus dem wir gerade gekommen waren. Ich hätte nicht erklären können, was mich dazu drängte.
Doch dann sah ich ihn.
Mister Dunkel und Schön.
Geheimnisvoll, sinnlich, purer Sex und mit einer Macht über meine Gedanken, meinen Körper, die niemand haben sollte. Am allerwenigsten ein Fremder, ein unverschämt gut aussehender Fremder, der nicht nur gefährlich und voller Mysterien zu sein schien, sondern der auch etwas von mir erwartete. Denn er stand nicht einfach nur dort, auf seinen Stock gestützt und erstarrt, als würde er nie etwas anderes tun. Das allein wäre schon rätselhaft genug, um meine Aufmerksamkeit an ihn zu binden. Nein, seine verstörend blauen Augen fixierten mich.
Was zum Teufel wollte dieser Mann von mir?
Gut, Fokus, Vel!, schimpfte ich innerlich mit mir selbst. Dieser Mann, dieser Knast … das alles hier war doch eine verfluchte Farce! Ich drehte mich um, lief in die Baracke, atmete tief durch und folgte den lauter werdenden Stimmen. Ich hörte Deutsch.
Charlotte Lukas war nur unwesentlich älter als ich – Ashford van Rensselaer hatte einige Eckdaten über sie zusammengetragen, als er sich an unsere Kanzlei gewandt hatte. Doch diese Tatsache verblasste zu einer Nebensächlichkeit, als ich die Spuren ihres bisherigen Aufenthaltes sah. Obwohl sie erst drei Tage hier sein konnte, wirkte ihre Haut blass, beinahe wächsern wie die einer Leiche. Das lange Haar war fettig und zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, ihre Kleidung starrte vor Dreck.
Bevor ich etwas sagte, griff ich als Erstes in meine Handtasche und holte die Flasche Wasser heraus, die ich vorsorglich aus dem Hotel mitgenommen hatte. Ich reichte sie Charlotte Lukas, die hektisch den Deckel abschraubte und den Inhalt gierig in ihren Rachen kippte.
Ich ließ ihr einen Augenblick. Nicht nur, um ihren Durst zu stillen. Mit dem lebensspendenden Wasser und der blitzblanken Flasche in der Hand sollte Charlotte Lukas begreifen, dass sie nicht länger allein war. In diesem Ausnahmezustand brauchte das Gehirn Zeit, um diese Erkenntnis verarbeiten zu können. Die letzten drei Tage und Nächte waren vermutlich die schlimmsten ihres Lebens gewesen. Allen Mandanten, die ich aus den tiefsten Löchern dieser Welt holte, ging es so. Angst zerfraß ihren Verstand, Ungewissheit ließ sie nicht schlafen, endlose Vernehmungen, bisweilen Folter, machten jede Hoffnung zunichte. Furcht um die Verwandten, Freunde, Geld – eine Menge Mist, die einem im Kopf umherwirbelte, wenn man nach den Verhören allein war.
Und jetzt platzte ich in dieses Horrorszenario und musste wirken wie ein Engel des Lichts in unfassbarer Finsternis. Manchen Menschen ging dabei vielleicht einer ab. Ich hingegen hatte gelernt, dieses Licht sparsam einzusetzen. Denn ich war kein Engel, nur eine Anwältin, die leider keine Wunder bewirken konnte. Mein erster Auftrag bestand darin, Charlotte Lukas die Hoffnung wiederzugeben, damit sie am Leben blieb. Aber diese Hoffnung musste auf einem realistischen Level gehalten werden, denn ich konnte nicht einfach mit den Fingern schnippen und sie war frei.
»Mein Name ist Velvety Prince. Mister Ashford van Rensselaer hat mich beauftragt, Sie zu finden. Ich bin Anwältin und werde Ihre Verteidigung übernehmen, wenn Sie das wollen. Ich kann …«
Charlotte Lukas’ Augen wurden tellergroß. »Anwältin? O Gott, Sie holen mich hier raus, ja? Ja? Holen Sie mich hier raus? Sagen Sie, dass Sie mich hier rausholen. Oh, bitte!« Die Worte purzelten aus ihr heraus, halb Deutsch, halb Englisch. Ihr Blick schwankte zwischen Überraschung und einer Menge Hoffnung. Sie sprang von der Pritsche, auf der sie gesessen hatte, und ließ sich gleich wieder darauf sinken. »Ich habe nichts getan, Miss …«
»Prince«, half ich ihr auf die Sprünge. Genau das meinte ich mit realistischem Level. Es war verdammt schwer, in Situationen wie diesen nicht die Fassung zu verlieren. Eine Stimme in mir schrie dann stets laut: Schnapp dir die Frau und laufe los! Aber das hier war keine Szene aus einem Action-Film und ich keine coole MI6-Agentin.
»Das Kokain ist nicht meins. Ich nehme keine Drogen. Damit habe ich nichts zu tun. Sie müssen mir glauben, Miss Prince.« Charlotte Lukas sprach Englisch, und das ziemlich gut. Ich dankte ihr im Stillen dafür, denn mein Deutsch war maximal mittelmäßig.
»Andres, würden Sie uns bitte einen Moment allein geben?« Ich drehte den Kopf, um mich zu vergewissern, dass der junge Mann meiner Bitte nachkam.
»Natürlich. Ich bin direkt vor der Tür.«
»Miss Lukas«, begann ich, legte meine Tasche auf den Tisch und setzte mich zu ihr auf die Pritsche.»Es geht nicht darum, was ich glaube. Es geht im Moment auch noch nicht um die Drogen an sich, die bei Ihnen gefunden wurden. Erst einmal muss ich wissen, was passiert ist. Das hier ist ein Gefängnis für männliche Strafgefangene. Haben Sie eine Ahnung, warum Sie hier gelandet sind?«
»Mein Name.«
»Wie bitte?«
»Mein Name. Die haben nur meine Visitenkarte. Mein Pass liegt noch im Safe in der Lodge.« Sie sah durch die vergilbten Fenster nach draußen, als suchte sie nach etwas. Dann ruckte ihr Kopf herum. »O Gott, meine ganzen Sachen. Geld, Pass, meine Kleidung, meine Kameras … o Gott, das liegt alles noch in der Hütte.«
Ich hatte Zweifel, dass etwas von ihrem persönlichen Besitz noch dort wäre, aber das konnte ich ihr unmöglich sagen. Nicht jetzt. Kein Mensch konnte so viel Wahnsinn auf einmal ertragen. »Ich werde sehen, was ich tun kann.« Ein Versprechen, das keinen Erfolg garantierte. Aber auch das verschwieg ich. Die oberste Priorität lag im Moment nicht in der Wahrheit, sondern dass Charlotte Lukas nicht durchdrehte.
»Wahrscheinlich bin ich wegen meines Namens hier. Geschäftlich nutze ich den Namen Charlie Lukas. Manche Aufträge werden lieber an Männer vergeben. Mein Bruder nannte mich immer Charlie. Als Fotografin trete ich nur als Charlie auf. Immer nur Charlie. Auf meiner Visitenkarte steht Charlie. Ich bin Charlie. Da dachte ich … wahrscheinlich ist es wegen des Namens.«
Das ergab irgendwie Sinn. Wenngleich den Polizisten, die Charlotte Lukas verhaftet hatten, doch aufgefallen sein musste, dass sie kein Mann war. Doch mit dieser Überlegung konnte ich mich jetzt nicht aufhalten. »Okay, Miss Lukas. Niemand ist also im Besitz Ihres Passes? Der liegt noch in der Lodge, richtig? Also hat niemand die deutsche Botschaft verständigt, oder? Mit wem haben Sie bislang gesprochen?« Mein Blut kochte hoch. Wie immer in Situationen, in denen staatliche Gutsherrenart und willkürliche Machtgeilheit auf dem Rücken derjenigen ausgetragen wurden, die sich nicht wehren konnten. Im Übrigen waren wir gerade in Bolivien. Es galten die Internationalen Menschenrechtskonventionen, verdammt noch mal!
Fokus, Vel!, ermahnte ich mich ein weiteres Mal. Job hin, Job her! Bei aller Professionalität, die definitiv wichtig war, brodelte es in mir. Mein tief verwurzeltes Gerechtigkeitsempfinden machte meinem Gemüt gelegentlich das Leben schwer. Dieser kindliche Trotz war aber auch das Geheimrezept meines beruflichen Erfolges. Denn ich ließ nicht locker, wenn ich überzeugt war, dass jemandem Unrecht angetan wurde.
Und Charlotte Lukas’ Fall war der Inbegriff einer Ungerechtigkeit, die nicht mal hätte passieren dürfen, wenn das Kokain tatsächlich ihr gehörte.
Ich kramte in meiner Tasche nach einem Stift, riss ein Blatt Papier aus meinem Notizbuch und reichte es der Frau. »Schreiben Sie mir bitte die Adresse Ihrer Lodge auf. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde jemanden schicken, um Ihre Sachen abzuholen. Wichtig ist Ihr Pass. Wir müssen den deutschen Botschafter einschalten. Mister van Rensselaer kümmert sich um einen Termin. Er ist sehr hilfreich und hat mich gebeten, Ihnen das hier zu geben.« Nachdem ich mich erneut vergewissert hatte, dass wir nicht beobachtet wurden, übergab ich ihr den letzten der Briefumschläge, die ich vorbereitet und nur für alle Fälle in einem nicht auf den ersten Blick zu erkennenden Innenfach meiner Handtasche verstaut hatte.
»Was ist das?«
»Ein bisschen Geld. Verstecken Sie es bitte gut! Nicht alles am gleichen Ort. Ein Loch in der Matratze, ein Spalt unter der Fensterbank. Etwas in der Art.«
Ein Nicken verriet mir, dass Charlotte Lukas bereits eine Idee hatte.
»Ich werde mehr mitbringen, wenn ich wiederkomme. Hoffentlich mit guten Nachrichten.«
»Ich muss also hierbleiben. Wie … wie stehen meine Chancen?« Ihre Unterlippe bebte. Es gab wenig, was einem mehr Angst einjagen konnte, als die bittere Erkenntnis, in einem fremden Land wegen eines Verbrechens inhaftiert zu werden, das im schlimmsten aller Fälle zu einer jahrzehntelangen Haft führen konnte.
»Ich werde ehrlich sein, Miss Lukas.« Das war ich immer. Niemandem halfen Versprechungen, die nicht eingehalten werden konnten. Wie gesagt, ich musste sparsam mit dem Licht umgehen. Außerdem brauchte ich einen gewissen emotionalen Abstand. Ich war Juristin, Strafverteidigerin, Rechtsbeistand, nicht ihre Freundin, nicht ihre Mutter, keine romantische Heldin und vor allem keine gute Fee. Es gehörte nicht zu meinen Aufgaben, therapeutisch zu agieren oder Mut zu machen oder Hoffnungen hervorzurufen, die unrealistisch waren.
»Ich bitte darum.«
Charlotte Lukas erweckte den Eindruck, realistisch einschätzen zu können, wie tief und dunkel die Wolken über ihrem Kopf hingen. Es war hilfreich, dass sie nicht hysterisch weinte oder lethargisch zusammensackte. Das alles wäre nachvollziehbar gewesen, brachte jedoch keine Lösung.
»Die Voraussetzungen sind denkbar schlecht«, begann ich mit den Fakten. »Der Besitz von Kokain zählt in Bolivien zu den schwersten Verbrechen überhaupt. Seit Jahren will die Regierung dem Handel und Konsum einen Riegel vorschieben. Nicht zuletzt auf Druck der Vereinigten Staaten und auch Europas. Deshalb werden von Zeit zu Zeit Exempel statuiert, vor allem an Ausländern. Hohe Strafen und wenig bis keine Möglichkeiten, sich zu verteidigen. Die in fast allen Staaten der Welt geltende Unschuldsvermutung gilt hier nicht. Das ist unser größtes Problem und gleichzeitig unsere größte Chance.«
»Wie meinen Sie das?«
»Die Beweislast liegt in Bolivien beim Beschuldigten, nicht beim Staat. Der Grundsatz, jemanden so lange als unschuldig zu betrachten, wie seine Schuld nicht bewiesen wurde, ist in diesem Land außer Kraft gesetzt. Bei Kokainbesitz muss der Beschuldigte seine Unschuld beweisen, nicht der Staat die Schuld. Für die Behörden sind Sie in diesem Moment schuldig – eine zu Recht inhaftierte Verbrecherin. Es sei denn, wir können nachweisen, dass es nicht Ihre Drogen waren.«
Die Worte taten weh … sie taten verdammt scheiß weh! Es fühlte sich an, als wären wir zweihundert Jahre in die Vergangenheit gereist. Als gäbe es keine Rechtsstaatlichkeit, keine Magna Charta, keine Vereinten Nationen, keine verdammten Menschenrechtskonventionen. Und auch wenn ich um vielerlei Missstände dieser Art wusste und tagtäglich in meinem Job damit zu tun hatte, schmerzte die Konfrontation mit der bitteren Wahrheit immer wieder aufs Neue.
Trotzdem oder gerade deshalb lief mein Hirn auf Hochtouren. Deshalb hatte ich Karriere gemacht und verdiente einen Haufen Geld, weil ich erst dann so richtig in Fahrt kam, wenn der Fall aussichtslos erschien.
»Das klingt nicht nach einer großen Chance«, wandte Charlotte Lukas ein.
»Ist es aber. Denn das Land verstößt mit dieser Gesetzgebung gegen internationales Recht. Es gibt die Amerikanischen Menschenrechtskonventionen, nach denen eine Unschuldsvermutung zu den Rechten eines jeden Menschen gehört. Niemand darf ohne ordentliches Verfahren schuldig gesprochen werden. Und bis dahin gilt jeder als unschuldig, bis ihm der Staat nachweist, dass er schuldig ist. Punkt. Boliviens Gesetze verstoßen dagegen. Und darin liegt unsere Chance.«
»Sie kennen sich damit aus?«
»Deshalb bin ich hier, Miss Lukas. Ich werde zunächst mit dem Botschafter sprechen. Wir brauchen die Unterstützung des deutschen Staates nicht unbedingt, aber wir werden nichts unversucht lassen. Erstes Ziel ist es, Sie hier rauszuholen. Und dann … dann, Miss Lukas, müssen wir uns überlegen, warum bei Ihnen Kokain gefunden wurde. Offenbar in Ihren persönlichen Sachen, verstehen Sie?«
Sie schüttelte energisch den Kopf. »Nein, ich verstehe nicht. Wo wurde es denn gefunden? Ich weiß nichts. Keiner sagt mir was. Die haben mich behandelt, als wäre ich eine Schwerverbrecherin. Dabei … ich habe doch nichts getan.« Mit zitternden Fingern schob Charlotte Lukas den Umschlag mit dem Geld an ihrem Rücken in den Bund der Hose und wischte sich dann mit beiden Händen über ihr Gesicht.
»Das sind Sie in deren Augen. Was aber nicht Ihre Behandlung rechtfertigt. Doch genau dort werden wir angreifen.«
»Und wenn das schiefgeht?« Sie schaute mich an mit ihren großen leeren Augen. »Wie viel Jahre?«
Was sollte ich antworten? Bisher lag keine Anklage vor, nichts Offizielles. Ich hatte keinen Einblick in die laufende Ermittlung – sofern es überhaupt eine gab. Aber letztlich kam es nicht darauf an, wie viel Kokain gefunden worden war, ob hundert Gramm oder zehn Kilo.
»Wenn die ein Exempel an Ihnen statuieren wollen, werden sie die Höchststrafe fordern.«
»Wie viel?«, fragte Charlotte Lukas tapfer.
»Dreißig Jahre. Mindestens.«
Ein Fakt, der so schwer wog wie ein Felsbrocken. Charlotte Lukas schob die ineinander gefalteten Hände zwischen ihre schmalen Schenkel und reckte ihr Kinn nach vorn. »Das ist viel!« Sie starrte auf das schmutzige Grün ihrer Jogginghose. Tränen tropften auf den fleckigen Stoff. »Ich war noch nie im Konflikt mit dem Gesetz, ich habe noch nie einen Strafzettel zu Hause bekommen. Diese Geschichte ist so abwegig.«
Für mich als Anwältin war es grundsätzlich nicht relevant, ob meine Mandantin die ihr vorgeworfene Tat begangen hatte. Dennoch machte ich mir natürlich Gedanken über die etwaige Schuld oder Unschuld. Ich war schließlich kein Computer, der lediglich Nullen und Einsen sortierte. Hatte eine mittelmäßig erfolgreiche Künstlerin durch einen Zufall die Chance gesehen, an großes Geld zu kommen? Möglicherweise hatte eine günstige Gelegenheit sie in Versuchung geführt. Oder war eine unbescholtene Fotografin einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen und in irgendeine schräge Sache gerutscht?
»Glauben Sie mir?«
Diese Frage kam immer, man konnte quasi die Uhr danach stellen. Aber es war nicht mein Job, der Wahrheit auf den Grund zu gehen.
»Ob ich Ihnen glaube, ist nicht relevant, Miss Lukas. Wir müssen beweisen, dass Sie unschuldig sind. Deshalb ist es wichtig, die folgenden Fragen zu klären: Wessen Kokain ist es? Wie kam es in Ihren Koffer? Und wer hat ein Interesse daran?«
Nachdem lange Zeit keine Antwort kam, beschloss ich, konkreter zu werden. »Wie gut kennen Sie van Rensselaer?«
Sofort traf mich ihr Blick. »Ashford?«
Aha!
»Nicht so gut. Wir haben uns ein einziges Mal persönlich getroffen, sonst nur per Videocall miteinander gesprochen. Er ist ein Auftraggeber.«
»Einer, der eine beträchtliche Summe locker macht, um Ihnen zu helfen. Und das ohne mit der Wimper zu zucken.«
Versteiften sich ihre Schultern gerade? Ich beobachtete Charlotte Lukas genau.
»Was wollen Sie damit sagen? Dass er …«
Mit einem widerlichen Knarzen wurde die Tür aufgerissen, die lautstark gegen die Wand schlug. »Das reicht für heute!«
VIER
»Es ist keine Schwäche, Hilfe anzunehmen, wenn man sie wirklich braucht.«
Velvety Prince – starke Anwältin mit Mut, aber nicht ohne Angst
Tomas Mamani stand in seiner beachtlichen Größe und Erscheinung an der Tür und verengte seine Augen, um seinem Blick eine gewisse Strenge zu verleihen.
Nun, das funktionierte. Er sah unheilvoll aus. Nur leider beeindruckte mich das nicht die Bohne. Wenn ich mich von großen bösen Männern einschüchtern lassen würde, wäre ich die Falsche für meinen Job. Und das war nicht der Fall.
»Das ist wohl ein schlechter Scherz, Mamani. Dieses Gespräch zwischen Anwältin und Mandantin ist vertraulich und dauert so lange, wie es dauert.«
Etwa zwei Sekunden lang war der Gefängnisboss verwirrt. Wahrscheinlich traf er nur selten eine Frau, die keine Angst vor ihm hatte. Vermutlich noch nie. Aber er fing sich schnell.
Ignoranter, hinterfotziger, piesackender Arsch!
»Señora Prince, Sie irren sich. Es dauert so lange, wie ich es gestatte.« Sein Gesicht kam mir entschieden zu nahe.
»Señor Mamani, nein, Sie irren sich, wenn Sie glauben, dass gewisse Regeln außer Kraft gesetzt sind, nur weil wir uns hinter meterhohen Mauern befinden. Gerade deswegen gelten sie!«
Der Ausdruck in Mamanis Augen wurde noch eine Nuance finsterer, als er seine riesige Pranke um meinen Oberarm legte. Fuck! Brutal zog er mich aus dem Raum hinaus auf den Gang. Ich stolperte, bemühte mich aber, seinem Blick standzuhalten. Nur keine Schwäche zeigen! Aus dem Augenwinkel scannte ich meine Umgebung. Wo zur Hölle steckte Andres?
»Sie begehen einen großen Fehler! Sie legen sich definitiv mit der Falschen an. Nehmen Sie Ihre Finger von mir!«
Mamanis Pranke schloss sich stärker um meinen Oberarm. Er konnte mich hier und sofort niederschlagen, vernichten und irgendwo verscharren. Jetzt bekam ich es doch mit der Angst zu tun. Verbales Kräftemessen war ich gewohnt, Argumente, Drohgebärden, von mir aus auch Beleidigungen. Aber Handgreiflichkeiten, körperliche Gewalt … die waren selten. Hier verlief eine Grenze, die die wenigsten Menschen überschritten. Eine Grenze, die Mamani offenbar gleichgültig war. Alles an einem rechtsfreien Ort wie diesem … Fuck!
»Du kleines hochnäsiges Püppchen glaubst also zu wissen, wie die Dinge laufen, ja?Aber ich verrate dir was. Hier kommst du mit deinen schlauen Anwaltssprüchen und deinem wichtigtuerischen Geplapper nicht weit. In meinem Reich gelten andere Regeln. Meine Regeln! Hast du das verstanden?« Sein Gesicht war nur noch einen Zentimeter von meinem entfernt.
Trotzig reckte ich mein Kinn vor. Ich würde nicht zurückweichen. Den Gefallen würde ich diesem selbstgefälligen Wichser nicht tun, auch wenn sich meine Beine anfühlten, als wären sie gekochte Nudeln.
»Vorsicht, Mamani!« Die Worte zischten durch meine zusammengebissenen Zähne.
»Und wenn nicht, du kleines Flittchen?« Der Druck seiner Hand erhöhte sich, in seinen Augen lag etwas, das mir nur zu gut bekannt war: die Erhabenheit, der Stolz eines Mannes, der seine Überlegenheit zur Schau stellen wollte, zur Schau stellen musste, um seine Vormachtstellung zu verteidigen. Hinter diesen Mauern zählte nur bloße Gewalt, das Gesetz des Stärkeren. Sollte er also klein beigeben, würde nicht nur sein Ego Schaden nehmen, sein Status als Big Boss wäre in Gefahr.
Bevor ich weiter darüber nachdenken konnte, wie ich mich am effektivsten aus dieser Situation befreien könnte, und wo zum Teufel noch mal mein Guide eigentlich steckte, riss Mamani erst die Augen auf, dann verzog er den Mund zu einem stummen O. Seine fiese Miene veränderte sich, wurde zu einer hässlichen Grimasse aus Schmerz und Überraschung.
Als sich sein Griff lockerte, bemerkte ich den Schatten hinter ihm.
»Du schießt übers Ziel hinaus, Mamani.«
Mister Dunkel und Schön. Er hatte seinen Gehstock meinem Angreifer zwischen die Beine gerammt. Der hatte mich mittlerweile losgelassen und krümmte sich so vorteilhaft nach vorn, dass ich nur mein Knie hätte heben müssen, um ihm zur Vervollständigung noch die Nase zu brechen. Doch waberte die Stimme des geheimnisvollen Mannes durch meine Synapsen, dass ich dem Arschloch zu meinen Füßen kein Fünkchen Aufmerksamkeit mehr schenkte.
Nicht nur sein Auftreten glich einer Dunkelheit und Mystik, auch seine Stimme besaß etwas, das mich an schwarzen Samt und silbernen Stahl denken ließ … und sich wie ein weicher Seidenschal auf meiner nackten Haut anfühlte, bevor der sich einer Lederpeitsche ähnlich zwischen meine Schenkel schlang.
Unter quälenden Lauten aus seiner Brust krümmte sich Mamani und stieß Flüche aus, die klangen, als wollte er alle Teufel und Dämonen aus der Hölle beschwören.
»Du wirst den Kürzeren ziehen. Verschwinde einfach!« Die Worte des Unbekannten – meines Retters – waren nicht mehr als ein Flüstern, aber sie wogen so viel schwerer als Mamanis Gebrüll, der sich wie ein geprügelter Hund davonschlich.
»Danke!« Das Wort erschien mir schwach und der Situation wenig angemessen, aber diese fünf Buchstaben waren alles, was mein Hirn gerade zustande brachte.
Mister Dunkel und Schön nickte nur und wollte gehen.
Was? Nein!
»Mein … mein Name ist …«, stotterte ich.
»Velvety Prince.« Wieder diese dunkle Stimme, die durch meinen Verstand waberte. Er kannte meinen Namen.
Natürlich!
Ein Mann wie er wusste einfach alles … In mir war nichts als Stille und schwarzer Samt. Es kam mir vor, als wären alle Geräusche um uns herum verstummt. Ich hörte keine Kinder mehr lachen, keinen Straßenlärm, der vorhin noch über die hohen Mauern herüberwehte, kein Plappern der Männer, die unten am Eingang Karten spielten.
Es fühlte sich an, als wäre eine Zeitlupe notwendig, um dem Universum die Gelegenheit zu geben, diese schicksalhafte Begegnung zu kompensieren. Und mir!
Er streckte mir seine Hand entgegen. »Sebastián Vargas.«
Ein Name wie die Sünde. Er klang, als sollte er verboten werden. Süß und höllisch heiß. Sollte er seinen Namen noch einmal aussprechen, müsste ich die Schenkel zusammenpressen, um mich unter Kontrolle zu halten.
»Sie sollten vorsichtiger sein, Velvety Prince.«
Ich nahm seine Hand und vergaß den Satz, den ich erwidern wollte. Kontrolle? Ich wollte mich unter Kontrolle halten? Bullshit! Die hatte ich längst verloren. Seine Berührung ließ mich schweben. Warm und kraftvoll. Seine Hand war die eines Klavierspielers und gleichsam die eines Mannes, der hart arbeiten und zupacken konnte. Sebastián Vargas war auf den ersten Blick … perfekt, aber der Schein trügte. Wie ein geschliffener Diamant. Dem nachlässigen Betrachter offenbarte sich Schönheit, Glamour, Opulenz. Nur demjenigen, der sich die Mühe machte, die Dinge der Welt zu hinterfragen, dem wurde bewusst, wie viele Millionen Jahre und aufwendige Prozesse und nicht zuletzt jede Menge Arbeit hinter dieser Schönheit steckten.
Ich war so jemand. Das brachte der Job mit sich. Ich nahm nie das für bare Münze, was mir offen präsentiert wurde. Denn das war meistens nicht interessant oder nicht wahr. Das wirklich Wesentliche lag hinter der vermeintlichen Wahrheit, unter der Oberfläche. Nicht für jeden sichtbar.
Sebastián Vargas war so einer.
Ein Diamant.
Verborgen im Lavastein aus den Feuern der Hölle.
Und das – verdammt, das imponierte mir und machte mich an.
»Warum haben Sie mir geholfen, Señor Vargas? Wer … wer …?«
Er zog seine Hand aus meinem Griff. »Nicht der Rede wert.«
»Ich frage mich nur …«
»Was?«
Scheiße, ich fragte mich eine Menge. Nur konnte ich schlecht meine absurden Gedanken preisgeben, ohne dass er mich für verrückt hielt. Nur mit Mühe gelang es mir, wenigstens eine logische Frage zu formulieren: »Warum hört Mamani auf Sie? Er ist hier doch der Boss. Also warum …«
Seine Lippen verzogen sich ein wenig. War das ein Lächeln?
»Sie denken zu kompliziert, Velvety Prince. Die Leute tun gewöhnlich, was ich von ihnen verlange.«
»So einfach?« Diese Erklärung war simpel, weil sie genau alles und gleichzeitig nichts preisgab.
»So einfach.« Er kam einen Schritt näher an mich heran. Ich konnte ihn riechen. O mein Gott! Er roch himmlisch. Schwer. Wichtig. Reich. Luxuriös. Männlich. Romantisch. Nach Zitrus, Wald und Karamell. Sebastián Vargas kontrollierte meine Sinne, sein Geruch strömte in meine Nase und provozierte ein Verlangen, dem ich schon lange nicht mehr gestattet hatte, aus den Schatten meiner selbstauferlegten Zurückhaltung hervorzutreten. Dieser Mann riss alle meine Mauern ein, vernichtete meine Prinzipien mit einem einzigen Blick. Seine Anwesenheit legte eine Glocke über mich, hielt mich gefangen in einem Kokon aus paradiesischer Illusion. Wenn er mich jetzt küsste, würde ich schmelzen … schweben … willenlos sein.
Was? Welchen Unsinn dachte ich da eigentlich?
Paradiesische Illusion! Echt jetzt?
Küssen? Einen wildfremden Mann? Diesen Mann, der zu mindestens einhundertzwanzig Prozent Unheil versprach? Nein, so war ich nicht. Und doch rief Sebastián Vargas die romantischsten Vorstellungen in mir wach, die archaischsten Triebe. Meine größte Furcht galt gerade dem Moment, wenn er sich einfach umdrehen und für immer aus meinem Leben verschwinden würde.
»Vergessen Sie, was Sie glauben zu wissen, Miss Prince. Tomas Mamani hat in einem Punkt recht. In San Pedro gelten keine Regeln, die Sie kennen. Hier passiert nichts, wie Sie es gewohnt sind. Also überlegen Sie genau, was Sie tun, Velvety Prince!«
»Wollen Sie mir drohen?« Die Worte platzten einfach aus mir heraus. Ich dachte nicht weiter darüber nach. Sie waren meinem ureigensten Instinkt geschuldet, dem, was mich ausmachte. »Niemand kann sich über allgemeingültige Regeln hinwegsetzen, die von der Weltgemeinschaft festgelegt wurden. Kein Gefängnisboss, kein Land, kein Staat … und auch nicht Sie, Mister Vargas.«
Er musterte mich. Sein Blick glitt über jeden Zentimeter meines Körpers, als wäre ich eine Statue, die er kaufen wollte. Dann schüttelte er den Kopf, als hätte er sich anders entschieden.
Ich bin nicht sein Typ!
Verdammt! Warum nicht?
Echt jetzt? War das wichtig? Nur ein paar Meter von mir entfernt kauerte eine Frau in trostloser Ohnmacht, und ich fragte mich wie ein unreifes Mädchen, ob ich diesem Mann gefiel?
Fokus, Velvety! Fokus!
»Sie sind eine kluge Frau, Velvety Prince. Denken Sie nach! Solange Sie hier drinnen sind, sitzt Mamani am längeren Hebel. Es spielt keine Rolle, ob Sie im Recht sind oder nicht. Das hier ist San Pedro! Werden Sie sich dessen bewusst. Selbst in Guantanamo geht es rechtsstaatlicher zu. Setzen Sie Prioritäten! Wo liegt Ihr Augenmerk? Auf Ihrer Mandantin, oder?«
Wieder reckte ich mein Kinn die Höhe. »Natürlich! Und dessen bin ich mir durchaus bewusst. Ich beherrsche meinen Job und brauche keine Belehrungen, Señor Vargas.«
»Das beruhigt mich.« Damit drehte er sich um und ging. Auf seinen Stock gestützt, bei jedem Schritt das linke Bein leicht nachziehend und einen Sturm der Entrüstung und der Sehnsucht in meinem Bauch zurücklassend.
FÜNF
»Setze Prioritäten! Was nicht bedeutet, dass sich nicht jeder Mensch gelegentlich gehenlassen und impulsive Entscheidungen treffen darf. Manchmal sind die Bedürfnisse, die dein Bauch verlangt, nicht unbedingt schlecht.«
Sebastián Vargas – verletzter Geschäftsmann mit Familiensinn, Retter in der Not
Ein schneller Besuch, um meinem Bruder rauszuholen, hatte es sein sollen – und nun wurde ich das Gesicht dieser Frau nicht mehr los.
Eine schöne Frau, und schon liefen meine schmutzigen Gedanken auf Hochtouren? Das sah mir doch gar nicht ähnlich. Wieso schwamm mein Fokus gerade in Emotionen? Es ging um meinen Bruder, Herrgott! Also, ein wirklicher Bruder war Julian nicht. Ein Freund, der einem Bruder nahekam.
Überflüssige Semantik.
Wichtig war, dass er zur Familie gehörte und meine Hilfe brauchte. Meine Hilfe und meinen objektiven Fokus. Wieder mal! Auch wenn er nicht unverschuldet in dieser Misere gelandet war. Jedes Mal, wenn er in meinem Auftrag nach Bolivien reisen musste, konnte er diesem einen Mädchen nicht widerstehen. Einer Frau, die niemals ihm gehören würde, weil ihr Vater einen Mann wie Julian nicht duldete. Und so landete er jedes Mal in San Pedro. Die Frage war, ob er der Narr war, der es nicht gut sein lassen konnte, oder ich der Idiot, weil ich gerade Julian immer wieder in diese Stadt und jene Situation schickte, der er sich offenbar nicht mit reiner Willenskraft entziehen konnte. Ich sollte mir bei Gelegenheit endlich Gedanken über einen neuen Ablauf der Geschäfte und Julians Part in dem Ganzen machen. Jetzt war es wieder einmal zu spät, und ich musste Schadensbegrenzung betreiben.
So lief das in der Familie. Keiner wurde im Stich gelassen. Wir holten unsere Lieben aus der Scheiße. Was nicht selten erforderlich war, weil die Dinge leider viel zu oft schiefgingen. Denn um ehrlich zu sein, nicht alle unsere Geschäfte waren hundertprozentig legal. Im Grunde liefen nur die Kaffeeplantagen im Einklang mit dem Gesetz. Das war ja auch mein Geschäft. Ich hatte vor einigen Jahren mit großen Feldern in meinem Heimatland Kolumbien damit angefangen und konnte heute mehr als zwanzig Felder mein Eigen nennen. Mein Großvater würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, dass ich mit dem Geld, das er zeit seines Lebens mit Diamanten, Saphiren, Gold und den schönsten Smaragden Kolumbiens gescheffelt hatte, weil er illegale Minen betrieben und das Leben Hunderter Arbeiter auf dem Gewissen hatte … also, wenn sein Enkel jetzt Geschäften nachging, die legal waren, wenn er seine Mitarbeiter nicht mutwillig ausbeutete und trotzdem einen Haufen Kohle machte.
Aber keine Sorge, Abuelo, wir finden immer noch Smaragde so groß wie Orangen und von einer Farbe wie das seichte Wasser an den weißen Stränden der Karibik.
Die Gewinnung von Edelsteinen in den Minen war immer noch schwierig, dreckig, gefährlich, sogar lebensgefährlich, aber sehr gewinnbringend. Gelegentlich stürzte der mit Hochdruckstrahlern ausgespülte Boden ein und Arbeiter verschwanden in einer Felsspalte. Während der Rettung wurden oft drei oder mehr Leichen geborgen. Das war nicht schön, und im Gegensatz zu meinem Großvater investierte ich in moderne Arbeitsgeräte und die Sicherheit meiner Leute, aber der Job blieb gefährlich. Das Ergebnis jedoch war es wert – wir förderten Smaragde zutage, die auf dem internationalen Markt bis zu fünfzigtausend Dollar pro Karat einbrachten, Rubine, die so tiefrot waren, dass sie beinahe schwarz wirkten, und Saphire, an denen Könige Interesse zeigten. Für die Arbeiter war der Job hart und verdammt gefährlich, aber wenn alles gut ging, verdienten sie in einem Monat so viel wie ihr Nachbar in drei Jahren.
Ha! Jetzt lief ich die schräge Rampe am Ende des Flures hinunter, dachte an meinen Abuelo und stellte fest, dass mich meine Überlegungen für ganze fünf Sekunden davon abhalten konnten, an … sie zu denken.
Velvety Prince.