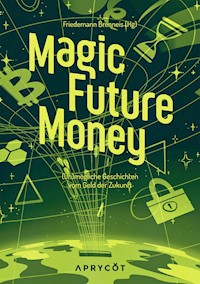
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aprycot Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Heute zahlen wir mit bunt bedruckten Baumwollscheinen, klimpernden Metallmünzen und abstrakten Plastikkarten. Doch womit bezahlen wir morgen? Mit Wasser, Klimazertifikaten, Bitcoin oder gleich mit purer Energie? Womöglich aber auch mit unserem Körper, mit einmaligen Erinnerungen, mit knapper Lebenszeit oder gar mit unserer Seele? 30 Geschichten, die uns vom Geld der Zukunft erzählen und wie es uns, unser Handeln und unsere Gesellschaft verändern würde, wenn es tatsächlich so käme.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Friedemann Brenneis (HG)
Magic
Future
Money
(Un)mögliche Geschichten vom Geld der Zukunft
Klimazertifikate, Erinnerungen, Kryptowährungen, Wasser, Gebete, gesellschaftlicher Status, reine Energie, abstrakte Zahlenreihen, Seelen, Lebenszeit, akzeptables Sozialverhalten, atomare Partikel, Online-Reputation, Wissen, Organe – das Geld der Zukunft könnte viele Formen annehmen. Doch was wären die Folgen und ist es uns das wert?
Im Magic Future Money-Wettbewerb haben 290 Geschichten Antworten auf diese Fragen gesucht. Dies sind die 30 besten.
www.magicfuturemoney.de
Alle Texte stehen unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de).
Lektorat_Tanja Giese, Berlin
Layout, Satz und Umschlaggestaltung_Sebastian Bach, Weimar
Coverillustration_Mathias Barth, Hamburg
Inhalt
Inhalt
Vorab
Die Frau in Zimmer 9
SOL
Unendlich reich
Eine Handvoll Glas
64 m², 2 ZKB, Erstbezug
L1BRA
#BackToZero
Sundressed
Wertpapier
Die Lebenszeithändlerin
Shoppingtrip
Ein guter Deal
Geld ist Nicht-Geld
Xtra Watt
Die letzte Währung
Keinen Cent, bitte!
Transpecunia
Flüssiger Reichtum
Zeitbürger
ZVE
Inselnovellen. Oder das Kartoffelgeld
Karl, der Bang-Bus
Aller guten Dinge sind vier …
Apartment No. 1010
Die Abstimmung
Grün wie die Hoffnung
Die Kryptofonie
Gefühlte Lebenszeit
Geschenkt
Weltenretterin
Die Kreativen
Danke!
Vorab
«Was wissen wir bisher über die Zukunft des Geldes? Leider so gut wie nichts.» Das war das ernüchternde Fazit eines Vortrags, den ich im Herbst 2020 in Leipzig gehalten habe. Seit mehreren Jahren begleitet mich die Frage nach der Zukunft des Geldes nun schon. Ende 2013 war ich aus journalistischem Interesse auf das Thema Bitcoin gestoßen und wollte herausfinden, was es damit auf sich hat. Bitcoin, dieses mysteriöse Phänomen, das nach ganz anderen Regeln funktioniert, als wir es bisher gewohnt sind, und dabei den Anspruch hat, eine neue Art von Geld zu sein. Eine zeitgemäße. Eine zukunftstaugliche. Eine bessere.
Aber stimmt das eigentlich? Bitcoin ist zwar ohne Frage futuristisch, aber ist es tatsächlich das Geld von morgen? Oder ist es doch eher nur eine vorübergehende Erscheinung in der bereits Jahrtausende zurückreichenden Historie des Geldes? Ein netter, aber letztlich bedeutungsloser Trend? Andererseits, was wäre denn die Alternative? Wenn nicht mit Bitcoin, womit bezahlen wir in 10, in 50 oder in 100 Jahren? Noch immer mit bunt bedruckten Baumwollscheinen, klimpernden Metallmünzen und abstrakten Plastikkarten? Kaum vorstellbar, angesichts der zunehmenden Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts.
Im 20. Jahrhundert hat die Menschheit keine 70 Jahre gebraucht, bis vom ersten bemannten Motorflug der Gebrüder Wright mit einem klapprigen Doppeldecker, der sich gerade einmal eine knappe Minute in der Luft halten konnte, mit Neil Armstrong zum ersten Mal ein Mensch in 384.000 Kilometer Entfernung auf dem Mond stand. Das alles mit Hilfe nur eines Bruchteils der Computerleistung, die uns heute zur Verfügung steht. Zur Jahrtausendwende waren handelsübliche Taschenrechner bereits hundertfach schneller als der wichtigste Computer an Bord der Apollo-11-Rakete. In unseren Hosentaschen tragen wir längst das Millionenfache an Rechenleistung mit uns herum: mächtige Minicomputer vollgepackt mit Sensoren, einfach zu bedienen und jederzeit online.
Wie also wird sich das Medium Geld weiterentwickeln, wenn die Digitalisierung weiterhin in diesem Tempo voranschreitet? Welche Gestalt und Eigenschaften wird Geld im Verlauf des 21. Jahrhunderts annehmen? Welche im 22. Jahrhundert und darüber hinaus? Und wie wird es dabei unser Leben und die Gesellschaft beeinflussen? Darauf haben wir bislang keine Antworten.
Dabei sind diese Fragen keineswegs hypothetisch, sondern drängend. Denn auch wenn wir es im Alltag kaum wahrnehmen, befindet sich Geld mitten im digitalen Umbruch und der Kampf um die Deutungs- und Gestaltungshoheit darüber hat längst begonnen. Verschiedene Akteure versuchen dabei, ihre ökonomischen und politischen Interessen durchzusetzen. Staaten und Banken, die ihren Einfluss und ihre historisch gewachsenen Privilegien als alleinige Geldproduzenten nicht verlieren wollen. Bitcoin soll als freies, offenes und gemeinschaftlich verwaltetes Geld ebendiese Institutionen überflüssig machen. Dazwschen stehen private, datengetriebene und rein profitorientierte Unternehmen, denen es vor allem darum geht, ihre Vormachtstellung im Digitalraum auszubauen. Denn Geld als bedeutende gesellschaftliche Infrastruktur ist ein strategisch wichtiges und lukratives Ziel. Wem es dabei gelingt, sich jetzt, im digitalen Umbruch, gut in Position zu bringen, der kann sich langfristig Einfluss und Ertrag sichern.
Doch wissen wir gar nicht, welche Folgen es hätte, wenn sich dieses oder jenes Konzept durchsetzt und was eigentlich erstrebenswert wäre. Weil wir keine Vorstellung davon haben, wie das Geld der Zukunft idealerweise aussehen sollte. Von einem neutralen Standpunkt aus betrachtet und möglichst unabhängig von ökonomischen und politischen Einzelinteressen. Einfach deshalb, weil sich bislang kaum jemand ernsthaft damit beschäftigt.
So ist das Mandat der Forschungsabteilung der Deutschen Bundesbank auf einen Zeithorizont von gerade einmal fünf Jahren ausgelegt. Weiter nach vorne schaut man nicht. Generell setzen sich Ökonomen und die Finanzindustrie viel mehr mit der Vergangenheit und der Gegenwart auseinander als mit der Zukunft. Wann immer ich in den vergangenen Jahren auf Konferenzen und Branchentreffen nach Experten gefragt habe, die sich mit der Zukunft des Geldes beschäftigen, habe ich fast nur fragende Blicke und Schulterzucken erhalten. Aber Veränderung ist eben auch kein sonderlich beliebtes Thema, wenn man zu den Profiteuren des Status quo gehört. Selbst wenn offensichtlich ist, dass dieser nicht mehr lange Bestand haben wird.
Das hat mich aber dazu gebracht, parallel noch einem anderen Ansatz nachzugehen. Wenn sich diejenigen, die sich professionell mit Geld beschäftigen, nicht besonders für dessen Zukunft interessieren, vielleicht könnte ich ja umgekehrt dort etwas über das Geld von morgen herausfinden, wo man sich intensiv mit der Zukunft auseinandersetzt – in der Science-Fiction. Immerhin sind viele der technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die für uns heute selbstverständlich sind, lange zuvor bereits Teil futuristischer Geschichten gewesen.
Jules Verne hat schon im 19. Jahrhundert erstaunlich akkurat die Umstände beschrieben, unter denen eine Reise zum Mond wie die von Neil Armstrong und Kollegen gelingen kann. Auch Drohnen, U-Boote, Videotelefonie und Elektroantriebe tauchen bereits in seinen Geschichten auf. Während die Gebrüder Wright Anfang des 20. Jahrhunderts noch fest davon überzeugt waren, dass niemals ein Flugzeug den Atlantik würde überqueren können, wissen wir heute, dass H. G. Wells mit seinem in etwa zur gleichen Zeit erschienenen Roman «Der Luftkrieg» den wenige Jahre später im Ersten Weltkrieg zum ersten Mal stattfindenden Flugzeugschlachten sehr viel näher gekommen ist.
Was können wir also aus der Science-Fiction über das Geld von morgen lernen? Dass dort auch etwas über dieses sehr spezifische Thema zu finden sein müsse, ist zumindest keine abwegige Annahme. Immerhin ist auch die Kreditkarte keine originäre Idee der Finanzindustrie, sondern wurde bereits 1888 in Edward Bellamys Roman «Ein Rückblick aus dem Jahr 2000 auf 1887» vorhergesagt.
Doch handelte es sich dabei um eine Ausnahme. Denn auch in der Science-Fiction spielt Geld bislang keine sonderlich große Rolle. Wenn in der zukunftsorientierten Literatur überhaupt irgendeine Art von Geld erwähnt wird, bleibt meist unklar, welche Form und Eigenschaften es hat, wie es funktioniert und welche Folgen sich daraus für die Akteure und die Gesellschaft ergeben. Science-Fiction-Geld ist oft nur eine kaum weiterentwickelte Kopie des Konzepts Geld, wie wir es bisher kennen. Statt mit Euro bezahlt man nun allerdings mit Credits oder anderen Einheiten, die einen futuristisch klingenden Namen tragen. Alternativ gibt es auch das Szenario, in dem Rohstoffe und Naturaliengeld eine zentrale Rolle als Zahlungsmittel und Wertspeicher einnehmen. Konzeptionell eigentlich ein Rückschritt ist das aus Autorensicht eine praktische Lösung. Diese historische Form von Geld ist plakativ und ökonomische Abhängigkeiten lassen sich damit darstellen, ohne dass viel erklärt werden müsste. Besonders originell oder wegweisend ist es aber nicht. Insbesondere weil man meist nicht erfährt, wie es zu diesem Rückschritt gekommen ist. Wenn Computer immer leistungsfähiger werden und der Menschheit geholfen haben, den Weltraum und andere Planeten zu erobern, warum ist die Evolution des Geldes dann dabei komplett auf der Strecke geblieben? Was genau passiert ist, ist auch die Frage, die meist nicht beantwortet wird, wenn es in den Geschichten der Zukunft gar kein Geld mehr gibt, wenn es einfach abgeschafft oder auf irgendeine Weise überwunden wurde. Dabei wäre es doch spannend, zu erfahren, wie und warum es so gekommen ist und ob wir diese Entwicklung aus heutiger Sicht für erstrebenswert halten.
Doch kann man den Science-Fiction-Autorinnen und -Autoren dabei keinen Vorwurf machen. Geld war lange Zeit ein furchtbar langweiliges, weil statisches Thema. Science-Fiction braucht hingegen die Inspiration des Fortschritts. Technische Trends, gesellschaftliche Veränderung, eine Dynamik, die sich aufgreifen, variieren und weiterdenken lässt. Geld hatte dabei bisher kaum Ansatzpunkte zu bieten. Abgesehen von der Kreditkarte und den ersten vorsichtigen Schritten im Bereich des digitalisierten Bezahlens gab es in den vergangenen hundert Jahren einfach keine inspirierenden Innovationen, die man hätte aufgreifen können. Nichts, was revolutionär, bahnbrechend oder spannend genug war, um eine Geschichte damit zu bereichern.
Doch hat sich das mit der Entstehung von Bitcoin vor gut zehn Jahren verändert. Über Geld und dessen Zukunft nachzudenken ist auf einmal sexy geworden. Weil uns Bitcoin die Grenzen unserer bisherigen Vorstellung von Geld aufzeigt und sie sprengt – was es ist, wie es funktioniert und was man damit alles machen kann. Weil dieses rein digitale Geld funktioniert, obwohl die Experten das angesichts dessen, was wir bisher über Geld zu wissen glaubten, für unmöglich hielten. Weil diese Kryptowährung eine Alternative zum Status quo aufzeigt und eine Möglichkeit bietet, die Zukunft des Geldes selbst aktiv mitzugestalten.
Doch auch wenn Bitcoin der Auslöser für ein neues Nachdenken über die Zukunft des Geldes ist, bleibt trotzdem noch immer die Frage, ob Bitcoin selbst das Geld der Zukunft ist. Oder welche Alternativen es sonst noch geben könnte oder vielleicht geben sollte?
«Eigentlich müsste man mal einen Schreib- und Ideenwettbewerb machen, in dem es nur um Geschichten geht, die uns vom Geld der Zukunft erzählen», war daher das zweite Fazit meines Vortrags. Damals nur so in den Raum geworfen, war damit die Idee zu Magic Future Money geboren, einem Wettbewerb, der erfreulicherweise nicht nur in der Bitcoin-Community auf großes Interesse stieß, sondern auch in Teilen der bestehenden Finanzindustrie, in der Science-Fiction-Szene und bei vielen ganz normalen Leuten, die sich von der Vorgabe inspiriert fühlten, über etwas nachzudenken, worüber sich bisher noch kaum jemand Gedanken gemacht hat.
Dieses Buch ist nun das Ergebnis. Es enthält die 30 besten Geschichten, die eine fachkundige Jury bestehend aus Zukunftsforschern, Journalistinnen, Science-Fiction-Autoren, Mathematikerinnen, Buchhändlern und Psychologinnen aus insgesamt 290 Wettbewerbsbeiträgen ausgewählt hat. Alle Geschichten verbindet die Frage nach dem Geld der Zukunft. Doch nähern sich die Autorinnen und Autoren dem Thema mit unterschiedlichen Perspektiven. Mal erzählen sie von einer näheren, mal von einer ferneren Zukunft. Einige Geschichten sind leicht und voller Hoffnung, andere düster und dystopisch. Manche sind fantastisch und von der Realität losgelöst, andere sind abgeleitet aus den unmittelbaren Herausforderungen der Gegenwart. Dass der Wettbewerb beispielsweise mitten in einer globalen Pandemie und vor dem Hintergrund einer sich verschärfenden Klimakrise stattfand, ist unverkennbar. Doch haben die Autorinnen und Autoren auch andere Themen unserer Zeit aufgegriffen – Gleichberechtigung, Kontrolle, Menschlichkeit, Individualismus, Freiheit, Liebe, Gemeinschaft, Sicherheit und damit verbunden immer auch die Frage, was uns all das letztlich wert ist.
Lassen Sie sich also unterhalten, inspirieren und vielleicht bringen die Geschichten Sie ja dazu, selbst noch mehr über Geld und die Zukunft nachzudenken. Es lohnt sich!
Leipzig im Oktober 2021,
Friedemann Brenneis
PS: Viele der Geschichten, die es nicht in das Buch geschafft haben, aber ebenfalls faszinierende Entwürfe vom Geld der Zukunft beinhalten, werden Stück für Stück noch auf www.magicfuturemoney.de veröffentlicht. Dort finden Sie auch den Blog und den Podcast, falls Sie noch tiefer in das Thema eintauchen wollen.
Die Frau in Zimmer 9
Text_Carsten Schmitt
Die Frau in Zimmer 9 stirbt und es ist Schröders Job, das Unvermeidliche so lange hinauszuzögern, wie es geht. Keine Heilung, sondern Verlängerung des Lebens um jeden Preis, lautet die unmissverständliche Anweisung. Etwas regt sich dabei in Schröder, und er fragt sich, ob es ein Rest von Berufsethos ist, oder, noch schwerer vorstellbar, sein Gewissen.
Dr. Philip Schröder, Onkologe, kann sich beides schon lange nicht mehr leisten. Topkarriere, Studium und Promotion in Rekordzeit, Teilhaber einer Privatklinik. Standesgemäße Hochzeit, Flitterwochen auf den Malediven, zwei Kinder, Haus am See, eine Geliebte als Konferenzbegleitung und eine andere für zwischendurch. Alles prima, tolle Aussichten, immer weiter, immer höher – voll an die Wand.
Schröder litt damals an der Krankheit so vieler brillanter Köpfe: maßlose Selbstüberschätzung. Wer fast immer recht hat, ist blind dafür, wenn er im Unrecht ist. Die Übernahme der Klinik sollte ein Deal unter Freunden werden, mit goldenem Handschlag für den Senior. Es wurde ein Millionengrab für Schröder. Er hatte gewusst, dass der Senior ein Arschloch war, aber zu wissen, dass ihn der andere trotzdem übers Ohr gehauen hatte, das schmerzte. Fast mehr noch als das, was danach kam. Pleite, Klinik weg, Haus weg, Frau weg. Dass er selbst die Löcher im Ehevertrag übersehen hatte, kostete ihn neben seinem Notgroschen auch die beiden Geliebten. Kein Geld und derart verarscht? Unsexy.
Um die Kinder tut es ihm leid und was sie von ihm denken werden. Ein Versager, der Papa, nicht so wie Mamas Neuer.
In der Talsohle dann kam die Rettung, ein einmaliges Angebot. Gesundheit steht immer hoch im Kurs, und Spezialisten wie Schröder werden gesucht. Drüben, im Gürtel, der Kerneuropa vom großen bösen Imperium im Osten trennt. Wo man die Einflusssphäre des einen schon fast betreten hat, ohne die des anderen ganz verlassen zu haben. Gutes Personal ist dort billig zu haben, ebenso wie schnelle Genehmigung – wenn das Geld stimmt. Schröders neues Geld stinkt nach Oligarchen, nach Mafia, aber es stimmt.
Schröder denkt sich nichts dabei. Er braucht das Geld, und da ist einer, der seines in einer Privatklinik anlegen will, vielleicht auch ein bisschen waschen. Ist das so schlimm?
Schröder arbeitet Tag und Nacht, denn er hat viel aufzuholen, wenn er eines Tages wieder ohne Scham seinen Kindern in die Augen blicken will. Hilfe gibt es aus dem Arzneischrank. Das neue Zeug ist kein Vergleich zum Schwarzmarkt-Methylphenidat seiner Studienzeit. Perfekte Wirkung, weiche Landung – trotzdem illegal. Der Drogentest jedoch verschwindet genauso in der Versenkung wie die ganzen anderen Verstöße gegen Gesetze und Auflagen, die Schmiergeldzahlungen und Unregelmäßigkeiten, die an der Klinik und damit an seinem Namen hängen. Spätestens jetzt ist ihm klar, dass die helfende Hand ihn nur aus der Scheiße gezogen hat, um ihn dann kopfüber darüber zappeln zu lassen.
Philip Schröders Treffsicherheit bei Entscheidungen mag in den letzten Jahren nicht hoch gewesen sein, doch als er um den ersten von vielen «Gefallen» gebeten wird, ist er nicht dumm. Er stellt keine Fragen.
Die Frau auf Zimmer 9 ist so ein Gefallen, und sie wird bald sterben. Selbst mit den Mitteln, die Schröder im Normalfall zur Verfügung stünden, wäre es keinesfalls sicher, dass sie überlebt. Er soll aber nicht ihr Leben retten, sondern es nur verlängern. Auch sonst wirkt sie nicht wie eine von denen, die er für gewöhnlich behandelt, abgeschirmt und diskret, mit Sicherheitsvorkehrungen wie nirgends sonst. Welches normale Krankenhaus erlaubt schon Eskorten aus durchtrainierten und bewaffneten Spetsnaz-Gorillas mit perfekten Manieren und einem völligen Mangel an Empathie, der es ihnen erlaubt, ohne Reue zu töten und ohne es böse zu meinen?
Die Eskorte ist da, aber der Beistand fehlt. Keine der besorgten Angehörigen, Geliebten oder Gesellschafterinnen, die sich um die Mütter, Väter oder Kinder der Mafiabosse sorgen, während Schröder ihren Brust- oder Prostatakrebs behandelt, ihre Leukämie oder Melanome.
Seit ihrer Ankunft war außer dem Personal niemand bei der Frau in Zimmer 9, weder Besuche noch Anrufe. Dabei ist es kein einfacher Brustkrebs, keine Leukämie, woran die Frau leidet. Die Tumore, die sich durch ihren Körper fressen, hat Schröder nie zuvor gesehen.
Mit Zeige- und Ringfinger sucht er den Puls am Handgelenk der Frau. Die Sensoren erfassen ihre Vitalwerte einwandfrei, doch es sind kleine Gesten wie diese, die Schröder das Gefühl geben, noch Arzt zu sein und nicht bloß Verwalter von Pflegekräften und Labormaschinerie. Außerdem ist es wichtig für das Wohlbefinden seiner Patienten, dass sie sehen, wie er sich persönlich kümmert. Wichtig für die, denen er helfen kann und soll. Er bildet sich viel ein auf seinen Umgang mit Patienten, und als ihm das klar wird, lässt er das Handgelenk der Frau los.
Die Frau schlägt die Augen auf. «Doktor?»
«Haben Sie Schmerzen? Ich kann Ihnen etwas dagegen geben.»
«Net – nein, danke.» Sie hat Deutsch gesprochen.
«Ist mein Russisch so schlecht? Ich sollte mehr üben.» Der Witz ist lahm, doch sie lächelt.
«Nicht schlecht, nur – die Aussprache.»
«Wie heißen Sie?»
«Ksenia Michailowa.»
«Frau Michailowa, ich heiße Philip Schröder. Mein Team und ich werden alles in unserer Macht Stehende tun, um Ihnen zu helfen.» Die Lüge geht ihm gewohnt von den Lippen, doch ihr Blick, mit dem sie ihm zeigt, dass sie die Wahrheit kennt, schnürt ihm die Luft ab. Wann ist er bloß so ein Arschloch geworden?
«Wann hat man ihre Erkrankung festgestellt?»
«Eine Woche. Krank seit einer Woche.»
Es muss an der Fremdsprache liegen, denn Schröder kennt keinen Krebs, der innerhalb einer Woche derart explodiert. «Aber Sie hatten doch bestimmt schon länger Beschwerden?»
«Eine Woche. Spritze vor eine Woche.»
Ein Hustenkrampf unterbricht sie und sie verzieht das Gesicht. Die Schmerzen müssen mörderisch sein.
«Wollen Sie nicht doch ein Schmerzmittel?»
Wieder schüttelt sie den Kopf.
«Ich werde nun eine Gewebeprobe entnehmen müssen. Sie werden es kaum spüren, aber ich gebe ihnen trotzdem eine kleine örtliche Betäubung.»
Während Schröder mit der hauchdünnen Biopsienadel eine Probe der riesigen Geschwulst an ihrem Oberschenkel nimmt, redet die Frau weiter.
«Sind aus Deutschland?»
Er nickt.
«Sohn lebt in Berlin. Studiert Medizin wie Sie.»
«Tatsächlich? Erzählen Sie mir von ihm!» Es ist gut, sie abzulenken, denn er muss weitere Proben nehmen, aus den anderen Knoten verrücktspielender Zellen, die sich an mehreren Stellen unter ihrer Haut abzeichnen.
Sie spricht über ihren Sohn, Anton, der einmal Arzt werden will, und sie vergisst darüber die Schmerzen. Er sei ein guter Junge – natürlich – und habe sich zum Studium in Berlin entschieden, weil er – hier zögert sie – es nicht so mit Mädchen habe und man in Berlin – er wisse schon – anders damit umginge. Sie ist erleichtert, als Schröder lächelt und erklärt, dass sein Bruder es auch nicht so mit Mädchen habe und das völlig in Ordnung sei.
«Was tun sie da?»
An die Gorillas hat Schröder sich gewöhnt, an Koen nicht. Die Leibwächter sind harmlos, solange man es vermeidet, in ihrer Umgebung Dinge zu tun, die ihre reflexhaften Verteidigungsreaktionen auslösen, doch der Holländer wirkt, als quäle er Tierbabys zum Spaß, und ist nervös und misstrauisch. Die fast farblosen, grauen Augen, die zwischen seiner blondierten Stoppelfrisur und der Ruine einer schlecht verheilten gebrochenen Nase herausleuchten, fordern stets den Blick des Gegenübers heraus. Ihre Farbe ist so künstlich, wie die zerschmetterte Nase es nicht ist und beides ist kein Zufall. Schröder ist kein Psychiater, doch er pflegt Annahmen über die Persönlichkeit von Menschen, die bewusst den Look eines soziopathischen Killers kultivieren.
«Ich habe etwas Derartiges noch nie gesehen. Um eine Prognose treffen zu können, müsste ich weitere Untersuchungen anstellen. Ein Einblick in ihre Daten würde mir helfen.» Schröder deutet zum DNA-Sequenzer, auf dem die Proben der Tumore der Frau aus Zimmer 9 sequenziert werden.
Seit zwei Tagen wird das japanische Hightech-Gerät von Sasha in Beschlag genommen. Typen wie Koen passen in das Bild, das Schröder von seinen stillen Teilhabern hat. Doch die junge Frau, die ihren Laptop mit der Labormaschine gekoppelt hat, ist ihm ein Rätsel. Sasha ist nach den anderen mit einem Taxi angekommen und hat seit ihrer Ankunft das Labor kaum verlassen. Sie sieht aus wie eine Studentin, trägt ein zwei Nummern zu großes Bandshirt und zerrissene enge Jeans, die im Schaft abgewetzter Militärstiefel stecken. Ihre Fingernägel sind abgekaut und die Nagelhaut hängt in blutigen Fetzen.
Sashas Rechner ist ein Outdoorgerät, wie man es auf einer Ölbohrplattform vermuten würde. Sie hat mehrere Terminalfenster geöffnet, und jedes Mal, wenn der Sequenzer einen Arbeitsschritt beendet hat, beginnen Zeichenketten über die Kommandozeilen zu tanzen. Dann wirft Sasha einen Blick darauf, bevor sie ihre Aufmerksamkeit wieder einem gewöhnlichen Notizblock widmet, auf den sie Zahlenreihen mit einem Kugelschreiber kritzelt. Hin und wieder sieht sie auf die Uhr, als stoppe sie die Zeit, die sie für die Berechnungen braucht.
«Ist das sicher?»
Schröders Alltagsrussisch ist gut genug, die Frage zu verstehen, die Koen fast akzentfrei an die junge Frau richtet. Sasha würdigt ihn keiner Antwort, zuckt nur die Schultern und nickt.
«Bitte.» Koen deutet mit einer spöttischen Handbewegung auf den Sequenzer.
Schröder setzt sich an den angeschlossenen Terminal und beginnt, sich die Daten anzusehen. Als er mehrere Stunden später wieder aufblickt, ist Koen verschwunden, und Sasha schläft mit dem Oberkörper auf einer Tischplatte, den Kopf auf den verschränkten Armen gebettet.
Wenn es stimmt, was er da gesehen hat, dann ist ihm dieser Tumor nicht nur unbekannt – sondern er wurde angefertigt.
Schröder weiß nicht weiter, und so tut er etwas, wovor ihm graut. Er redet mit Koen.
«Das sollten Sie besser nicht tun.»
Koens Hand mit dem Feuerzeug hält inne. Sein Blick ist eine Mischung aus Drohung und Frage. «Soll ich an Ihrer Kompetenz zweifeln, Herr Doktor? Ein Lungenkrebs sollte für Sie doch ein Klacks sein.»
Koen schafft es, selbst die Flamme sarkastisch an der Zigarettenspitze lecken zu lassen. Tatsächlich hat der medizinische Fortschritt zu einer kleinen Renaissance des Tabaks geführt, und so deutet Schröder an die Decke: «Rauchmelder.»
Koen grinst und drückt die Zigarette auf der polierten Oberseite eines Labortischs aus. Der Moment hat gereicht, um die Luft mit dem Geruch nach karzinogenem Rauch zu füllen, und Schröder erfüllt das irrationale Verlangen nach einer Kippe.
«Wie ist die Prognose, Doktor?»
«Es handelt sich bei Frau Michailowas Erkrankung um eine ungewöhnliche Art eines Liposarkoms, das heißt eines Weichteiltumors.» Als er den Namen der Frau ausspricht, suchen Koens Kunstaugen die seinen. Es ist das erste Mal, dass einer von ihnen ihren Namen genannt hat.
«Diese Tumore werden selten bösartig und wenn, dann sind die Heilungschancen normalerweise recht gut. Dieser hier scheint von einem Herd am Oberschenkel auszugehen. Auch das ist an sich nicht ungewöhnlich.»
«Kommen Sie zum Punkt, Doktor Schröder.»
«Ungewöhnlich ist, wie schnell der Krebs wächst und sich ausbreitet. Ich kenne leider ihre Krankheitsgeschichte nicht», Schröder blickt demonstrativ zu Boden, um keinen Zweifel daran aufkommen zu lassen, dass er nicht dumm genug ist, direkt danach zu fragen, «aber der ansonsten gute Allgemeinzustand der Frau lässt annehmen, dass sie noch nicht lange erkrankt ist.»
«Alles irrelevant, Doktor. Was schlagen Sie vor?»
«Ohne mehr zu wissen, würde ich zu einer Chemotherapie raten sowie zu einer Bestrahlung.»
«Kommt nicht in Frage.»
«Dann stirbt die Frau.»
«Wann?»
«Wie ich bereits sagte, ist eine Prognose schwierig, aber wir reden hier vermutlich von wenigen Tagen.»
Koen nickt, als ginge ihn das alles nichts an. «Haben Sie die Proben, um die wir Sie gebeten haben?»
Später trifft Schröder Sasha allein im Labor. Koen ist irgendwo im Park, der sich um die Privatklinik erstreckt.
Manchmal telefoniert er draußen stundenlang und Schröder hofft, dass es diesmal genauso ist.
«Haben Sie Durst?» Er verzichtet darauf, sein warmes, väterliches Arztlächeln aufzusetzen. Sasha ist keine, die auf so etwas anspringt.
Sie schaut vom Bildschirm auf. Ihre Augen sind gerötet, und sie riecht, als könne sie eine Dusche vertragen. Schröder glaubt nicht, dass sie das Labor schon einmal länger als fünf Minuten verlassen hat, um zur Toilette zu gehen. Im Labor herrscht striktes Lebensmittelverbot, aber der Energydrink, den er ihr anbietet, zählt kaum als solches.
«Haben Sie auch was Stärkeres?»
Er stellt die Dose ab und greift in die Hosentasche. Als seine Hand wieder zum Vorschein kommt, hält sie ein Pillendöschen, auf das ein Wehrmachtssoldat aufgedruckt ist, zusammen mit der Aufschrift Neo-Pervitin in Frakturschrift.
«Haben Sie die von Ihrem Opa?»
Schröder lacht. «Wohl kaum. Das Zeug hat mit seinem Namensvetter nur noch wenig gemeinsam. Gut möglich, dass es sogar noch irgendwo auf der Welt legal ist.»
Sie streckt den Arm aus und er schüttelt eine kleine weiße Tablette in ihre Handfläche.
«Ich werde mir auch eine genehmigen. War ein langer Tag.»
Sasha wirft die Pille ein und verzieht das Gesicht. «Minze? Really?»
Sie zieht die Dose mit dem Energydrink auf und nimmt einen Schluck.
«Ich müsste noch irgendwo welche mit Zitronengeschmack haben, falls Sie möchten?»
«Danke, geht schon.» Sie trinkt einen weiteren Schluck, um den Rest des Geschmacks hinunterzuspülen. «Was wollen Sie?»
«Ich habe mich gefragt, ob ich Ihnen helfen kann. Ist gerade wenig zu tun.»
«Haben Sie nicht eine Klinik zu leiten?»
«Haben Sie außer der Frau auf Zimmer 9 noch irgendwelche Patienten gesehen?» Es stimmt, die Klinik ist verwaist – bis auf das notwendigste Personal. Diesmal geht es seinen Kunden nicht nur um Diskretion, sondern um Geheimhaltung.
«Sie sind neugierig, stimmt’s?»
«Verständlich, oder? Sind Sie Mathematikerin?» Er deutet auf den Block neben ihrem Rechner, auf den sie weitere Zahlenreihen gekritzelt hat.
«Bioinformatik. Mathe ist mein Hobby, könnte man sagen, wobei das hier kaum als höhere Mathematik zählt.»
«Was ist es dann?»
«Kennen Sie sich mit Kryptowährungen aus?»
«Nur insoweit, als dass ich darin bezahlt werde.»
«Aber Sie wissen nicht, wie das eigentlich funktioniert.» Es ist eine Feststellung. Sie hält ihn für ein bisschen naiv, was solche Dinge betrifft und sie hat recht damit. «Aber Sie haben schon mal von Mining gehört?»
Er nickt. Wer hat das nicht? Der digitale Goldrausch, der immer wieder die Preise für bestimmte Hardwarekomponenten in die Höhe treibt und den Klimaschützern die Tränen in die Augen, wenn ganze Lagerhallen voller Computer auf der Suche nach Nuggets heiß laufen.
«Die Berechnungen dafür sind nicht kompliziert. Ich mache das hier zum Spaß auf einem Blatt Papier.»
«Das funktioniert? Ich dachte, das sei der Witz an der ganzen Sache – dass es so kompliziert ist.»
«Nein, gar nicht. Das Problem liegt darin, dass man wahnsinnig viele Berechnungen braucht, um ein Nugget zu finden. Ich brauche dafür mittlerweile im Schnitt zwölfeinhalb Minuten.»
«Ist das gut?»
Sie sagt: «Ziemlich gut», doch ihr Blick meint: Ziemlich gut, Arschloch.
«Ich würde es wahrscheinlich trotzdem nie erleben, etwas Verwertbares finden. Deshalb nutzt man Computer, die eine simple Rechenaufgabe verdammt schnell, verdammt oft durchführen können. Dann nimmt man verdammt viele Computer, die alle zusammen eine simple Berechnung, noch viel öfter verdammt schnell hintereinander ausführen können.»
«Und dann findet man ein Nugget?»
«Jep. Wenn man Glück hat, sogar viele davon. Hoffentlich genug, um die Stromrechnung zu zahlen.»
«Und warum dann die Biologie, all das hier?» Er zeigt auf den Sequenzer, der die Gewebeproben der Frau aus Zimmer 9 bearbeitet.
«Biologie ist im Grunde Chemie, Chemie ist eigentlich nur Physik und – at the end of the day – ist Physik auch nur Mathematik. Ganz weit unten, ganz tief drin, ist alles Mathematik.»
Sie lacht kurz auf. «Verdammter Scheiß, das Zeug ist nicht übel. Hast du noch was von Opas Stuka-Tabletten?»
Die Dinger sind Made in Russia, denkt er und legt das Döschen auf den Tisch: «Behalten Sie sie. Ich habe noch mehr davon im Giftschrank.»
Sie hebt die Dose mit dem Energydrink zum Salut und wendet sich wieder ihren Berechnungen zu.
Die Wohnung im ehemaligen Verwalterhaus des Schlösschens, das als Klinik dient, ist Teil der Privilegien, die Schröder genießt. Er muss sich um nichts kümmern und ist im Notfall immer schnell zur Stelle. Seine Patienten erwarten das. Außerdem hat er von hier direkten Zugriff auf den Server im Labor. Spätestens wenn die Untersuchungen gelaufen sind, geht es nur noch um Daten, und ob er sie dort auswertet oder hier, unterscheidet sich nur darin, dass im Wohnzimmer mehr Alkohol zu finden ist.
Er ruft die Ergebnisse der DNA-Analyse der Tumore der Frau aus Zimmer 9 auf. C A A G G G A G G T G T – die Basenpaare tanzen als farbige Linien wie die Ausschläge eines Seismographen über den Bildschirm. Doch in Philip Schröders Geist werden sie überlagert von einem anderen Bild. Ksenia im Krankenbett, ihr grotesk aufgeschwollener Körper, von den Tumoren entstellt und bewegungsunfähig gemacht.
Er nippt an einem Whiskey und das Brennen auf der Zunge holt ihn wieder zurück zu seinen Linien. Die Onkologie hat in den letzten Jahrzehnten immer größere Überschneidungen zur Genetik entwickelt, denn was ist Krebs anderes als Erbgut, das einen Snowball aus LSD und Speed eingeworfen hat? Er hat mittlerweile genug Sequenzen der häufigsten Tumore gesehen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sie aussehen sollten. Doch etwas stimmt nicht mit dieser DNA. Sie ähnelt auf den ersten Blick einem Liposarkom, der bösartigen Variante eines normalerweise gutartigen Fettzellentumors. Heutzutage sind die Heilungschancen dafür groß, das weiß Schröder aus erster Hand. Aber nicht, wenn der Krebs so explodiert wie dieser hier. Etwas stimmt damit nicht. Man hat das Erbgut manipuliert und wenn er sich nicht täuscht, nicht erst nachdem sich der Krebs gebildet hat, sondern vorher.
Krebs ist nicht ansteckend, doch, seitdem man Erbgut verändern kann, übertragbar, erzeugbar. Jemand hat das der Frau in Zimmer 9 absichtlich angetan. Es wundert ihn nicht wirklich. Man hat das bereits vor langer Zeit mit Mäusen gemacht und wie es das ungeschriebene Gesetz wissenschaftlicher Forschung vorschreibt, war klar, dass es eines Tages jemand bei einem Menschen tun würde.
Aber warum? Rache? Eine Erpressung? Soll er die Frau nur so lange am Leben halten, bis jemand ein Geheimnis verraten, einen Gefallen getan hat? Zu kompliziert. Es ergibt keinen Sinn.
Ein weiteres Privileg seiner Stellung ist der Zugang zu den besten kostenpflichtigen medizinischen Datenbanken der Welt. Nicht, dass er zur Behandlung von Väterchens Prostatakrebs medizinische Journale konsultieren muss, aber es schadet nicht, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Er hat eine Vermutung, die er nicht aus dem Kopf bekommt. Er ruft die Datenbank auf und beginnt zu suchen. Die Artikel sind nicht schwer zu finden.
Schröder fragt sich, was man der Frau in Zimmer 9 erzählt hat. Dass der Job sicher sei, und dass sie nach diesem einen Mal genug verdient hätte? Nicht für sich, sondern für die, denen sie einen «Gefallen» schuldete? Hat sie deshalb «Ja» gesagt, als man sie fragte, ob sie Geld über die Grenze schmuggeln wolle? Viel Geld. Sie hat keine Vorstellung davon, wie viel. Eine wie Ksenia rechnet in Monatsmieten, in Semesterstudiengebühren für ihre Kinder, in den Beträgen, die sie zur Seite legt, um in ein paar Jahren woanders neu anzufangen. Die Leute, deren Geld sie in ihrem Körper trägt, denken nicht in solchen Kategorien, sondern in Firmenbeteiligungen, Bürokomplexen und Containerschiffen.
CRISPR hat sich vom Präzisionswerkzeug, vom feingeschliffenen Skalpell, zum Biologiebaukasten entwickelt, zum Äquivalent eines Wachsmalstifts für ungeschickte Kinderhände. Jede Biologiestudentin kurz vorm Bachelor kann jetzt mit DNA herumspielen. Oder es für jemanden tun, der sie bezahlt und das Equipment dazu liefert. Die Anleitungen dazu gibt es im Netz.
Das Speichern von Informationen in DNA war in den 2010er-Jahren der heiße Scheiß – gewaltiger Speicherplatz und automatisches Backup durch Zellteilung, betrieben mit einer Scheibe Brot. Man speicherte Videos in Zellkernen, schleuste sogar in Genmaterial gespeicherten Schadcode in einen DNA-Sequenzer. Warum also nicht Geld darin verstecken? Ein harmloser Fettzellentumor, leicht operabel, deutlich abgegrenzt vom umgebenden Gewebe. Nicht dass am Ende das Muli mit ein paar Millionen im Unterfettgewebe durchbrennt.
Schröder stellt sich das freundliche Gesicht eines Kollegen vor, wie er Ksenia mit ruhiger Stimme den Eingriff erklärt. Oder war es eine Kollegin gewesen – so von Frau zu Frau? Da kann nichts passieren, alles völlig harmlos. Früher hat ein Muli wie Ksenia Kondome mit unverschnittenem Heroin darin schlucken müssen, und wenn die platzten – hässliche Sache. Dagegen ist das hier ein Kinderspiel, da bleibt nicht einmal eine Narbe.
Schröders stille Teilhaber haben so viel Geld, dass sie sich keine Biologiestudentin kurz vor dem Bachelor gekauft haben, sondern Sasha. Wie konnte es schiefgehen?
«Wie haben Sie es appliziert?»
Sasha weiß sofort, wovon er spricht.
«Im Kühlschrank», sagt sie und deutet mit einer Kopfbewegung in Richtung des Laborkühlschranks, der in der Ecke steht.
Schröder öffnet die Edelstahltür und sieht oben in der Ecke eine Styroporbox, die vorher nicht dort stand. Darin befinden sich zwei Ampullen, die leere Vertiefung im Material daneben zeigt, dass es eine dritte gegeben hat.
«Legen Sie das wieder zurück.» Sasha gibt den Befehl in lässigem Tonfall. «Wenn Sie einem Ihrer Patienten das statt einem Vitaminspritzchen verabreichen, haben Sie beide ein großes Problem.»
«Wie Midas.»
«Was?»
«König Midas. Alles, was er berührte, verwandelte sich in Gold, so dass er weder essen noch trinken konnte.»
«Ist er verhungert, oder hat ihm jemand Brot in den Mund geworfen?»
Schröder erinnert sich nicht an das Ende der Geschichte. «Keine Ahnung.»
Sasha wendet sich wieder ihrem Laptop zu, doch Schröder fragt weiter: «Was ist schiefgegangen?»
«Was meinen Sie?»
«Mit dem Lipom, ihrer Geldbörse.»
Sie schaut ihn an, zuerst genervt, dann amüsiert. «Was soll schiefgegangen sein?»
«Nicht gerade ein nachhaltiges Geschäftsmodell, ein Bargeldmuli zu haben, dass es nicht mal über die Grenze schafft, bevor der Krebs es zerfrisst, ganz abgesehen von der Einmaligkeit der Sache.»
«Alles läuft wie geplant. Die Frau ist ein Versuch. Sie nennen sie ein Muli, als ginge es hier um ein bisschen Heroin wie früher. Sagen wir, wir haben ihren Aufgabenbereich erweitert. Goldesel trifft es besser.»
Was hat sie getan? Sasha sieht ihm seine Ratlosigkeit an.
«DNA ist nichts weiter als ein Bauplan in Form eines Codes. Ein Programm innerhalb eines Computers, der sich selbst und damit seinen Code dupliziert. Manchmal wird er dabei ein wenig abgewandelt – aus Zufall oder wenn ich dem Computer die Anweisung gebe, jedes Mal ein etwas anderes Programm zu kopieren. Wissen Sie, wie viele Zellen ein Körper hat? Das sind ganz schön viele Computer.»
Schröder versteht. Ganz weit unten, ganz tief drin ist alles Mathematik.
Auf dem Weg nach draußen muss er sich an Koen vorbeidrängen, der in der offenen Tür des Labors steht und ihm nur den kleinstmöglichen Raum zur Flucht lässt. Er hetzt die Treppe hinauf und durch den Korridor, verlässt die Villenklinik durch den Hinterausgang zur Terrasse. Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit hat er den Wunsch, wieder eine Zigarette zu rauchen. Er hat keine, und der Einzige, den er um eine bitten könnte, ist Koen. Er zuckt zusammen, als hinter ihm ein Feuerzeug klickt und er den Geruch verbrannten Tabaks riecht.
«Hatte er einen goldenen Schwanz?»
«Was?»
«König Midas. Er muss sich doch selbst angefasst haben. Kann mir vorstellen, dass es eine Menge Leute gegeben hätte, die scharf drauf gewesen wären, sich eine Scheibe von ihm anzuschneiden.»
Schröder dreht sich um. Koen steht zwei Schritte hinter ihm und bläst Rauch aus den Nasenlöchern. Zwischen den Schwaden stechen seine fast farblosen Augen hervor und fordern Schröder heraus. Erzähl mir was von deinem heiligen Eid, scheinen Sie zu sagen, und deiner ärztlichen Ethik.
Er würde dem Holländer jetzt gerne sagen, dass er ihn anekelt. Was für widerliche Scheißkerle er und seine Arbeitgeber sind. Aber Koens Arbeitgeber sind auch seine und statt einer vernichtenden Erwiderung steigt ihm nur ein saurer Geschmack den Rachen empor.
Ksenia, die Frau in Zimmer 9, hat die Augen geschlossen. Schröder weiß nicht, ob sie schläft oder weil es in diesem Zimmer, bei diesen fremden Menschen nichts gibt, das es sich in ihren letzten Stunden zu sehen lohnt. Er kann es abkürzen, ihr die Quälerei ersparen. Er hat seinen Eid schon so oft gebrochen, was ist da dieser letzte Schritt? Doch vorher muss er etwas erledigen. Schröder berührt Ksenias Hand und ihre Lider flattern. Als er ihren Namen spricht, öffnet sie die Augen, und der Gorilla, der seit neuestem in ihrem Zimmer sitzt und nicht mehr nur davor, sieht auf.
«Ich muss die Frau untersuchen. Können wir hier bitte ein paar Minuten Privatsphäre haben?», herrscht Schröder ihn an. Der Typ blinzelt nur einmal und bleibt sitzen.
«Herrgott Mann, haben Sie Angst, dass sie durchs Fenster abhaut? Und wenn Sie schon hier sind, wollen Sie mir gleich helfen, ihre Windel zu wechseln?»
Der Mann steht auf und verlässt das Zimmer. Er wirft Schröder einen letzten Blick zu, der zu sagen scheint, dass er keine Dummheiten machen soll. Doch dafür ist es zu spät.
«Ksenia, ihr Sohn. Der, der Medizin studiert. Können Sie mir sagen, wie ich ihn erreichen kann?»
Er beugt sich zu ihr, so dass sie es ihm ins Ohr flüstern kann.
Sasha zuckt, als er ihr auf die Schulter tippt. Sie trägt Kopfhörer und wippt leicht mit den Beats der Musik auf ihrem Stuhl, während ihre Finger über die Tastatur huschen und Kommandos tippen. Die Ringe unter ihren Augen sind fast violett und ihre Bewegungen fahrig.
Er hat einen Energydrink mitgebracht und einen Kaffee für sich. Sie nimmt die Dose und nickt dankend. Schröder zieht ein Röhrchen mit Pillen aus der Tasche und wirft sich eine ein.
«Auch eine?», fragt er.
Wieder nickt sie nur, hält die Hand auf und wendet sich ihrem Terminalfenster zu.
«Nehmen Sie zwei», sagt er und legt ihr die Tabletten in die Hand.
Sie spült sie mit der Zuckerplörre hinunter. «Gott sei Dank keine Minze.»
Nein, keine Minze, denkt Schröder und geht in den hinteren Teil des Labors. Er setzt sich, nippt an seinem Kaffee und schaut auf die Uhr. Genau zehn Minuten später kippt Sasha von ihrem Stuhl.
Noch eine halbe Stunde und er ist an der Grenze. Er widersteht der Versuchung, das Gaspedal durchzudrücken. Er weiß nicht, wie viel Zeit ihm bleibt. Die Freisprechanlage kündigt einen Anruf an.
«Wo sind Sie?» Koens Stimme klingt ruhig, doch in ihrem Unterton liegt die Androhung von Gewalt. «Ich weiß nicht, was sie vorhaben, aber Sie haben Ihre Arbeitgeber gerade sehr viel Geld gekostet. Wenn ich Ihnen sage, dass Sie damit nicht durchkommen werden, dann rede ich nicht von einer Abmahnung. Wenn Sie jetzt zurückkommen …»
Schröder fällt ihm ins Wort: «Ist Sasha noch da?»
«Was?»
«Ist sie noch da? Hat sie es Ihnen erzählt?»
«Was erzählt?»
Natürlich nicht. Schröder hätte es an ihrer Stelle auch nicht getan.
«Die Einstichstelle an ihrem Oberarm. Wenn Sie einen Blick in den Laborkühlschrank werfen, werden sie feststellen, dass etwas fehlt. Ich denke, damit sollten alle meine Schulden bezahlt sein.» Er zögert. «Es sei denn, sie verspüren Sasha gegenüber eine sentimentale Verpflichtung. Dann kann ich Ihnen einen sehr guten Kollegen empfehlen. Zu lange warten sollten Sie damit aber nicht.»
Schweigen, dann: «Sie werden das trotzdem nicht überleben, das wissen Sie, Doktor.»
«Natürlich weiß ich das.»
Der Einstich an seinem eigenen Oberarm juckt ein bisschen.
Er öffnet das Fenster und wirft das Telefon hinaus. In vier Stunden wird er in Berlin sein. Er hat Freunde dort – ehemalige Studienkollegen –, die Zugang zu einem Labor haben. In ein, zwei Tagen wird er das Geld haben, um ihnen sämtliche Gewissensbisse abzukaufen. Für Anton wird mehr als genug übrigbleiben. Er muss nur schnell sein, den richtigen Zeitpunkt abpassen, solange er noch handeln kann. Ein Zahlenspiel. Denn ganz unten, ganz tief drin, ist alles nur Mathematik.
SOL
Text_Dennis Deter
Schwach glühendes Licht scheint durch mein Fenster und auf die Keramiktöpfe, Blätter und Blüten um mich herum. Zumindest hier drin ist es grün und voller Leben. Irgendwann habe ich begonnen, mir vor jedem Job eine Pflanze zu kaufen.
Ein kleiner Kaktus war meine erste Errungenschaft. Die erste Pflanze, der erste erledigte Job. Mittlerweile ist es ein Ritual geworden. Pflanzen sind lebendig und genügsam und stumm. Sie sind Marker meiner Geschichte, aber sie erzählen mir nichts, was ich nicht wissen möchte.
Meine Augen scannen mein Zimmer. Es ist nicht nur das Gießen, Umtopfen und Beschneiden. Ich habe diesen Pflanzen gegenüber eine größere Verantwortung. Jede Veränderung muss akribisch von mir beobachtet werden. Wahrgenommen. Da, die Maranta auf dem Glastisch bekommt ein neues Blatt und hat sich weiter zur Sonne gedreht. Der Ohrenkaktus ist etwas gewachsen und der Rizinus treibt immer noch aus wie wild. Meine Aufmerksamkeit richtet sich auf eine Ecke meines Zimmers.
Dort steht, unübersehbar und irgendwie falsch, eine Pflanze, die ich nicht kenne.
Ich habe sehr viele Pflanzen. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber in der Regel kann man sagen, je wichtiger und risikoreicher ein Job ist, desto größer die Pflanze, die ich mir vorher zulege.
Die unbekannte Pflanze, die mich von der Ecke meines Zimmers aus anstarrt, ist eine Palme.
Eine bis zur verdammten Decke ragende, ausgewachsene Palme. Und ich habe keine Ahnung, was ich dafür getan und was ich dafür bekommen habe.
Ich bin irritiert, aber ich bin keine Anfängerin. Ich setze mich und beginne zu meditieren. Surfe durch meine Gedanken, Gefühle, Erinnerungen. Tatsächlich, dort, noch ganz frisch, klafft eine Lücke. Ich kann das Brennen an den Rändern spüren. Die Stellen, an denen meine Erinnerung lokalisiert, abgetrennt und extrahiert wurde. Eine saubere Arbeit, es ist nichts geblieben. In wenigen Tagen wird auch das Brennen verschwunden sein und damit die letzte Spur an etwas, was einmal ein kleiner Moment in meinem Leben war. Es gab also diesen Job und ich habe ihn verdammt nochmal getan. Gut. Aber da ist noch eine zweite Leerstelle, wo es keine geben sollte. Eine Lücke, wo eigentlich die Erinnerung an den Abschluss wäre.
Was fehlt, ist die Übergabe. Die Bezahlung.
Dadurch ist es, als hätte es in meinem Leben diesen Job bis auf die Palme gar nicht gegeben, und ich könnte es dabei belassen. Aber es fühlt sich nicht richtig an. Mir ist egal, was ich getan habe. Aber ich will zumindest wissen, was ich bekommen habe. Ich arbeite nicht umsonst.
Ohne Umschweife gehe ich an die beiden Behälter, in denen ich meine zwei SOLs aufbewahre. Einen Job in der Palmen-Größenordnung hätte ich für nicht weniger als ein SOL gemacht.
SOLs sind die wertvollste, aber auch die gefährlichste Währung, die im Moment im Umlauf ist. SOLs – auch Seelen genannt – sind kompliziert und grundlegend unverständlich. Man muss sehr, sehr vorsichtig im Umgang mit ihnen sein. Sie wirken vertraut, wie kleine, leuchtende Sonnen. Aber es gibt nicht wenige Gerüchte darüber, wie verheerend sich SOLs auf ihre Besitzer auswirken können.
Ich öffne die Behälter, aber ich habe nur die beiden SOLs, die ich vorher schon besaß. Auch in meinen konventionellen, virtuellen und realen Konten hat sich, nach einer kurzen Übersicht, nichts verändert.
Das gefällt mir gar nicht. Es schmerzt immer, eine Erinnerung und damit einen Teil meines Lebens zu verlieren. Obwohl es wahrscheinlich besser so ist. Aber normalerweise ist die Entschädigung für diesen Schmerz ausgesprochen gut – und vor allem: vorhanden.
Ich reibe mir mit den Knöcheln die Schläfe. Die Stellen in meinem Bewusstsein, an denen die Erinnerung an was immer ich getan habe herausgetrennt wurde, fühlen sich an wie pulsierende, dunkle Gruben. Heiß und unendlich tief.
Für diesen Schmerz gibt es keine Tabletten.
Als Mem-Traderin tut man viele Dinge, die man wahrscheinlich nicht machen würde, wenn man die Erinnerungen daran behielte. Ich habe nur bruchstückhafte Indizien darüber, was ich alles getan habe. Aus verbliebenen Erinnerungen an die Vorbereitungen der Jobs und die abschließenden Transaktionen. Was ich weiß ist: Die schlecht bezahlten Jobs sind schmutzig. Die wirklich lukrativen Mems sind schmutziger. Manchmal auch einfach absurd für alle – außer die Käufer.
Ich fasse die Palme an, als müsste ich prüfen, ob sie echt ist.
Sie ist.
Echt und fest und groß. So viel größer als all die anderen Pflanzen hier.
An meinem Arm entdecke ich einen blauen Fleck, der vom letzten Job stammen könnte oder auch nicht. Ansonsten scheint alles o.k. zu sein. Mein Körper hat schon deutlich Schlimmeres überstanden, um am Ende Mems abliefern zu können. Ich habe die letzten Jahre nicht nur überlebt. Ich habe mich hochgearbeitet und gehöre mittlerweile zu den besten Mem-Traderinnen.
Dafür bin ich eine Frau ohne viel Vergangenheit.
Ein beträchtlicher Teil meiner gelebten Jahre existiert für mich nicht mehr. Ich habe ihn weitergegeben, an verschiedenste Käufer. Das ist o.k. Ich lebe im Hier und Jetzt. Was hinter mir liegt und ohne eigene Erinnerung ist, habe ich, was mich betrifft und wenn die Wunden verheilt sind, nie wirklich getan. Es ist kein Teil von mir. Nicht mehr.
Jetzt würde ich – zum allerersten Mal – gerne einen kleinen Teil von mir zurückerhalten.
Nur um zu wissen, was genau der Deal war.
Ich habe noch nie davon gehört, dass die Erinnerung an die Übergabe einer Erinnerung Teil einer Handelsvereinbarung gewesen ist. Wer hätte Interesse an so etwas? Und warum sollte ich mich darauf einlassen?
Ich weiß nicht einmal, wo ich beginnen soll zu suchen. Leider ist vollständiges Vergessen ein so essenzieller Teil meiner Arbeit, dass ich mir nie Notizen über meine Jobs mache. Diese Art von Hinweisen fällt also komplett aus. Und doch kenne ich mich gut genug, um zu wissen, dass ich mir manchmal in mein gut funktionierendes System eine Hintertür einbaue. Wenn mir etwas komisch vorkommt. Oder nach Ärger riecht.
Und alles, was mit dem Palmen-Job zu tun hat, stinkt bisher so gewaltig, dass ich bestimmt mehr als eine Hintertür offengehalten habe.
Eventuell habe ich eine 360er gemacht. Das ist nicht ungefährlich, aber ich habe die nötige Hardware, um heimlich und unbemerkt aufzuzeichnen. Einen Versuch ist es wert. Ich sehe meine Aufnahmen durch und finde tatsächlich eine 360er, die noch ungespielt ist. Mein Herz klopft. Sollte es das sein? Die Aufnahme einer Situation, der Situation, deren Erinnerung ich weggegeben habe? Das würde mir reichen. Es muss ja kein Mem sein, ich will nichts erleben und nichts erinnern. Ich möchte nur wissen, wo meine Bezahlung ist und mittlerweile auch, warum die Erinnerung an den Handel selbst nicht mehr da ist. Ich bin lange genug in dem Job, aber diese fehlende zweite Erinnerung bringt meine ganze Statik durcheinander.
Ich setze mich auf einen Stuhl, der unter den Blättern der Palme steht. Nur ein kurzer Moment des Zögerns, dann starte ich die Aufnahme.
Sofort baut sich um mich herum eine fremde Umgebung auf. Wie immer verliert sich die Auflösung in den Details, aber in der Regel kann ich alles erkennen, was ich sehen will. Was wichtig ist. Ich pausiere die Aufnahme, direkt nachdem ich sie gestartet habe. Ich möchte mir erst ein Bild der Situation machen. Von dem Ort und möglichen anderen Personen.
Ich blicke mich in der 360er um. Leider gibt es nur Bild und Ton. Gedanken und Gefühle sind bisher exklusiv den Mems vorbehalten. Aber das ist nunmal alles, was ich jetzt zur Verfügung habe. Vielleicht ist Objektivität, eine gewisse Distanz zum Geschehen genau das, was ich brauche. Ich kann mich sehen. Adrett gekleidet, aber nicht zu feminin. Offensichtlich nervös. Eine seltsame, feine Kleidungswahl, die vielleicht der Größe des Jobs geschuldet ist. Meine Hände liegen lässig in meinem Schoss, aber ich kann an dem Weiß meiner Knöchel sehen, dass ich meine Finger fest zusammenpresse. Kurz zuvor muss ich die Aufnahme gestartet haben. Heimlich.
Der Raum, in dem ich mich befinde, ist mit indirektem Licht ausgeleuchtet. So indirekt, dass es die holzvertäfelten Wände leicht erglühen lässt. Der Dateiname und die Geodaten sind noch in der rechten oberen Ecke eingeblendet. Ich könnte eine genaue Lokalisierung vornehmen, aber ich beschließe, mich erst weiter im Standbild umzusehen.
Eine Seite des Raums ist etwas anachronistisch mit Büchern ausgestattet. Vielleicht sind es aber auch nur die früher so beliebten Regalattrappen voller Buchrücken. Leider kann ich nicht zoomen, um es herauszufinden.
An der gegenüberliegenden Seite stehen einige Vitrinen aus Glas, erleuchtet. Ich kann nicht alle Inhalte genau erkennen. Eine Vitrine enthält eine hölzerne Maske, eine andere ein leicht zerfranstes Papier oder ein Schriftstück mit Zeichen, die mir auf die Entfernung nichts sagen. Im Glas daneben etwas Schwarzes, Verschrumpeltes wie ein mumifiziertes Organ oder uralte, vertrocknete Exkremente. Die letzte Vitrine, deren Inhalt ich gerade noch sehen kann, enthält eine kleine Statue oder einen Götzen. Kupfergrün thront sie auf einem Sockel. Zu unförmig, um einen Menschen darzustellen.
Dahinter verlieren sich die ausgestellten Stücke komplett ins Konturlose.
Es sieht aus wie in einem Museum. Ich hatte schon immer ein zwiespältiges Verhältnis zu Museen, denn sie zeugen vor allem von der Macht der Überlebenden. Es sind die Sieger, die bestimmen, was bleibt und wie es erinnert wird. Wo immer ich hier bin, es ist das Haus einer reichen Person, einer Siegerin, die stolz ist auf ihre Privatsammlung. Ansonsten ist der Raum – bis auf einen massiven Tisch, vier Stühle und ebenjene Vitrinen – unmöbliert.
Keine Pflanzen.
Hinter dem Tisch, mir gegenüber, sitzen drei Personen. Ich weiß sofort, warum ich die Aufnahme heimlich gestartet habe.
Denn diese drei dort sind keine Zwischenhändler, wie ich es gewohnt bin. Sie sind the real deal. Ich sitze Auge in Auge mit den Auftraggebern und Empfängern der Mems. Empfängerinnen. Es ist schwer zu sagen. Die drei wirken so androgyn, dass es unmöglich ist, ihr Geschlecht zu bestimmen. Oder auch ihr Alter zu schätzen. Sie sehen sich so ähnlich, dass sie kaum auseinanderzuhalten sind. Wie Drillinge. Und doch würde es mich nicht wundern, wenn ich erführe, dass hier drei unterschiedliche Generationen vor mir sitzen. Die Person in der Mitte blickt mich durchdringend an, der zierliche Mund mitten in einem Satz erstarrt. Selbst in diesem Standbild umweht alle drei eine jeweils eigene autoritäre, herrschaftliche Aura.
Warum wollt ihr, dass ich mich nicht an euch erinnere? An diesen Raum, diese Unterhaltung? Was habt ihr zu verbergen? Ich blicke die Drillinge an und sehe mich, wie ich dort sitze und sie anblicke. Genau in diesem Moment, dem Beginn der Aufzeichnung wirkt es so, als ob die Person zur Linken nicht nur in diesem Moment ist, sondern mir direkt ins Auge sieht. Nicht mir, die ich dasitze. Sondern mir, die ich mir diese Aufnahme ansehe.
Ich lasse die 360er laufen.
«… wenn alles in der richtigen Reihenfolge durchgeführt wurde. Die Reihenfolge ist ausschlaggebend.»
«Das richtige Timing!», ergänzt die Person zur Rechten.
«Natürlich», höre ich mich antworten. «Ich habe mich strikt an die Anweisungen gehalten.» Meine Stimme klingt wundervoll fest und fast ein wenig arrogant. Nur meine Finger verraten mich, aber das können die drei nicht sehen.
«Davon gehen wir aus», sagt die Person zur Linken mit einem Lächeln, das ich nicht deuten kann.
«Um ehrlich zu sein», fährt die Person rechts fort, «warst du nicht die Erste, der wir diesen Job angeboten haben.»
«Aber du warst die erste Person, die bereit zu dieser – Arbeit war.»
«Das hat uns sehr imponiert.»
Ich kann sehen, wie ich die Schultern hochziehe und minimal verkrampfe. Ich frage mich, was es für eine Erinnerung ist, auf die die drei sich beziehen und auf die ich dort noch zugreifen kann. Auf eine Weise ist dieses vergangene Ich kompletter als ich. Aber wahrscheinlich auch kaputter. Mein Gesicht kommt mir merkwürdig fremd vor. Da ist etwas in den Augen. Sie sehen aus, als wäre hinter ihnen zersplittertes Glas. Wahrscheinlich konnte ich es kaum erwarten, das Mem loszuwerden. Mich wieder zu kitten und mich wieder zu der zu machen, die ich jetzt bin.
Die Stimmen der drei sind erstaunlich sanft und wechseln sich auf anmutige Weise miteinander ab. Wie Wellen in ihrem unendlichen Hin und Her, organisch ineinander verzahnt. Sie haben begonnen, ihre Worte mit kleinen Gesten zu untermalen.
«Wir möchten uns bei dir bedanken.»
«Du hast uns sehr geholfen.»
«Wir möchten auch in Zukunft deine Hilfe in Anspruch nehmen.»
«Wenn du uns lässt.»
«Wenn du bereit dazu bist.»
«Du musst bereit dazu sein.»
«Dieser Deal ist noch nicht abgeschlossen», höre ich meine Stimme scharf dazwischen schneiden. Die Gesten hören auf. Die Person in der Mitte macht ein erschrockenes wie unschuldiges Gesicht:
«Natürlich nicht!»
«Es ist alles Teil des Geschäfts.»
«Geschäft ist Geschäft.»
Alle drei drücken ihren Rücken durch, bevor die mittlere Person sich über den Tisch zu mir beugt.
«Du hast Erstaunliches getan.»
«Das möchten wir dir sagen.»
«Es ist erstaunlich, was Leute tun.»
«Es lässt sich vielleicht alles kaufen.»
«Aber nicht von jedem.»
«Wo soll das nur enden?»
Alle drei blicken mich an.
Von hier kann ich nicht erkennen, ob die Frage tatsächlich an mich gerichtet war. Ob sie auf eine Antwort von mir warten. Ich sehe mich ein Bein über das andere schlagen. Eine meiner abwehrenden Gesten.
«Ich weiß es nicht.», sage ich. Nach einem Moment füge ich hinzu: «Ich bin mir nicht sicher, dass ich die Frage verstehe.»
Ich kann deutlich an meinem Gesicht ablesen, dass ich nicht die geringste Lust auf so einen verquasten Bullshit habe. Für alle anderen zeigt sich an meiner Mimik nichts. Nach außen hin bleibe ich die professionelle, unnahbare Mem-Traderin.
«Natürlich ist es wichtig, dieses Geschäft abzuschließen.»
«Wir wollen uns nichts nachsagen lassen.»
«Wir haben, wie du weißt, einen guten Ruf.»
«Einen exzellenten Ruf.»
«Wir sind zwar Sammler», sagt die Person in der Mitte und zeigt mit einer weichen, ausladenden Geste über den Raum und darüber hinaus. «Aber was wir akkumulieren geht weit über das hinaus, was wir in den Händen halten können.»
«Der wahre Wert einer Sache …»
«… ist meist nur den wenigsten bekannt.»
«Ist nicht verborgen, ist aber auch nicht immer sichtbar.»
«Wir sind keine Sadisten.»
«Das ist wichtig zu wissen.»
«Der Wert deines Mems ist eher – spiritueller Natur.»
«Ein Stäubchen auf der Waage.»
Das Gespräch verwirrt mich. War ihnen schon bewusst, dass sie die Erinnerung an diese Unterhaltung von mir nehmen werden? Warum dann aber so offen reden? Warum überhaupt? Und wie hätten sie reagiert, wenn sie wüssten, dass ich alles aufzeichne?
«Was glaubst du?», fragt die Person zur Rechten wie beiläufig und legt einen halbtransparenten Behälter auf den Tisch, in dem sich schwach das Glühen einiger SOLs abzeichnet, «als Expertin auf diesem Gebiet …»
«Sind Erinnerungen die wahre Essenz einer Tat?»
Ich ziehe leicht eine Augenbraue nach oben. Die Mimik meines vergangenen Ichs in diesem Raum bleibt unbewegt.
«Immerhin sind sie alles, was bleibt von dem, was wir tun.»
«Erinnerungen sind mein Job», antworte ich möglichst diplomatisch und mit einer leicht gepressten Stimme. «Erinnerungen schaffen, Erinnerungen verkaufen ist das, was ich tue.»
Die drei lächeln mich an, als hätte ich etwas sehr Schlaues oder sehr Dummes gesagt. Eine Hand ist immer noch wie zufällig auf dem Behälter mit den SOLs platziert.
«Ja», sagen sie, «Handlungen vergehen.»
«Sie existieren nur einen einzigen Wimpernschlag im Universum.»
«Die Mems, sie bleiben.»
«Die Mems sind der Nektar, von dem wir noch jahrelang zehren können.»
«Das Mark der Zeit.»
«Eine wertvolle, wertvolle Substanz.»
Finger trommeln leicht auf dem Behälter. Dann hört es auf.
Ich kenne diese Stille. Jetzt ist, endlich, der Moment gekommen, in dem wir das Geschäft abschließen werden.
Die drei schauen sich an, vergewissern einander wortlos. Eine stumme Kommunikation findet zwischen ihnen statt. Über mich. Ohne ein Wort zu wechseln legen sie mich auf eine goldene Waage und prüfen, wie schwer ich wirklich ihrer Meinung nach bin. Ob ich mehr wiege als eine Feder.
Die Person in der Mitte nickt kurz.
«Bevor wir beginnen, dein Mem zu externalisieren, möchten wir dir ein Angebot machen.»
«Du kannst wie vereinbart diese fünf Seelen an dich nehmen.»
Sie öffnen den Behälter und tatsächlich: Im Inneren befinden sich fünf SOLs, wesentlich mehr als ich bisher in meinem ganzen Leben verdient habe. Aber wo sind sie jetzt? Warum besitze ich sie nicht mehr? Wo ist der Haken?
«Oder du kannst», sagt die Person in der Mitte und legt einen deutlich größeren Behälter auf den Tisch, «diese 20 Seelen bekommen.»
«Die Entscheidung liegt bei dir.»
«Wir glauben, du bist zu mehr bestimmt, als kleine Brotjobs auszuführen.»
«Du hast dich bewiesen.»
Mein Herz klopft. Noch nie habe ich so viele SOLs auf einen Haufen gesehen. Oder kenne jemanden, der dies von sich behaupten kann. Ich bewundere die Ruhe, mit der ich antworte. Eine Ruhe, die nicht zeigt, dass hinter ihr ein Abgrund lauert. Dass die Fassade brüchig ist und jederzeit leicht einstürzen kann.
«Was wollt ihr, das ich tue?»
Als wäre mir nicht gerade ein Vermögen angeboten worden, größer als alles, was ich mir bisher erarbeitet habe. 20 SOLs! Auf einen Schlag. Solch eine Gelegenheit kommt nie wieder.
«Es ist nicht viel, ehrlich gesagt.»
«Nichts, was nicht schon einmal getan worden wäre.»
«Wir möchten, dass du dieses hier zu dir nimmst.»
Und damit halten sie eine Hand aus und bieten mir ein Mem an. «Dieses Mem für dich, deins für uns, und die 20 gehören dir.»
Ich denke an einen Scherz, aber niemand lacht. Ihre Gesichter sind ernst. Sie warten auf meine Antwort. Ich hoffe, dass ich die fünf SOL nehme, mein Mem loswerde und verschwinde. Aber dann wäre das dort auf dem Stuhl wohl eine andere Person als ich.
«Das ist alles?», frage ich.
«Das ist alles.»
«Dann gehören die 20 Seelen dir.»
«Unabhängig davon, ob du noch einmal für uns arbeitest.»
«Oder nicht.»
«Aber du musst es jetzt zu dir nehmen.»
Ich kann die Falle förmlich riechen. Es muss eine Falle sein.
Äußerlich zeige ich nach wie vor keine Regung. Aber ich sehe das Glitzern in meinen Augen und ich weiß, dass ich erst das Mem und dann die 20 SOLs nehmen werde. Genommen habe. Das Angebot ist zu verlockend. Ich gebe mir nicht einmal die Zeit, zu überlegen, ob die Erinnerung an etwas, das ich nicht getan habe, schlimmer sein könnte als all die Sachen, die ich in meinem Leben bereits gemacht und deren Erinnerungen ich verkauft habe.
Ich sehe, wie ich mich zum Tisch beuge, meine Hand ausstrecke und das Mem in Empfang nehme. Ich sehe, wie ich mir die fremde Erinnerung zu eigen mache. Und ich sehe, wie ich im Erstkontakt mit dem Mem die Erinnerung in Echtzeit nacherlebe, bevor sie sich anschließend als Ablagerung in meinem Bewusstsein verankern wird.
Hier zeigt sich der große Nachteil der 360er. Ich kann nur an der Oberfläche bleiben. Was mein vergangenes Ich nun nacherlebt, was es fühlt und denkt und sieht, kann ich nicht fühlen und denken und sehen. Ich kann nur beobachten. Von außen. Wie durch Glas.
Zuerst zeigt sich nichts in meinem Gesicht. Meine Züge bleiben starr, undurchsichtig. Dann bildet sich langsam eine Falte auf meiner Stirn. Der Blick bleibt unfokussiert, nach innen gerichtet, während sich die fremde Erinnerung in all ihren Facetten vor mir, in mir entfaltet. Ich sehe meinen Körper weich werden, durchlässig und in sich zusammensacken. Ich bin jetzt nicht mehr ansprechbar, ganz in meinem Kopf. Ich sehe, wie die Falte auf meiner Stirn sich vertieft. Wie sie allmählich, nach und nach die ganze Gesichtshaut mit sich zieht, meine Kieferknochen dagegen arbeiten. Die Stirn wird ein Graben, der Fluchtpunkt, zu dem sich alles hinzieht. Die ganze Zeit über kommt kein Ton aus meinem Mund. Flüssigkeit sammelt sich in meinen Augen. Meine Schläfen pochen im Versuch, bloß keine Schwäche zu zeigen, die Kontrolle nicht zu verlieren. Es ist schon kaum auszuhalten für mich, nur von außen zuzusehen. Ich kann mir nicht ausmalen, was ich dort gerade erlebe. Nacherlebe. Denn das, was mir geschieht, ist schon einmal geschehen. Jemand anderem. Und ich hoffe für diese Person, ich hoffe für mich und für uns beide, dass es bald vorbei ist.
Es ist ganz still im Raum. Nur das leichte Schaben von Fingern über Holz ist zu hören. Das Knistern der Kleidung, wenn die drei ihre Haltung ändern.
Und dann, dann sehe ich, wie ich langsam, Stück für Stück aufgebe. Ich kann es nicht anders sagen. Ich sehe mich unter dem Eindruck des Mems meine Würde verlieren. Und ich kann es kaum mit ansehen. Mein Körper bleibt schlaff, mein Gesicht fällt in sich zusammen, lässt, was immer dort mit ihm geschieht, über sich hinwegrollen. Der Schrecken ist ein stummer Gletscher, der sich langsam und unerbittlich über mein Gesicht schiebt. Ich habe das seltsame Gefühl, mich selbst in den Arm nehmen zu wollen. Mir zu sagen, dass was immer ich dort gerade erlebe, wieder weggehen wird. Dass der Moment nicht fern ist, in dem nichts von diesem Mem mehr in mir bleibt. Dass der Schmerz, den ich fühle, die Erfahrung dieser Erinnerung vergänglich ist und sich auflösen wird und es jetzt ist, also sein wird, als wäre es nie passiert. Aber es ist eine Ewigkeit, die vergeht. Ich spule nicht vor.
Als es endlich vorbei ist und mein Blick sich langsam wieder fokussiert, sehe ich aus wie eine andere Person. Nein. Das stimmt nicht. Ich sehe aus wie eine Person, die in einer anderen Welt aufgewacht ist. Anders als die, die sie zu kennen meinte. Eine schlechtere Welt.
Die drei schauen mich mit ernsten Augen an. War das die Reaktion, die sie erwartet haben? Wollten sie meinen Zusammenbruch herbeiführen? Sie räuspern sich.
Irgendwann, während ich im Mem war, haben sie den großen Behälter geöffnet. Die SOLs leuchten sirenenhaft im Inneren.
Meine. Ich habe sie mir verdient. Hart verdient.
Eine der drei Personen greift in eine Schublade. Sie reichen mir ein Taschentuch. Ich wische mir das Gesicht, mit fahrigen, zitternden Fingern.
«Was», frage ich und meine Stimme bricht. Ich straffe meinen Körper, richte mich auf und beginne noch einmal. Diesmal ist meine Stimme fest. «Was habe ich gerade erinnert?»
Sie haben die Fingerspitzen aneinander gelehnt und taxieren mich.
«Eine Prägung.»
Ich blicke von einer Person zur anderen, verständnislos.
«Es mag brutal erscheinen.»
«Verstörend.»
«Unnötig.»
«Aber das ist es nicht.»
«Das ist es nicht.»
Sie schütteln leicht den Kopf. Ihre Stimmen sind sanft und mitfühlend.
«Es ist die Kraft, die es braucht.»
«Die Erschütterung, die nötig ist.»
«Um die Schale eines Menschen zu knacken.»
«Um an seinen flüssigen Kern zu gelangen.»
«Das höchste Gut.»
«Die Essenz.»
«Ein unschätzbarer Wert.»
Keine Reaktion von mir. Ich sitze dort wie versteinert. Das Taschentuch geknüllt in meiner linken Hand.





























