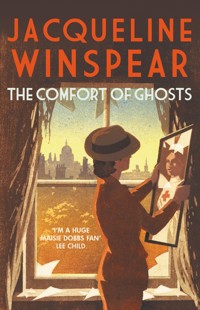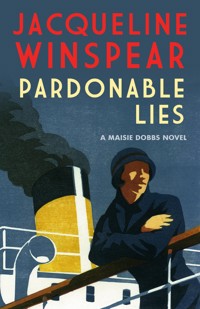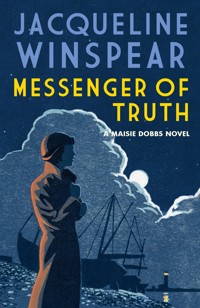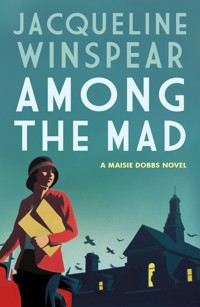9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Maisie Dobbs: Englands erste Detektivin ermittelt
- Sprache: Deutsch
Entdecken Sie die Welt der unerschrockenen Maisie Dobbs – Krankenschwester, Psychologin und Londons erste weibliche Privatdetektivin! London, 1929: Die Schrecken des Krieges verblassen allmählich und Maisie Dobbs wagt den mutigen Schritt, ihr eigenes Detektivbüro zu eröffnen. Doch dies ist ein höchst ungewöhnliches Unterfangen für eine junge Frau und sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Als Maisie den Auftrag erhält, einer vermeintlichen Ehebrecherin auf den Zahn zu fühlen, stößt sie unverhofft auf einen Mann, der die Hilflosigkeit von Kriegsversehrten skrupellos ausnutzt. Ihre Ermittlungen führen sie an einen Ort, an dem der Tod lauert – und bringen sie selbst in größte Gefahr ... Tauchen Sie ein in die atmosphärische Welt des historischen Kriminalromans Maisie Dobbs – Das Haus zur letzten Ruhe von Jacqueline Winspear. Ein fesselnder Mystery-Roman um eine starke Heldin in einer Zeit des Umbruchs und der Herausforderungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Jacqueline Winspear
Maisie Dobbs – Das Haus zur letzten Ruhe
Englands erste Detektivin ermittelt
Über dieses Buch
Hinter diesen Mauern lauert der Tod …
London 1929: Der Krieg scheint vergessen, und auch für Maisie Dobbs brechen neue Zeiten an. Aber dass eine junge Frau ihr eigenes Detektivbüro eröffnet, ist dann doch reichlich skandalös. Während der Ermittlung gegen eine vermeintliche Ehebrecherin treten die Schrecken der Vergangenheit erneut zutage. Maisie kommt einem Mann auf die Spur, der die Hilflosigkeit von Kriegsversehrten auf abscheuliche Weise ausnutzt. Unversehens gerät sie dabei selbst in höchste Gefahr …
Vita
Jacqueline Winspear wurde in England in der Grafschaft Kent geboren. Lange Zeit war sie im Londoner Verlagswesen tätig, ehe sie 1990 in die USA zog. Heute lebt sie mit ihrem Mann, einem Hund und einer Katze in Ojai, Kalifornien. Mit der Serie um die ungewöhnliche Detektivin Maisie Dobbs wurde sie sowohl in ihrer neuen als auch in ihrer alten Heimat über Nacht berühmt.
Impressum
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2018
Copyright © 2007 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
© 2003 by Jacqueline Winspear
Published by arrangement with Soho Press, New York
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung Shutterstock
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-688-11163-3
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Frühjahr 1929
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Frühjahr 1910 bis Frühjahr 1917
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Sommer 1929
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Dank
Dieses Buch ist meinem Großvater väterlicherseits und meiner Großmutter mütterlicherseits zum Andenken gewidmet.
John «Jack» Winspear erlitt bei der Schlacht an der Somme im Juli 1916 eine schwere Beinverletzung. Nach seiner Genesung nahm er seine Arbeit als Gemüsehändler im Südosten Londons wieder auf.
Clara Frances Clark, geborene Atterbury, war im Ersten Weltkrieg im Woolwich Arsenal als Munitionsarbeiterin tätig. Durch eine Explosion, bei der mehrere ihrer Kolleginnen umkamen, ist sie teilweise erblindet. Später heiratete sie und wurde Mutter von zehn Kindern.
Now, he will spend a few sick years in institutes, And do what things the rules consider wise, And take whatever pity they may dole. Tonight he noticed how the women’s eyes Passed from him to the strong men that were whole. How cold and late it is! Why don’t they come And put him to bed? Why don’t they come?
Jetzt wird er ein paar sieche Jahre in Sanatorien verbringen Und alles, was die Regeln dort für gut erachten, tun Und jede Art von Mitleid nehmen, das man dort verteilt. Heut Nacht hat er bemerkt, wie die Augen der Frauen Von ihm hinüberglitten zu den starken, ganzen Männern. Wie kalt und spät es ist! Warum kommen sie nicht Und bringen ihn ins Bett? Warum kommen sie nicht?
Letzte Strophe des Gedichts «Disabled» von Wilfred Owen.Es entstand im Oktober 1917 in Craiglockhart, einem Krankenhausfür Offiziere mit Kriegstrauma. Owen fiel am 4. November 1918nur eine Woche vor dem Waffenstillstand.
Frühjahr 1929
Kapitel 1
Die große, schlanke Frau in dem gutgeschnittenen marineblauen Kostüm, unter dessen Faltenrock wohlgeformte Knöchel hervorschauten, wäre Jack Barker auch dann aufgefallen, wenn sie nicht als Letzte das Drehkreuz der U-Bahn-Haltestelle Warren Street passiert hätte. Denn sie hatte das, was seine Mutter «Haltung» nannte – einen aufrechten Gang, die Schultern zurück, den Kopf gerade – und dabei gelang ihr das Kunststück, ihre schwarzen Handschuhe überzustreifen, ohne die leicht ramponierte Aktentasche loszulassen.
Die ist mit einem silbernen Löffel im Mund geboren, dachte Jack. Eingebildet, aber nichts dahinter.
Diese Frau würde ihn bestimmt nicht beachten. Er stampfte mit seinen klobigen Schuhen auf, um die beißende Kälte zu vertreiben. Mit den restlichen Zeitungen winkte er einem herannahenden Taxi – vielleicht hielt es ja mit quietschenden Reifen, und eine Hand reichte ihm die Münzen für einen Daily Express durchs Fenster.
«Verzeihung, ich hätte gern einen Express, junger Mann», sprach ihn da eine samtweiche Stimme an.
Jack blickte auf. Die Augen, in die er nun schaute, waren wie eine Sommernacht – ein Farbton dunkler als blau, wie ihm schien. Die Frau hielt ihm das Geld entgegen.
«Geht klar, Miss, bitte schön. Ziemlich frisch heute Morgen, was?»
Lächelnd nahm sie ihre Zeitung, und schon im Gehen erwiderte sie: «Das kann man wohl sagen. Eine Affenkälte ist das, da hilft nur noch ein schöner heißer Tee. Sie sollten sich bald ein Tässchen gönnen.»
Jack sah der Frau nach, die nun die Warren Street Richtung Fitzroy Square entlangging. Haltung hin oder her – so nett, wie sie zu ihm gewesen war, stammte sie ganz sicher nicht aus einer vornehmen Familie.
Am Ende der Warren Street blieb Maisie Dobbs vor einem etwas heruntergekommenen georgianischen Reihenhaus stehen, klemmte den Daily Express unter den linken Arm, öffnete mit Bedacht ihre schwarze Aktentasche und holte den Brief ihres Vermieters sowie zwei Schlüssel heraus. Das Schreiben enthielt den Rat, der Haustür nach dem Aufsperren mit einem kräftigen Schubs nachzuhelfen, die Gaslampe unten im Treppenhaus vorsichtig zu entzünden und im ersten Stock auf die oberste Treppenstufe zu achten: Sie müsse repariert werden. Auch dürfe sie nicht vergessen, ihre Tür zu verriegeln, wenn sie abends nach Hause ging. Der Hausmeister, Billy Beale, werde an der Eingangstür gern ein Namensschild für sie anbringen, es sei denn, sie ziehe es vor, anonym zu bleiben.
Maisie lächelte. Ich brauche Aufträge, sagte sie sich. Anonym zu bleiben hätte da nicht viel Sinn.
Sie vermutete, dass der Hauswirt, Mr. Sharp, nicht so scharfsinnig war, wie sein Name versprach. Wahrscheinlich würde er ihr jedes Mal, wenn sie ihm über den Weg lief, unnütze Fragen stellen. Sein Rat erwies sich jedoch als hilfreich: Die Tür ging tatsächlich nur mit einem Ruck auf, und die Gaslampe ließ sich zwar anzünden, vermochte es aber kaum, Licht ins Halbdunkel des Treppenhauses zu bringen. Hier musste sich einiges ändern. Im Augenblick hatte Maisie allerdings genug zu tun, auch wenn es noch keine Fälle zu bearbeiten gab.
Vorsichtig trat Maisie auf die oberste Stufe, wandte sich auf dem Treppenabsatz nach rechts und steuerte auf die braune Tür mit Milchglasfenster zu. Sie nahm das Schild «Zu vermieten» vom Türknauf, schloss auf und holte tief Luft, dann betrat sie ihr neues Büro. Der Raum hatte eine Gasheizung, je eine Gaslampe an beiden Wänden und ein Schiebefenster, von dem aus man auf das Gebäude gegenüber und die Dächer der Nachbarschaft blickte. Möbliert war das Zimmer mit einem Eichenschreibtisch und einem passenden Stuhl, der nicht gerade stabil wirkte; außerdem stand rechts vom Fenster ein alter Aktenschrank.
Lady Rowan Compton, ihre Gönnerin und ehemalige Dienstherrin, hatte recht; diese Gegend war kein Kurort. Aber wenn sie ihre Karten richtig ausspielte, konnte Maisie sich die Miete leisten und behielt noch ein wenig von ihren Ersparnissen übrig. Ein elegantes Büro brauchte sie nicht, aber schäbig durfte es auch nicht wirken. Nein, die goldene Mitte sollte es sein, etwas für jeden, gut zu erreichen, aber auch nicht gerade im innersten Stadtkern. In diesem Winkel von Bloomsbury fühlte sich Maisie gut aufgehoben. Hier am Fitzroy Square konnte man sich mit jedermann zum Tee treffen, konnte sich mit einer Gräfin und einem Zimmermann zum Dinner am selben Tisch niederlassen, und beide hätten gegen die Gesellschaft des anderen nichts einzuwenden. Ja, für den Augenblick war die Warren Street ideal. Nur das Problem mit dem Namensschild war etwas knifflig, dafür hatte sie noch keine Lösung.
«So, meine Liebe», hatte Lady Rowan gesagt, «wie werden Sie sich nennen? Wir wissen ja alle, was Sie tun, aber wie wollen Sie Ihre Dienste offiziell anbieten? Etwa: ‹Findet Vermisste, tot oder lebendig, auch wenn sie sich im Grunde selbst finden› – das geht ja wohl kaum. Wir müssen uns etwas ausdenken, was kurz und bündig auf Ihre einzigartigen Talente hinweist.»
«Ich dachte an ‹Diskrete Ermittlungen›. Was halten Sie davon, Lady Rowan?»
«Aber das macht niemanden darauf aufmerksam, wie Sie Ihren Verstand einsetzen – und darum geht es ja.»
«Eigentlich ist es nicht mein Verstand, den ich benutze, sondern der anderer Leute. Ich stelle nur die Fragen.»
«Papperlapapp! Wie finden Sie ‹Diskrete Erforschung von Gehirnwindungen›?»
Maisie lächelte mit gespieltem Entsetzen über den Vorschlag der älteren Freundin. Sie saß sehr behaglich vor dem Kamin in der Bibliothek ihrer ehemaligen Dienstherrin, einem Kamin, den sie einst mit den rauen, abgearbeiteten Händen eines Hausmädchens gereinigt hatte.
«Nein, ich bin ja kein Hirnchirurg. Am besten schlafe ich noch einmal darüber. Ich möchte es richtig anpacken.»
Die ergraute Edelfrau tätschelte Maisies Knie. «Wie Sie sich auch entscheiden, Sie werden Ihre Sache hervorragend machen, davon bin ich überzeugt, liebe Freundin. Ganz hervorragend sogar.»
Und als Billy Beale, der Hausmeister, eine Woche nach ihrem Einzug in der Warren Street bei Maisie anklopfte und sich erkundigte, ob er ihren Namen am Hauseingang anbringen sollte, reichte sie ihm ein Messingschild mit der Aufschrift «M. Dobbs. Privat- und Wirtschaftsdetektei».
«Wo hätten Sie’s denn gerne, Miss? Links von der Tür oder rechts?»
Fragend sah er sie an. Billy war um die dreißig, knapp eins achtzig groß, stark und muskulös, und sein Haar hatte die Farbe eines Weizenfelds in der Sonne. Er schien eigentlich recht beweglich, gab sich aber mächtig Mühe, sein Hinken zu verbergen – das Maisie natürlich nicht entgangen war.
«Wo sind denn die anderen Namen angebracht?»
«Links, Miss, aber da würde ich es an Ihrer Stelle nicht hintun.»
«Und warum nicht, Mr. Beale?»
«Billy, nennen Sie mich einfach Billy. Na, weil die Leute links eigentlich nicht hingucken. Jedenfalls nicht, wenn sie den Türknauf betätigen, und der ist rechts. Da schauen sie sofort hin, wenn sie die Außentreppe hochsteigen, erst auf den Löwenkopftürklopfer, dann auf den Knauf. Also kommt das Schild am besten nach rechts. Dann machen Sie ein besseres Geschäft.»
«Gut, Mr. Beale, dann also nach rechts. Vielen Dank.»
«Billy, Miss. Sie können mich ruhig Billy nennen.»
Billy Beale ging, um das Messingschild anzubringen. Tief seufzend rieb sich Maisie den Nacken, die Stelle, an der sich die Sorgen gern einnisten.
«Miss …»
Billy pochte leise an die Milchglasscheibe, steckte den Kopf zur Tür herein und nahm seine Mütze ab.
«Was gibt’s, Mr. Beale?»
«Billy, Miss. Darf ich Sie kurz etwas fragen?»
«Ja, kommen Sie rein. Worum geht’s?»
«Es ist eine eher persönliche Frage, wenn Sie erlauben?» Ohne eine Antwort abzuwarten, sprach er rasch weiter. «Waren Sie Krankenschwester? In einem Kriegslazarett? Vor Bailleul?»
Wie um sich zu schützen, legte sie die Hand auf die Brust, ließ sich aber sonst von dem jähen Schmerz, der sie durchzuckte, nichts anmerken.
«Ja. Ja, das stimmt.»
«Wusst ich’s doch!» Billy schlug sich mit der Kappe aufs Knie. «Es war mir sonnenklar, als ich Ihre Augen gesehen habe. An mehr kann ich mich nicht mehr erinnern, nachdem sie mich eingeliefert hatten. Das waren Ihre Augen, Miss. Der Doktor meinte, ich sollte ganz konzentriert etwas anschauen, solange er sich an meinem Bein zu schaffen macht. Also hab ich Ihre Augen angeguckt, Miss. Sie und er haben mein Bein gerettet. Voller Granatsplitter war’s. Aber Sie haben’s geschafft, nicht wahr? Wie war doch gleich sein Name?»
Maisies Kehle war wie zugeschnürt. Dann schluckte sie schwer. «Simon Lynch. Captain Simon Lynch. Den meinen Sie wohl.»
«Ich habe Sie nie vergessen, Miss. Niemals. Sie haben mir das Leben gerettet.»
Maisie nickte und versuchte die Erinnerungen wieder an den Ort zu verbannen, den sie ihnen zugewiesen hatte, um nur dann hervorgeholt zu werden, wenn sie es wollte.
«Miss, wenn ich irgendwas für Sie erledigen kann, sagen Sie einfach Bescheid. Ich bin für Sie da. Ist das ein Glückstreffer, dass wir uns nochmal über den Weg laufen. Wenn ich das meiner Frau erzähle. Wenn ich irgendwas tun kann, melden Sie sich. Egal, was es ist.»
«Danke. Herzlichen Dank. Ich werde Bescheid sagen, wenn ich etwas brauche. Und, Mr. … Billy, danke, dass Sie sich um das Schild kümmern.»
Billy Beale wurde rot, zog mit einem Nicken seine Mütze wieder auf und verließ das Büro.
Ein Glückstreffer, dachte Maisie. Abgesehen vom Krieg habe ich im Leben bis jetzt immer Glück gehabt. Sie ließ sich auf dem wackligen Eichenstuhl nieder, zog die Schuhe aus und rieb sich die Füße. Die Kälte, die Nässe, den Dreck und das Blut Frankreichs spürte sie auch jetzt noch. In den zwölf Jahren seit 1917 waren ihre Füße nicht wieder warm geworden.
Sie dachte an Simon. Das war wie in einem anderen Leben gewesen, als sie mit ihm unter einem Baum saß inmitten der Hügellandschaft der South Downs in Sussex. Sie hatten gleichzeitig Urlaub bekommen, das verdankten sie keinem Wunder, sondern den richtigen Beziehungen – trotzdem war es nicht einfach zu arrangieren gewesen. Der Tag war schön gewesen, und doch konnte er nicht von den Kämpfen ablenken. Das Dröhnen des Geschützfeuers hallte über den Ärmelkanal herüber. Ein Klang, dem auch die Weiten des Meeres und des Landes nichts von seiner Bedrohlichkeit nahmen. Maisie klagte, dass ihr die Feuchtigkeit Frankreichs immer noch in den Knochen sitze, da zog Simon ihr mit einem Lächeln die Wanderschuhe aus, um ihre Füße warm zu reiben.
«Mensch, Mädchen, so kalte Füße haben sonst nur Tote …»
Beide lachten, doch dann verstummten sie abrupt. In solchen Zeiten machte man über den Tod keine Witze.
Kapitel 2
Das kleine Büro sah nun schon ein wenig anders aus als bei Maisies Einzug vor einem Monat. Der Schreibtisch stand jetzt schräg zu dem großzügigen Fenster, sodass Maisie von ihrem Platz aus den Blick über die Dächer der Stadt genießen konnte. Auf dem Tisch prangte ein modernes schwarzes Telefon, denn Lady Rowan hatte erklärt: «Im Geschäftsleben kommt man heute ohne Telefon nicht mehr aus. Das ist ganz einfach unverzichtbar.» Maisie hätte der Apparat allerdings besser gefallen, wenn sein gebieterisches Klingeln etwas häufiger ertönt wäre. Weitere Verbesserungsvorschläge stammten von Billy Beale.
«Sie wollen hier doch nicht etwa Leute empfangen, ohne ihnen ein Tässchen anzubieten, Miss? Diesen Wandschrank da könnte ich Ihnen herrichten, da kommt ein Gasbrenner rein, viel mehr brauchen Sie nicht. Und schon können Sie eine schöne Kanne Tee kochen. Was meinen Sie, Miss? Das Holz besorge ich Ihnen, und die Gasleitung verlege ich Ihnen auch. Das macht keine Umstände.»
«Großartig, Billy. Das wäre wirklich nett.»
Maisie seufzte. Augenscheinlich wussten alle anderen ganz genau, was ihr fehlte. Natürlich hatten ihre Helfer das Herz am rechten Fleck, aber was sie im Augenblick am dringendsten brauchte, waren Klienten.
«Soll ich Ihnen das Geld für das Material schon mal geben, Billy?»
«Das kostet nichts.» Billy zwinkerte ihr zu und tippte sich mit dem Zeigefinger an die Nase. «Einen Blinden stört der Rauch nicht, wenn Sie wissen, was ich meine, Miss.»
Maisie konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. «Ja, das Sprichwort kenne ich: Ich soll Sie ruhig machen lassen, nicht so genau hinsehen und mir nicht den Kopf zerbrechen.»
«Sie haben’s erfasst, Miss. Überlassen Sie das mir. Und in null Komma nichts können Sie Ihre Besucher empfangen, wie es sich gehört.»
Billy tippte zum Abschied an seine Mütze und zog die Tür hinter sich zu. Maisie lehnte sich zurück, rieb ihre müden Augen und betrachtete durch das Fenster die Dächer Londons, die am Ende eines langen Tages von der untergehenden Sonne in rosiges Licht getaucht wurden.
Dann nahm sie sich ihre handschriftlichen Aufzeichnungen vor; es war der Entwurf eines Berichts, an dem sie gerade arbeitete. Es handelte sich nur um einen unbedeutenden Fall, aber Maisie hatte von Maurice Blanche gelernt, wie wichtig es war, sich ausführliche Notizen zu machen. Während ihrer Lehrzeit hatte er ihr eingeschärft, man solle sich niemals nur auf das Gedächtnis verlassen, dürfe keine Einzelheit übersehen und müsse jede noch so kleine Beobachtung aufzeichnen. Alles, absolut alles, bis hin zur Farbe der Schuhe, die die fragliche Person am fraglichen Tag trug, musste festgehalten werden. Es galt, das Wetter zu schildern, die Windrichtung, die Blumen, die gerade blühten, die Speisen, die verzehrt wurden. Und zwar schriftlich. «Sie müssen es niederschreiben, ohne Wenn und Aber, halten Sie alles lückenlos fest», befahl ihr Mentor. Insgeheim dachte Maisie, wenn sie für jedes «Ohne Wenn und Aber», das sie zu hören bekam, einen Shilling erhielte, dann bräuchte sie nie wieder zu arbeiten.
Wieder rieb sich Maisie den Nacken, schloss die Akte auf ihrem Tisch und streckte sich. Da zerriss das dröhnende Schellen der Türglocke die Stille. Zuerst glaubte Maisie, jemand habe versehentlich den Klingelstrang gezogen. Seit Billy die neue Vorrichtung eigens für Maisies Büro installiert hatte, war sie kaum ertönt. Offenbar half es Maisie nicht viel, dass sie für Maurice Blanche gearbeitet und dessen Detektei übernommen hatte, als der Sechsundsiebzigjährige in den Ruhestand ging. Der Neuanfang unter eigenem Namen lief keineswegs rosig. Wieder ertönte die Türglocke.
Maisie strich ihren Rock glatt, fuhr sich übers Haar, um etwaige widerspenstige Locken zu bändigen, und eilte die Treppe hinunter.
«Gut –» Der Mann zögerte, dann nahm er seine Taschenuhr heraus, als wolle er nachsehen, welcher Gruß um diese Tageszeit angebracht war. «Guten Abend. Mein Name ist Davenham, Christopher Davenham. Ich möchte Mr. Dobbs sprechen. Ich habe zwar keinen Termin, aber man hat mir versichert, dass er mich empfangen würde.»
Er war groß, etwa eins fünfundachtzig, schätzte Maisie. Guter Tweedanzug, den Hut hatte er genau im richtigen Moment gelüftet, aber sogleich wieder aufgesetzt. Teure Lederschuhe, vermutlich von seinem Butler auf Hochglanz gebracht. Die Times trug er zusammengerollt unter dem Arm, aber in der Zeitung steckten, kaum sichtbar, zwei Bögen Schreibpapier. Sein tiefschwarzes Haar war mit Pomade zurückgekämmt, sein Schnurrbart gepflegt. Christopher Davenham mochte zwei- oder dreiundvierzig sein. Seit er sich vorgestellt hatte, waren nur Sekunden verstrichen, doch Maisie hatte bereits alles registriert. Soldat war er sicher nicht gewesen, vermutlich aus beruflichen Gründen freigestellt.
«Hier entlang, Mr. Davenham. Heute Abend sind keine Termine mehr vorgesehen, Sie haben also Glück.»
Maisie führte Christopher Davenham in ihr Büro und bat ihn, ihr gegenüber auf dem Besucherstuhl Platz zu nehmen, den Lady Rowans Chauffeur erst letzte Woche geliefert hatte. Ein weiteres Geschenk, um ihr auf dem eingeschlagenen Weg zu helfen.
Davenham sah sich kurz um, als rechne er damit, dass ein Mann auf ihn zukommen und ihn begrüßen werde, aber stattdessen stellte die junge Frau sich vor.
«Maisie Dobbs. Zu Ihren Diensten, Mr. Davenham.» Mit einer Geste bat sie ihn erneut, Platz zu nehmen. «Setzen Sie sich doch, Mr. Davenham. Und verraten Sie mir doch bitte, wer Ihnen meinen Namen genannt hat.»
Christopher Davenham suchte seine Überraschung zu verbergen, indem er sich ein Taschentuch vors Gesicht hielt und vorgab zu husten. Anschließend faltete er das offenbar frischgebügelte, makellose Tüchlein wieder sorgfältig zusammen und steckte es ein.
«Miss … Dobbs. Tja … Mein Anwalt hat Sie mir aufs Wärmste empfohlen.»
«Wer ist Ihr Anwalt?»
Maisie unterstrich die Frage mit einer Kopfbewegung und hoffte, das Gespräch nun auf eine sachlichere Ebene zu bringen.
«Ah ja, Blackstone und Robinson. Joseph Robinson.»
Maisie nickte. Wieder Lady Rowan. Seit gut vierzig Jahren beriet Joseph Robinson sie in allen Rechtsfragen. Er hatte für Narren wenig Verständnis – außer sie bezahlten seine fürstlichen Honorare.
«Er ist seit Jahren unser Familienanwalt. Ich will offen mit Ihnen reden, Miss Dobbs. Es überrascht mich, Sie hier zu sehen. Ich dachte, ich hätte es mit einem Mann zu tun. Aber Robinson versteht sein Handwerk, also fangen wir an.»
«Ja, tun wir das, Mr. Davenham. Vielleicht könnten Sie mir erzählen, was Sie herführt?»
«Meine Frau.»
Maisies Magen rebellierte. O Gott, war sie nach ihrer Schulung, ihrer Ausbildung, ihren Erfolgen bei Maurice Blanche so weit gesunken? Eine Dreiecksgeschichte? Aber sie lauschte aufmerksam und beherzigte Blanches Rat: «Das Außerordentliche verbirgt sich oft unter der Maske des Gewöhnlichen. Vermutungen führen Sie nicht weiter, Maisie.»
«Und was hat es mit Ihrer Gattin auf sich, Mr. Davenham?»
«Ich glaube … ich glaube, dass sie ihr Herz an einen anderen verloren hat. Das vermute ich schon seit geraumer Zeit, und jetzt, Miss Dobbs, muss ich wissen, ob mein Verdacht begründet ist.»
Maisie lehnte sich zurück und sah ihrem Klienten direkt in die Augen. «Mr. Davenham, zunächst möchte ich Sie darauf vorbereiten, dass ich Ihnen einige Fragen stellen muss. Diese Fragen sind womöglich weder angenehm noch leicht zu beantworten. Das gehört zu meinem Beruf. Allerdings habe ich meine eigenen Methoden, und die sind ebenso außerordentlich wie das Honorar, das ich für meine Dienste berechne.»
«Geld ist kein Problem, Miss Dobbs.»
«Gut. Aber die Fragen könnten sich als problematisch erweisen.»
«Fahren Sie fort.»
«Mr. Davenham, bitte sagen Sie mir, welche Anhaltspunkte Sie zu der Annahme führen, dass Ihre Frau Ehebruch begeht?»
«Seit Wochen verlässt sie dienstags und donnerstags das Haus, unmittelbar nachdem ich mich auf den Weg ins Büro gemacht habe, und sie kehrt gerade rechtzeitig heim, um mich wieder in Empfang zu nehmen.»
«Mr. Davenham, dass sie Zeit außer Haus verbringt, ist noch kein hinreichender Grund, um Ihrer Gattin Untreue nachzusagen.»
«Aber die Lügen sind es.»
«Erzählen Sie mir mehr.» Maisie machte sich Notizen, ohne den Blick von ihm zu nehmen – eine Kunstfertigkeit, die ihn nervös machte.
«Sie behauptet, sie gehe einkaufen, besuche Freunde oder ihre Mutter – und wenn ich nachforsche, finde ich heraus, dass diese Besuche zwar stattgefunden, aber höchstens eine Stunde in Anspruch genommen haben. Offensichtlich ein Täuschungsmanöver.»
«Es gibt noch andere Möglichkeiten, Mr. Davenham. Vielleicht sucht Ihre Gattin ihren Arzt auf? Oder sie bildet sich weiter? Haben Sie bei Ihren Nachforschungen auch andere Gründe für die Abwesenheit Ihrer Frau berücksichtigt? Oft gibt es eine vollkommen unschuldige Erklärung.»
«Miss Dobbs. Das herauszufinden ist ja gerade Ihre Aufgabe. Folgen Sie ihr, und Sie werden sehen, dass ich recht habe.»
«Mr. Davenham. Einen Menschen zu beschatten verletzt die rechtlich geschützte Privatsphäre des anderen. Wenn ich diesen Fall übernehme – und in dieser Entscheidung bin ich völlig frei –, geht es mir um mehr als nur die Frage, wer wann was getan hat. Dann übernehme ich die Verantwortung für Sie und für Ihre Gattin, und zwar in einer Weise, über die Sie sich vielleicht noch keine Gedanken gemacht haben. Sagen Sie mir, was Sie mit den Informationen zu tun gedenken, die ich liefere.»
«Nun … ich werde sie benutzen und die Sache im Zweifelsfall meinem Anwalt übergeben.»
Wie zum Gebet faltete Maisie die Hände vor dem Gesicht. «Eine Frage möchte ich Ihnen noch stellen. Wie viel ist Ihnen Ihre Ehe wert?»
«Was für eine Frage ist denn das?»
«Eine Frage, auf die ich eine Antwort brauche, wenn ich diese Ermittlungen führen soll.»
«Sie ist mir sehr viel wert. Ein Gelübde sollte man in Ehren halten.»
«Und welchen Wert messen Sie dem Verständnis, dem Mitgefühl und dem Verzeihen bei?»
Davenham schwieg. Er schlug die Beine übereinander, strich seine Tweedhose glatt und versuchte, eine nicht vorhandene Schramme an seinen makellosen Lederschuhen wegzuwischen, ehe er antwortete. «Verdammt nochmal!»
«Mr. Davenham!»
«Miss Dobbs, ich bin nicht frei von Mitgefühl, aber ich habe meinen Stolz. Meine Frau verschweigt mir, was sie an den fraglichen Tagen treibt. Ich bin hierhergekommen, um die Wahrheit zu erfahren.»
«Ah, ja. Die Wahrheit. Mr. Davenham, ich werde die Wahrheit für Sie herausfinden, aber nur unter einer Bedingung: Nachdem Sie meinen Bericht erhalten haben und die Wahrheit wissen, werden wir gemeinsam über die Zukunft sprechen.»
«Was soll das heißen?»
«Wir müssen unser Gespräch fortsetzen, damit Sie und Ihre Frau die Zukunft gemeinsam gestalten können.»
«Mir ist völlig schleierhaft, wovon Sie sprechen.»
Maisie erhob sich, trat ans Fenster, dann wandte sie sich dem Mann zu, der sich um ihre Dienste bemühte. Um jeden Preis will er Haltung bewahren, dachte Maisie, die sein Unbehagen deutlich spürte und seine Gefühle nur allzu gut nachvollziehen konnte. Er sprach von Stolz, während ihm das Herz brach.
«Meine Aufgabe ist etwas komplizierter, als Sie vermuten, Mr. Davenham. Ich bin stets dafür verantwortlich, dass keiner der Beteiligten zu Schaden kommt. Und das gilt sogar dann, wenn ich es mit den eher kriminellen Elementen dieser Gesellschaft zu tun habe.»
Davenham antwortete nicht sofort. Auch Maisie schwieg; sie wollte ihm Zeit lassen, seine Entscheidung zu treffen. Nach einigen Minuten brach er das Schweigen.
«Ich vertraue Robinson, also erteile ich Ihnen den Auftrag», sagte Davenham.
Maisie kehrte an ihren Schreibtisch zurück, warf einen Blick auf ihre Notizen und blickte über die Dächer, wo sich die Tauben in ihren neugebauten Nestern einfanden. Dann wandte sie sich wieder dem Mann zu, der ihr gegenüber auf dem Lederstuhl saß.
«Ja, Mr. Davenham, und ich nehme ihn an.» Durch einen weiteren Augenblick des Schweigens unterstrich sie ihr Einverständnis.
«Dann fangen wir mit Ihrer Adresse an?»
Kapitel 3
Am Dienstag, dem 9. April, stand Maisie in aller Frühe auf. Sie entschied sich für das blaue Kostüm, zog ihren marineblauen Mantel über, setzte ihren Glockenhut auf und verließ das Haus. Sie hatte in einem viktorianischen Haus in Lambeth, südlich der Themse, ein Zimmer gemietet. Draußen war es kalt. Der Frühling lässt auf sich warten, dachte sie und zog Handschuhe über ihre klammen Finger.
Auf ihrem täglichen Spaziergang konnte sie sich in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, was sie sich für den Tag vornehmen wollte, und dabei die «schönste Stunde des Morgens» genießen, wie ihr Vater zu sagen pflegte. Von der Royal Street gelangte sie in die Palace Road und bog von dort rechts ab zur Westminster Bridge. Wie gerne sah sie frühmorgens erst einmal den «Fluss», wie die Londoner die Themse nannten. Seit dem Mittelalter war sie die Lebensader der Stadt, und das wussten die Menschen, die an ihren Ufern wohnten am besten. Maisies Großvater mütterlicherseits war Kahnführer auf der Themse gewesen, und wie seine Kollegen kannte er den Fluss und seine Stimmungen durch und durch.
Die Londoner wussten, dass die Themse ein launisches Geschöpf war. Die Menschen besaßen im Grunde keine Gewalt über sie, konnten sie aber für Wasserfahrzeuge aller Art schiffbar machen, sofern sie mit einer gehörigen Portion Vorsicht und Respekt an die Sache herangingen. Maisies Großvater hätte seine Tochter beinahe verstoßen, als sie sich mit ihrem späteren Mann zusammentat, denn er war eine Landratte – obwohl sich Frank Dobbs, der in den Straßen Londons zu Hause war, selbst wohl kaum so bezeichnet hätte. Er handelte mit Obst und Gemüse, das er in seinem Pferdekarren von Lambeth nach Covent Garden brachte, wo er es auf dem Markt feilbot. Für Frank Dobbs war der Fluss Mittel zum Zweck, denn hier kaufte er tagtäglich in aller Frühe seine Ware ein, die er mit etwas Glück an den Mann gebracht hatte, bevor am Nachmittag zu Hause zum Tee gedeckt wurde.
Mitten auf der Brücke blieb Maisie stehen, winkte der Mannschaft eines Lotsenbootes zu und setzte ihren Weg fort. Heute würde sie den Tag mit Celia Davenham verbringen, allerdings ohne dass die Gute davon etwas wusste.
Jenseits der Westminster Bridge stieg Maisie in die Untergrundbahn und fuhr mit der District Line zur Haltestelle Charing Cross. Die Station hatte ihren Namen so oft gewechselt, dass man sich fragen konnte, welche Bezeichnung den Stadtvätern wohl als Nächstes einfallen würde. Zuerst hatte sie Embankment geheißen, dann Charing Cross Embankment und jetzt einfach Charing Cross. Maisie stieg in die Northern Line um, fuhr bis zur Goodge Street, wo sie an der Tottenham Court Road wieder in die kühle Morgenluft hinaustrat. Sie überquerte die Straße, folgte der Chenies Street und gelangte zum Russel Square. Die Gegend war ein trauriger Anblick. Das alte Findelhaus, Coram’s Field, das Sir Thomas Coram vor fast zweihundert Jahren errichtet hatte, war 1926 abgerissen worden, und seitdem war hier nicht mehr viel geschehen. «Eine Schande», flüsterte Maisie, während sie auf den Mecklenburg Square trat.
Der Platz war nach Sophie Charlotte von Mecklenburg-Strelitz benannt, der Frau George III. von England. In der Mitte des Platzes mit den hübschen georgianischen Häusern lag ein Garten, den ein schmiedeeiserner Zaun schützte. Zweifellos hatte der Butler der Davenhams, die hier wohnten, einen Schlüssel zum Gartentor. Wie an den meisten Plätzen Londons hatten auch hier nur die Anwohner Zutritt zum Garten.
Maisie machte sich ein paar Notizen, hielt auch fest, dass sie hier schon einmal zusammen mit Maurice Blanche gewesen war, als sie seinen Kollegen Richard Tawney besuchten, einen politischen Schriftsteller, dessen Ansichten über soziale Gerechtigkeit Maisie teils aufregend, teils peinlich fand. Damals war sie froh gewesen, dass die beiden Männer, in ein lebhaftes Gespräch vertieft, Maisies Unbehagen nicht bemerkten.
Als sie nun den Platz von einer Hausecke aus überblickte, fragte sie sich, ob Davenham das Anwesen wohl geerbt hatte. Die Gegend schien nicht recht zu ihm zu passen, hier wohnten Sozialreformer in enger Nachbarschaft mit Professoren, Schriftstellern und ausländischen Gelehrten. Wahrscheinlich fühlte sich Mr. Davenham nicht nur in seiner Ehe, sondern auch in seinem Zuhause ein wenig unwohl. Da trat aus einem Nachbarhaus ein Mann und kam in ihre Richtung. Rasch heuchelte Maisie Interesse für die Krokusse, die im Blumenkasten vor einem Fenster die Köpfchen aus der feuchten Erde reckten, als wollten sie nachsehen, ob es sich schon empfahl, ihre Blüten zu entfalten. Der Mann ging vorüber. Noch beugte sich Maisie über die Blumen, als sie hörte, wie eine weitere Tür ins Schloss fiel.
Aus dem Gebäude, das sie beobachtet hatte, kam eine Frau. Sie ließ einen Schlüsselbund in ihre Handtasche gleiten, rückte ihren Hut zurecht und ging über die Außentreppe auf die Straße. Christopher Davenham hatte Maisie eine ausgezeichnete Beschreibung seiner Frau geliefert: Sie war zierlich, hatte helle Haut, ein zartes Gesicht, und mit ihren eins achtundfünfzig konnte man sie nicht unbedingt als groß bezeichnen. Der Hut, den ohnehin schon mehr als eine Nadel hielt, verrutschte leicht auf Celia Davenhams seidigem blondem Haar, und ihre Hände machten sich unaufhörlich an Tasche, Handschuhen, Hut und Haaren zu schaffen, während sie auf die Hauptstraße zusteuerte.
Auch aus ein paar Metern Entfernung bemerkte Maisie, wie fein und teuer Mrs. Davenhams dunkelrotes Gabardinekostüm und die weichen Lederhandschuhe waren. Der Filzhut ergänzte das elegante Ensemble ebenso perfekt wie die dunkelroten Lederschuhe, deren Riemchen in der Mitte durch eine Seidenschleife zusammengehalten wurden. Gerade die Schleife hatte es Maisie angetan – ein mädchenhaftes Detail, das zu einer Frau ihres Alters nicht so recht zu passen schien.
Celia Davenham ging nun zügig die Heathcote Street entlang, bog dann in die Grays Inn Road und winkte vor dem Royal Free Hospital ein Taxi herbei. Glücklicherweise bekam auch Maisie sofort ein Taxi, sodass sie Mrs. Davenham nicht aus den Augen verlor. Auf der Rückbank des schweren schwarzen Wagens hoffte Maisie, dass die Fahrt nicht lange dauern möge. Sie persönlich zog es vor, zu Fuß zu gehen; Ausgaben für andere Verkehrsmittel hielt sie für Verschwendung. Eine Fahrt mit der U-Bahn gönnte sie sich morgens nur, wenn sie fand, dass sie sich diesen Luxus durch harte Arbeit verdient hatte.
Am Bahnhof Charing Cross stieg Celia Davenham aus, bezahlte den Fahrer und eilte zum Fahrkartenschalter. Maisie blieb ihr auf den Fersen. Als sie sich hinter ihr anstellte und vorgab, in ihrer Handtasche nach Geld zu kramen, lauschte sie aufmerksam, als die kindliche Frau ihr Fahrziel nannte.
«Nether Green, bitte. Erster Klasse, hin und zurück, vielen Dank.»
Was in aller Welt wollte die Frau in Nether Green? In dieser Kleinstadt am Rande von London begann bereits die Grafschaft Kent. Dort standen Apfelbäume in den Gärten, es gab Reihenhäuser, einige schöne Anwesen und einen alten Bahnhof. Es hätte Maisie eher eingeleuchtet, wenn sie nach Chislehurst gefahren wäre, wo sich neureicher Prunk entfaltete. Aber Nether Green? Maisie verlangte eine Fahrkarte zweiter Klasse mit demselben Ziel, dann begab sie sich auf den Bahnsteig, um auf den Zug zu warten. Vorher kaufte sie noch rasch eine Zeitung und klemmte sie unter den Arm.
Fauchend und zischend fuhr der Zug ein und kam mit dicken Dampfwolken und kreischenden Bremsen zum Stehen. Das Rotbraun der Southern-Railways-Waggons war vom Kohlenstaub geschwärzt. Ein Schaffner öffnete Celia Davenham die Tür zur ersten Klasse und bot ihr beim Einsteigen die Hand. Maisie ging unterdessen weiter zur zweiten Klasse. Kurz bevor sich die Türen schlossen, bemerkte sie noch, dass Kragen und Ärmelaufschläge von Mrs. Davenhams weinrotem Kostüm mit eben jenem Band eingefasst waren, aus dem auch die Schleifen an ihren Schuhen bestanden. Rasch überschlug sie den Preis der Kleider, die diese Frau trug.
Als Maisie sicher sein konnte, dass das Objekt ihrer Nachforschungen im Zug saß, belegte sie einen Sitz in einem Abteil und zog das Fenster auf, um den Bahnsteig im Auge zu behalten. Endlich ging der Aufseher den Bahnsteig entlang und erklärte Maisie, es sei «besser für Ihren Kopf», wenn sie sich setze. Als der Mann dafür gesorgt hatte, dass alle, die nicht mitfuhren, zurückgetreten waren, gab er mit seiner Pfeife das Signal zur Abfahrt und schwenkte seine grüne Fahne.
Während der Zug den Süden der Stadt durchquerte und der Grenze zur Grafschaft Kent entgegenfuhr, dachte Maisie darüber nach, wie sehr sich London im Laufe der Jahre verändert hatte. Die Hauptstadt wuchs. Wo früher Wiesen gewesen waren, standen nun Häuser, die Geschäfte konnten sich nicht über fehlende Kundschaft beklagen, und Pendler – eine neue Erscheinung – reisten täglich zwischen der City und den Randgebieten hin und her. Als der Zug Grove Park erreichte, hatte Maisie jedes kleinste Detail ihres Vormittags festgehalten, seit sie – auch die Uhrzeit notierte sie – in aller Frühe aus ihrer Mietwohnung aufgebrochen war bis zum gegenwärtigen Augenblick, und natürlich vermerkte sie auch jeden Penny, den sie unterwegs ausgegeben hatte.
Die nächste Station war Nether Green. Maisie stand auf, warf einen Blick in den Spiegel, der zwischen zwei trüben Lampen am Ende des Waggons hing, rückte ihren Hut zurecht und setzte sich noch einmal, bis der Zug seine Fahrt verlangsamte und die Bremsen zu zischen begannen. Während der Zug im Bahnhof einrollte, trat Maisie ans Fenster, um die Abteile der ersten Klasse zu beobachten. Als der Zug stand, öffnete sie die schwere Tür. Ohne die Erster-Klasse-Waggons aus den Augen zu lassen, stieg sie rasch aus und eilte zur Absperrung, wo die Fahrkarten eingesammelt wurden. Celia Davenham hatte nur ein paar Meter Vorsprung, wurde aber von anderen Passagieren verdeckt, darunter eine alte Dame, die alle Zeit der Welt zu haben schien.
«Nun mal langsam, junger Mann», ermahnte sie den Schaffner. «Es ist schon traurig, wenn man es nicht abwarten kann, bis Respektspersonen ihre Fahrkarte gefunden haben.»
Der Schaffner machte erschrocken einen Schritt rückwärts, als rechne er damit, dass ihm die beleibte Dame ihren schwarzen Schirm über den Kopf ziehen würde. Ungeduldig sah Maisie Celia Davenham nach, die die Absperrung bereits passiert hatte und den Bahnhof verließ. Als sie endlich ihre Fahrkarte abgeben konnte, eilte sie zum Ausgang, schaute nach links und rechts und entdeckte Celia. Sie war vor einem Blumenstand stehen geblieben. So ein Glück. Während sie sich mit flotten Schritten dem Blumenhändler näherte, rückte sie die Zeitung unter ihrem Arm zurecht und sah auf die Uhr, obwohl sie auf die Sekunde genau wusste, wie spät es war. Sie erreichte den Stand, als Celia Davenham sich gerade entfernte.
Mit Blick auf die duftenden Sträuße bemerkte Maisie: «Hübsche Blumen haben Sie der Dame eben eingepackt.»
«Ja, Madam, wirklich hübsch. Sie nimmt immer die Iris», gab der Verkäufer zurück.
«Immer?»
«Ja, zweimal die Woche kommt sie hier vorbei, darauf kann man sich verlassen.»
«Dann liebt sie die Blumen wohl sehr», meinte Maisie und griff nach einem kleinen Strauß Osterglocken. «Trotzdem nehme ich lieber etwas anderes.»
«Diese Iris haben ja auch eine traurige Farbe», meinte der Mann. «Die Osterglocken sehen doch viel freundlicher aus!»
Erneut warf Maisie einen Blick auf die Uhr. Celia Davenham hatte ihren Weg inzwischen fortgesetzt. Sie ging langsam, ließ sich aber nicht von den Schaufenstern ablenken, sondern senkte den Blick, als wolle sie jeden Kontakt zu den Vorübergehenden vermeiden.
«Ja, das finde ich auch. Ich nehme die Osterglocken, vielen Dank.»
«Iris gehen wirklich gut, oben am Ende der Straße ist ja der Friedhof. Für den Zweck sind auch Chrysanthemen sehr beliebt.»
Maisie nahm ihren Strauß und gab dem Verkäufer das exakt abgezählte Kleingeld für die Blumen.
«Schönen Dank. Beehren Sie uns bald wieder.»
Es dauerte nicht lang und sie hatte Celia Davenham bis auf wenige Schritte eingeholt. Nun hatten sie die Geschäfte hinter sich gelassen, und damit verringerte sich auch die Zahl der Passanten, die die Straße bevölkerten. Mrs. Davenham wandte sich nach rechts, dann bog sie links auf die Hauptstraße. Sie wartete, bis die Fahrbahn frei war, und ließ dabei das grüngestrichene Eisentor des Friedhofs von Nether Green nicht aus den Augen. Maisie achtete darauf, gebührenden Abstand zu halten.
Celia Davenham hielt den Kopf gesenkt und ging zielstrebig mit festem Schritt weiter. Unterdessen prägte sich Maisie jede kleinste Geste der Frau genau ein. Ihre Schultern wirkten so angespannt, als hinge sie an einem Kleiderbügel. Maisie ahmte Mrs. Davenhams Körperhaltung nach, während sie ging, und merkte sofort, wie sich ihr Magen verkrampfte und ihr ein Schauer über den Rücken lief. Dann senkte sich die Trauer wie ein schwarzer Schleier über sie. Maisie spürte, dass Celia weinte und sich gegen ihren Schmerz zu wappnen suchte. Als Maisie die Körperhaltung der Frau wieder abschüttelte, fühlte sie sich grenzenlos erleichtert.
Sie folgte Celia Davenham durch die offenen Tore. Nach etwa fünfzig Metern verließ Celia den Weg, betrat den Rasen und blieb schließlich vor einem relativ frischen Grab stehen. Den großen Marmorengel, der über ein benachbartes Grab wachte, prägte sich Maisie als Orientierungspunkt ein. Dass sie sehr aufmerksam vorgehen musste, war klar. Gräber glichen einander oft wie ein Ei dem anderen.
Als Maisie an Celia Davenham vorüberging, wurde ihr schwer ums Herz. Auf den nahen Bahngleisen ratterte ein Zug vorbei, dessen rußige Rauchschwaden eine Weile über den Grabsteinen hingen, bis eine kühle Brise sie fortwehte.
Maisie blieb vor einem Grab stehen, um das sich offenbar seit Jahren niemand mehr kümmerte. Den Kopf geneigt, spähte sie zwischen den Steinen hindurch zu Mrs. Davenham hinüber. Die Frau hatte sich hingekniet, entfernte die welken Blumen, stellte den frischen Strauß in die Vase und sprach – offenbar mit dem Toten.
Maisie betrachtete nun den Grabstein, den sie sich als Tarnung ausgesucht hatte. «Donald Holden», stand darauf, «1900 – 1919. Der geliebte Sohn von Ernest und Hilda Holden. ‹Lass Erinnerungen goldne Bänder weben, die uns zusammenhalten bis zum Wiedersehen.› Möglich, dass sie sich schon wiedergefunden haben, dachte Maisie mit Blick auf das Unkraut, das hier wucherte. Unterdessen kniete Celia Davenham immer noch mit gesenktem Kopf vor ihrem makellosen Grab und hielt leise Zwiesprache. Maisie begann, das Unkraut auf Donald Holdens letzter Ruhestätte auszurupfen.
«Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mich ebenso gut ein bisschen um dich kümmern», sagte sie leise und stellte die Osterglocken in die Vase, die glücklicherweise mit Regenwasser gefüllt war. Für den Weg zum Wasserhahn hatte sie keine Zeit – womöglich wäre ihr Celia unterdessen entwischt.
Als Maisie das gejätete Unkraut in einem Behälter am Wegesrand deponierte, sah sie, wie die Trauernde sich über den Grabstein neigte, den kalten grauen Marmor küsste, eine Träne fortwischte, sich dann abrupt umdrehte und ging. Maisie hatte es nicht eilig, die Verfolgung wiederaufzunehmen. Stattdessen verabschiedete sie sich mit einem Nicken von Donald Holden und ging dann hinüber zu dem Grab, das Davenhams Frau besucht hatte. Auf dem Stein stand «Vincent». Nur «Vincent». Kein Nachname, kein Geburtsdatum. Dann folgten die Worte: «Ein schwerer Verlust für alle, die dich innig lieben.»
Als Maisie wieder beim Bahnhof ankam, war es wärmer geworden. Celia Davenham stand schon auf dem Bahnsteig und blickte immer wieder nervös auf ihre Armbanduhr. Maisie ging auf die Damentoilette, deren feucht-kalte Bodenfliesen anscheinend niemals trockneten, und wusch sich mit eisigem Wasser den Schmutz von den Händen. Kritisch musterte sie ihr Gesicht im Spiegel. Ja, in den blauen Augen lag noch ein Funkeln, aber die kleinen Falten an den Lippen und an der Stirn verrieten sie, gaben etwas über ihre Vergangenheit preis.
Nachmittags würde sie Celia Davenham folgen, bis sie in ihr Haus am Mecklenburg Square zurückkehrte. Aber Maisie war überzeugt, dass sich nichts Denkwürdiges mehr ereignen würde. Der Liebhaber, für dessen Auffindung Mr. Davenham ihr ein fürstliches Honorar bezahlte, war jedenfalls gefunden. Nur ein Problem stellte sich noch: Der Mann, der Maisies Klienten angeblich die Hörner aufsetzte, war tot.
Kapitel 4
Maisie saß frühmorgens, es war noch nicht einmal hell, in ihrem Büro und dachte über ihren Fall nach. Nur eine kleine Lampe warf Licht auf ihre Aufzeichnungen und ein Häuflein kleiner Karteikarten. Maurice behauptete immer, dass die Intuition vor Tagesanbruch am besten arbeite.
Zu Beginn ihrer Lehrzeit hatte Maurice Maisie von seinen Lehrern erzählt, den weisen Männern, die von dem Schleier sprachen, der sich in den frühen Morgenstunden lüftet, und vom alles erkennenden Auge, das sich öffnet, bevor der Tag erwacht. In der heiligen Zeit vor Anbruch der Dämmerung schlief der Intellekt noch, und die innere Stimme konnte sich bemerkbar machen. Seit vor einigen Tagen der Name «Vincent» ihre Neugier geweckt hatte, wartete Maisie auf eine Eingebung, denn Mrs. Davenhams scheinbar so gewöhnlicher Kummer warf mehr Fragen als Antworten auf.
Maisie streifte ihre Schuhe ab, legte sich ihre Wolljacke um die Schultern, nahm ein Sitzpolster von ihrem Stuhl und legte es auf den Boden. Sie zog ihren Rock über die Knie hoch, um sich im Schneidersitz hinsetzen zu können, dann ließ sie sich nieder und legte die Hände auf den Schoß. Maurice hatte ihr erklärt, dass es schwieriger ist, den Verstand verstummen zu lassen, als den Körper zu beruhigen, dass sich aber nur im stillen Wasser die Wahrheit widerspiegeln kann. Jetzt, im Dunkeln, wartete Maisie auf einen Fingerzeig ihrer Intuition und formulierte die Frage, die ihr zur rechten Zeit Antworten liefern würde.
Warum nur ein Name? Warum fehlten auf dem Grabstein Geburts- und Todesjahr? Was hielt die Beziehung zwischen Celia und Vincent am Leben? War es schlichte Trauer, die kein Ende fand, weil sie nicht glauben konnte, dass der geliebte Mensch gegangen war? Oder steckte eine andere Emotion dahinter? Maisie sah das Grab vor ihrem geistigen Auge und betrachtete den Ort, an dem Vincent zur letzten Ruhe gebettet lag.
Wie lautet die Frage, die ich nicht in Worte fassen kann?, überlegte sie. Donald Holden starb nur ein Jahr nach dem Krieg. Dass sein Grab zehn Jahre alt war, sah man deutlich. Bei Vincent hingegen schien es, als sei der Erdhügel erst vor wenigen Monaten aufgeschüttet worden.
Maisie verharrte noch eine Weile in ihrer Meditationshaltung, um ihren allzu regen Verstand zu beruhigen, bis das graue Morgenlicht sie aus ihrer Versunkenheit holte. Sie erhob sich und reckte, auf Zehnspitzen stehend, die Arme zur Decke. Heute würde sie Celia Davenham wieder zum Friedhof folgen.
Celia war ein Routinemensch. Auch an diesem Morgen verließ sie das Haus um Punkt neun Uhr. Diesmal trug sie ein kleegrünes Wollkostüm und darunter eine cremefarbene Seidenbluse mit breitem Kragen. Passend zu ihren Jadeohrringen steckte eine Jadebrosche am Revers. Auch Schuhe, Handtasche, Hut und Regenschirm waren aufeinander abgestimmt. Die sonst unauffälligen Schuhe zierte ein modischer blattförmiger Clip. Maisie trug wieder ihren dunkelblauen Rock mit passender Jacke – ihre seriöse Geschäftskleidung. Die Fahrt nach Nether Green verlief ereignislos. Erneut löste Celia Davenham eine Fahrkarte erster Klasse, während Maisie billiger und weniger komfortabel reiste. Wie gewohnt kaufte Celia den Irisstrauß, und auch hier entschied sich Maisie für eine preiswertere Variante.
«Ich hätte gern die Gänseblümchen.»
«Da haben Sie recht, Miss. Gänseblümchen stimmen einen doch immer fröhlich. Die halten auch eine Weile. Ist Zeitungspapier in Ordnung, oder sollen sie hübscher verpackt werden?»
«Zeitungspapier reicht, danke», erwiderte sie und gab dem Verkäufer den exakt abgezählten Betrag.
Rasch setzte sie ihren Weg fort. Am Friedhof angelangt, schritten beide nacheinander durch das grüne Tor, und als Maisie an Vincents Grab vorbeikam, stand Celia bereits vor dem Marmorstein. Sie fuhr mit grün behandschuhten Fingern den eingemeißelten Namen nach. Mit gesenktem Kopf strebte Maisie auf Donald Holdens letzte Ruhestätte zu. Nach einem stillen Gebet leerte sie das Wasser aus der Vase und rupfte etwas Unkraut aus. Dann ging sie zum Wasserhahn, um die Vase zu füllen, und warf unterwegs die verblühten Osterglocken auf den Abfallhaufen. Schließlich kehrte sie zu Donalds Grab zurück und stellte die Gänseblümchen ins Wasser. Dabei behielt sie Celia die ganze Zeit im Auge.
Auf der Spur nach den Gefühlen der Frau ahmte Maisie ihre Körperhaltung nach. Ihr Kopf neigte sich tiefer, ihre Schultern sackten zusammen, und ihre Hände verkrampften sich vor Schmerz. Welch eine Melancholie, welch eine unstillbare Sehnsucht. Instinktiv begriff Maisie, dass Celia innerlich einen langsamen Tod starb, dass sie im Gestern lebte und es keinen Raum für ihren Mann gab, bis Vincent wahrhaftig Ruhe gefunden hatte.
Plötzlich erschauderte die Frau und sah Maisie direkt ins Gesicht. Sie lächelte nicht, und es schien, als würde sie durch Maisie hindurch in die Ferne blicken. Maisie, die wieder ihre natürliche Haltung annahm, nickte ihr zu, und die kleine Geste holte Celia in die Gegenwart zurück. Sie erwiderte den Gruß, klopfte ihren Rock ab, zog die Handschuhe über und ging.
Maisie hatte es nicht eilig. Sie wusste, dass Celia jetzt heimging, um die Rolle der liebenden Ehefrau zu spielen, in die sie schlüpfte, sobald sie ihr Haus betrat. Dass sie ihm etwas vormachte, hatte ihr Mann zwar durchschaut, doch er hatte die falschen Schlüsse gezogen. Für Maisie stand auch fest, dass nach diesem zweiten Blick und dem kurzen Gruß Celia sie auf jeden Fall wiedererkennen würde, wenn sie sich erneut begegneten.
Maisie blieb noch eine Weile an Donalds Grab. Dieses Ritual, den Toten die letzte Ruhestätte schön zu gestalten, hatte etwas Tröstliches. Ihre Gedanken kehrten nach Frankreich zu den Toten und Sterbenden zurück, zu den entsetzlichen Wunden, bei denen jede Hilfe zu spät kam. Besonders aber gingen ihr die Verletzungen der Seelen nah, die Wunden jener, die ihre Schlachten täglich weiterführten, obwohl längst Frieden herrschte. Wie gern würde ich etwas für die Überlebenden tun, dachte Maisie, während sie ein paar besonders hartnäckige Unkräuter vor Donald Holdens Grabstein ausriss.
«Sehr schön machen Sie das.»
Maisie drehte sich um. Hinter ihr stand ein Friedhofsarbeiter, ein älterer Mann, der mit roten knochigen Händen eine hölzerne Schubkarre hielt. Auch sein wettergegerbtes Gesicht zeugte von der jahrelangen Arbeit im Freien, doch in seinen freundlichen Augen lag Mitgefühl.
«Ja, traurig, dass sich niemand darum kümmert», bemerkte Maisie.
«Das kann man sagen, wenn man bedenkt, was die Jungs für uns geopfert haben. Arme Schweine. Oje, Miss, tut mir leid, ich hab vergessen –»
«Das ist schon in Ordnung, man kann ruhig sagen, was man denkt», erwiderte Maisie.
«Da haben Sie ein wahres Wort gesprochen. Zu dem Thema kann man gar nicht genug sagen.»
Der Mann deutete auf Donalds Grab.
«Da sorgt schon seit ein paar Jahren niemand mehr dafür. Früher sind seine Eltern immer gekommen. Der einzige Sohn. Wahrscheinlich hat es sie auch ins Grab gebracht.»
«Kannten Sie seine Eltern? Bei so vielen Gräbern kommt man doch nicht mit allen Angehörigen ins Gespräch.»
«Ich bin jeden Tag hier, außer sonntags natürlich. Und zwar seit kurz nach dem Krieg. Da lernt man die Leute schon kennen. Klar, man kann nicht lange reden, dafür ist keine Zeit, und nicht jeder will reden, aber manche unterhalten sich ganz gern mal ein bisschen.»
«Ja, ja, das kann ich mir vorstellen.»
«Sie hab ich hier noch nie gesehen.» Der Mann musterte Maisie neugierig.
«Stimmt. Ich bin eine Cousine. Gerade hergezogen», erklärte Maisie und sah dem Mann ins Gesicht.
«Schön, dass sich jemand drum kümmert.» Der Mann umfasste wieder die Griffe der Schubkarre.
«Einen Augenblick. Sind das hier in diesem Teil des Friedhofs nur Soldatengräber?»
«Im weitesten Sinne. Die meisten sind im Krieg gefallen, aber manche haben mit ihren Verwundungen noch eine ganze Weile gelebt. Ihr Donald, der hatte ja Sepsis. Ein grausiger Tod, und noch dazu, wo sie ihn ja nach Hause gebracht hatten. Die Leute beerdigen ihre Toten gern hier wegen der Eisenbahn.»
Der Mann stellte seine Schubkarre wieder ab und deutete auf die Gleise, die neben dem Friedhof verliefen.
«Man sieht die Züge von hier aus. Nicht dass die Jungs sie sehen könnten, aber den Angehörigen gefällt das. Sie sind ja auf der Reise, das ist – Sie wissen schon, wie man das nennt – wenn es einem etwas bedeutet.»
«Eine Metapher?»