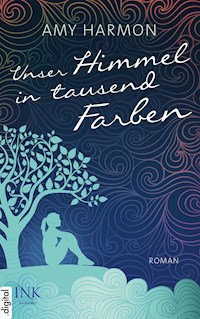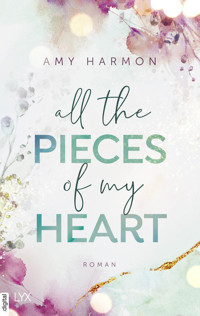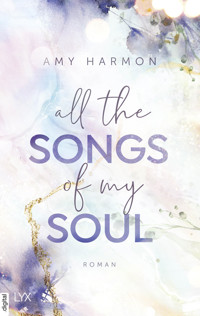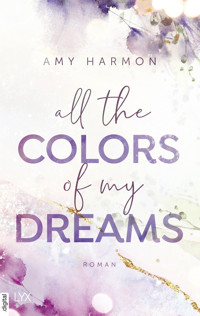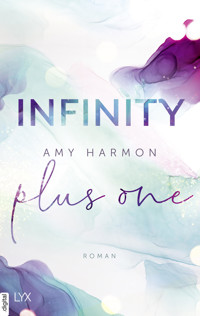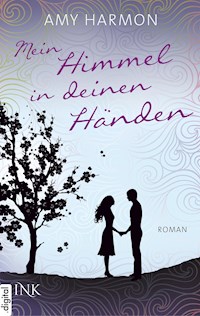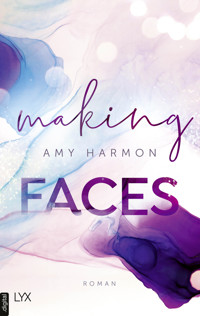
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sterben ist einfach. Die wahre Herausforderung ist das Leben.
Seit sie denken kann, ist Fern Taylor in Ambrose Young verliebt. Ambrose, der überall beliebt ist und so schön, dass ein unscheinbares Mädchen wie Fern niemals auch nur auf die Idee gekommen wäre, bei ihm eine Chance zu haben. Ihre Freizeit verbringt sie mit ihrem besten Freund Bailey, der an den Rollstuhl gefesselt ist, aber dennoch das Leben mit jeder Faser aufsaugen will. Eigentlich schien es ganz klar, was die Zukunft für sie bereithält. Bis zu dem Moment, als Ambrose Fern endlich "sieht", aber so zerbrochen ist, dass sie nicht weiß, ob ihre Liebe genug sein wird ...
"Ich liebe, liebe, liebe dieses Buch!" Colleen Hoover
NEUAUSGABE von "Vor uns das Leben"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Motto
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Amy Harmon bei LYX
Impressum
Amy Harmon
Making Faces
Roman
Ins Deutsche übertragen von Corinna Wieja und Jeannette Bauroth
ZU DIESEM BUCH
Seit sie denken kann, ist Fern Taylor in Ambrose Young verliebt. Ambrose, der überall beliebt ist und so schön, dass ein unscheinbares Mädchen wie Fern niemals auch nur auf die Idee kommen würde, bei ihm eine Chance zu haben. Schon gar nicht Fern, die als Jugendliche selbst von ihrer Mutter liebevoll als »hässliches Entlein« bezeichnet wurde und sich manchmal einfach nur mit einem Liebesroman vor der Welt verkriechen will. Ihre Freizeit verbringt sie mit ihrem Cousin und besten Freund Bailey, der an den Rollstuhl gefesselt ist, aber dennoch das Leben mit jeder Faser aufsaugen will, solange es ihm möglich ist. Eigentlich schien es ganz klar, was die Zukunft für sie alle bereithält. Bis zu dem Moment, als fünf junge Männer aus ihrer kleinen Stadt fortgehen und nur einer lebend zurückkehrt – Ambrose, dessen Schönheit jetzt nur noch eine Erinnerung ist. An Ferns Gefühlen für ihn hat sich jedoch nichts geändert, und zum ersten Mal scheint er sie wirklich zu sehen. Doch Ambrose ist so zerbrochen, dass sie nicht weiß, ob ihre Liebe genug sein wird …
Für die Familie Roos
David, Angie, Aaron, Garrett und Cameron
»Ich bin nur einer,
aber ich bin immer noch jemand.
Ich kann nicht alles tun,
aber ich kann immer noch etwas tun;
und nur weil ich nicht alles tun kann,
werde ich mich nicht weigern, das Etwas zu tun,
was ich tun kann.«
Edward Everett Hale
PROLOG
»Die alten Griechen glaubten daran, dass alle Seelen, gleich ob gut oder schlecht, nach dem Tod in das Königreich des Hades in der Unterwelt hinabfahren und dort für alle Ewigkeit weilen würden«, las Bailey laut vor. Sein Blick flog über die Seite.
»Die Unterwelt wurde durch Zerberus, einen gewaltigen, bösartigen, dreiköpfigen Höllenhund bewacht, der einen Drachenschwanz und Schlangenköpfe auf dem Rücken hatte.« Bailey erschauerte bei dem Bild, das ihm dabei durch den Kopf ging, und fragte sich, wie Herkules wohl zumute gewesen war, als er das Monstrum zum ersten Mal gesehen hatte, in dem Wissen, dass er es mit bloßen Händen besiegen musste.
»Es war die letzte Aufgabe, die Herkules zu erfüllen hatte, und es war zugleich die schwierigste. Herkules wusste, dass er vielleicht nie wieder ins Reich der Lebenden zurückkehren würde, wenn er einmal in die Unterwelt hinabgestiegen war, um sich Monstern, Geistern, Dämonen und mythischen Geschöpfen aller Art zu stellen. Aber der Tod jagte ihm keine Furcht ein. Herkules hatte ihm schon viele Male ins Auge geblickt, und er sehnte den Tag herbei, an dem auch er von seiner fortwährenden Bürde erlöst werden würde. Also stieg er in die Unterwelt hinab, insgeheim darauf hoffend, dass er im Königreich des Hades die Seelen der geliebten Menschen wiedersehen würde, die er verloren hatte und deretwegen er nun Buße tat.«
1
Superstar oder Superheld
Erster Schultag – September 2001
In der Turnhalle war es so laut, dass sich Fern ganz nah zu Baileys Ohr hinunterbeugen musste, damit er sie hörte. Bailey war zwar durchaus in der Lage, seinen Rollstuhl allein durch das Schülergewimmel zu manövrieren, aber Fern schob ihn, damit sie leichter zusammenbleiben konnten.
»Kannst du Rita irgendwo sehen?«, brüllte sie und blickte sich um. Rita wusste, dass sie einen Platz in der unteren Reihe der Tribüne finden mussten, damit Bailey neben ihnen sitzen konnte. Bailey deutete mit dem Finger, und als Fern in die angegebene Richtung sah, entdeckte sie Rita, die ihnen hektisch zuwinkte. Ihre Brüste hüpften auf und ab, und die blonden Haare flogen ihr wild um die Schultern. Sie kämpften sich zu ihr durch, und Fern überließ Bailey die Kontrolle über den Rollstuhl, während sie in die zweite Reihe kletterte und sich direkt hinter Rita setzte, damit Bailey ans Ende der Bank fahren konnte.
Fern hasste Pep Rallys. Sie war klein und wurde meistens geschubst und gequetscht, ganz egal wo sie bei diesen Motivationsversammlungen vor den Sportveranstaltungen saß. Außerdem hatte sie nur wenig Interesse am Hurraschreien und Füßestampfen. Sie seufzte und wappnete sich innerlich für die kommende halbe Stunde Brüllen, laute Musik und die Footballspieler, die sich gleich in einen Rausch jubeln lassen würden.
»Bitte erhebt euch für die Nationalhymne« ertönte eine Stimme. Das Mikrofon protestierte mit einem schrillen Ton, der die Anwesenden zusammenzucken und sich die Ohren zuhalten ließ, aber augenblicklich Ruhe in die Turnhalle brachte.
»Heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch, Jungs und Mädels.« Connor O’Toole, auch als Beans bekannt, hielt das Mikrofon in der Hand und grinste breit. Beans heckte immer irgendwas aus, und die ungeteilte Aufmerksamkeit aller war ihm sofort sicher. Seine Vorfahren waren irischer und hispanischer Abstammung, und seine Stupsnase, die strahlend haselnussbraunen Augen und das teuflische Grinsen standen in krassem Kontrast zu seiner olivfarbenen Haut. Außerdem redete er gerne und genoss ganz offensichtlich seine Mikrofonzeit.
»Unser aller Freund, Ambrose Young, hat eine Wette verloren. Er hat gesagt, wenn wir unser erstes Spiel gewinnen, wird er heute die Nationalhymne singen.« Ein Keuchen ging durch die Menge, und die Lautstärke auf der Tribüne stieg schlagartig an.
»Aber wir haben nicht nur unser erstes, sondern auch unser zweites Spiel gewonnen!« Die Zuschauer jubelten und stampften mit den Füßen. »Und da er zu jenen gehört, die zu ihrem Wort stehen, kommt hier Ambrose Young mit der Nationalhymne«, verkündete Beans und schwenkte das Mikrofon in Richtung seines Freundes.
Beans war schmächtig. Obwohl Zwölftklässler, gehörte er zu den kleineren Spielern im Team und hatte eher die Statur eines Ringers als die eines Footballspielers. Auch Ambrose war in der zwölften Klasse, aber keineswegs klein. Er überragte Beans deutlich – sein Bizeps hatte fast den Umfang von Beans’ Kopf –, und er sah aus wie dem Cover eines Liebesromans entsprungen. Sogar sein Name klang nach dem Helden einer heißen Geschichte. Fern wusste das besser als jeder andere. Sie hatte Tausende solcher Romane gelesen. Alphamänner, brettharte Bauchmuskeln, feurige Blicke, Happy Ends. Allerdings konnte es niemand mit Ambrose Young aufnehmen, weder im fiktiven noch im realen Leben.
In Ferns Augen war Ambrose Young einfach wunderbar, ein griechischer Gott unter Sterblichen, eine Figur wie aus einem Märchen oder Film. Anders als die anderen Jungen trug er seine dunklen Haare wellig bis auf die Schultern und strich sie gelegentlich zurück, wenn sie ihm in die braunen Augen mit den langen, dichten Wimpern fielen. Sein kantiges Kinn sorgte dafür, dass er nicht wie ein Schönling wirkte, genauso wie die Tatsache, dass er mit achtzehn Jahren und in Socken einen Meter neunzig maß und knapp einhundert knackige Kilo wog. Sein Körper war von den Schultern bis zu den wohlgeformten Waden von straffen Muskeln überzogen.
Wenn man den Gerüchten glauben durfte, hatte sich Ambrose’ Mutter, Lily Grafton, auf ihrer Suche nach Reichtum und Ruhm in New York City mit einem italienischen Unterwäschemodel eingelassen. Die Beziehung fand jedoch ein schnelles Ende, als der Typ entdeckte, dass sie von ihm schwanger war. Abserviert und in anderen Umständen kehrte sie nach Hause zurück, wo ihr alter Freund, Elliott Young, sie tröstete, nur zu gerne heiratete und gemeinsam mit ihr sechs Monate später einen Sohn willkommen hieß.
Die ganze Stadt hatte den heranwachsenden Jungen aufmerksam beobachtet, besonders weil der schmächtige, blonde Elliott Young nun einen muskelbepackten Sohn mit dunklen Augen und Haaren und der Statur eines, nun ja, Unterwäschemodels hatte. Als Lily vierzehn Jahre später Elliott verließ und zurück nach New York ging, um Ambrose’ leiblichen Vater zu suchen, war niemand überrascht. Die eigentliche Überraschung bestand darin, dass der vierzehnjährige Ambrose in Hannah Lake bei Elliott blieb.
Zu dieser Zeit war Ambrose bereits eine Institution in der Kleinstadt gewesen, und die Leute nahmen an, dass das der Grund für sein Bleiben war. Er konnte einen Speer so weit werfen wie ein mystischer Krieger und durch seine Gegner auf dem Footballfeld pflügen, als ob sie aus Papier wären. Er führte seine Jugendbaseballmannschaft zur regionalen Meisterschaft und schaffte mit fünfzehn seinen ersten Slam Dunk beim Basketball. Und obwohl alle diese Dinge gebührend anerkannt wurden, waren es Ambrose Youngs Fähigkeiten auf der Matte, die ihn zu einer Berühmtheit gemacht hatten. Denn in Hannah Lake, Pennsylvania, wo die Stadt die Geschäfte für Lokalderbys schloss und die Rangliste im Staat so aufmerksam wie die Ziehung der Lotteriegewinnzahlen verfolgte, war Ringen eine Besessenheit, die man höchstens noch mit Football in Texas vergleichen konnte.
Sobald Ambrose das Mikrofon übernahm, wurde es still. Alle erwarteten ein höchst unterhaltsames Massaker der Nationalhymne. Ambrose war für seine Kraft, sein gutes Aussehen und seine sportlichen Erfolge bekannt, aber nie hatte ihn jemand singen gehört. In der Stille schwang freudige Erwartung mit. Ambrose strich sich die Haare zurück und schob die Hand in die Tasche, als ob ihm das Ganze unangenehm wäre. Dann fixierte er den Blick auf die Flagge und begann zu singen.
»Oh, say can you see by the dawn’s early light …« Wieder hörte man die Zuschauer keuchen. Nicht weil der Gesang so schlecht gewesen wäre, sondern weil Ambrose wunderbar sang. Er hatte eine Stimme, die zu ihrer Verpackung passte – weich und tief und unglaublich voll. Wenn dunkle Schokolade singen könnte, würde sie klingen wie Ambrose Young. Fern erschauerte, als sich seine Stimme wie ein Anker um sie legte, sich tief in ihrem Inneren verhakte und sie mitriss. Hinter ihren dicken Brillengläsern schloss sie die Augen und ließ den Klang über sich hinwegspülen. Es war unglaublich.
»O’er the land of the free …« Ambrose’ Stimme erreichte den höchsten Ton des Liedes, und Fern hatte das Gefühl, den Mount Everest bestiegen zu haben – so atemlos und euphorisch und triumphierend war ihr zumute. »And the home of the brave!« Um sie herum brach die Menge in lauten Jubel aus, aber Fern klammerte sich immer noch an diesen letzten Ton.
»Fern!« Ritas Stimme drang zu ihr durch. Fern aber ignorierte sie ebenso wie das Rütteln an ihrem Knie. Sie erlebte gerade einen ganz besonderen Moment. Einen Moment mit der ihrer Meinung nach schönsten Stimme auf dem Planeten.
»Fern hat gerade ihren ersten Orgasmus«, sagte eine von Ritas Freundinnen kichernd. Fern riss die Augen auf und entdeckte Rita, Bailey und Cindy Miller, die sie grinsend anstarrten. Glücklicherweise hatten die anderen um sie herum durch den Applaus und das Johlen Cindys peinliche Bemerkung nicht gehört.
Zierlich und blass, mit leuchtend roten Haaren und einem leicht zu vergessenden Aussehen war sich Fern darüber im Klaren, dass sie schnell übersehen und problemlos ignoriert werden konnte und niemals irgendjemand von ihr träumen würde. Sie war dramafrei und ohne großes Trara durch ihre Kindheit und Jugend geglitten und sich ihrer Mittelmäßigkeit sehr genau bewusst.
Wie Zacharias und Elisabet, die Eltern von Johannes dem Täufer, waren auch Ferns Eltern bereits älter gewesen, als sie plötzlich überraschend ein Kind bekamen. Der fünfzig Jahre alte Joshua Taylor, ein beliebter Pfarrer in der Kleinstadt Hannah Lake, war sprachlos gewesen, als ihm seine Frau, die er fünfzehn Jahre zuvor geheiratet hatte, unter Tränen erklärte, dass sie ein Baby erwartete. Die Kinnlade fiel ihm herunter, seine Hände zitterten, und wenn er nicht den Ausdruck stiller Freude im Gesicht seiner fünfundvierzigjährigen Ehefrau Rachel gesehen hätte, hätte er geglaubt, dass sie ihm zum ersten Mal in ihrem Leben einen Streich spielte. Sieben Monate später wurde Fern geboren, ein unerwartetes Wunder. Die ganze Stadt freute sich mit dem beliebten Paar. Fern fand es ironisch, dass sie einmal als ein Wunder gegolten hatte, da ihr Leben alles andere als magisch war.
Sie nahm die Brille ab und putzte sie mit dem Saum ihres T-Shirts, wodurch sie die amüsierten Gesichter um sich herum effektiv ausblendete. Sollten sie doch lachen. Sie fühlte sich gleichzeitig euphorisch und schwindlig, genauso wie manchmal nach einer besonders befriedigenden Liebesszene in einem ihrer Lieblingsromane. Fern Taylor liebte Ambrose Young, seit sie mit zehn Jahren seine Stimme bei einem ganz anderen Lied gehört hatte. In diesem Moment hatte er jedoch eine ganz neue Dimension der Schönheit erreicht, und Fern war überwältigt und benommen, dass ein Junge so viele Talente haben konnte.
August 1994
Fern ging hinüber zu Baileys Haus. Sie hatte bereits jedes Buch ausgelesen, das sie sich in der Woche zuvor aus der Bibliothek geholt hatte, und nun war ihr langweilig. Bailey saß wie eine Statue auf den Betonstufen, die zu seiner Haustür führten, und beobachtete etwas auf dem Weg vor ihm. Erst als Fern fast auf das Objekt seiner Faszination trat, erwachte er aus seiner Starre. Er schrie auf, und Fern quiekte, als sie die riesige braune Spinne neben ihrem Fuß entdeckte.
Langsam überquerte das Tier den breiten Betonstreifen. Bailey erzählte Fern, dass er es bereits seit einer halben Stunde beobachtete, aber niemals zu nah herangegangen war, weil es sich trotz allem um eine eklige Spinne handelte. Fern hatte noch nie zuvor ein so riesiges Exemplar gesehen. Der Körper war so groß wie ein Fünf-Cent-Stück, aber durch die langen Beine wirkte er so groß wie ein Fünfzig-Cent-Stück. Bailey schien vor Ehrfurcht ganz gebannt. Schließlich war er ja auch ein Junge und die Spinne ziemlich eklig.
Fern setzte sich neben ihn und sah zu, wie die Spinne gemächlich die Einfahrt zu Baileys Haus entlanglief. Sie bewegte sich wie ein alter Mann auf einem Spaziergang – nicht gehetzt, ohne Angst, ohne ersichtliches Ziel, ein älterer Bürger mit langen, spindeldürren Beinen, der vorsichtig seine Schritte setzt. Sie beobachteten sie und waren fasziniert von ihrer angsteinflößenden Schönheit. Die Erkenntnis traf Fern völlig überraschend – die Spinne war wunderschön, obwohl sie ihr Angst machte.
»Sie ist cool«, sagte sie bewundernd.
»Na klar. Sie ist super«, antwortete Bailey, ohne den Blick von ihr zu nehmen. »Ich wünschte, ich hätte acht Beine. Ich frage mich, warum Spiderman keine acht Beine bekommen hat, als er von dieser radioaktiven Spinne gebissen wurde. Er hat doch auch unglaubliche Sehkraft und Stärke und die Fähigkeit, ein Netz zu weben, bekommen. Warum also keine Beine? Hey! Vielleicht kann Spinnengift Muskeldystrophie heilen, und wenn ich mich von ihr beißen lasse, werde ich groß und stark«, mutmaßte Bailey und kratzte sich am Kinn, als ob er das Ganze tatsächlich in Erwägung zog.
»Hmm. Ich würde das nicht riskieren.« Fern schüttelte sich. Danach beobachteten sie wieder fasziniert die Spinne, und keiner von beiden bemerkte den Jungen, der mit seinem Fahrrad auf dem Bürgersteig herangefahren kam.
Als der Junge sah, wie still Fern und Bailey dasaßen, war sein Interesse sofort geweckt. Er stieg vom Rad, legte es ins Gras und folgte ihren Blicken bis zu einer großen braunen Spinne, die vor dem Haus über den Weg kroch. Die Mutter des Jungen hatte wahnsinnige Angst vor Spinnen und zwang ihn, sie immer sofort zu töten. Er hatte schon so viele Spinnen getötet, dass er sich inzwischen nicht mehr vor ihnen fürchtete. Vielleicht hatten ja Bailey und Fern Angst. Möglicherweise waren sie so verängstigt, dass sie sich nicht mehr rühren konnten. Er konnte ihnen helfen. Er lief auf den Weg und zerquetschte die Spinne unter seinem großen weißen Turnschuh. Fertig.
Zwei geschockte Augenpaare richteten sich auf ihn.
»Ambrose!«, rief Bailey entsetzt.
»Du hast sie umgebracht!«, flüsterte Fern erschrocken.
»Du hast sie umgebracht!«, brüllte Bailey, kämpfte sich auf die Füße und stolperte den Weg entlang. Er sah hinunter auf die braune Masse, die einmal die Spinne gewesen war, mit der er sich die vergangene Stunde beschäftigt hatte.
»Ich hab ihr Gift gebraucht!« Bailey war immer noch in seiner Vorstellung von Heilung durch Spinnen und Superhelden gefangen. Plötzlich brach er überraschend in Tränen aus.
Ambrose starrte Bailey an und beobachtete, wie dieser auf unsicheren Beinen die Stufen hochstieg und im Haus verschwand, wobei er die Tür hinter sich zuknallte. Ambrose schloss den Mund und schob die Hände in die Taschen seiner Shorts.
»Tut mir leid«, sagte er zu Fern. »Ich dachte … Ich dachte, ihr habt Angst. Ihr habt beide einfach nur dagesessen und sie angestarrt. Ich hab keine Angst vor Spinnen. Ich wollte euch bloß helfen.«
»Wollen wir sie begraben?«, fragte Fern. Ihre Augen hinter den großen Brillengläsern wirkten traurig.
»Sie begraben?«, fragte Ambrose verblüfft. »War sie ein Haustier?«
»Nein. Wir haben uns gerade erst kennengelernt«, sagte Fern ernst. »Aber vielleicht fühlt sich Bailey dann besser.«
»Warum ist er denn so traurig?«
»Weil die Spinne tot ist.«
»Und?« Ambrose wollte nicht gemein sein, er verstand es einfach nicht. Und die kleine Rothaarige mit den wirren, lockigen Haaren machte ihm auch ein bisschen Angst. Er hatte sie in der Schule gesehen und wusste, wie sie hieß. Aber sonst wusste er nichts über sie. Er fragte sich, ob sie eins von diesen besonderen Kindern war, von denen sein Vater gesagt hatte, er müsste ihnen gegenüber immer nett sein, weil sie nichts dazu könnten, dass sie besonders waren.
»Bailey hat eine Krankheit. Sie macht seine Muskeln schwach. Er stirbt vielleicht daran. Es ist schwer für ihn, wenn etwas stirbt«, sagte Fern ehrlich. Sie klang sogar ziemlich klug. Plötzlich ergaben die Ereignisse im Ringercamp diesen Sommer einen Sinn für Ambrose. Bailey durfte nicht ringen, weil er eine Krankheit hatte. Sofort fühlte sich Ambrose wieder schuldig.
Er setzte sich neben Fern. »Ich helfe dir, sie zu begraben.«
Fern war schon aufgestanden und halb hinüber zu ihrem eigenen Haus gerannt, bevor er noch den Satz vollständig ausgesprochen hatte. »Ich habe genau die richtige Schachtel dafür! Du kannst sie so lange vom Weg aufkratzen«, rief sie ihm über die Schulter hinweg zu.
Mit einem Stück Rinde aus dem Blumenbeet der Sheens hob Ambrose die Überreste der Spinne auf. Dreißig Sekunden später war Fern zurück. Sie hielt ihm eine weiße Ringschachtel hin, und Ambrose legte die Eingeweide der Spinne auf die blütenweiße Baumwolle darin. Fern machte den Deckel zu und gestikulierte feierlich. Er folgte ihr hinters Haus, und zusammen gruben sie mit den Händen in einer Ecke des Gartens ein kleines Loch in die Erde.
»Das müsste groß genug sein«, sagte Ambrose, nahm Fern das Kästchen aus der Hand und legte es in das Loch. Gemeinsam starrten sie es an.
»Sollen wir auch singen?«, fragte Fern.
»Ich kenne nur ein Spinnenlied.«
»Itsy Bitsy?«
»Ja.«
»Das kann ich auch.« Zusammen sangen Fern und Ambrose das Lied über eine Spinne, die eine Regenrinne hinuntergespült wird und eine zweite Chance erhält, als die Sonne herauskommt.
Als das Lied vorüber war, legte Fern ihre Hand in die von Ambrose. »Wir sollten ein kurzes Gebet sagen. Mein Dad ist Pfarrer. Ich weiß, wie’s geht, also mache ich das.«
Ambrose kam sich komisch vor, wie er da mit Fern Händchen hielt. Ihre Hand war feucht und schmutzig vom Ausheben des Grabes und sehr klein. Aber bevor er noch protestieren konnte, begann sie schon zu sprechen, mit zusammengekniffenen Augen, das Gesicht vor Konzentration verzerrt.
»Vater im Himmel, wir sind dankbar für alles, was du erschaffen hast. Wir haben diese Spinne sehr gerne beobachtet. Sie war cool und hat uns glücklich gemacht, bevor Ambrose sie zertreten hat. Danke, dass du selbst Hässlichem bezaubernde Schönheit gibst. Amen.«
Ambrose hatte die Augen nicht geschlossen. Er starrte Fern an. Sie öffnete die Lider, lächelte und ließ seine Hand los. Dann schob sie Erde über das weiße Kästchen, bis es vollständig bedeckt war. Ambrose suchte ein paar Steine und ordnete sie in S-Form an – für »Spinne«. Fern legte noch ein paar Steine in Form eines Bs vor Ambrose’ S.
»Wofür steht das B?«, fragte Ambrose. Vielleicht hatte die Spinne ja einen Namen gehabt, von dem er nichts wusste.
»Bezaubernde Spinne«, sagte sie schlicht. »Denn genauso werde ich sie immer in Erinnerung behalten.«
2
Mutig sein
September 2001
Fern liebte den Sommer – die faulen Tage und die vielen Stunden mit Bailey und ihren Büchern. Aber der Herbst in Pennsylvania war absolut atemberaubend. Es war noch nicht mal Mitte September, doch die Blätter begannen bereits, sich zu verfärben, und Hannah Lake war in bunte Farbspritzer getaucht, die sich mit dem tiefen Grün des ausklingenden Sommers vermischten. Das neue Schuljahr hatte begonnen. Sie waren jetzt in der zwölften Klasse, ganz oben; ein Jahr noch, ehe das echte Leben begann.
Für Bailey fand das echte Leben jedoch schon jetzt statt, in dieser Sekunde, denn jeden Tag ging es abwärts für ihn. Er wurde nicht stärker, sondern schwächer, er näherte sich nicht dem Erwachsensein, sondern dem Ende, deshalb unterschied sich sein Ausblick auf das Leben von dem aller anderen. Er war inzwischen sehr gut darin, für den Moment zu leben und den Blick nicht allzu weit in die Zukunft zu richten.
Durch seine Krankheit war Bailey nicht einmal mehr in der Lage, die Arme bis auf Brusthöhe zu heben, wodurch all die kleinen Dinge, die andere Menschen jeden Tag taten, ohne überhaupt darüber nachzudenken, für ihn unmöglich geworden waren. Seine Mutter hatte Bedenken, ihn weiterhin zur Schule zu schicken. Die meisten Kinder mit Duchenne-Muskeldystrophie schaffen es nicht über das einundzwanzigste Lebensjahr hinaus, und Baileys Tage waren gezählt. Dass er in der Schule täglich unterschiedlichen Keimen ausgesetzt war, bereitete seinen Eltern Sorge, aber da er sein Gesicht nicht berühren konnte, konnte er sich dort auch keine Keime hinwischen wie die anderen Kids, sodass er kaum einen Schultag verpasste. Mit einem Klemmbrett auf dem Schoß kam er zurecht, aber wenn er es halten musste, wurde es schwierig. Wenn es ihm aus der Hand rutschte, konnte er sich nicht bücken, um es wieder aufzuheben. Es war deutlich einfacher für ihn, an einem Computer zu arbeiten oder seinen Rollstuhl nah an einen Tisch heranzufahren und die Hände auf der Tischplatte aufzulegen. Die Hannah Lake Highschool war klein und nicht besonders üppig ausgestattet, aber mit etwas Hilfe und ein paar Veränderungen des normalen Schulalltags würde Bailey die Highschool beenden können, und das vermutlich sogar als Klassenbester.
In der zweiten Stunde hatten Bailey und Fern Mathematik. Die beiden saßen hinten an einem Tisch, der hoch genug für Bailey war. Fern war ihm als Hilfe zugeteilt, obwohl er ihr in Mathe mehr half als sie ihm. Auch Ambrose Young und Grant Nielson hatten ihre Plätze hinten, und Fern war ganz aufgeregt, so nah bei Ambrose zu sein, obwohl er nicht mal wusste, dass sie existierte und einen Meter entfernt von ihm und seinem Tisch hockte, der für jemanden von seiner Größe viel zu klein war.
Mr Hildy hatte sich verspätet. Das kam bei ihm andauernd vor, aber niemandem machte es wirklich etwas aus. Er hatte in der ersten Stunde keinen Unterricht, und deshalb fand man ihn gewöhnlich morgens mit einer Tasse Kaffee in der Hand vor dem Fernseher im Lehreraufenthaltsraum. An diesem Dienstag kam er in das Klassenzimmer gestürmt und schaltete schnurstracks das TV-Gerät an, das in einer Zimmerecke neben der Tafel hing. Die Fernseher waren neu, die Tafeln alt und die Lehrer steinalt, deshalb schenkte ihm niemand besonders viel Aufmerksamkeit, als er den Bildschirm anstarrte, auf dem gerade eine Nachrichtensendung über einen Flugzeugabsturz gezeigt wurde. Es war neun Uhr vormittags.
»Ruhe, bitte!«, blaffte Mr Hildy, und die Schüler gehorchten zögernd. Das Fernsehbild zeigte zwei große Gebäude. Aus dem einen drangen seitlich schwarzer Rauch und Feuer.
»Ist das in New York, Mr Hildy?«, fragte jemand aus der ersten Reihe.
»Hey, ist nicht Knudsen in New York City?«
»Das ist das World Trade Center«, sagte Mr Hildy. »Und das war kein Linienflugzeug, ganz egal, was die da in den Nachrichten erzählen.«
»Da kommt noch eins!«
»Noch ein Flugzeug?«
Man hörte ein vielstimmiges Aufkeuchen.
»Verdammte Schei…« Bailey verstummte, und Fern schlug sich die Hand vor den Mund, als sie alle zusahen, wie sich ein weiteres Flugzeug in die Seite des noch nicht brennenden Turms bohrte.
Die Reporter reagierten ziemlich genau wie die Schüler – geschockt, verwirrt, verzweifelt bemüht, etwas Intelligentes zu sagen, als sie voller Grauen erkannten, dass es sich hier nicht um einen Unfall handelte.
An diesem Tag fand kein Matheunterricht statt. Stattdessen sah Mr Hildys Klasse zu, wie sich vor ihren Augen die Welt veränderte. Vielleicht hielt Mr Hildy seine Zwölftklässler für alt genug, um die Fernsehbilder zu sehen und die Spekulationen zu hören.
Er war ein alter Vietnamveteran, nahm kein Blatt vor den Mund und konnte Politik nicht ausstehen. Gemeinsam mit seinen Schülern verfolgte er, wie Amerika angegriffen wurde, und zuckte nicht einmal mit der Wimper. Aber innerlich war er zutiefst erschüttert. Er wusste vermutlich besser als alle anderen, was der Preis dafür sein würde. Junge Leben. Ein Krieg stand bevor. Nach einer solchen Tat war das unvermeidlich. Unausweichlich.
»Knudsen ist doch auch in New York, oder?«, fragte jemand. »Er hat doch erzählt, dass er mit seiner Familie die Freiheitsstatue besichtigen will und noch einen ganzen Haufen andere Sachen.« Landon Knudsen war der stellvertretende Schülersprecher, Mitglied im Footballteam und in der ganzen Schule beliebt.
»Brosey, wohnt deine Mom nicht in New York?«, fragte Grant plötzlich, die Augen erschrocken aufgerissen.
Mit angespannter Miene, den Blick auf den Fernseher fixiert, nickte Ambrose. In seinem Magen wütete die Angst. Seine Mom wohnte nicht nur in New York City, sie arbeitete als Sekretärin in einer Werbeagentur im Nordturm des World Trade Centers. Immer wieder versicherte er sich selbst, dass es ihr bestimmt gut ging. Ihr Büro befand sich in einem der unteren Stockwerke.
»Vielleicht solltest du sie anrufen.« Grant sah besorgt aus.
»Das habe ich schon versucht.« Ambrose hielt sein Handy hoch, das er im Unterricht eigentlich gar nicht dabeihaben durfte, aber Mr Hildy wies ihn deswegen nicht zurecht. Alle sahen Ambrose zu, wie er es erneut versuchte.
»Besetzt. Wahrscheinlich probiert jetzt jeder anzurufen.« Er klappte das Handy zu. Niemand sprach. Es klingelte, aber alle blieben sitzen. Ein paar Schüler kamen zur dritten Stunde herein, doch die Neuigkeiten über die aktuellen Ereignisse verbreiteten sich schnell in der Schule. Der normale Stundenplan konnte es mit dem sich entfaltenden Drama nicht aufnehmen. Die neu dazugekommenen Schüler setzten sich auf die Tische oder standen an den Wänden und beobachteten wie die anderen das Geschehen auf dem Bildschirm.
Und dann kollabierte der Südturm. In einem Moment war er da, im nächsten nicht mehr. Er hatte sich in eine riesige Wolke aufgelöst, die krachend nach unten fiel – schmutzig-weiß, dick und fett, vor Schutt strotzend und vollgepackt mit Zerstörung. Jemand schrie, und alle redeten durcheinander und zeigten mit den Fingern auf den Fernseher. Fern ergriff Baileys Hand. Einige Mädchen begannen zu weinen.
Mr Hildys Gesicht war so weiß wie die Tafel, an der er seinen Lebensunterhalt verdiente. Er ließ den Blick über die in seinem Klassenraum gedrängten Schüler schweifen und wünschte sich, er hätte den Fernseher nicht angestellt. Das sollten sie nicht sehen müssen. Sie waren so jung, so unerfahren, so unschuldig. Er öffnete den Mund, um sie zu beruhigen, aber da er für leere, blödsinnige Phrasen nichts übrig hatte, war es ihm unmöglich. Es gab nichts, was er sagen konnte, das nicht eine krasse Lüge gewesen wäre oder ihnen noch mehr Angst eingejagt hätte. Es war nicht real. Konnte es einfach nicht sein. Es war eine Illusion, ein Zaubertrick, mit Spiegeln und Rauch. Aber der Turm stand nicht mehr. Als Zweites getroffen, als Erstes zusammengebrochen. Vom Aufprall bis zum Einsturz waren nur sechsundfünfzig Minuten vergangen.
Fern klammerte sich an Baileys Hand. Die pralle Wolke aus Rauch und Staub sah aus wie die Füllung von Ferns altem Teddybär. Der war ein Preis vom Rummel gewesen, gefüllt mit billiger, struppiger synthetischer Baumwolle. Sie hatte Bailey damit mal an den Kopf geschlagen, dabei war der rechte Arm des Teddys abgerissen. Daraufhin hatte der Bär in alle Richtungen struppiges weißes Zeug von sich gespuckt. Aber das hier war kein Rummel. Das hier war eine Horrorshow mit allem, was dazugehört, einem Labyrinth aus Straßen voller aschebedeckter Menschen. Wie Zombies. Aber diese Zombies weinten und riefen um Hilfe.
Als die Nachricht bekannt wurde, dass ein Flugzeug kurz vor Shanksville abgestürzt war, nur fünfundsechzig Meilen von Hannah Lake entfernt, verließen die ersten Schüler das Klassenzimmer. Sie konnten es nicht mehr ertragen. Gruppenweise rannten sie aus der Schule. Sie brauchten die Bestätigung, dass das Leben in Hannah Lake noch da war; sie brauchten ihre Familien. Ambrose Young blieb in Mr Hildys Klassenzimmer sitzen und beobachtete, wie eine Stunde nach dem Südturm der Nordturm einstürzte. Seine Mutter ging immer noch nicht ans Telefon. Wie sollte sie auch, wenn er jedes Mal nur ein komisches Pfeifen als Antwort erhielt, sobald er versuchte, sie anzurufen? Er ging in den Trainingsraum der Ringer. In der hintersten Ecke, wo er sich am sichersten fühlte, setzte er sich auf eine zusammengerollte Matte und schickte ein unbeholfenes Gebet zum Himmel. Es schien ihm nicht richtig, Gott um irgendwas zu bitten, wenn der offensichtlich gerade alle Hände voll zu tun hatte. Nach einem erstickten »Amen« versuchte er erneut, seine Mutter zu erreichen.
Juli 1994
Hoch oben auf der klapprigen braunen Tribüne saßen Fern und Bailey und schlürften das lila Wassereis, das sie sich aus dem Gefrierschrank im Lehreraufenthaltsraum stibitzt hatten. Mit der Faszination der Ausgeschlossenen sahen sie hinunter auf die sich windenden und zupackenden Ringer auf der Matte. Baileys Dad, der Highschool-Coach der Ringer, hielt sein jährliches Ringercamp ab, und keiner von beiden nahm daran teil. Mädchen wurden nicht zum Ringen ermutigt, und Baileys Krankheit hatte begonnen, seine Gliedmaßen deutlich zu schwächen.
Im Prinzip war Bailey schon mit seiner maximalen Muskelmasse geboren worden, deshalb mussten seine Eltern sorgfältig auswählen, an wie vielen Aktivitäten er teilnehmen konnte. Zu viele, und seine Muskeln würden zerreißen. Bei normalen Menschen reparierten sich gerissene Muskeln von selbst und wurden dadurch letztendlich sogar stärker und größer als zuvor. Baileys Muskeln konnten sich jedoch nicht heilen. Zu wenig unternehmen durfte er auch nicht, sonst würden die Muskeln, die er hatte, noch schneller schwächer werden. Seit die Duchenne-Muskeldystrophie bei ihm mit vier Jahren diagnostiziert worden war, hatte Baileys Mutter seine Aktivitäten wie ein Feldwebel überwacht. Sie hatte ihn dazu gezwungen, im Wasser eine Rettungsweste zu tragen, obwohl er wie ein Fisch schwimmen konnte; sie hatte Mittagsruhe und Auszeiten und ruhige Spaziergänge im Leben ihres lebhaften kleinen Jungen angeordnet, damit ihm der Rollstuhl so lange wie möglich erspart blieb. Und bisher hatten sie dem Schicksal ein Schnippchen geschlagen. Mit zehn Jahren saßen die meisten Kinder mit Duchenne bereits im Rollstuhl, aber Bailey konnte immer noch laufen.
»Ich bin vielleicht nicht so stark wie Ambrose, aber ich könnte ihn bestimmt schlagen«, sagte Bailey und beobachtete das Match unter ihnen mit zusammengekniffenen Augen. Ambrose Young fiel auf wie ein bunter Hund. Er war in derselben Klassenstufe wie Bailey und Fern, aber schon elf, also einer der Ältesten in der Klasse, und er überragte seine Altersgenossen um etwa zehn Zentimeter. Er kämpfte mit ein paar älteren Jungs vom Highschool-Team, die beim Camp aushalfen, und konnte sich behaupten. Coach Sheen sah ihm vom Rand aus zu, rief Anweisungen und griff ab und zu ein, um eine Bewegung oder einen Griff zu demonstrieren.
Fern schnaubte und leckte weiter ihr Eis. Sie wünschte sich, sie hätte ein Buch dabei. Ohne das Eis wäre sie schon längst gegangen. Schwitzende Jungs interessierten sie nicht besonders.
»Du könntest Ambrose nicht besiegen, Bailey. Aber mach dir nichts draus. Ich könnte ihn auch nicht schlagen.«
Wütend sah Bailey sie an. Er hatte sich so schnell zu ihr umgedreht, dass ihm das Eis aus der Hand gerutscht und von seinem knochigen Knie abgeprallt war.
»Ich habe vielleicht keine großen Muskeln, aber ich bin superschlau und ich kenne alle Techniken. Mein Dad hat mir alle Bewegungen und Griffe gezeigt, und er sagt, ich habe einen großartigen Ringerverstand!«, plapperte er seinem Dad nach. Sein Mund hatte sich missbilligend nach unten verzogen. Das Eis war vergessen.
Fern tätschelte ihm das Knie und leckte weiter. »Das sagt dein Dad, weil er dich liebt. Genauso wie mir meine Mom immer sagt, dass ich hübsch bin, weil sie mich lieb hat. Ich bin nicht hübsch … und du kannst Ambrose nicht schlagen, Kumpel.«
Plötzlich stand Bailey auf. Er schwankte ein bisschen, und Fern drehte sich vor Angst der Magen um, als sie sich vorstellte, wie er die Tribüne hinunterstürzte.
»Du bist nicht hübsch!«, brüllte Bailey und sofort kochte Fern vor Wut. »Aber mein Dad würde mich nie so anlügen wie deine Mom dich. Wart nur ab! Wenn ich groß bin, werde ich der stärkste, beste Ringer auf der Welt sein!«
»Meine Mom sagt, du bist längst tot, ehe du groß bist!«, schrie Fern zurück. Sie wiederholte die Worte, die sie von ihren Eltern aufgeschnappt hatte, wenn die glaubten, sie wären unbelauscht.
Baileys Gesicht wurde aschfahl, und er begann, die Tribüne hinunterzuklettern. Er klammerte sich an das Geländer und stakste taumelnd nach unten. Fern spürte, wie ihr Tränen in die Augen schossen und auch ihr Gesicht die Farbe von Baileys annahm. Sie folgte Bailey, obwohl er sich weigerte, sie noch einmal anzusehen. Auf dem Heimweg weinten sie beide. Bailey fuhr sein Rad so schnell er konnte und sah Fern nicht ein einziges Mal an, ignorierte völlig ihre Gegenwart. Fern fuhr neben ihm her und wischte sich immer wieder die Nase mit ihren klebrigen Händen ab.
Mit von Rotz und lila Wassereis verschmiertem Gesicht beichtete sie stammelnd ihrer Mutter, was sie gesagt hatte. Ferns Mutter nahm sie schweigend bei der Hand, und sie gingen hinüber zu Baileys Haus.
Ferns Tante Angie, Baileys Mutter, saß mit dem Jungen auf dem Schoß auf der Veranda und redete leise auf ihn ein, als Fern mit ihrer Mutter die Stufen heraufkam. Rachel Taylor glitt in den danebenstehenden Schaukelstuhl und zog auch Fern auf ihren Schoß. Angie sah zu Fern hinüber und lächelte ein bisschen, als sie die tränenverschmierten Wangen mit den lila Streifen sah. Bailey versteckte sein Gesicht an ihrer Schulter. Fern und Bailey waren eigentlich beide ein bisschen zu alt, um bei ihren Müttern auf dem Schoß zu sitzen, aber in dieser Situation schien es genau richtig.
»Fern«, sagte Tante Angie leise. »Ich habe Bailey gerade gesagt, dass es stimmt. Er wird sterben.«
Sofort begann Fern wieder zu weinen, und ihre Mutter zog sie an die Brust. Fern spürte den Herzschlag ihrer Mutter an ihrer Wange, aber das Gesicht ihrer Tante blieb ruhig, und sie weinte nicht. Offensichtlich war sie bereits an einen Punkt der Akzeptanz gekommen, an den Fern erst viele Jahre später gelangen würde. Bailey schlang die Arme um seine Mutter und heulte.
Tante Angie rieb ihrem Sohn über den Rücken und küsste ihn auf den Kopf. »Bailey? Hörst du mir mal einen Moment zu?«
Bailey weinte immer noch, als er das Gesicht hob und erst seine Mutter und dann Fern ansah, als wäre das alles ihre Schuld.
»Du wirst sterben, und ich werde sterben, und Fern wird sterben. Hast du das gewusst, Bailey? Tante Rachel wird auch sterben.« Angie sah Ferns Mutter entschuldigend an, weil sie sie in die düstere Prognose miteinbezog.
Entsetzt blickten sich Bailey und Fern an. Der Schock hatte die Tränen versiegen lassen.
»Jedes Lebewesen stirbt, Bailey. Manche leben länger als andere. Wir wissen, dass deine Krankheit dein Leben wahrscheinlich kürzer machen wird als das von anderen. Aber keiner von uns weiß, wie lange wir leben werden.«
Bailey sah zu ihr auf. Ein Teil des Entsetzens und der Verzweiflung waren aus seinem Gesichtsausdruck verschwunden. »Wie Grandpa Sheen?«
Angie nickte und drückte ihm einen Kuss auf die Stirn. »Ja. Dein Großvater hatte keine Muskeldystrophie. Aber er hatte einen Autounfall, stimmt’s? Er hat uns früher verlassen, als uns lieb war, aber so ist das Leben. Wir können uns nicht aussuchen, wie wir gehen oder wann wir gehen. Keiner von uns.« Angie sah ihrem Sohn direkt in die Augen und wiederholte bestimmt: »Hast du das verstanden, Bailey? Keiner von uns.«
»Also stirbt Fern vielleicht vor mir?«, fragte Bailey hoffnungsvoll.
Fern spürte, wie die Brust ihrer Mutter vor unterdrücktem Gelächter zuckte, und sah überrascht zu ihr auf. Rachel Taylor biss sich lächelnd auf die Lippe. Plötzlich verstand Fern, was Tante Angie da tat.
»Ja!«, unterbrach Fern und nickte. Ihre Locken hüpften stürmisch. »Vielleicht ertrinke ich in der Badewanne, wenn ich heute Abend bade. Oder ich falle die Treppe hinunter und breche mir das Genick, Bailey. Oder ich werde morgen von einem Auto zerquetscht, wenn ich mit dem Rad fahre. Siehst du? Du musst nicht traurig sein. Früher oder später müssen wir alle abkratzen!«
Angie und Rachel kicherten, und Bailey nahm mit breitem Grinsen sofort den Faden auf. »Oder vielleicht fällst du vom Baum in eurem Garten, Fern. Oder vielleicht liest du so viele Bücher, dass dein Kopf explodiert!«
Angie legte die Arme fest um ihren Sohn und lachte. »Ich denke, das reicht, Bailey. Wir wollen doch nicht wirklich, dass Ferns Kopf explodiert, oder?«
Bailey sah hinüber zu Fern, und alle erkannten, dass er ernsthaft darüber nachdachte. »Ich schätze nicht. Aber ich hoffe trotzdem, dass sie vor mir abkratzt.« Dann forderte er Fern zu einem Ringkampf auf dem Rasen heraus, den er nach etwa fünf Sekunden gewonnen hatte. Wer weiß? Vielleicht hätte er ja Ambrose Young tatsächlich schlagen können.
2001
In den Tagen und Wochen, die auf die Anschläge vom elften September folgten, kehrte das Leben zum Normalzustand zurück, aber es fühlte sich falsch an. So als ob man sein Lieblings-T-Shirt links herum anhat – es ist immer noch dasselbe T-Shirt, aber es kratzt überall, die Nähte sind sichtbar, das Etikett hängt heraus, die Farben sind blasser, die Aufschrift spiegelverkehrt. Aber anders als beim T-Shirt ließ sich der neue Normalzustand nicht korrigieren. Er war dauerhaft.
Bailey verfolgte die Nachrichten gleichermaßen mit Faszination und Entsetzen und tippte stundenlang an seinem Computer. Er füllte viele Seiten mit seinen Beobachtungen, protokollierte die Ereignisse, dokumentierte die Videoaufnahmen und die zahllosen Tragödien mit seinen eigenen Worten. Wo Fern sich in Liebesromanen verlieren konnte, verlor sich Bailey in Geschichte. Sogar als Kind war er tief in Erzählungen aus der Vergangenheit eingetaucht und hatte sich in die tröstliche Gewissheit ihrer Zeitlosigkeit und Langlebigkeit eingehüllt. Von König Arthur zu lesen, der vor mehr als tausend Jahren gestorben war, vermittelte ihm ein Gefühl von Unsterblichkeit. Für einen Jungen, dem die Zeit in einem endlosen Countdown wie Sandkörner durch die Finger rann, war Unsterblichkeit eine berauschende Vorstellung.
Seit er schreiben konnte, hatte Bailey peinlich genau Tagebuch geführt. Die Bücher füllten in seinem Schlafzimmer ein ganzes Regal und standen neben den Geschichten anderer Männer. Sie bedeckten die Wände mit den Höhepunkten eines jungen Lebens, den Gedanken und Träumen eines aktiven Geistes. Trotz seiner Besessenheit, geschichtliche Ereignisse zu dokumentieren, schien Bailey der Einzige zu sein, der gut mit der Situation zurechtkam. Er zeigte weder mehr Angst noch andere Gefühlsregungen als sonst. Er hatte Spaß an den Dingen, die ihm schon immer Spaß gemacht hatten, piesackte Fern wie gewöhnlich, und wenn Fern die Ereignisse auf dem Fernsehbildschirm nicht mehr ertragen konnte, war er derjenige, der sie durch Gespräche von der emotionalen Klippe herunterholen konnte, auf der alle entlangzutaumeln schienen.
Fern hingegen brach schneller in Tränen aus, hatte mehr Angst und war anhänglicher geworden, und das nicht als Einzige. Ein durchdringendes Gefühl von Wut und Trauer durchzog jedermanns Alltag. Der Tod war sehr real geworden, und die Zwölftklässler an der Hannah Lake Highschool waren verbittert und besorgt. Es war ihr Abschlussjahr! Es hätte die schönste Zeit ihres Lebens sein sollen. Sie wollten keine Angst haben müssen.
»Ich wünschte, das Leben wäre mehr so wie in meinen Büchern«, beschwerte sich Fern, während sie versuchte, sich nach Unterrichtsschluss sowohl ihren eigenen als auch Baileys Rucksack auf die schmalen Schultern zu hieven. »In Büchern sterben die Hauptfiguren nie. Sonst wäre die Geschichte ruiniert oder vorbei.«
»Jeder ist für irgendjemanden die Hauptfigur«, philosophierte Bailey und manövrierte sich durch die vollen Flure und den am nächsten gelegenen Ausgang hinaus in den Novembernachmittag. »Es gibt keine Nebendarsteller. Stell dir doch mal vor, wie sich Ambrose gefühlt haben muss, als wir bei Mr Hildy die Nachrichten gesehen haben. Seine Mom arbeitete in einem der beiden Türme. Er sitzt da, sieht alles im Fernsehen und fragt sich vermutlich, ob er da gerade zusieht, wie seine Mutter stirbt. Für uns ist sie vielleicht eine Nebenfigur, aber für ihn ist sie die weibliche Hauptdarstellerin.«
Fern grübelte über seine Worte nach und schüttelte den Kopf beim Gedanken an die Erinnerung. Sie hatten damals alle erst später erfahren, wie nahe Ambrose Young die Anschläge gegangen, wie persönlich sie für ihn gewesen waren. Er hatte so gefasst gewirkt, so still, wie er da im Matheunterricht saß und immer wieder eine Nummer wählte, unter der nie abgenommen wurde. Keiner von ihnen hatte auch nur die leiseste Ahnung gehabt. Mehr als fünf Stunden nach dem Einsturz der Türme hatte ihn Coach Sheen im Ringerraum gefunden. Alle anderen waren längst nach Hause gegangen.
»Ich kann sie nicht erreichen, Coach«, hatte Ambrose geflüstert, als ob die Steigerung der Lautstärke seine Selbstkontrolle zum Zersplittern bringen würde. »Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sie arbeitet im Nordturm. Den gibt es jetzt nicht mehr. Was, wenn es sie jetzt auch nicht mehr gibt?«
»Dein Vater macht sich wahrscheinlich Sorgen und fragt sich, wo du steckst. Hast du mit ihm gesprochen?«
»Nein. Er macht sich mit Sicherheit selbst schon verrückt. Er tut so, als ob er sie nicht mehr liebt. Aber ich weiß, dass das nicht stimmt. Ich will nicht mit ihm reden, bevor ich gute Neuigkeiten habe.«
Coach Sheen blieb neben dem Jungen sitzen, der ihn überragte, und legte ihm die Arme um die Schultern. Wenn Ambrose noch nicht bereit war, nach Hause zu gehen, dann würde er gemeinsam mit ihm warten. Er redete über belanglose Dinge – die bevorstehende Wettkampfsaison, die Jungs in Ambrose’ Gewichtsklasse, die Stärken der Teams in ihrem Bezirk. Zusammen mit Ambrose entwarf er Strategien für die anderen Jungs in der Mannschaft und lenkte ihn mit Belanglosigkeiten ab, während die Minuten vorüberrannen. Und Ambrose hatte seine Gefühle unter Kontrolle, bis sein Handy in ein schrilles Klingeln ausbrach, das sie beide zusammenzucken und in ihre Taschen greifen ließ.
»Sohn?« Elliotts Stimme war laut genug, dass auch Mike Sheen sie hören konnte. Sein Herz krampfte sich aus Angst vor den Worten, die noch nicht gesagt worden waren, zusammen. »Es geht ihr gut, Brosey. Es geht ihr gut. Sie kommt her.«
Ambrose versuchte zu sprechen und seinem Dad für die gute Nachricht zu danken, aber er war nicht in der Lage dazu. Er stand auf und reichte dem Coach sein Handy. Dann ging er ein paar Schritte und setzte sich überwältigt erneut hin. Mike Sheen versicherte Elliott, dass er ihn sofort nach Hause bringen würde, klappte das Handy zu und legte den Arm um die zitternden Schultern seines Ringerstars. Ambrose brach nicht in Tränen aus, aber er zitterte, als hätte er Fieber oder eine Schüttellähmung, und einen Moment lang befürchtete Mike Sheen, dass die Emotionen und der Stress des Tages den Jungen ernstlich krank gemacht hatten. Irgendwann legte sich das unkontrollierbare Zittern, und sie verließen gemeinsam den Raum, machten die Lichter hinter sich aus und schlossen die Tür nach diesem qualvollen Nachmittag – dankbar dafür, dass ihnen an einem Tag mit einer beispiellosen Tragödie eine Atempause vergönnt worden war.
»Mein Dad macht sich Sorgen um Ambrose«, sagte Bailey. »Er sagt, er ist anders und wirkt abwesend. Mir ist aufgefallen, dass er zwar genauso intensiv trainiert wie sonst auch, aber irgendwas stimmt nicht mit ihm.«
»Die Ringkampfsaison hat erst vor zwei Wochen begonnen.« Fern verteidigte Ambrose, obwohl sie das nicht musste, denn er hatte keinen größeren Fan als Bailey Sheen.
»Aber der elfte September ist schon zwei Monate her, Fern. Und er ist immer noch nicht darüber weg.«
Fern blickte zum grauen Himmel hinauf, der aufgrund des vorhergesagten Sturms düster und unruhig über ihren Köpfen hing. Die Wolken wirbelten umher, der Wind nahm gerade Fahrt auf. Der Sturm war im Anmarsch.
»Keiner von uns ist das, Bailey. Und ich glaube nicht, dass wir es jemals sein werden.«
3
Eine Tarnung erfinden
Lieber Ambrose,
du bist verdammt heiß und auch ein unglaublich guter Ringer. Du gefällst mir echt total! Wollen wir vielleicht mal zusammen abhängen?
xxRita
Fern runzelte die Stirn angesichts des kindlichen Textes und sah in Ritas hoffnungsvolles Gesicht. Fern war nicht die Einzige, der Ambrose aufgefallen war. Bisher hatte er allerdings nicht viele Freundinnen gehabt, was vielleicht daran lag, dass er sich so intensiv mit dem Ringen beschäftigte, dauernd reisen musste und in jeder freien Minute trainierte. Dass er nicht so einfach verfügbar war, erhöhte seinen Reiz noch, und Rita hatte beschlossen, sich ihn zu schnappen. Nun zeigte sie Fern den Brief, den sie ihm geschrieben hatte – auf pinkem Papier, mit Herzchen und viel Parfüm. »Äh, ja, das ist so in Ordnung, Rita. Aber möchtest du denn nicht originell sein?«
Rita zuckte mit den Schultern und wirkte verwirrt. »Ich will doch nur, dass er mich mag.«
»Aber du hast ihm doch einen Brief geschrieben, weil du seine Aufmerksamkeit erregen willst, richtig?«
Rita nickte energisch. Fern sah in ihr engelsgleiches Gesicht, auf die blonden Haare, die um ihre schmalen Schultern und die perfekten Brüste schwangen, und fühlte einen Anflug von Verzweiflung. Sie war sich ziemlich sicher, dass Rita die Aufmerksamkeit von Ambrose bereits erregt hatte.
1994
»Sie ist so ein schönes Mädchen«, hörte Fern ihre Mutter in der Küche sagen. Sie unterhielt sich mit Tante Angie, die neben der Fliegengittertür saß und Bailey und Rita beim Schaukeln im Garten zusah. Fern befand sich auf dem Weg zur Toilette, aber sie war durch die Garage hereingekommen und nicht durch die Tür, weil sie nach der Schildkröte sehen wollte, die sie und Bailey an diesem Morgen am Bach gefangen hatten. Sie saß in einer Kiste mit Blättern und allem anderen, was eine Schildkröte möglicherweise brauchen könnte. Sie hatte sich bisher nicht bewegt, und Fern fragte sich, ob es vielleicht ein Fehler gewesen war, sie von ihrem Zuhause mitzunehmen.
»Sie sieht fast unwirklich aus.« Ferns Mutter schüttelte den Kopf und lenkte damit Ferns Aufmerksamkeit von der Schildkröte auf sich. »Diese hellen blauen Augen und diese perfekten Züge. Wie eine Puppe.«
»Und die Haare! Weiß von den Wurzeln bis zu den Spitzen. Ich glaube, so was hab ich noch nie gesehen«, sagte Angie. »Und trotzdem ist sie ganz braun. Sie hat diese seltene Kombination aus weißblonden Haaren und goldbrauner Haut.«
Fern stand betreten im Flur und belauschte die beiden Frauen, die über Rita sprachen und dachten, sie wäre noch im Garten. Rita war in diesem Sommer mit ihrer Mutter nach Hannah Lake gezogen, und Rachel Taylor, durch und durch Pfarrersfrau, hatte als Erste die junge Mutter und ihre zehnjährige Tochter willkommen geheißen. Es dauerte nicht lange, bis sie Einladungen zum Mittagessen aussprach und Rita einlud, mit Fern zu spielen. Fern mochte Rita. Sie war nett und fröhlich und bereit, alles mitzumachen, was Fern tat. Sie verfügte über keine besonders große Vorstellungskraft, aber Fern hatte genug für sie beide.
»Ich glaube, Bailey ist völlig hingerissen von ihr«, sagte Angie lachend. »Seitdem er sie zum ersten Mal gesehen hat, hat er nicht einmal gezwinkert. Ist schon lustig, dass Kinder genauso von Schönheit angezogen werden wie wir. Bevor ich mich versehe, fängt er womöglich noch an, ihr seine Ringerkünste zu demonstrieren, und dann muss ich mir etwas überlegen, um ihn abzulenken. Er hat Mike wieder angefleht, ihn am Ringercamp teilnehmen zu lassen. Jedes Jahr das Gleiche. Er bettelt, er weint, und wir müssen ihm erklären, warum es nicht geht.«
Stille füllte die Küche, während Angie ihren Gedanken nachzuhängen schien und Rachel Sandwiches für die Kinder machte. Auch sie war nicht in der Lage, Angie vor der Realität von Baileys Krankheit zu schützen.
»Fern scheint Rita zu mögen, oder?«, wechselte Angie nach einem Seufzer das Thema, den Blick weiterhin auf ihren Sohn fixiert, der vor- und zurückschaukelte und dabei nonstop auf das niedliche kleine Mädchen neben sich einredete. »Es ist gut für sie, wenn sie eine Freundin hat. Sie verbringt ihre gesamte Zeit mit Bailey, aber wenn sie älter wird, braucht sie auch eine Freundin.«
Nun seufzte Rachel. »Die arme Fernie.«
Fern hatte sich umgedreht, um zum Bad zu gehen, blieb aber jetzt abrupt stehen. Die arme Fernie? Erschüttert fragte sie sich, ob sie vielleicht eine Krankheit hatte, so wie Bailey, die ihre Mutter ihr verschwiegen hatte. »Die arme Fernie« klang ernst. Angestrengt lauschte sie.
»Sie ist nicht hübsch wie Rita. An ihren Zähnen muss viel gemacht werden, aber sie ist immer noch so klein und hat noch die meisten ihrer Milchzähne. Vielleicht wird es ja nicht mehr ganz so schlimm aussehen, wenn erst alle bleibenden Zähne da sind. Wenn sie weiterhin so langsam wächst, hat sie mit fünfundzwanzig noch eine Zahnspange.« Ferns Mutter lachte. »Ich habe mich gefragt, ob sie vielleicht eifersüchtig auf Rita ist. Aber bisher scheinen ihr die körperlichen Unterschiede gar nicht aufgefallen zu sein.«
»Unsere kleine, witzige Fernie«, sagte Angie. In ihrer Stimme klang ein Lächeln mit. »Es gibt kein besseres Kind auf der Welt als Fern. Sie ist der reinste Segen für Bailey. Gott hat genau gewusst, was er da tut, als er sie zu Verwandten gemacht hat, Rachel. Er hat sie einander gegeben. Ein Akt liebevoller Barmherzigkeit.«
Fern stand wie angewurzelt da. Das Wort Segen hörte sie nicht. Sie fragte sich auch nicht, was es hieß, ein Akt liebevoller Barmherzigkeit von Gott zu sein. Sie ist nicht hübsch. Die Worte klapperten und klimperten in ihrem Kopf wie scheppernde Töpfe und Pfannen. Sie ist nicht hübsch. Unsere kleine, witzige Fernie. Sie ist nicht hübsch. Die arme Fernie.
»Fern!« Rita rief ihren Namen und wedelte ihr mit der Hand vor dem Gesicht herum. »Hallo? Wo bist du denn gerade? Was soll ich schreiben?«
Fern schüttelte die Erinnerung ab. Schon komisch, wie man manche Sachen ein Leben lang nicht mehr aus dem Kopf bekam.
»Wie wäre es denn mit ›Selbst wenn du nicht da bist, bist du alles, was ich sehe. Alles, woran ich denke. Ich frage mich, ist dein Herz genauso schön wie dein Gesicht? Ist dein Geist genauso faszinierend wie das Spiel der Muskeln unter deiner Haut? Und ist es vielleicht möglich, dass du auch an mich denkst?‹« Fern machte eine Pause und sah Rita an.
Deren Augen hatten sich geweitet. »Oh, das ist gut. Ist das aus einem deiner eigenen Liebesromane?« Rita gehörte zu den wenigen Menschen, die wussten, dass Fern Liebesgeschichten schrieb und davon träumte, sie einmal zu veröffentlichen.
»Keine Ahnung. Wahrscheinlich.« Fern lächelte verlegen.
»Hier. Schreib es auf!«, quiekte Rita, zog Papier und Stift hervor und drückte Fern beides in die Hand.
Die versuchte, sich an ihre Worte zu erinnern. Beim zweiten Mal klang es sogar noch besser. Rita hüpfte kichernd auf und ab, als Fern den Liebesbrief mit einem Schnörkel abschloss. Sie unterschrieb mit Ritas Namen und gab ihr den Brief. Rita zog Parfüm aus ihrem Rucksack, spritzte etwas davon auf das Papier, faltete es und adressierte es an Ambrose.
Der Junge antwortete nicht sofort. Er brauchte sogar mehrere Tage für seine Antwort. Aber am vierten Tag lag ein Umschlag in Ritas Spind. Mit zitternden Händen öffnete sie ihn und las ihn still mit zusammengezogenen Augenbrauen. Dabei krallte sie sich in Ferns Arm, als ob sie gerade den Hauptgewinn bei der Lotterie gezogen hätte.
»Fern! Hör zu!«, hauchte sie.
»In ihrer Schönheit wandelt sie
Wie wolkenlose Sternennacht;
Vermählt auf ihrem Antlitz sieh’
Des Dunkels Reiz, des Lichtes Pracht.«
Ferns Augenbrauen schossen in die Höhe und verschwanden unter ihren viel zu langen Ponyfransen.
»Er ist fast so gut im Schreiben wie du, Fern!«
»Besser sogar«, sagte Fern trocken und blies sich eine Haarsträhne aus den Augen. »Auf jeden Fall ist der Typ besser, der sich das ausgedacht hat.«
»Er hat einfach nur mit einem A unterschrieben«, flüsterte Rita. »Er hat mir ein Gedicht geschrieben! Ich kann es nicht fassen!«
»Äh, Rita? Das ist von Lord Byron. Es ist sehr berühmt.«
Rita zog ein langes Gesicht, und Fern beeilte sich, sie zu trösten.
»Aber es ist ganz toll, dass Ambrose … Lord Byron … zitiert … in einem Brief an dich, wirklich«, versicherte sie stockend. Tatsächlich war es toll. Fern glaubte nicht, dass es viele Achtzehnjährige gab, die regelmäßig berühmte Gedichte für hübsche Mädchen zitierten. Plötzlich war sie sehr beeindruckt. Rita auch.
»Wir müssen ihm antworten! Auch mit einem berühmten Gedicht?«
»Vielleicht«, überlegte Fern, den Kopf zur Seite geneigt.
»Ich könnte selbst ein Gedicht schreiben.« Einige Sekunden lang sah Rita zweifelnd aus, aber dann ging ein Strahlen über ihr Gesicht, und sie setzte zum Sprechen an.
»Aber nicht so was wie ›Rosen sind rot, Veilchen sind blau‹«, warnte Fern, die instinktiv wusste, was gleich gekommen wäre.
»Ach Mensch«, schmollte Rita und schloss den Mund wieder. »Ich wollte gar nichts über Veilchen sagen. Sondern: ›Rosen sind rot, und manchmal nicht, ich will dich küssen, glaube ich‹.«
Fern kicherte und gab ihrer Freundin einen kleinen Klaps auf den Arm. »Das kannst du nicht schreiben, nachdem er dir gerade ›In ihrer Schönheit wandelt sie …‹ geschickt hat.«
»Es klingelt gleich.« Rita knallte ihren Spind zu. »Schreibst du mir bitte was, Fern? Bitte, bitte, biiiiiiiiitte! Du weißt doch, dass mir nichts Gutes einfallen wird.« Rita sah Ferns Zögern und bettelte so lange weiter, bis sie nachgab. Und so begann Fern Taylor, Liebesbriefe an Ambrose Young zu schreiben.
1994
»Was machst du denn da?«, fragte Fern, ließ sich auf Baileys Bett fallen und sah sich um. Sie war schon eine Weile nicht mehr in seinem Zimmer gewesen. Normalerweise spielten sie draußen oder im Wohnzimmer. In seinem Zimmer hingen überall Fanartikel von Ringermannschaften, die meisten von der Penn State University. Zwischen dem Blau und Weiß waren Bilder seiner Lieblingssportler verteilt, Schnappschüsse seiner Familie bei verschiedenen Aktivitäten und stapelweise Bücher über alle möglichen Themen von Geschichte über Sport bis hin zu griechischer und römischer Mythologie.
»Ich mache eine Liste«, sagte Bailey knapp, ohne aufzusehen.
»Was für eine Liste?«
»Von den Dingen, die ich machen möchte.«
»Was hast du denn bis jetzt alles?«
»Das sag ich dir nicht.«
»Warum nicht?«
»Weil manches davon privat ist«, sagte Bailey sachlich, ohne es böse zu meinen.
»Schön. Vielleicht mache ich auch eine Liste, und dann sag ich dir auch nicht, was draufsteht.«
»Mach nur.« Bailey lachte. »Aber ich kann vermutlich sowieso alles erraten, was du aufschreibst.«
Fern schnappte sich ein Stück Papier von Baileys Schreibtisch und nahm sich einen Stift mit Penn-State-Schriftzug aus einer Dose mit Kleingeld, Steinen und anderem Krimskrams auf seinem Nachttisch. Ganz oben auf das Blatt schrieb sie LISTE und starrte dann auf das Papier.
»Verrätst du mir nicht wenigstens einen einzigen Punkt auf deiner Liste?«, fragte sie kleinlaut, nachdem sie einige Minuten lang auf ihr Blatt gestarrt hatte, ohne auch nur die winzigste aufregende Idee zu haben.
Bailey seufzte, ein riesiger Luftstoß, der eher nach einem gestörten Erwachsenen klang als nach einem zehnjährigen Jungen. »Also gut. Aber einige der Dinge auf meiner Liste werde ich vielleicht nicht jetzt sofort machen. Vielleicht, wenn ich älter bin … aber ich will sie trotzdem noch machen. Ich werde sie machen!«, betonte er.
»Okay. Verrat mir eins«, bat Fern. Obwohl sie eine lebhafte Fantasie hatte, fiel ihr nichts ein, was sie gerne einmal tun wollte. Vielleicht, weil sie jeden Tag in ihren Büchern auf neue Abenteuer ging und durch die Figuren in den Geschichten lebte, die sie schrieb.
»Ich möchte ein Held sein.« Bailey sah Fern so ernst an, als würde er ihr geheime Informationen weitergeben. »Ich weiß aber noch nicht, was für einer. Vielleicht wie Herkules oder Bruce Baumgartner.«
Fern wusste, wer Herkules war, und sie wusste auch, um wen es sich bei Bruce Baumgartner handelte, denn er war einer von Baileys Lieblingsringern. Laut Bailey gehörte er zu den besten Schwergewichtlern aller Zeiten. Sie sah ihren Cousin zweifelnd an, behielt ihre Meinung aber für sich. Herkules war nicht real, und Bailey würde niemals so groß und stark wie Bruce Baumgartner sein.
»Und wenn ich nicht so ein Held sein kann, dann rette ich vielleicht einfach jemanden«, fuhr Bailey fort, dem Ferns mangelndes Vertrauen nicht aufgefallen war. »Dann wäre mein Foto in der Zeitung, und alle wüssten, wer ich bin.«
»Ich will gar nicht, dass alle wissen, wer ich bin«, sagte Fern nach einigem Nachdenken. »Ich möchte eine berühmte Schriftstellerin werden, aber vermutlich unter einem Pseudonym. Ein Pseudonym ist ein Name, den man benutzt, wenn niemand erfahren soll, wer man wirklich ist«, schob sie noch für den Fall nach, dass Bailey das nicht wusste.
»Dann kannst du deine Identität geheim halten, so wie Superman«, flüsterte er, als ob Ferns Geschichten gerade einen ganz neuen Grad an Coolness gewonnen hätten.
»Und niemand wird je erfahren, dass ich sie schreibe«, sagte sie leise.
Es waren keine gewöhnlichen Liebesbriefe. Es waren Liebesbriefe, weil Fern darin ihr Herz und ihre Seele ausschüttete, und Ambrose schien das Gleiche zu tun. Er antwortete mit einer Ehrlichkeit und Verletzlichkeit, die sie nicht erwartet hatte. Fern zählte nicht die Dinge auf, die sie/Rita an ihm mochte – sie schwärmte nicht von seinem Aussehen, seinen Haaren, seiner Kraft, seinem Talent. Das hätte sie gekonnt, aber sie war mehr an jenen Dingen interessiert, die sie nicht schon von ihm wusste. Deshalb wählte sie ihre Worte sorgfältig und stellte Fragen, die ihr Zugang zu seinen innersten Gedanken gewähren würden. Sie wusste, dass das Ganze eine Scharade war. Aber sie konnte sich nicht zurückhalten.