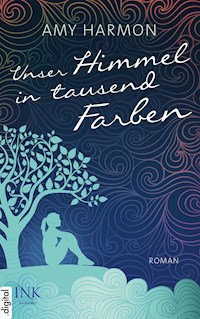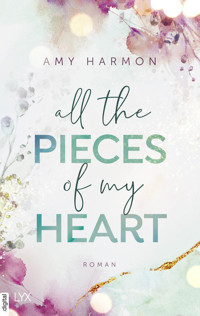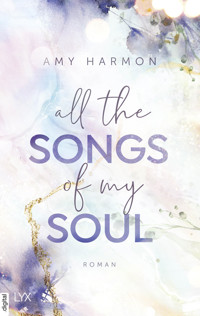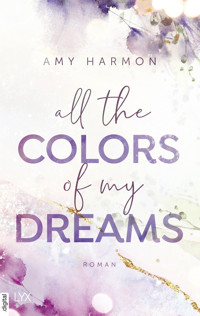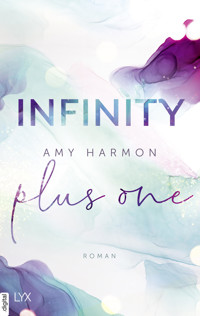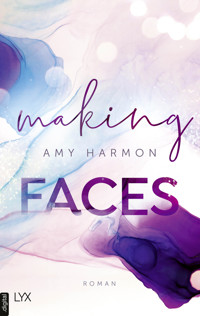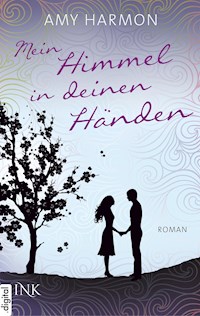9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Bird-and-Sword-Reihe
- Sprache: Deutsch
"Kein Geheimnis, kein Kummer, nichts verborgen und verlor’n. Sahen nicht, was sein würde oder was war - sahen nur das Jetzt und Hier. Sie sah ihn. Er sah sie. Und nichts außerdem."
Kjell von Jeru kannte seinen Platz - Soldat, Krieger der Krone, Bastardbruder des Königs - und war damit zufrieden. Doch seitdem er seine Gabe als Heiler erkannt hat, ist die einfache Ordnung seiner Welt aus den Fugen geraten. Als er eine junge Frau sterbend in der Wildnis findet, rettet er ihr mithilfe seiner Kräfte das Leben. Die geheimnisvolle Sasha, die nichts über ihre Vergangenheit weiß, hält sein Herz vom ersten Moment an ihn ihren Händen, ganz gleich, wie sehr er sich dagegen wehrt. Doch als Sashas wahre Identität ans Licht kommt, droht ihre Liebe an der Wirklichkeit zu zerbrechen ...
"Ich bin so überwältigt von diesem Buch, dass ich weinen möchte." Natasha's Book Junkie Blog
Band 2 der "Bird & Sword"-Reihe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchKarteMottoAussprache der NamenWidmungProlog1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. Kapitel18. Kapitel19. Kapitel20. Kapitel21. Kapitel22. Kapitel23. KapitelEpilogDanksagungDie AutorinDie Romane von Amy Harmon bei LYXImpressumAMY HARMON
Queen and Blood
Roman
Ins Deutsche übertragen von Corinna Wieja
Zu diesem Buch
Kjell von Jeru kannte seinen Platz – Soldat, Krieger der Krone, Bastardbruder des Königs – und war damit zufrieden. Doch seit dem furchtbaren Krieg gegen die Vogelmenschen ist nichts, wie es war. Kjell ist nicht mehr länger nur ein Krieger, der die Krone verteidigt. Nun ist Kjell ein Heiler, einer der Begabten, ein Mann mit einer Kraft, die er nicht versteht und nicht anzunehmen weiß. Als er von seinem König den Auftrag erhält, das Land von den letzten der grausamen Vogelmenschen zu befreien, findet er eine junge Frau sterbend am Fuße einer Klippe. Mit all seiner Kraft gelingt es Kjell, sie ins Leben zurückzuholen. Die geheimnisvolle Sasha besitzt keine Erinnerung daran, wer sie ist oder woher sie kommt. Sie weiß nur, dass sie Kjell seit jeher in ihren Visionen gesehen hat. Und seit dem Moment, als er sein innerstes Selbst öffnen musste, um sie zu heilen, scheint sie ein Teil von ihm zu sein. Sie hält Kjells Herz in ihren Händen und bleibt unbeirrt an seiner Seite, ganz gleich, wie sehr sich der verschlossene Krieger dagegen wehrt. Doch als Sashas wahre Identität ans Licht kommt, droht ihre Liebe an der Wirklichkeit zu zerbrechen. Von Neuem muss sich Kjell von Jeru fragen, wer er ist – und wer er sein will …
Er aber wird zu der Zeit schwören und sagen: Ich bin kein Arzt. Setzt mich nicht zum Fürsten im Volk!
Jesaja 3.7
Ausspracheder Namen
Aren – EHR an
Ariel – AH rie el
Bale – Behl
Bin Dar – BIN Dahr
Brisson – BRIS sen
Caarn – KAHRN
Corvar – KOHR vahr
Corvyn – KOHR vin
Degn – Dehgn
Dendar – DEN dahr
Enoch – I nok
Firi – FIri
Isak – EI sak
Janda – JAHN da
Jeru – JEH ru
Jerick – JER rik
Jedah – JAY dah
Jeruvianisch – Jeh RU via nisch
Jyräisch – Ji RÄ isch
Kjell – Kjell
Kilmorda – Kil MOOR da
Koorah – KUR ah
Lark – Lahrk
Liesh – LII tsch
Lucian – LU schen
Meshara – Meh SCHAH rah
Padrig – PA drig
Quondoon – Kwahn DUN
Saoirse – SIR schah
Solemn – Soh lem
Sasha – SA scha
Tiras – TIR as
Volgar – VOHL gahr
Zoltev – ZOHL tehv
Für die Heiler
Prolog
Die Sonnenstrahlen spiegelten sich auf dem leeren Thron, tauchten den großen Saal in Streifen, lugten um Ecken und erklommen die Wände. Schweigen füllte den Raum, nur ein Flattern an der Decke durchbrach die Stille.
Ranken mit smaragdgrünen Blättern, die im Schatten fast schwarz erschienen, wanden sich um Steinmauern und an Fenstern vorbei und filterten das Licht, wodurch das Innere in ein sanftes Grün getaucht wurde. Der Palast lag im Dornröschenschlaf. Und das schon sehr lange Zeit.
Selbst die Tiere hatten ihn verlassen. Im Wald mochte es noch eine Maus oder einen Vogel geben, aber innerhalb der Palastmauern tummelten sich weder Vieh noch Pferde. Kein Hund bellte, keine Katze sonnte sich faul auf den Steinmauern. In den Ställen grunzte kein einziges Schwein, und in den Gehegen scharrten keine Hühner. Es gab nichts mehr, das Pflege bedurfte, nichts, um das man sich kümmern musste. Die Spinnen allerdings waren fleißig. Ihre zarten Netze spannten sich über Gemälde und Fackeln, hingen von Kronleuchtern und Wandteppichen und erweckten den Anschein, als hätte jemand ein Spitzentuch über alles geworfen.
Der lange Banketttisch war mit Kelchen und silbernen Tellern gedeckt. Schüsseln und Servierplatten, gefüllt mit leeren Erwartungen, standen in einer langen ordentlichen Reihe in der Mitte.
Hinter dem Hof drängten sich Bäume aller Art und Größe aneinander, die Äste verschlungen, die Stämme eng aneinandergeschmiegt wie Liebende in der Nacht. Reihe um Reihe bildeten sie einen undurchdringlichen Kreis um den Palast. Ein Wald stummer Beobachter, der lebte und doch in Zeitlosigkeit verloren war. Manche Bäume waren nur mannshoch, andere ragten hoch in den Himmel hinauf mit Stämmen breiter als der Kreis, den sechs Mädchen beim Tanz um den Maibaum bildeten. Bei genauerem Hinsehen konnte man erkennen, dass manche Bäume Gesichter hatten; Vertiefungen und Erhebungen in der Rinde verliehen ihnen Persönlichkeit und Charakter. Einer ähnelte einem schlafenden Riesen, ein anderer einem spielenden Kind.
Tage und Jahreszeiten kamen und gingen, doch die Bäume bemerkten nicht, wie viel Zeit verstrich. Sie verharrten in ihrem Schlummer, gefangen an einem Ort, an dem niemand sie berühren oder verschleppen konnte. Niemand hatte daran gedacht, sie aufzuwecken und ihnen zu sagen, dass keine Gefahr mehr bestand.
1. KAPITEL
»Alles hat seinen Ursprung. Jeder Ort. Jeder Mensch. Wir entstammen dem Bauch einer Frau, die ebenfalls dem Bauch einer Frau entstammte. Wir erben Gaben und Schwächen, wir werden in Triumph und Zwietracht geboren, in Freundlichkeit oder Gleichgültigkeit gehüllt, und wir lernen und leben mit anderen, die ihre eigene Ursprungsgeschichte, ihre eigene Last und ihre eigene Vergangenheit haben.«
Sasha sprach in einem leisen Singsang, während sie den fiebrigen Kopf ihrer Herrin kühlte und ihr dabei Geschichten erzählte, die der alten Frau Trost spenden und sie von ihren Schmerzen und ihrer Furcht ablenken sollten. Der Tod schlich bereits um die kleine steinerne Hütte, klopfte an die Tür, lugte durch die Fenster und wartete ungeduldig darauf, sich sein Opfer zu holen.
»Wie lautet deine Ursprungsgeschichte, Sasha?«, wollte die alte Frau wissen, wie schon Hunderte Male zuvor.
»Ich kenne meine Herkunft nicht, Mistress Mina«, antwortete Sasha.
»Dann musst du dich auf die Suche danach machen«, verlangte die alte Frau matt.
»Und wo soll ich suchen?«, erwiderte Sasha geduldig. Das Gespräch war schon beinahe zum Ritual geworden.
»Deine Gabe wird dich führen.«
»Warum nennt Ihr es immer wieder Gabe?«, entgegnete Sasha.
Mina seufzte. »Du weißt, warum. Du kennst die Legende. Erzähl mir die Geschichte noch einmal.«
Sasha seufzte nicht, obwohl sie die Geschichte schon so oft erzählt hatte, dass sie ihr fade und abgenutzt erschien, jeglicher Magie und Wahrheit beraubt. Ihre Herrin behauptete jedoch, dass es die Ursprungsgeschichte der ganzen Menschheit sei und daher auch Sashas.
»Mit Worten hat Gott Welten erschaffen«, begann Sasha, und die alte Frau entspannte sich. Sie schloss die Lider und lauschte der Geschichte. Sasha sprach sanft, beruhigend, und auch sie fand Trost in der Erzählung. »Mit Worten hat er Tag und Nacht erschaffen, Wasser und Luft, Bäume und Sträucher, Vögel und andere Tiere. Und aus dem Staub und der Erde dieser Welten hat er seine Kinder gemacht, zwei Söhne und zwei Töchter. Er formte sie nach seinem Ebenbild und hauchte Leben in ihre Lehmkörper«, wiederholte sie pflichtbewusst.
»Das stimmt«, murmelte Mina und nickte. »Du erzählst die Geschichte so schön. Sprich weiter.«
»Am Anfang schenkte der Schöpfer jedem Kind ein Wort. Es war ein mächtiges Wort, das ihnen eine besondere Fähigkeit verlieh. Eine kostbare Gabe, die sie auf ihrer Reise durch ihre Welt leiten sollte. Einem Sohn wurde das Wort ›wandeln‹ gegeben, was ihm die Gabe verlieh, sich in die Tiere des Waldes oder Wesen der Luft zu verwandeln. Eine Tochter erhielt das Wort ›spinnen‹, und sie konnte alle möglichen Dinge zu Gold spinnen. Gras, Blätter, sogar ihre Haare. Das Wort ›heilen‹ wurde dem zweiten Sohn gegeben, damit er die Krankheiten und Verletzungen seiner Geschwister kurieren konnte. Die zweite Tochter bekam das Wort ›weissagen‹, und sie konnte die Zukunft vorhersagen. Manche behaupteten sogar, dass sie die Zukunft mit der Macht ihrer Worte gestalten konnte.
Die Spinnerin, der Wandler, der Heiler und die Weissagerin lebten lange und hatten viele Kinder, doch selbst mit gesegneten Worten und Wunderkräften war das Leben in ihrer Welt gefährlich und schwierig. Oftmals war Gras nützlicher als Gold. Ein Mensch wünschenswerter als ein Tier. Der Zufall verführerischer als Wissen, und das ewige Leben war ohne Liebe völlig bedeutungslos.«
»Völlig bedeutungslos«, wiederholte Mina und fing an zu weinen, als ob die uralte Geschichte ihr eigenes Leben widerspiegelte. Statt Sasha zum Weitersprechen aufzufordern, spann sie die Geschichte nun selbst weiter und hob mit schwacher Stimme die Einzelheiten hervor, die ihr am wichtigsten waren.
Als die Stimme der alten Frau schließlich verebbte und die Tränen auf ihren Wangen trockneten, stand Sasha auf und leerte die Schüssel mit lauwarmem Wasser vor der Hütte aus. Die Tür ließ sie offen, damit sie schnell zurückkehren konnte, falls die alte Frau nach ihr rief.
Dabei ging ihr die Ursprungsgeschichte nicht aus dem Kopf. Ihre innere Stimme erzählte weiter von dem Wandler, der Spinnerin, dem Heiler und der Weissagerin und den Kindern, die nach ihnen kamen. Hunderte von Jahren. Generation um Generation feierte man die Magischen und verehrte sie, bis die Gaben immer öfter vergeudet und missbraucht und schließlich begraben und verleugnet wurden, weil die wenigen, die noch darüber verfügten, sich Hass und Anfeindungen ausgesetzt sahen.
Nach und nach wurden Weissager, Heiler, Wandler und Spinner vernichtet. Die Soldaten des Königs hackten den Spinnern die Hände ab. Man verbrannte die Weissager auf dem Scheiterhaufen, jagte die Wandler wie die Tiere, deren Gestalt sie annahmen, und steinigte die Heiler auf den Marktplätzen, bis selbst die Magischen Angst vor ihren besonderen Fähigkeiten bekamen und ihre Gabe – gleich, worin sie bestand – vor allen anderen verbargen.
In Solemn herrschte Totenstille; jegliches Leben und Licht schien erloschen; die sengende Hitze des Tages schlummerte mit dem gebeutelten Dorf. Da durchschnitt plötzlich ein Schrei die Luft. Sasha wappnete sich für den Namen, der aus dem Klagelaut entstand. Als sie ihn hörte, trieb ihr die Bestätigung ihrer Befürchtung Tränen in die Augen, und ihre Lippen bebten. Ein weiteres Kind war gestorben. Edwin. Der kleine Junge mit dem schiefen Bein.
Die Schwächsten traf es zuerst.
Mit müden Schritten entfernte Sasha sich von den Reihen der Hütten und den etwas robusteren Häusern der Dorfältesten, um zu dem Wasserfall zu laufen, der sich in die Schlucht ergoss. Er lag zwar weiter entfernt vom Dorf als der Fluss im Osten, aber sie nahm an, dass sie das Wasser dort unbeschadet trinken konnte. Das Flusswasser hatte Mina krankgemacht. Als es ihrer Herrin immer schlechter ging, war Sasha zu dem freundlichsten der Ältesten gegangen, Minas Bruder, und hatte ihn gebeten, die anderen zu warnen, damit sie kein Flusswasser mehr tranken. Sie hatte ihm gesagt, dass sich im Wasser irgendetwas Dunkles befände, das Krankheiten hervorrief. Minas Bruder beriet sich mit den Ältesten. Keiner der Männer fühlte sich krank, obwohl sie das Wasser aus dem östlichen Fluss seit langer Zeit tranken. Sie behaupteten, dass Sasha verrückt sei und den Leuten mit ihrer Warnung nur unnötig Angst machen würde. Sie drohten Sasha damit, ihr die Zunge abzuschneiden, wenn sie sie nicht im Zaum hielte.
Vor Kurzem hatte ein schrecklicher Krieg im Königreich Jeru gewütet. Unrecht wurde gerichtet. Unterdrückung besiegt. In den Dörfern der Provinz Quondoon hatte sich seither dennoch wenig verändert. Die Händler kamen mit Waren und Geschichten aus Jeru City nach Solemn. Sashas Herrin hatte bei den Ältesten gesessen und sich die Erzählungen über den mächtigen König Tiras angehört, der fliegen konnte wie ein Vogel und die alten Gesetze abgeschafft hatte. Die Ältesten schimpften, dass die mit der Gabe nun überall frei herumlaufen und Unheil anrichten konnten, obwohl noch nie jemand einen Spinner oder Heiler in Solemn gesichtet hatte. Im nahe gelegenen Dorf Doha gab es Wandler – einen alten Mann und ein Kind. Sie konnten jedoch nur einen Teil ihres Körpers verwandeln und sich Flügel oder kräftige Tierbeine wachsen lassen. Sasha hatte sie nie zu Gesicht bekommen, doch die Ältesten redeten verächtlich über sie, lachten über ihre Eigentümlichkeit und sagten, es sei eher ein Fluch denn eine Gabe. Die Händler brachten auch Geschichten aus Bin Dar mit – der Provinz, die nördlich von Quondoon lag. Sie erzählten von großen Vogelmenschen, die Nester bauten und Menschenfleisch fraßen, doch auch die hatte man in Solemn noch nicht gesehen. Sasha war keine Wandlerin oder Spinnerin, keine Heilerin und auch keine Weissagerin. Ihre Gabe war völlig anders. Niemand zog über Sasha her, aber das Schweigen der Dorfbewohner bedeutete deswegen noch lange nicht, dass sie sich sicher fühlen konnte. Sasha hegte kein Vertrauen in einen König, der so weit entfernt lebte, und seine Gesetze, die angeblich jeden schützten. Sogar Sklaven.
Sein Gesicht war unvergesslich, und doch konnte sie sich nicht daran erinnern. Obwohl es Nacht war, erkannte sie ihn ganz deutlich. Wie ein Schatten beugte er sich unter dem angenagten Halbmond über sie. Seine Augen waren wie das Meer, blau und stürmisch, sein Mund ankerte sie und versprach ihr Dinge, die sie davon abhielten, davonzuschweben. Seine Hände waren sanft, seine Worte rau, und als er sie bat, mit ihm zu kommen, folgte sie ihm, entstieg ihrem Körper und wurde ein neuer Mensch.
Sie fanden sie trotzdem.
Gestalten tauchten im Nebel auf und verschwanden wieder, veränderten sich und suchten. Menschen schrien, Schatten flogen durch die Luft, schossen herab und schnappten zu. Sie versteckte sich und presste sich flach auf den Boden, das Gesicht im Schmutz vergraben. Sie rang nach Luft, doch sie verschluckte sich an Erdkrümeln. Ihr Tuch vors Gesicht gedrückt kroch sie voran. Kein Laut war zu hören. Sie versuchte zu rufen und spürte, wie sich sein Name auf ihren Lippen formte, ein Wort, das sie nicht hören konnte. Ein Name, den sie nicht kannte.
Flapp, flapp, flapp.
Das Geräusch hallte in ihrem Kopf und ihrer Brust wider, doch dann wirbelte ein lautes Klopfen die Welt der Schatten und des fliegenden Todes fort.
Sasha merkte, dass sie zu nah am Feuer eingeschlafen war.
Wieder einmal.
Ihre Haare und ihr Gesicht waren gewiss mit Ruß verschmutzt, und sie hatte Asche eingeatmet. Im Haus war es eigentlich zu warm für ein Feuer, aber Mina hatte gefroren und das Kohlefeuer brannte noch, obwohl das Lebenslicht der alten Frau längst erloschen war. Sashas Herz trommelte wild in ihrer Brust, und ihre Kehle war ausgedörrt. Das flappende Geräusch wurde lauter und verließ ihren Kopf. Plötzlich erzitterte die Luft vom Geräusch tausender Schwingen.
»Sasha! Lass mich rein. Mach die Tür auf.«
Müde rieb sich Sasha die Augen und stand auf, immer noch in dem Traum gefangen, den sie nicht zum ersten Mal träumte. Ihre Beine fühlten sich wacklig an, ihre Wangen brannten. Zu viele Tage und Nächte hatte sie am Bett ihrer Herrin gewacht und sich um die alte Frau gekümmert, bis Mina wie der Traum von eben davongeschwebt war. Sie hatte allein getrauert und den Namen in die Nacht hinausgerufen. Als Antwort erhielt sie kaum mehr als ein Seufzen. Erst vor wenigen Stunden hatte Minas Bruder sie gemeinsam mit den Ältesten aufgesucht. Sie hatten die Leiche ihrer Herrin fortgetragen und Sasha allein zurückgelassen.
»Sasha! Lass mich rein!«
»Maeve! Du weckst noch das ganze Dorf auf«, mahnte sie, während sie zur Tür eilte und rasch den Riegel öffnete. Das Mädchen, klein und dunkel wie viele Menschen in Quondoon, stürzte ins Haus und warf sich Sasha in die Arme.
»Sasha, du musst weglaufen. Auf der Stelle! Sie wollen dich holen«, rief Maeve atemlos. »Mina kann dich nicht mehr schützen. Und jetzt wollen sie zu dir. Ich habe sie gehört. Sie haben Angst, und sie geben dir die Schuld.«
»Für was?«, erwiderte Sasha. Doch sie wusste es. Maeve wusste es auch, und sie verschwendete keine Zeit mit unnötigen Worten. Sie packte sie an der Hand und zog sie mit sich.
»Wo soll ich denn hin?«
»Du bist frei. Geh, wohin du willst.«
»Aber ich bin hier zu Hause.«
»Jetzt nicht mehr. Mina ist tot. Und du wirst es auch bald sein, wenn du jetzt nicht gehst.«
»Ich bin nicht angezogen.« Hastig griff Sasha nach ihrem Tuch, das sie brauchte, um ihre bleiche Haut und ihr leuchtend rotes Haar zu verbergen. Ihre Schuhe standen vor der Tür.
»Dafür ist keine Zeit mehr!«
Und dann hörte Sasha es. Spürte es. Und eine Erinnerung erwachte. Sie hatte diesen Augenblick vorausgesehen. Ein Gefühl von Verlust, aber auch der Erleichterung überflog sie. Der Moment war gekommen. Auch wenn sie nicht wusste, warum, verspürte sie immer Erleichterung, wenn sich eine Vision bewahrheitete.
Aus der Ferne hörte sie Rufe und Schreie, als ob das Dorf angegriffen wurde. Aber es gab keine Eindringlinge, die das Dorf überfielen. Es gab keine Drachen in der Luft, die Solemn attackierten. Der Feind lauerte im Dorf.
Der Halbmond leuchtete hoch über ihnen am Himmel und machte die nächtliche Reise zu einem kalten Vergnügen. Funkelnde Sternensplitter bedeckten den wolkenlosen Himmel, und die Felsen erhoben sich wie gestrandete Schiffe, deren zerklüftete steinerne Masten zum Firmament wiesen. Die Pferde begannen den steilen Abstieg nach Solemn, das an der äußersten Grenze von Quondoon lag. Kjell von Jeru, Hauptmann der königlichen Leibgarde, war bisher nur einmal dort gewesen. Er erinnerte sich jedoch noch gut an die schlichte Kleidung der Wüstenbewohner, ihre verhüllten Köpfe und ruhige Art.
In den vergangenen Tagen hatten sie keine Anzeichen gesehen, die darauf hindeuteten, dass die Volgar hier ihr Unwesen trieben. Weder Nester der monströsen Vogelmenschen noch Leichen, kein Gestank, nicht einmal eine verlorene Feder. Erneut fragte er sich, ob die Berichte über die verheerenden Verwüstungen in Solemn, die in den Grenzdörfern von Bin Dar kursierten, tatsächlich der Wahrheit entsprachen. Es lag jedoch etwas in der Luft, das sein Pferd Lucian beunruhigte. Der Hengst tänzelte schnaubend und ging nur widerwillig den steilen Bergpfad hinab.
Es wäre so vieles leichter, wenn er über Königin Larks Gabe verfügen würde und die Feinde Jerus durch die Macht der Worte besiegen und vernichten könnte. Stattdessen bereiste er mit seiner Elitegarde die Provinzen von Jeru, angefangen im Norden in Firi über Bin Dar im Westen bis hin nach Bilwick ganz im Osten, um die Volgar auf die harte, herkömmliche Art und Weise zu bekämpfen, mit dem Schwert. Die vergangenen beiden Jahre hatte er zumeist auf dem Rücken seines Pferdes verbracht und zerstört, was von den gefiederten Bestien noch übrig war. Einst hatten sie viele Opfer in den Provinzen gefordert und hätten fast ein ganzes Königreich vernichtet.
Als ihm zu Ohren kam, dass ein Schwarm der Vogelmenschen angeblich in den Bergen von Quondoon gesichtet worden war, hatte er Jeru City mit der Garde erneut verlassen, froh, etwas zu tun zu bekommen. Sein Halbbruder Tiras, der König von Jeru, regierte gerecht und litt längst nicht mehr unter dem Fluch, der Kjell dazu veranlasst hatte, nicht von seiner Seite zu weichen.
Seit dem Tag, an dem Tiras seinem Vater auf den Thron gefolgt war, waren sie nur selten voneinander getrennt gewesen. Tiras verfügte über die Gabe und hatte niemanden, den er um Hilfe bitten konnte, nur seinen unehelichen älteren Halbbruder. Inzwischen brauchte er Kjell jedoch nicht mehr. Zumindest nicht mehr so wie früher.
Kjell wünschte sich keine Reichtümer. Er wollte keine Macht und keine hohe Stellung. Er hatte nie nach Besitz gestrebt und nie ein eigenes Haus besessen. Obwohl er der Ältere war, wollte er nie König werden. Er verspürte auch keinen Neid auf Tiras, den legitimen Sohn und Thronerben, der die Bürde der Verantwortung mit einer Gelassenheit und Bereitwilligkeit trug, die Kjell nie aufgebracht hätte. Kjell fühlte sich im Kampf und als Beschützer seines Bruders am glücklichsten und hatte immer gewusst, wer er war und wohin er gehörte.
Es machte ihn nicht besonders stolz, aber er wusste um seine Herkunft.
Er war der Bastard des verstorbenen Königs Zoltev und der Dienstmagd Koorah, die eine Weile das Bett des Königs gewärmt hatte. Eine sehr kurze Weile. Sie starb bei der Geburt, und Kjell hatte seinen Namen von der Hebamme bekommen, die meinte, dass sein erster Schrei so klang wie der einer Kjell-Eule vor dem Angriff.
Das, was einen Menschen ausmachte, war jedoch nicht allein auf seine Herkunft beschränkt. Auch nicht auf seine Geschicklichkeit im Umgang mit dem Schwert, seine Größe oder seine Fähigkeiten. Im vergangenen Jahr hatte sich all das, was Kjell als sicher und selbstverständlich erschienen war, grundlegend geändert. Er war gezwungen gewesen, Seiten an sich anzuerkennen, die er stets verleugnet hatte. Auch er besaß die Gabe. Er war einer von ihnen. Einer der Menschen, die er gefürchtet und im Stich gelassen hatte. Und es fiel ihm nicht leicht, das zu akzeptieren. Es kam ihm so vor, als hätte er sein ganzes Leben lang gegen das Meer angekämpft, in das er gehörte, nur um festzustellen, dass er Flossen und Schuppen besaß und nicht der Fischer war, der die Netze auswarf. Er wusste nicht mehr, wer er war oder worin sein Lebenssinn bestand. Vielleicht wusste er es aber auch, und es gefiel ihm bloß nicht.
Mit dem Einbruch der Nacht war es kühler geworden. Sobald die Sonne aufging, würde es jedoch wieder heiß werden. Zu heiß, doch Quondoon lebte von den Extremen. Hitze bei Tag, Kälte in der Nacht, aufragende Gipfel und flache Wüstenlandschaften, kurze schwere Regenfälle gefolgt von langen Dürreperioden, in denen monatelang kein einziger Tropfen fiel. Die Menschen hier arbeiteten als Hirten und Händler, Weber und Töpfer, aber sie bauten kaum etwas an. Das Land war nicht fruchtbar genug. Kjell dachte erneut über die Volgarsichtungen nach. Die Volgar bevorzugten Sumpfland. Wenn sie jetzt auch in den Dörfern von Quondoon ihre Nester bauten, mussten sie wirklich verzweifelt sein.
Ein unheimliches Jaulen hallte plötzlich durch die Nacht und verschreckte Lucian.
»Halt!«, befahl Kjell. Seine Männer gehorchten sofort, die Hände an den Schwertern, die Blicke auf die Schlucht zu ihrer Rechten gerichtet, auf der Suche nach dem Verursacher des Klagelautes. Über ihnen, auf dem Felsvorsprung, tauchten schemenhafte Gestalten auf. Unter ihnen konnte man bereits Solemn erkennen. Bei den Gestalten auf den Klippen handelte es sich jedoch nicht um misstrauische Wächter, die sie aufhalten wollten, sondern um Wölfe, die sich offenbar gestört fühlten. Erneut stimmten sie ihr Geheul an, und die Pferde scheuten.
»Da ist etwas, Hauptmann. Entweder verletzt oder tot. Die Wölfe wollen es haben«, meinte ein Soldat, dessen Blick am Fuß eines großen Felsens klebte.
»Wenn es ein Volgar ist, dann ist er allein. Die Wölfe würden sich nicht in die Nähe eines Schwarms trauen«, sagte Jerick, Kjells Leutnant.
»Das ist kein Volgar«, erwiderte Kjell. Er stieg ab und zog sein Schwert. »Isak, Peter und Gibbous bleibt bei den Pferden, der Rest kommt mit mir.«
Seine Männer taten wie geheißen und schlichen mit ihm durch das trockene Gras auf die hohe Felswand zu, die sich wie eine Mauer vor ihnen erhob. Die Nacht verhüllte, was sich dort unter den bleichen Felsen befand. Es bewegte sich wie eine Volgarschwinge, und Kjell hielt inne und gebot seinen Männern, das Gleiche zu tun.
Die Wölfe verspürten jedoch nicht das Verlangen, sich still zu verhalten. Das einsame Heulen eines Wolfes durchschnitt die Luft, gleich darauf stimmten die anderen mit ein. Ihr Geheul vertrieb den sich kräuselnden Schatten nicht und veränderte auch nicht seine Form. Vorsichtig schlich Kjell weiter, ohne die dunkle Gestalt aus den Augen zu lassen.
Nach einigen Schritten entschleierte der Mond das Geheimnis. Die Bewegung, die sie wahrgenommen hatten, war kein Volgarflügel, sondern das sich bauschende Kleid einer Frau. Reglos lag sie am Fuß des Felsens. Ihr Haar schimmerte selbst in der Finsternis noch feuerrot und bildete mit dem Blut auf dem Boden einen grellen Farbfleck. Sie lag mit geschlossenen Augen auf dem Rücken, ihr Gesicht so bleich wie die Felsen, die sie umgaben. Ihre Arme hatte sie weit zur Seite gestreckt, als hätte sie im Fall versucht, den Wind einzufangen und zu fliegen.
Ihr Rücken war seltsam gekrümmt, ein Bein lag abgewinkelt unter ihr, aber sie wies keine Biss- oder Klauenspuren auf, und ihre Kleidung war nicht zerrissen. Das war kein Volgarangriff gewesen, sie war von dem Felsvorsprung gestürzt. Jerick lief zuerst los und kniete sich an ihre Seite. Mit einer Dreistigkeit, die er sich gewöhnlich für Kjell aufsparte, tastete er nach dem Puls an ihrer Kehle.
»Sie ist noch warm, Hauptmann, und ihr Herz schlägt.«
Kjell stieß nicht als Einziger die Luft aus. In seinen Ohren klang das Geräusch wie das Zischen einer Schlange. Die Frau war schwer verletzt.
»Was wollt Ihr tun?« Jerick schaute seinen Hauptmann fragend an. Eine andere Frage lag unausgesprochen in der Luft. Jerick wusste, dass Kjell ein Heiler war. Seine Männer wussten es alle, weswegen sie ihn zugleich fürchteten und verehrten. Voller Ehrfurcht sahen sie zu, wenn er die Verletzten und Sterbenden mit bloßen Händen heilte. Bisher hatte er das jedoch nur bei Menschen getan, für die er Zuneigung empfand, die ihm dienten oder denen er diente. Und das auch nicht sehr oft. Er hatte mehreren seiner Männer geholfen. Seinen Bruder gerettet. Und seine Königin. Aber die Gabe gehorchte ihm nicht, wenn er keine Liebe verspürte. Ein verbittertes Lachen brannte ihm in der Kehle, doch erst als er die bestürzten Blicke seiner Männer bemerkte, wurde ihm bewusst, dass er das Lachen nicht unterdrückt hatte.
»Geht!«, befahl er barsch. »Sucht euch einen Platz, wo ihr mit den Pferden warten könnt. Und nehmt Lucian mit.«
Niemand rührte sich. Alle Augen waren auf die Frau und die Blutlache gerichtet, die auch den lauernden Wölfen auf den Felsen nicht entgangen war. Die Wölfe warteten auf den Rückzug der Soldaten, damit sie über die Frau herfallen konnten.
»Geht!«, blaffte Kjell. Er kniete nieder, wohl wissend, dass er Zeit verschwendete, die er nicht hatte. Wachsam wie die Wölfe beeilten sich die Soldaten, seinen Befehl auszuführen, doch sie wirkten nicht gerade froh darüber. Jerick blieb, womit Kjell allerdings gerechnet hatte.
»Ich kann das nicht, wenn du zuschaust«, gab Kjell schroff zu. »Dabei bin ich mir meiner selbst zu stark bewusst.«
»Ich hab schon öfter bei Euren Heilungen zugesehen, Hauptmann.«
»Ja. Aber das hier ist anders. Ich kenne diese Frau nicht.« Kjell legte die Hände auf ihre Brust und spürte ihre Wärme. Ihr Herz schlug kräftig, obwohl ihr Körper darum bettelte, von seiner Qual erlöst zu werden. Er lauschte ihrem Lied, suchte die eine Note, die ihm helfen würde. Ihren Geist, ihre Willenskraft, ihr Selbst.
»Stellt Euch vor, dass Ihr sie kennt«, drängte Jerick sanft. »Stellt sie Euch … voller Leben vor. Rennend. Lachend. Beim Liebesakt.«
Kjells Blick schoss zu Jerick, doch sein Leutnant sah ihn ungerührt an, als ob er sich dieses Bild ganz leicht vorstellen könne und es Kjell daher ebenso ergehen müsse.
»Stellt Euch vor, dass Ihr sie liebt«, meinte Jerick.
Kjell schnaubte und beugte den Kopf. Die Augen vor Jericks prüfendem Blick verschlossen, legte er die Hände zurück auf die Brust der Frau und befahl ihrem Herzen, ihm zu gehorchen. Plötzlich stieg ein Bild vor seinem inneren Auge auf. Eine lächelnde Frau mit aufrichtigem Blick, der weder Geheimnisse noch Lügen barg. Eine Frau mit feuerrotem Haar wie die, die vor ihm auf dem Boden im Sterben lag. Wieder vollführte er eine scheuchende Handbewegung und befahl Jerick zu gehen. Sie lag im Sterben, und er hörte auf das alberne Geplapper eines vorlauten Leutnants, der eindeutig zu lange nicht mehr die Gesellschaft einer Frau genossen hatte. Rennend, lachend, beim Liebesakt. Der verdammte Narr.
»Lass mich allein, Jerick. Sofort.« Wenn Jerick blieb, würde er ihn verprügeln. Jerick merkte offenbar, dass sein Hauptmann keine Widerrede duldete, denn er wandte sich wortlos ab und ging, wenn auch widerstrebend.
Kjell tastete die schmalen Rippen der Frau ab, erspürte die gebrochenen Knochen und befahl ihnen zu heilen. Er betete nicht, während seine Hände ihren Körper erkundeten. Der Schöpfer hatte ihm die Gabe der Heilung gegeben, die Fluch und Segen zugleich war, und er hatte nicht vor, um noch mehr zu bitten.
Die Frau widersetzte sich ihm; ihr Körper verharrte störrisch im Todeskampf.
Aus einem Bauchgefühl heraus begann Kjell zu summen und passte die Melodie dem Geheul der Wölfe auf dem Felsen über ihm an. Nach einem Augenblick spürte er ein verräterisches Kribbeln in den Händen, sein Puls beschleunigte sich triumphierend. Er befahl seinem Körper, sein Lebenslicht zu teilen, und die gebrochenen Rippen richteten sich unter seiner Berührung, hoben die Brust der Frau und pressten sich an seine breiten Hände. Dennoch hörte er ihr Lied immer noch nicht.
»Wo bist du, Frau?«, fragte er. »Ich spüre deinen Herzschlag und dein sickerndes Blut. Sing für mich, damit ich dich zurückbringen kann.«
Seine Hände glitten zu ihren Oberschenkeln, spürten, wie sie sich wieder richteten und heilten. Als ihre Wirbelsäule wieder eine gerade Linie bildete, drehte er sie auf die Seite und fuhr mit den Händen über ihren Hinterkopf. Er war feucht vom Blut und fühlte sich weich an. Die Galle kam Kjell hoch; überrascht und verärgert über seine Zimperlichkeit schluckte er den bitteren Geschmack hinunter. Er hatte ohne zu zögern Männer und Bestien aufgeschlitzt und dabei nie auch nur mit der Wimper gezuckt.
»Ich bin ein Mann mit wenig Vorstellungskraft«, flüsterte er und strich ihr die Haare glatt. »Ich kann nicht so tun, als ob ich dich liebe. Aber ich kann dich heilen, wenn du mir hilfst.«
Angestrengt lauschte er auf diese eine Note, die ihr Leben retten würde. Schon einmal war er in einer ähnlichen Situation gewesen. Jahre zuvor hatte er auch auf Töne gelauscht, die er nie zuvor gehört hatte, und wusste nicht, wonach er suchen sollte, dennoch hatte er gelauscht. Damals war es Tiras gewesen, der seine Hilfe gebraucht hatte, und seine Wunden waren ebenso schwer gewesen wie die der Frau. Kjell hatte ihn gerettet, ihn geheilt. Aber das war ihm nur möglich gewesen, weil er seinen Halbbruder liebte.
Furcht breitete sich in seinem Bauch aus. Sofort ließ die Hitze seiner Hände nach. Er zwang seine Gedanken zurück zu seinem Halbbruder, seiner Zuneigung für ihn, seinem Respekt, seiner Treue. Der Gedanke stärkte ihn, und die Hitze seiner Hände verwandelte sich in Licht.
Er beugte sich vor und flüsterte ihr ins Ohr, singend und einschmeichelnd.
»Kannst du mich hören, Frau? Komm, sing mit mir.« Die einzigen Lieder, die er kannte, waren derbe, vulgäre Kampf- und Sauflieder, in denen es darum ging, unter Röcke zu schauen und ein Schwert zu führen.
»Komm zu mir, dann versuche ich dich zu heilen. Ich versuche dich zu heilen, wenn du nur zu mir kommst«, sang er leise. Die Melodie war eintönig, der Text mäßig, aber es war eine Art Lied, und die Bitte floss ihm rau über die Lippen.
»Komm zu mir, und ich schütze dich, ich schütze dich, wenn du nur zu mir kommst.« Sein Mund streifte über ihr Ohrläppchen. Ein seltsames Seufzen entfuhr ihm und zupfte an einer Strähne ihrer Haare. Ihr Herzschlag wurde stärker, als hätte sie ihn gehört. Er sang weiter und ließ es zu, dass die aufkeimende Hoffnung ihn zum Lügner machte.
»Komm zu mir, und ich werde versuchen dich zu lieben. Ich werde versuchen dich zu lieben, wenn du nur zu mir kommst.«
Er vernahm einen einzelnen glockengleichen Laut, fast unhörbar. Nur wie ein Hauch. Ganz kurz.
Aber das genügte ihm.
Kjell erhob die Stimme, ahmte den Ton nach und entlockte ihn den funkelnden Sternen. Plötzlich änderte sich die Totenglocke zu fröhlichem Geläut, das klar und deutlich ertönte und immer lauter wurde. Er summte mit, bis der Ton in seiner Haut, seinem Kopf, hinter seinen Lidern und tief in seinem Bauch widerhallte. Er fühlte sich euphorisch, vibrierte vor Triumph. Er glättete ihr vom Blut verklebtes Haar, wischte ihr mit den Fingerspitzen über die schmutzigen Wangen und blickte in Augen, die so dunkel waren, dass sie wie unendlich tiefe Brunnen wirkten. Ihre Blicke verfingen sich, und einen Moment lang gab es nur diesen Widerhall zwischen ihnen.
»Ich habe Euch gesehen«, sagte sie. Der Glockenklang hatte sich in Worte verwandelt. Erschrocken ließ Kjell sie los, und das Lied erstarb in seiner Kehle. Er ballte die Hände zu Fäusten und spürte ihr Blut an seinen Fingern.
»Ich habe Euch gesehen«, wiederholte sie. »Ihr seid hier. Ihr seid endlich gekommen.«
2. KAPITEL
Ihre Worte ergaben keinen Sinn. Kjell hatte ihren Körper geheilt, aber ihren Verstand konnte er nicht beeinflussen. Er setzte sich auf die Fersen, um ein wenig Abstand zu gewinnen.
»Bist du … geht es dir gut?« Er wollte wissen, ob sie ganz kuriert war, möglichst aber ohne dabei noch mehr Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was er gerade getan hatte. Seine Gabe verschreckte die Menschen ebenso wie ihn. Als sich die Frau vorsichtig aufsetzte, streckte er die Hand aus, um ihr zu helfen. Sie ignorierte seine Hilfe jedoch und verharrte reglos, als lausche sie ihrem Körper. Er hatte so lange an ihrer Seite gekniet, dass ihn seine tauben, kribbelnden Beine und seine ächzenden Hüften zum Aufstehen drängten. Sein Kopf fühlte sich so leicht an, als würde er losgelöst vom Rest seines Körpers wie eine Wolke über ihm schweben. Seine Gedanken waren von Müdigkeit umnebelt.
Mit zittrigen Händen stieß er sich hoch und zwang seine wackeligen Beine, ihm zu gehorchen. Die Heilung hatte ihn völlig ausgelaugt, er fühlte sich leer und wollte nicht, dass seine Männer – oder diese Frau, die ihn mit großen Augen betrachtete – die Nebenwirkungen seiner Gabe bemerkten. Keiner durfte von dieser Schwäche erfahren. Solches Wissen war ein gefundenes Fressen für Intriganten und Verräter, die die Absicht hegten, mit dem Feind zu feilschen. Kjell war sich bewusst, dass er nicht so sehr verehrt wurde wie sein Bruder und nicht auf bedingungslose Loyalität vertrauen konnte. Allerdings fürchtete man ihn wie seinen Vater, und auch das erfüllte seinen Zweck.
Die Frau, die so mühelos mit ihm aufstand, als hätte sie nicht eben noch in der Blutlache gelegen, die immer noch die Erde tränkte, war groß, langgliedrig und schlank. Er musste sich nicht den Nacken verrenken, wenn er ihr in die Augen sehen wollte. Das zerzauste Haar fiel ihr bis zu den Hüften. Ihr dünnes Kleid, wohl eher ein Nachtgewand, war blutdurchtränkt und klebte ihr am Körper. An den Füßen trug sie die üblichen halbhohen Lederstiefel der Wüstenbewohner. Es machte ganz den Eindruck, als hätte sie ihr Zuhause in größter Eile verlassen und mehr Wert auf Schuhe denn auf Kleidung gelegt.
»Wie heißt du?«, fragte er. Sie zögerte, und er rechnete damit, dass sie ihn anlügen würde. Er kannte sich gut genug mit Lügnerinnen aus und stellte sich darauf ein, ihr kein Wort zu glauben.
»Man nennt mich Sasha«, gestand sie widerwillig ein. Zweifelnd hob er die Brauen.
Das war wohl kaum ein Name. Es war ein Befehl, mit dem man Vieh oder Pferde antrieb, oft begleitet durch einen Tritt in die Flanken. Er selbst benutzte das Wort mehrmals am Tag und fragte sich, wer der armen Frau diesen Spitznamen gegeben hatte.
»Und wo lebst du, Sasha?« Peinlich berührt wand er sich innerlich, als er ihren Namen aussprach.
Sie drehte sich zu dem steilen Felsen um, der feindselig über ihnen im Mondschein aufragte.
»Ich lebe in Solemn, aber dort war ich nie zu Hause.« In ihrer Stimme schwang Trauer, und er wappnete sich dagegen. Er wollte nichts von ihrem Kummer wissen. Er hatte sein Bestes getan und konnte auch nicht jeden Schmerz lindern. Sie verstummte, den Blick auf die Berge gerichtet, als ob ihr Leben dort geendet hätte und sie nun nicht weiterwüsste. Er beobachtete, wie sie auf die Felswand zuschritt, und entdeckte ein Tuch, das sich in einem Busch verfangen hatte, der in einer Felsritze etwa zwanzig Fuß vom Boden entfernt wuchs. Die Frau – Sasha – ging zielstrebig darauf zu. Sie war schon ein Stück hinaufgeklettert, bis ihm klar wurde, dass sie unbedingt den Berg erklimmen wollte, um das Tuch zu holen.
»Komm runter. Ich werde dich kein zweites Mal heilen.«
Sie nickte kurz, kletterte aber dennoch weiter. Mit einer Hand hielt sie sich am Felsen fest, mit der anderen löste sie den hellen Stoff von dem Zweig.
»Das gehört mir«, sagte sie leicht atemlos, als sie wieder vor ihm stand. Sie schlang das Tuch über ihr blutverkrustetes Haar und band die Enden um ihre Taille, ganz so, als sei nichts geschehen. Und das weckte seinen Argwohn. Er hatte sie geheilt, aber eine Heilung löschte weder ihr Gedächtnis aus noch beeinträchtigte es die Erinnerung an das Erlebte. Sie war am Abgrund zwischen Leben und Tod gewandelt und wirkte trotzdem völlig gefasst. Keine Tränen, kein Zittern. Sie stellte auch keine Fragen oder versuchte zu erklären, was passiert war.
»Zwischen den Felsen gibt es einen Wasserfall und einen kleinen Bach. Ich zeige ihn Euch und Euren Männern«, sagte sie.
»Woher weißt du, dass ich nicht allein bin?«, fragte er.
»Ich habe Euch gesehen«, wiederholte sie ihre Worte, und ihm wurde flau. Sie war bewusstlos gewesen. Wie konnte sie ihn und seine Männer gesehen haben?
Als Signal für seine Männer stieß er einen Pfiff aus, der laut durch die Dunkelheit hallte. Die Augen auf die seltsame Frau gerichtet wartete er, bis Jerick, gefolgt von einigen anderen Soldaten, aus der Dunkelheit trat. Er vernahm leise erstaunte Rufe, eine Lanze fiel klappernd zu Boden.
»Die Frau kennt sich hier aus und kann uns zu einem Bach führen. Wir übernachten hier«, ordnete Kjell an. »Holt die anderen und bringt mir mein Pferd.«
»Reiten wir nicht nach Solemn?«, fragte Jerick, der sich schnell von seiner Verwunderung erholt hatte und wirkte, als hätte er nie an den Fähigkeiten seines Hauptmanns gezweifelt.
Sasha zuckte wie von einem Peitschenschlag getroffen zusammen.
»Morgen«, antwortete Kjell, und ihr Blick flog zu ihm. »Wir reiten morgen nach Solemn, wenn es hell ist.«
Sasha lag zusammengerollt neben Kjell. Sein Mantel diente ihr als Decke und das Tuch von der Klippe als Kissen. Es war hellblau, wie er nun erkennen konnte, mit weißen Streifen, als hätte es die Sonne ungleichmäßig gebleicht. Als er eingeschlafen war, hatte sie noch in seinen Mantel gekuschelt am Feuer gesessen, um ihr dunkelblaues Gewand zu trocknen. Offenbar hatte sie in der Dunkelheit seine Nähe gesucht. Sie lag zwar nicht direkt neben ihm, sondern zu seinen Füßen, dennoch war sie ihm immer noch so nahe, dass er über sie stolpern würde, wenn er im Dunkeln aufstand. Er wusste nicht, was er davon halten sollte, dass sie seine Nähe suchte, außer dem Offensichtlichen: Sie nahm wohl an, sie sei ihm wichtig, weil er sie geheilt hatte. Und fühlte sich deshalb in seiner Nähe am sichersten.
Im zunehmenden Licht zeigten sich die Sommersprossen auf ihrer Haut deutlicher und spiegelten den warmen Farbton ihres flammend roten Haares. Das Blut hatte dunkle Flecken auf ihrem Kleid hinterlassen, aber sie selbst war sauber. Ihr gewaschenes Haar glänzte in den matten Sonnenstrahlen, die von Osten her über die Ebene schlichen und an die Felsen stießen. Sie hatte mit dem Bach recht gehabt. Ein Wasserfall stürzte sich von der Klippe, das Wasser sammelte sich in einem Graben zwischen zwei zerklüfteten Felswänden. Sie hatte sie durch eine enge Schlucht dorthin geführt, die nur ein kurzes Stück von jener Stelle entfernt lag, an der sie verletzt gelegen hatte. Sasha wartete, bis die Männer getrunken und ihre Feldflaschen gefüllt hatten, ehe sie selbst an dem Bach niederkniete und sich die Haare und das Gesicht wusch. Ihr Kleid war eine andere Sache. Kjell hatte ihr seinen Mantel und ein Stück Seife dagelassen und sich mit seinen Männern auf eine kleine Lichtung in der Nähe zurückgezogen.
Insgeheim hatte er gehofft, dass sie die Gelegenheit nutzen würde, um sich wegzustehlen und das Leben wieder aufzunehmen, das sie beinahe verloren hätte. Doch das tat sie nicht. Als sie zu ihm kam, eingehüllt in seinen Mantel, das Haar tropfnass, in den Händen das feuchte Kleid, hatte er ihr etwas zu essen gegeben und sie angewiesen, sich ans Feuer zu setzen. Er hatte Isak, der die Gabe des Feuerspinnens besaß, gebeten, ein Lagerfeuer zu entfachen, und Sasha war davor niedergekauert, den Kopf auf die angezogenen Beine gebettet. Seine Männer behandelten Sasha mit Umsicht und hielten Abstand zu ihr. Die Verwunderung machte die Soldaten wortkarg, aber er erwischte sie dabei, wie sie ebenso oft zu ihm herüberstarrten wie zu ihr.
Ehrfurcht und auch ein wenig Angst lag in ihren Mienen. Sie wussten, was er getan hatte, doch sie konnten es immer noch nicht fassen. Sie hatten schon öfter gesehen, wie er eine blutende Wunde oder einen gebrochenen Knochen geheilt hatte, aber sie hatten auch schon erlebt, dass Soldaten unter seinen Händen gestorben waren, ohne dass er etwas für sie tun konnte, außer ihre Leichen zu ihren Familien zurückzubringen oder sie auf dem Schlachtfeld zu begraben. Seine Männer hatten den Angriff auf Jeru City überlebt, doch nur wenige hatten mit angesehen, welche außergewöhnliche Rolle ihm dabei zuteilgeworden war. Alle sahen jedoch, dass diese Frau gesund und munter war, obwohl sie nur wenige Augenblicke zuvor leblos in ihrem Blut auf dem Boden gelegen hatte.
Die Ehrfurcht seiner Männer rief bei Kjell Unmut hervor. Er blaffte jeden an, der ihn gefühlt zu lange anstarrte. Ein dumpfer Schmerz pochte in seinen Schläfen, seine Finger waren schon taub, so fest ballte er die Hände, um sein Temperament zu zügeln. Er aß mit Bedacht und ohne Vergnügen, allein um wieder zu Kräften zu kommen und seine Beherrschung zurückzugewinnen. Da ihm beides nicht zu gelingen schien, zog er sich schließlich vom Feuer und den ehrfurchtsvollen Blicken, die ihm auf der Haut brannten, zurück.
Jerick wollte ihm folgen, doch Kjell wies ihn brüsk zurecht. »Achte darauf, dass die Frau alles hat, was sie braucht, und ihr nichts geschieht, und lass mich allein.«
»Jawohl, Hauptmann«, antwortete Jerick und wandte sich um.
Kjell richtete sein Schlaflager her und legte sich, ohne die Stiefel auszuziehen, auf die Decke. Beinahe sofort fiel er in einen tiefen Schlaf.
Nun nahte der Morgen, und während er Sasha beobachtete, fragte er sich, ob ihre Augen tatsächlich so dunkel waren wie in seiner Erinnerung. Als sie die Lider unvermittelt öffnete, wie jemand, der es gewohnt war, selbst im Schlaf auf Gefahren zu lauschen, stellte er fest, dass ihre Augen tatsächlich so dunkelbraun waren, dass man die Iris kaum von der Pupille unterscheiden konnte. Und das verwirrte ihn. Er hatte schon Menschen mit einem Teint so hell und sommersprossig wie ein Spatzenei gesehen, aber keiner von ihnen hatte so ungewöhnlich dunkle Augen gehabt.
Sasha streckte sich, um den Schlaf abzuschütteln, und erwischte ihn beim Starren, was ihn peinlich berührte. Er war es nicht gewohnt, sich derart unbehaglich zu fühlen, vor allem nicht in Gesellschaft einer Frau, die ihm nichts bedeutete. Er stand auf und schüttelte den Staub ab. Dann rollte er seine Decke fest zusammen und verschnürte sie. Auch Sasha erhob sich, zog seinen Mantel aus und hielt ihn vor sich. Wortlos nahm er ihn entgegen. Die Sonne wärmte bereits den Boden und würde schon bald erbarmungslos auf sie niederbrennen. Aus dem Augenwinkel beobachtete er, wie sie das hellblaue Tuch geschickt so um ihren Kopf wickelte, dass es ihr Gesicht beschattete wie eine Kapuze. Sie verkreuzte die langen Enden über ihrer Brust und band sie in der Taille zusammen.
»In Solemn wütet eine Krankheit«, sagte sie. Ihre Stimme klang, obwohl noch rau vom Schlaf, seltsam lieblich in seinen Ohren. »Und Ihr seid ein Heiler.«
»Welche Art von Krankheit?«, fragte er.
»Fieber. Delirium. Den Menschen fallen die Haare aus, egal ob jung oder alt. Die Kinder wachsen nicht. Manche sind missgebildet.«
»Bist du deshalb gestürzt? Bist du krank?«
»Nein«, antwortete sie. Er wusste nicht, auf welche seiner Fragen sich ihr Nein bezog. »Ich bin nicht krank, aber meine Herrin war krank.«
»Deine Herrin?«
»Ich war … Sklavin.«
»Wieso?«, fragte er. Sie runzelte leicht die Stirn. Er wollte erfahren, wieso sie zur Sklavin geworden war, doch sie missverstand ihn.
»Warum seid Ihr Heiler?«, gab sie zurück, als ob beides dasselbe sei. Er schnaubte, denn der Vergleich schien ihm absurd, aber sie erklärte sich nicht weiter. Die Hände gefaltet trat sie näher an ihn heran und fiel vor ihm auf die Knie. Sie beugte sich nach vorn und berührte mit der Stirn die Erde direkt vor seinen Füßen. Ihr Haar umgab sie wie ein Schleier. »Meine Herrin ist tot. Ihr habt mich geheilt. Jetzt gehöre ich Euch.«
Er zog sie hoch und schob sie nachdrücklich von sich weg. »Nein, das tust du nicht. Ich habe dich freiwillig geheilt. Ich erhebe keine Ansprüche.«
»Ich werde bei Euch bleiben.«
»Nein! Das wirst du nicht.« Seine Stimme klang barsch und viel zu laut. Zähneknirschend bemerkte er, dass er die Aufmerksamkeit seiner Männer geweckt hatte. Einer lachte sogar, unterdrückte sein Grinsen jedoch schnell. Kjell bedachte seine Leute mit finsterem Blick, worauf sie in hektische Betriebsamkeit ausbrachen und sich mit ihren Stiefeln und Decken beschäftigten.
Sasha hielt den Kopf gebeugt, das Tuch verbarg ihr Gesicht. In der Annahme, sie hätte ihn gehört und würde ihm gehorchen, ging Kjell zum Fluss.
Sie heftete sich jedoch an seine Fersen.
Er kletterte über die Felsen. Sie folgte ihm in gebührendem Abstand, sodass sie nicht mit ihm zusammenstoßen würde, falls er plötzlich stehen blieb. Dennoch war sie ihm nahe genug, um seinen Unmut zu wecken. Seine Blase war voll, sein Geduldsfaden zum Zerreißen gespannt, und er wollte allein sein. Offenbar bemerkte sie seinen Ärger, denn plötzlich verschwand sie hinter einem Busch. Er tat dasselbe und genoss einen Moment der Einsamkeit, bis sie sich am Wasserfall wieder zu ihm gesellte.
Er putzte sich die Zähne und wusch sich Gesicht, Arme und Nacken. Dann kratzte er sich mit seinem Dolch die Bartstoppeln von den Wangen und knurrte sie unwillig an, als sie anbot, ihm zu helfen. Er reichte ihr seine Seife und sein Zahnpuder. Artig bedankte sie sich und kümmerte sich um ihre eigenen Belange. Mit geschickten Fingern flocht sie ihr Haar zu einem Zopf und band das Tuch wieder um ihren Kopf.
»Werdet Ihr nach Solemn reiten?«, fragte sie auf dem Rückweg zum Lagerplatz.
»Deshalb sind wir hier.«
»Solemn ist das Ziel Eurer Reise? Aber Ihr seid die Leibgarde des Königs. Ich dachte, die Soldaten des Königs machen Jagd auf Menschen mit der Gabe.«
»Der König selbst besitzt die Gabe.« Ganz zu schweigen vom Bruder des Königs. »Ich jage Volgar.«
»Die Vogelmenschen?«, fragte sie überrascht. »Hier gibt es keine Volgar.«
»Nein?« Er blieb stehen und schaute sie erstaunt an. »Uns wurde berichtet, dass Solemn verheerend verwüstet wurde.«
»Das Einzige, was Solemn verwüstet, ist die Seuche.« Sie schaute ihn ernst an.
Kjell stöhnte auf. Der Schöpfer erlöse ihn von seiner Gabe. Er wollte Vogelmenschen töten, nicht Krankenschwester spielen. Falls die Leute in Solemn so schwer krank waren, setzte er zudem seine Männer dem Risiko der Ansteckung aus. Wenn sie sich ansteckten, würde sich die Krankheit bald im ganzen Königreich und womöglich auch in anderen Ländern ausbreiten. Er konnte keine Toten erwecken und kein ganzes Dorf heilen. Allein der Gedanke brachte sein Herz ins Stolpern, und seine Knie wurden weich wie Pudding.
»Ihr könnt sie nicht alle heilen«, stellte Sasha fest, als hätte sie seine Gedanken gelesen. »Aber einige schon.«
Er bezweifelte, dass er auch nur einen retten konnte. »Ich kann meine Männer nicht in ein Dorf schicken, das von einer Seuche befallen ist.«
Zögernd nickte sie und blickte ihn unverwandt an. »Das verstehe ich. Aber … ich glaube nicht, dass sie krank werden würden.«
»Und warum nicht?«
»Weil die Krankheit nicht in der Luft liegt.«
Die Hände in die Hüften gestützt wartete er auf eine Erklärung. Am liebsten hätte er sich auf sein Pferd gesetzt und wäre davongeritten, aber sein Gewissen nötigte ihn zu bleiben.
»Ich glaube, die Krankheit wird durch das Wasser des Flusses im Osten ausgelöst. Wenn Eure Männer ihre Feldflaschen hier füllen, sich hier waschen und sich vom östlichen Fluss fernhalten, werden sie wahrscheinlich nicht erkranken. Einige scheinen gegen das Leiden auch immun zu sein. Kräftige Menschen in mittleren Jahren sind weniger betroffen. Vielleicht dauert es auch nur länger, bis die Krankheit bei ihnen ausbricht. Aber viele sind krank.«
»Und wenn ich sie heile, werden sie danach wieder erkranken«, mutmaßte Kjell. »Denn sie müssen trinken, um zu leben, und dieser kleine Bach spendet nicht genug Wasser für ein ganzes Dorf.« Er deutete auf das Rinnsal hinter ihnen, das sich zu einer flachen Pfütze sammelte, ehe es den Weg über die Felsen fortsetzte.
»Wenn Ihr sie heilt, geht es ihnen vielleicht so gut, dass sie von hier fortgehen können.«
Kjell fluchte und rieb sich müde die Augen beim Gedanken, dass er mit eintausend oder mehr Menschen, die hinter ihm herstolperten, nach Jeru zurückreisen musste. »Warum sind sie nicht längst fortgegangen? In den Dörfern im Norden herrscht keine Krankheit. Ich habe jedes Dorf zwischen Bin Dar und diesem Ort passiert.«
»Die Menschen glauben mir nicht. Sie glauben nicht, dass das Wasser sie krank macht. Ich muss sie erst noch davon überzeugen. Aber ich kann nicht allein nach Solemn zurückkehren«, sagte sie mit leiser Stimme.
»Und warum nicht?«
»Sie haben mich von dort vertrieben.«
»Vertrieben«, wiederholte er tonlos.
»Sie haben mich über den Abgrund gehetzt«, erklärte sie.
»Sie haben dich über den Abgrund gehetzt?« Wut brodelte in ihm hoch, die sich jedoch nicht gegen sie richtete. Allerdings mussten die Menschen von Solemn einen Grund für ihr Handeln gehabt haben, auch wenn ihm der Gedanke Übelkeit bereitete. »Und warum?«
»Ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, wie sie das Wasser tranken. Und ich habe gesehen, wie sie krank wurden. Ich habe es den Ältesten gesagt.« Ihre Worte vom vergangenen Abend bekamen eine neue Bedeutung.
»Du hast es gesehen?«
»Ich sehe vieles.«
»Besitzt du die Gabe?«, fragte er leise.
»Ich kann niemanden heilen.« Sie schüttelte den Kopf, als sei dies die einzig wahre Gabe. Eine Antwort auf seine Frage erhielt er jedoch nicht und er presste die Lippen zusammen, weil Sasha ihm bewusst auswich.
»Besitzt du die Gabe?«, wiederholte er nachdrücklich.
»Ich kann niemanden heilen … Aber manchmal kann ich jemanden retten«, ergänzte sie. »Wenn ich über das, was ich sehe, schweige, dann tritt es meiner Erfahrung nach immer ein. Oft aber auch, wenn ich nicht schweige und versuche, mich gegen Anfeindungen zu wappnen. Aber gelegentlich ist es mir auch gelungen, die Menschen vor den Gefahren eines nahenden Unglücks zu bewahren.«
»Trotz dieser Gabe konntest du dich jedoch nicht davor schützen, in den Abgrund getrieben zu werden?«
»Nein«, flüsterte sie. Ihre Augen glitzerten, schwarze Seen, in denen Tränen schimmerten. Sie blinzelte hastig. Plötzlich wirkte ihr Blick leer, als weile sie in Gedanken in weiter Ferne. Sie hob das Kinn. Das Licht streichelte ihre Wangen, und der Wind zupfte an den Haaren, die unter ihrem Schleier hervorlugten. Er beobachtete, wie eine Vielzahl von Gefühlen über ihr Gesicht huschte, ehe sich ihre Züge entspannten und ihr Blick sich wieder fest auf ihn richtete.
»Sie wissen, dass Ihr hier seid.«
»Wer?«, fragte er verwundert. Er war immer noch von der Erinnerung an ihren zerschmetterten Körper am Fuß der Felsen gefangen, bewegt von den Gefühlen, die sich in ihrem Gesicht spiegelten, und abgelenkt von dem Feuer ihrer Haare.
»Sie kommen. Die Ältesten von Solemn. Sie wollen mit Euch handeln.«
»Handeln? Wir sind Soldaten, keine Hausierer. Wir haben nicht viel mehr als unsere Waffen und unsere Pferde. Und beides steht nicht zum Verkauf.«
»Nicht diese Art von Handel.« Sie schüttelte den Kopf und berichtigte sich bedächtig, als müsse sie erst ein Geheimnis ergründen, das sie nicht ganz verstand. »Sie wollen euch etwas … geben. Der Nachtwächter hat vermutlich Eure Anwesenheit gemeldet.«
»Warum sollten sie uns etwas schenken wollen?«
»Ich kann nicht alles sehen.« Sie schüttelte den Kopf. »Absichten sind besonders schwierig zu erkennen. Vielleicht wissen sie, dass der König Euch schickt, und wollen Euch Geschenke machen, um Eure Gunst zu gewinnen. Vielleicht fürchten sie, dass Ihr von der Seuche wisst und ihre Schwäche ausnutzen wollt.«
Ein Pfiff durchschnitt die Luft und zeigte Kjell, dass Sasha mit ihrer Vermutung richtig lag. Kjell verschob seine Fragen auf später und lief den Hügel hinunter zu der Lichtung. Sasha folgte ihm langsamer und verbarg sich hinter den Soldaten, die sich rasch für die Ankömmlinge rüsteten. Kjell stieg auf Lucians Rücken, denn er wollte Autorität ausstrahlen, auch wenn es keine Bedrohung gab. Auf dem Bergpass tauchten sechs Männer auf, nicht auf Pferden, sondern auf großen, anmutig schreitenden Kamelen. Die Dorfältesten trugen helle Gewänder, die Köpfe, wie der von Sasha, mit Tüchern verhüllt, um sich vor der sengenden Sonne zu schützen. In gebührendem Abstand hielten sie vor Kjell und seinen Männern an.
»Ich bin Kjell von Jeru«, grüßte Kjell. »Der Hauptmann der königlichen Leibgarde. Wir sind auf der Suche nach Volgar und hier, um Euch zu Diensten zu sein. Nicht um Euch zu schaden oder … Steuern einzutreiben.« Es hatte Zeiten gegeben, als die königlichen Wachen die Steuereintreiber begleiten mussten. Zum Glück gehörten diese Tage der Vergangenheit an. Die Provinzen schickten Geld nach Jeru, um das Königreich zu unterstützen und sich den Schutz des Königs und seines Heeres zu sichern. Das Steuerneintreiben oblag nun den Lords der Provinzen.
Der bärtige Mann in der Mitte der Gruppe, dessen Gesicht so hager und dunkel wirkte wie die Bäume im Wald von Drue, übernahm das Wort. »Wir haben von Euch gehört, Kjell von Jeru. Ihr seid des Königs Bruder.«
Kjell stritt die Verwandtschaft nicht ab, verspürte aber auch keinen Stolz auf seinen Status. Auf die Blutlinie, die ihn mit dem König verband, konnte er sich nichts einbilden, und er war sich keineswegs sicher, ob es einen Vorteil bedeutete, dass ihm sein Ruf vorausgeeilt war. Immerhin war er nicht von makelloser Herkunft. Stumm wartete er darauf, dass der Mann weitersprach.
»Seid mir gegrüßt und auch Eure Männer. Ich bin Syed. Wir haben Geschenke für König Tiras mitgebracht und bitten Euch untertänigst, ihm unsere Lehnstreue zu versichern, wenn Ihr nach Jeru City zurückkehrt.« Die Andeutung war gut verschleiert, aber Kjell entging sie dennoch nicht. Die Ältesten hatten den Weg nur auf sich genommen, um ihn und seine Männer loszuwerden. Sie würden es lieber sehen, wenn die Wachen des Königs weiterzogen und niemals auch nur einen Fuß nach Solemn setzten.
Nun, das war die völlig falsche Taktik, denn Kjell hasste es, wenn man ihm sagen wollte, was er zu tun habe.
»Das ist sehr großzügig von Euch, Syed. Aber Ihr müsst uns keine Geschenke machen. Eine Mahlzeit, ein Bad und vielleicht einen Tag zum Ausspannen, mehr brauchen wir nicht. Auch unsere Pferde würden sich über Ruhe und etwas Futter freuen. Anschließend reisen wir weiter. Könnt Ihr uns in Eurem Dorf eine Unterkunft zur Verfügung stellen?« Kjells Stimme klang sanft, als er seinen Blick durchdringend auf sein Publikum richtete. Sashas Worte hatten sich bisher immer als wahr erwiesen.
Der bärtige Mann erstarrte. Die anderen tauschten unruhige Blicke.
»Es gibt … ein paar Schwierigkeiten bei uns im Dorf«, sagte Syed zögernd. »Manche Bewohner sind krank. Es wäre klüger, wenn Ihr nicht mit dorthin kommt.«
»Unser Hauptmann ist ein sehr geschickter Heiler«, mischte Jerick sich ein. »Gestern Nacht hat er eine Eurer Frauen geheilt. Sie war gestürzt und dem Tode nahe. Vielleicht kann er auch den Bewohnern Eures Dorfes helfen.« In Jericks Stimme schwang eine Ernsthaftigkeit, der nur wenige anmerken würden, dass sie trog. Kjell hätte ihn sofort zum Schweigen gebracht – mit Nachdruck –, hätte seine Äußerung ihm nicht in die Hände gespielt. Offenbar hatte Sasha am vergangenen Abend auch Jerick ein paar Einzelheiten über ihre Herkunft verraten.
»Sasha!«, rief Kjell ihr zu. »Tritt vor, Frau. Zeig deinen Dorfältesten, dass es dir gut geht. Gewiss haben sie sich sehr gesorgt, als du gestern nicht zurückgekehrt bist. Hier streift ein Wolfsrudel herum.« Er spürte, wie seine Männer den Weg für sie freimachten, drehte sich aber nicht um. Er hörte ihre Schritte und sah das Wiedererkennen auf den Gesichtern der Ältesten vor ihm.
Einer der sechs, ein weißhaariger Mann mit Hängebacken, Schlupflidern und besorgter Miene, entdeckte Sasha als Erster und keuchte hörbar auf. Seine Brust hob sein gelbes Gewand, und seine Finger packten die Zügel seines Kamels so fest, dass die Knöchel weiß wurden. Das Tier spürte seine Angespanntheit und wich ein paar Schritte zurück. Der Mann wollte sich aus dem Staub machen und war nicht der Einzige.
»Sie ist eine Hexe«, rief ein dicker Mann. »Drei Sommer hat sie in unserem Dorf gelebt; sie hat das Böse zu uns gebracht. Feuer und Überschwemmungen, Krankheiten und Gebrechen. Wir haben sie mit unseren Speeren gejagt, doch sie ist uns entkommen.«
Kjell musterte ihn finster. In Gedanken sah er den geschundenen Körper der Frau vor sich, die gebrochenen Knochen, das viele Blut. Sie war nicht entkommen. Wäre sie geflohen und entkommen, hätte er sie nicht heilen und ihre Seele in ihren Körper zurücklocken müssen.
»Es verstößt gegen die Gesetze von Jeru, jenen mit der Gabe Leid zuzufügen«, stellte er vorwurfsvoll fest.
»Sie hat unsere Leute krankgemacht. Sie wird auch Eure Männer krankmachen. Eure Pferde werden sterben und Eure Knochen auf den Ebenen von Quondoon in der Sonne verrotten. Da sie nun mitten unter Euch weilt, werdet Ihr ebenso leiden wie wir«, sagte Syed. Sein Blick schweifte zwischen Kjell und Sasha hin und her. Vermutlich wunderte er sich darüber, wie sie gesund und wohlauf vor den Ältesten stand.
Sie verteidigte sich nicht, sie sagte gar nichts, und Kjell tat es ihr nach. Seiner Erfahrung nach konnte man jemanden von einer vorgefassten Meinung nur selten abbringen. Und diese Männer waren so überzeugt von der Schuld dieser Frau, dass sie nicht einmal davor zurückschreckten, sie für ihre angeblichen Sünden zur Strafe über eine Klippe zu stoßen. Er würde Sasha selbst über das Schicksal jener entscheiden lassen, die ihr Leid zugefügt hatten. So hätte es auch König Tiras gehalten.
»Was sollen wir tun, Frau? Verdienen die Leute von Solemn, dass man sie heilt?«, fragte er, die Hand am Schwert, den Blick auf die Männer gerichtet, die ihn von hier fortwünschten. Ihm war das recht. Auch er wollte schnellstmöglich von hier fort. Nur zu gern würde er das Dorf seinem Leiden überlassen.
»Ein jeder hat Heilung verdient«, antwortete Sasha sofort, und Kjell seufzte innerlich. Der Mann mit den Hängebacken wich noch weiter zurück.
Der Anführer hob einen zittrigen Finger und deutete auf Sasha. »Du bist in Solemn nicht willkommen«, zischte er.
»Gebt Euren Leuten Bescheid, Syed«, befahl Kjell, ohne auf ihn einzugehen. »Wir kommen nach Solemn.« Er vollführte eine scheuchende Geste. Seine Männer bildeten einen schützenden Kreis um ihn und trieben die Ältesten mit ihren gesenkten Speeren zurück, ohne weitere Worte oder Argumente zu dulden. Kjell wartete, bis die Ältesten ihre Kamele gewendet und sich auf den Rückweg gemacht hatten. Ihre Geschenke waren abgewiesen worden, ihre schlimmsten Befürchtungen hatten sich bestätigt.
»Jerick, nimm dir ein Dutzend Männer. Reite nach Solemn. Sorg dafür, dass die Ältesten keinen Ärger machen. Ich komme bald nach. Und Jerick?«
»Ja, Hauptmann?«
»Sprich nie wieder für mich. Niemals. Ich allein entscheide, wen ich heile. Du gehst mit dieser Information viel zu freizügig um. Mach das nie wieder, sonst schicke ich dich zurück nach Jeru City.«
»Jawohl, Hauptmann.« Jerick machte ein zerknirschtes Gesicht und straffte die Schultern, aber Kjell war noch nicht fertig.
»Trinkt auf keinen Fall Wasser in Solemn. Keiner von euch. Trinkt nur, was ihr in euren Feldflaschen habt. Und wartet meine Ankunft ab«, wies er die Männer an.
Jerick hob überrascht die Brauen, aber er nickte. Dann wendete er sein Pferd und brüllte den Soldaten, die bereits auf ihren Pferden saßen, Befehle zu.
Nachdem Jerick und sein Trupp aufgebrochen waren, wies Kjell die verbliebenen Männer an, ihre Flaschen zu füllen und das Lager abzubrechen. Während sie seine Befehle eilig ausführten, stieg Kjell von Lucians Rücken und wandte sich der schweigsamen Sasha zu. Sie sah ihn nicht an. Ihr Blick war leer und in jene Richtung gewandt, in die die Ältesten verschwunden waren.
»Du musst nicht nach Solemn mitkommen. Ich will mir nur ein Bild von der Situation machen, damit ich die Gefahr einschätzen kann. Dann ziehe ich mit meinen Männern weiter. Ich hege nicht den Wunsch, länger in Quondoon zu bleiben als notwendig. Ich will gegen Bestien kämpfen, nicht gegen Kleinkariertheit und Dummheit.«
»Ich ziehe das Böse nicht an«, sagte Sasha leise, als hätte sie ihm gar nicht zugehört. »Ich bringe keine Seuchen oder Feuersbrünste über Menschen. Ich verursache kein Leid. Aber ich weiß manchmal, wann es kommt.«
Kjell zog eine Grimasse, brachte sie jedoch nicht zum Schweigen.