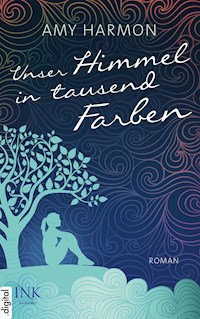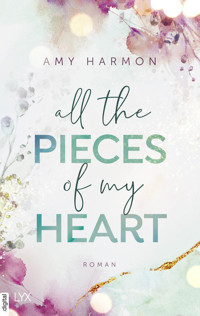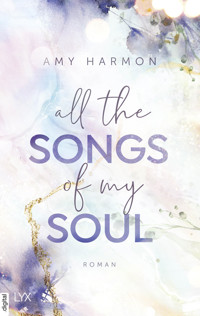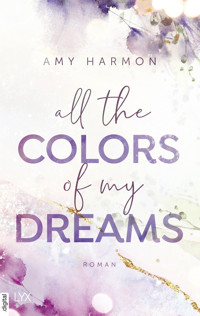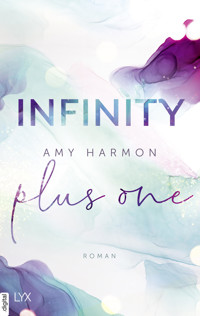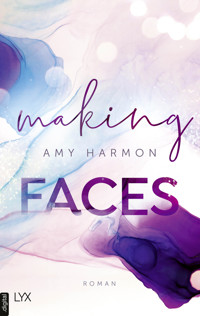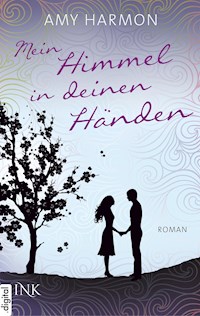9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Bird-and-Sword-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein Mädchen ohne Stimme.
Ein König in Ketten.
Ein Fluch, der sie vereint.
Mit fünf Jahren musste Lark mit ansehen, wie ihre Mutter vor ihren Augen hingerichtet wurde. Mit dem letzten Atemzug nahm sie ihrer Tochter die Stimme und die Macht der Worte. Denn Magie ist eine Todsünde in Jeru. Dreizehn Jahre später erscheint der junge König Tiras am Hof von Larks Vater, um diesen an seine Treuepflicht im Krieg zu erinnern. Er nimmt die stumme junge Frau als Geisel mit sich. Zunächst fürchtet Lark den König, doch sie merkt schnell, dass Tiras ebenso wenig frei ist wie sie und dass die Liebe womöglich die einzige Waffe ist, die ihrer beider Ketten sprengen kann ...
"Atemberaubend - eine epische Geschichte voller Magie und Romantik!" Totally Booked Blog
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchKarteAussprache der NamenWidmungProlog1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435EpilogDanksagungDie AutorinImpressumAMY HARMON
Bird and Sword
Roman
Ins Deutsche übertragen von Corinna Wieja
Zu diesem Buch
»Schweige, Tochter,
bleib am Leben.«
Kurz bevor sie unter dem Schwert des alten Königs stirbt, spricht die Mutter der kleinen Lark einen mächtigen Fluch aus – um ihre Tochter zu schützen und ihren Henker zu strafen. Im Lande Jeru ist Magie eine Todsünde, und Larks Gabe der Worte könnte sie ebenfalls das Leben kosten. Ihrer Stimme beraubt, wächst das Mädchen fortan wie in einem goldenen Käfig auf, denn durch denselben Fluch, der Lark die Stimme nahm, ist das Leben ihres Vaters an das ihre gebunden. Dreizehn Jahre nach jenem schicksalhaften Tag kommt der junge König Tiras an den Hof ihres Vaters. Da dieser seiner Treuepflicht nicht nachgekommen ist, nimmt Tiras Lark als Friedgeisel mit in die Hauptstadt. Denn der König braucht jeden Mann im Kampf gegen die Vogelbestien, die das Land heimsuchen. Obwohl Lark eine Gefangene ist und den König zunächst fürchtet, begreift sie rasch, dass er nicht wie sein grausamer Vater ist. Und bald geschieht etwas Unfassbares – Tiras kann sie auch ohne ihre Stimme hören. Zwischen ihnen scheint ein geheimnisvolles Band zu existieren. Lark erkennt, dass der junge König ebenso wenig frei ist wie sie und dass die Liebe womöglich die einzige Waffe ist, die ihrer beider Ketten sprengen kann.
Aussprache der Namen
Jeru – JEH ru
Meshara – Meh SCHAH rah
Lark – Lahrk
Tiras – TIR as
Boojohni – Bu JAH nie
Degn – Dehgn
Corvyn – KOHR vin
Zoltev – ZOHL tehv
Volgar – VOHL gahr
Kjell – Kjell
Kilmorda – Kil MOOR da
Bin Dar – BIN Dahr
Gol – Gohl
Drue – Dru
Firi – FIri
Bilwick – BIL wik
Enoch – I nok
Quondoon – Kwahn DUN
Janda – JAHN da
Jyräisch – Ji RÄ isch
Jeruvianisch – Jeh RU via nisch
Niva – NI vah
Liesh – LII tsch
Shenna – Schenna
Hashim – Ha SCHIM
Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer denn kein zweischneidig Schwert, und dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens.
Prolog
Sie war so klein. Nur ihre Augen waren groß. Ernst und grau wie der Nebel über dem Moor nahmen sie ihr Gesicht ein. Sie war fünf Sommer alt und doch kaum größer als ein Kind von drei Sommern. Und sie war so schmächtig, dass ich mir Sorgen machte. Nicht etwa, weil sie krank aussah. Sie war auch noch nie krank gewesen. Keinen einzigen Tag. Aber sie war so zierlich und wirkte so zerbrechlich wie ein kleiner Vogel. Kleine Knochen und eine schmale Statur, ein spitzes Kinn und Elfenohren. Ihre hellbraunen Haare waren dick und so weich wie Daunen. Wenn ich sie an mich drückte, fühlte es sich an, als würden Federn über mein Gesicht streichen, was den Vergleich noch verstärkte.
Sie war meine kleine Lerche. Lark – der Name schoss mir sofort in den Kopf, als ich sie sah, und ich akzeptierte ihn, nahm ihn vom Vater aller Wörter an und vertraute darauf, dass das Schicksal ihn für sie bestimmt hatte.
»Was machst du denn hier, Lark?«, fragte ich in absichtlich strengem Ton. Meine Tochter zeigte jedoch keine Spur von Angst vor mir, obwohl ich sie an einem Ort erwischt hatte, an dem sie nicht sein durfte. Dieses Zimmer war etwas ganz Besonderes für mich, mein Lieblingsort. Ich hielt mich gern dort auf, vor allem mit ihr. Ich befürchtete jedoch, dass sie sich an der spitzen Spindel des Spinnrads stechen oder durch die hohen, offenen Fenster in den Burghof hinabstürzen könnte, deshalb durfte sie nicht allein herkommen. Nun stellte ich fest, dass sie sich meiner Anweisung widersetzt hatte.
»Ich mache Puppen«, antwortete sie. Ihre rauchige Stimme bot einen merkwürdigen Kontrast zu ihrer winzigen Gestalt. Ihre Zunge spitzte zwischen den rosigen Lippen heraus, was verriet, dass sie ganz in ihre Bastelei vertieft war. Sie wickelte einen Faden um das ausgestopfte Stück Stoff in ihrer Hand und gestaltete so den Kopf, der ein wenig schief auf dem Körper saß. Beine und Arme hatte die Puppe bereits. Drei weitere Puppen lagen fertig daneben auf dem Boden.
»Lark, du sollst doch nicht allein hierherkommen. Das ist gefährlich für ein kleines Mädchen. Und du darfst deine Worte nicht benutzen, wenn ich nicht dabei bin«, schimpfte ich.
»Aber du warst so lange weg«, erwiderte sie mit bekümmertem Blick.
»Schau mich nicht so an. Das ist keine Entschuldigung für Ungehorsam.«
Sie ließ den Kopf sinken und wirkte wie ein Häufchen Elend. »Es tut mir leid, Mutter.«
»Versprich mir, dass du dich daran erinnern wirst und mir immer gehorchst.«
»Ich verspreche es … und gehorche.«
Ich wartete einen Moment, damit das Versprechen Zeit hatte, sich auf uns niederzulegen und sie an ihre Worte zu binden.
»Und jetzt erzähl mir von deinen Puppen.«
»Die hier tanzt gerne.« Sie deutete auf die Lumpenpuppe zu ihrer Linken. »Und die klettert gern …«
»Wie eine kleine Lerche, die ich kenne«, unterbrach ich zärtlich.
»Ja, wie ich. Und die hier springt gern.« Sie hielt die kleinste Puppe hoch.
»Und die hier?« Ich deutete auf die Puppe, die sie gerade fertiggestellt hatte.
»Die ist ein Prinz.«
»Ach ja?«
»Ja. Der Prinz der Puppen. Er kann fliegen.«
»Ohne Flügel?«
»Ja. Man braucht keine Flügel, um zu fliegen.«
»Was braucht man dann dazu, Tochter?«, fragte ich.
»Wörter«, antwortete sie. Ein wissender Blick leuchtete in ihren großen grauen Augen auf.
»Zeig mir, was deine Worte bewirken«, flüsterte ich.
Sie nahm die Puppe neben sich hoch und drückte die Lippen an die Stelle, wo das Herz sitzen würde.
»Tanz«, wisperte Lark. Sie glaubte fest daran, dass die Puppe es konnte. Sie legte sie auf den Boden und wir sahen zu, wie die kleine Lumpenpuppe ihre ungleichen Arme und Beine anhob und dann durchs Zimmer sprang und sich drehte. Ich lachte leise. Meine kleine Lark nahm die nächste Puppe in die Hand.
»Spring«, befahl sie, während sie den Mund auf die Brust der Puppe drückte. Die Puppe sprang ihr aus der Hand und hüpfte lautlos hinter der tanzenden her.
Auch die anderen Puppen wurden mit einem Wort bedacht und wir beobachteten fasziniert, wie eine die Vorhänge erklomm und der Prinz der Puppen die Lumpenarme wie Flügel ausbreitete und, einem glücklichen Vogel gleich, durchs Zimmer segelte. Lark klatschte in die Hände und tanzte mit ihren neuen Freunden herum. Ich schloss mich ihr an.
Ausgelassen verloren wir uns in unserem Freudentanz. Daher vernahm ich die schweren Schritte im Flur vor der Tür fast zu spät. Ich war dumm gewesen, und viel zu leichtsinnig. Das sah mir gar nicht ähnlich.
»Lark, nimm die Worte fort!«, rief ich und verschloss schnell die Tür.
Lark schnappte sich die tanzende Puppe und nahm ihr das Wort wieder fort, wie ich es sie gelehrt hatte, indem sie es rückwärts auf die Brust der Puppe hauchte.
»Znat«, sagte sie, atmete das Wort ein und schluckte es hinunter. Sie hob die hüpfende Puppe, die ihr um die Beine sprang, hoch und sagte: »Gnirps.«
Ein Hämmern ertönte an der Tür, und mein Diener Boojohni rief mich mit drängender Stimme. »Lady Meshara! Der König ist hier. Lord Corvyn sagt, Ihr sollt sofort kommen.«
Ich klaubte die kletternde Puppe von der Steinmauer neben der schweren Tür und warf sie Lark zu. Wie zuvor bei den anderen machte sie auch bei ihr das Wort wieder rückgängig.
»Wo ist der fliegende Prinz?«, zischte ich und suchte mit fieberhaftem Blick die Deckenbalken und Ecken ab. Da, aus dem Augenwinkel entdeckte ich ihn. Er war durch das offene Fenster geflogen und flatterte wie ein Taschentuch im Wind, obwohl Windstille herrschte.
»Lady Meshara!« Boojohni schien genauso hektisch zu sein wie wir, aber aus anderem Grund.
»Komm, Lark. Es wird schon gut gehen. Er ist zu hoch, man wird ihn nicht sehen. Bleib hinter mir, verstanden?«
Als sie nickte, konnte ich sehen, dass ich ihr Angst eingejagt hatte. Sie hatte auch allen Grund, sich zu fürchten. Ein Besuch vom König verhieß nichts Gutes. Ich öffnete die Tür und grüßte Boojohni, der sich sofort umwandte und den Flur hinunterlief. Er wusste, dass ich ihm folgen würde.
Zwanzig Reiter hatten sich in dem großen Burghof versammelt. Mein Gatte kniete und katzbuckelte vor dem König, als ich mit Lark am Rockzipfel hinunterkam. Für jemanden, der immer so verächtlich von unserem Herrscher sprach, war mein Lord erstaunlich schnell bereit, ihm die Stiefel zu küssen. Die Angst machte aus uns allen Schwächlinge.
»Lady Meshara!«, polterte der König. Mein Gatte erhob sich und drehte sich zu mir; Erleichterung stand in seiner Miene.
Ich sank in einen tiefen Hofknicks, wie man es von mir erwartete, und Lark ahmte mich nach. Der König musterte sie.
»Wen haben wir denn da? Eure Tochter, Meshara?«
Ich nickte, nannte ihm jedoch nicht ihren Namen. Namen üben Macht aus, und ich wollte nicht, dass er Macht über sie bekam. In meiner Jugend hatte ich darüber nachgedacht, ob ich um die Aufmerksamkeit des Königs wetteifern sollte – ich war die Enkelin des Lords von Enoch, von nobler Geburt und verliebt in den gut aussehenden König Zoltev von Degn.
Das war allerdings, bevor ich erlebte, wie er einer alten Frau die Hände abhackte, weil sie Weizen zu langen goldenen Bändern gesponnen hatte. Daher bat ich meinen Vater, eine Ehe mit Lord Corvyn zu arrangieren. Corvyn war zwar ein Schwächling, aber nicht boshaft, obwohl ich mich durchaus fragte, ob Feigheit nicht ebenso gefährlich war wie Boshaftigkeit. Die Feigen und Schwachen ließen zu, dass das Böse gedieh.
»Keine Söhne, Corvyn?«, fragte König Zoltev gutmütig.
Mein Gatte senkte beschämt den Blick, als ob ihm dies peinlich sei, und Wut brodelte in mir hoch.
»Ich zeige meinem Sohn sein Königreich. Eines Tages wird all das ihm gehören.« König Zoltev vollführte eine weit ausholende Geste, die die Burg, die Berge und die demütig niederknienden Menschen im Burghof umfasste, als ob ihm sogar der Himmel über unseren Köpfen gehörte und die Luft, die wir atmeten.
»Prinz Tiras, zeig dich deinem Volk.« Der König drehte sich im Sattel um und winkte seinen Sohn zu sich.
Die königlichen Wachen wichen zur Seite und machten einem Jungen auf einem großen, schwarzen Hengst den Weg frei. Er war schlank und geschmeidig und schien nur aus Ellbogen, Schultern, Knien und Füßen zu bestehen, als hätte er gerade einen Wachstumsschub hinter sich gebracht. Seine Haare und Augen waren fast so schwarz wie sein Pferd, und seine Haut schimmerte wie das Gold der Spinnerin. Seine Mutter, die verstorbene Königin, stammte nicht aus Jeru. Sie war aus einem südlichen Land gekommen, dessen Bewohner für ihre dunkle Hautfarbe und ihre Geschicklichkeit im Umgang mit dem Schwert bekannt waren. Prinz Tiras saß sicher im Sattel, umgeben von einem Halbkreis aus Wachen. Auf seiner Brust prangte kein königliches Wappen, und auch sein Pferd war in dunkles Grün gehüllt, wie die Streitrösser der Soldaten. Womöglich sollte dies aber auch nur seinem Schutz dienen. Ob als Sohn eines unbeliebten oder beliebten Königs, in beiden Fällen könnte er ins Visier von Entführern oder rachsüchtigen Intriganten geraten.
Ehrerbietig versank ich in einem tiefen Hofknicks. Furchtlos wie immer kam Lark hinter meinem Rücken hervor und streichelte das Pferd des Prinzen. Neben dem riesigen Tier wirkte sie wie ein winziges Feenkind. Der Prinz glitt aus dem Sattel und streckte die Hand zum Gruß aus. Lark kicherte erfreut und legte ihre winzige Hand in seine. Er lächelte, als sie ihm einen Kuss auf die Knöchel drückte. Ich glaubte, sie flüstern zu hören, als ihr Mund seine Finger berührte, und wollte sie wegziehen, weil ich plötzlich Angst hatte, dass sie ihn mit einer ihrer unschuldigen Wortgaben bedachte. Aber niemand beachtete sie und den Prinzen.
Ein Raunen durchlief die Menge. Ich hob den Blick und sah, dass die weiße Puppe in der Luft tanzte. Einen Herzschlag lang herrschte Stille, als Mensch und Tier beobachteten, wie die alberne Puppe wie eine seltsam geformte Taube durch die Luft schwebte. Wie ein Kind, das zu seiner Mutter will, kehrte die Puppe zu ihrer Erschafferin zurück.
»Vater, schau!« Der Prinz war bezaubert von dem lustigen Flugobjekt. »Das ist Magie!«
»Der Prinz der Puppen ist uns gefolgt, Mutter«, flüsterte Lark ängstlich. Sie streckte die Hand nach der Puppe aus, die sie mit dem Wort »Flieg« zum Leben erweckt hatte.
So harmlos. So unschuldig. So tödlich.
Ich pflückte den Flieger aus der Luft und schob die Faust hinter meinen Rücken, wo Lark sich versteckt hatte. Ich spürte, wie sich ihre kleinen Hände verzweifelt in meinen Rock krallten, aber ich wagte es nicht, mich zu ihr umzudrehen und dadurch Aufmerksamkeit auf sie zu lenken.
»Magie!«, zischten die Wachen des Königs, und plötzlich war der Bann gebrochen. Die Pferde bäumten sich auf und Schwerter wurden gezogen. In den Augen des Prinzen stand Entsetzen, als er versuchte, sein Pferd zu bändigen, das wenige Sekunden zuvor noch so sanft gewesen war.
»Hexe«, brüllte der König. »Hexe!« Er hob sein Schwert zum Himmel, als wolle er eine andere Art von Macht beschwören. Sein Pferd stieg und seine Augen funkelten.
»Gesteht, Lady Meshara«, donnerte er. »Kniet nieder und gesteht, dann werde ich Euch rasch töten.«
»Wenn Ihr mich tötet, dann werdet Ihr Eure Seele verraten und Euren Sohn an den Himmel verlieren«, warnte ich. Mein Blick flog kurz zu seinem jungen Sohn, der mich ansah, die Hände in die Mähne seines Pferdes gekrallt.
»Kniet nieder!«, befahl Zoltev erneut. Seine von Wut erfüllte Stimme hallte wie Donner über den Hof.
»Ihr seid ein Monster und Jeru wird Euer wahres Gesicht sehen. Ich werde nicht niederknien, um mich von Euch abschlachten zu lassen, und ich werde Euch auch nicht beichten, als ob Ihr mein Gott seid.«
Lark presste wimmernd die Lippen auf die Puppe in meiner Faust.
»Geilf«, hörte ich sie flüstern und die sich windende Puppe erschlaffte, während der König sein Schwert zum vernichtenden Schlag erhob. Jemand schrie und der Schrei gellte durch die Luft, als ob der König den Himmel in zwei Hälften geteilt und das Grauen freigelassen hätte. Ich fiel zu Boden, bedeckte mein kleines Mädchen, die Puppe immer noch in der Faust.
Ich spürte keinen Schmerz. Nur Druck. Druck und Kummer. Herzzerreißenden Kummer. Meine Tochter würde allein mit ihrer außerordentlichen Gabe aufwachsen. Ich würde sie nicht mehr beschützen können. Ich spürte, wie mein Blut aus meinem Körper floss und auf ihren strömte, und ich drückte meinen Mund an ihr Ohr und rief die Worte an, die jedes Lebewesen benennen.
»Schlucke, Tochter, die Worte, die dir auf den Lippen liegen. Halte sie bei dir, auch wenn sie noch so viel wiegen. Verschließ sie tief in deiner Seele, verbirg sie, bis sie an Größe gewinnen. Verschließ deinen Mund der Macht, verfluche nicht, heile nicht, bis die rechte Zeit gekommen ist. Du wirst nicht reden, wirst keine Worte geben, wirst weder Himmel noch Hölle befehlen. Du wirst erblühen und nach Wissen streben. Schweige, Tochter, bleib am Leben.«
Ich hörte jemanden rufen, um Gnade flehen und erkannte, dass sich Boojohni über mich geworfen hatte, um mich vor einem weiteren Schlag zu schützen. Aber ein weiterer Schlag war nicht nötig.
Corvyn kniete neben mir nieder und stöhnte entsetzt auf. Ich hob meinen Kopf von Larks Ohr und schaute ihm in die grauen Augen, in denen Tränen der Angst standen. Ich musste ihm Stärke geben und dafür sorgen, dass er glaubte, und sei es nur, damit er selbst überlebte. Ich konzentrierte mich auf das, was gesagt werden musste. Die Macht meiner Worte ergoss sich auf die Pflastersteine.
»Verbirg ihre Worte, Corvyn. Denn wenn sie stirbt … wenn ihr auch nur ein Haar gekrümmt wird, dann wird dir dasselbe Schicksal blühen.«
Seine Augen weiteten sich vor Schreck, als sich meine schlossen und die Worte und die Welt um mich herum verstummten.
1
Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort.
Ich kann keine Worte bilden. Ich kann keinen Laut von mir geben. Ich habe Gedanken und Gefühle. Ich spüre Bilder und Farben. All das bleibt jedoch tief in mir verschlossen, denn ich kann keine Worte bilden.
Aber ich kann sie hören.
Die Welt ist voller Worte, sie lebt dadurch. Die Tiere, Bäume, das Gras und die Vögel unterhalten sich mit ihren eigenen Worten.
»Leben«, sagen sie.
»Luft«, hauchen sie.
»Hitze«, summen sie. Die Vögel rufen »Fliegen, fliegen!« und die Blätter winken sie voran, entfalten sich und flüstern: »Wachsen, wachsen.«
Ich liebe diese Wörter. Sie täuschen nicht und sie verwirren nicht. Die Wörter sind einfach. Die Vögel verspüren Freude, ebenso wie die Bäume. Sie verspüren Freude in ihrer Schöpfung, weil sie »sind«. Jedes Lebewesen hat ein Wort, und ich höre sie alle.
Dennoch kann ich sie selbst nicht formen.
Meine Mutter hat mir erzählt, dass Gott mit Worten Welten entstehen ließ. Mit seinen Worten hat er Licht und Dunkelheit, Wasser und Luft, Pflanzen und Tiere erschaffen. Aus dem Staub und dem Schmutz dieser Welten hat er Kinder nach seinem Ebenbild geformt, zwei Söhne und zwei Töchter, und ihren Lehmkörpern Leben eingehaucht.
Im Anfang gab er jedem Kind ein Wort. Es war ein mächtiges Wort, denn es beschrieb eine Fähigkeit, eine kostbare Gabe, die sie auf ihrer Reise durch die Welt leiten sollte. Eine Tochter erhielt das Wort »spinnen«, weil sie alle möglichen Dinge zu Gold spinnen konnte. Das Gras, die Blätter, eine Strähne ihres Haars. Ein Sohn erhielt das Wort »wandeln«, was ihm die Gabe verlieh, sich in die Tiere des Waldes oder Wesen der Luft zu verwandeln. Das Wort »heilen« wurde dem zweiten Sohn gegeben, damit er die Krankheiten und Verletzungen seiner Geschwister kurieren konnte. Die zweite Tochter erhielt das Wort »weissagen« und konnte die Zukunft vorhersagen. Einige behaupteten sogar, dass sie die Zukunft mit der Macht ihrer Worte verändern konnte.
Die Spinnerin, der Wandler, der Heiler und die Weissagerin lebten lange und hatten viele Kinder, doch selbst mit gesegneten Worten und Wunderkräften war das Leben in ihrer Welt gefährlich und schwierig. Oftmals war Gras nützlicher als Gold. Ein Mensch wünschenswerter als ein Tier. Der Zufall verführerischer als Wissen, und das ewige Leben war ohne Liebe völlig sinnlos.
Der Heiler konnte die Krankheiten seiner Geschwister heilen, aber er konnte sie nicht vor sich selbst retten. Er beobachtete wie sein Bruder, der Wandler, so viel Zeit als Tier inmitten von Tieren verbrachte, dass er selbst zu einem wurde. Die Spinnerin, die den Wandler liebte, verzehrte sich darüber so sehr vor Kummer, dass sie ohne Unterlass weiterspann, bis sie sich selbst zu Gold gesponnen hatte und als traurige Statue neben dem Brunnen der Welt endete, aus dem sie emporgestiegen war. Als ihr klar wurde, dass sie alles vorausgesagt hatte, schwor sich die Weissagerin, nie wieder zu sprechen. Der Heiler, der sich ohne sie einsam fühlte, starb an gebrochenem Herzen, weil er sich weigerte, sich selbst zu heilen.
Ihre Kinder verteilten sich über das ganze Land, und die Zeit verging. Aus Jahren wurden Jahrzehnte und aus Jahrzehnten Jahrhunderte. Die Familien wurden größer und größer, und viele besaßen die Gabe der Worte oder die Fähigkeit, sich zu verwandeln, zu heilen oder zu spinnen. Doch durch das Vermischen der Gaben war deren Macht geschwächt oder verändert worden. Neue Gaben entstanden, einige verschwanden ganz. Manche nutzten ihre Gabe auch, um anderen aus Selbstsüchtigkeit zu schaden.
Ein Abkömmling des Wandlers, ein König, der sich in einen Drachen verwandeln konnte, plünderte das Land und brannte es nieder. Er tötete alle Menschen, die sich ihm widersetzten. Ein mächtiger Krieger, der König werden wollte, erlegte den Drachen und verdiente sich damit die Dankbarkeit eines verängstigten Volkes. Er bestimmte, dass alle dieselben Fähigkeiten haben sollten. Er befahl, dass jene, die spinnen, weissagen, sich wandeln oder heilen konnten, ihre Gaben nicht nutzen durften, da sie dadurch anderen gegenüber im Vorteil waren. Die Menschen waren sowohl neidisch als auch verängstigt, und viele stimmten dem ehrgeizigen Krieger zu, manche jedoch nicht. Eine Frau, deren kranker Sohn durch einen Heiler genesen war, meinte, dass die Gaben allen nutzten. Sie wurde von einem Mann unterstützt, dessen Ernte von einer Weissagerin gerettet worden war, die einen Sturm prophezeit und ihn aufgefordert hatte, früher aufs Feld zu gehen.
Die Stimmen der Angst und Unzufriedenheit sind jedoch immer die lautesten und so wurden die Weissager, Heiler, Wandler und Spinner vernichtet. Man verbrannte die Weissager auf dem Scheiterhaufen, hackte den Spinnern die Hände ab, jagte die Wandler wie die Tiere, deren Gestalt sie annahmen, und steinigte die Heiler auf den Dorfplätzen. Diejenigen, die eine besondere Gabe besaßen, verbargen aus Angst ihre Fähigkeiten schließlich sogar voreinander.
Der Krieger wurde König, und sein Sohn folgte ihm auf den Thron. Generation um Generation wurde das Land von Kriegerkönigen regiert, die mit Eifer die Begabten unter ihren Untertanen vernichteten, überzeugt davon, dass Gleichheit nur dann erreicht werden konnte, wenn niemand besonders war, und die Macht der Worte ausgelöscht wurde.
Meine Mutter hatte Worte geformt. Sie war eine Weissagerin gewesen und ihre Worte waren magisch. Sie konnte sie zum Leben erwecken. Sie wurden zur Wirklichkeit und verkündeten die Wahrheit. Mein Vater wusste das und hatte Angst. Worte können grausam sein, wenn man die Wahrheit nicht hören will.
Meine Mutter ging achtsam mit ihren Worten um und ließ sie im Tod verstummen. Nun schwirrten ihre Worte lautlos um mich herum wie stille Beobachter, die darauf warteten, dass jemand sie aussprach und ihnen Leben einhauchte.
Während ich durch den Wald lief, lauschte ich den Geräuschen. Die Nacht flüsterte mir ins Ohr, die Worte legten sich Schicht für Schicht übereinander. Die Eule rief ihr »Huhu«, doch sie wollte nicht wissen, wer kam. Sie wusste es bereits und beobachtete mich ohne Furcht. Der Mond hing riesig groß über mir am Nachthimmel, der Boden unter meinen Füßen war weich. Ich fühlte mich den anderen stummen Lebewesen verbunden und genoss dieses Gefühl der Zugehörigkeit. Wir waren gleich. Wir lebten, aber niemand nahm uns richtig wahr. Ich streifte mit den Fingerspitzen über die raue Rinde eines Baumes und spürte, wie er mich grüßte, obwohl es mehr eine Empfindung als ein Wort war.
Die Welt schlief, und auch der Wald schlummerte, wenn auch nicht ganz so tief. Hier erwachte eine andere Welt zum Leben. Ich lehnte mich gegen den Baum, der sich wie ein Freund anfühlte, und ließ mich von Frieden erfüllen.
Ein plötzlicher Schrei schallte durch das Blätterdach und durchschnitt die Stille. Der Baum zog sich in sich zurück, und die Worte, die um mich schwebten, verstummten. Nur eines blieb: Gefahr. Gefahr, rauschte der Wald um mich herum, doch anstatt wegzulaufen, drehte ich mich in die Richtung, aus der der Schrei gekommen war.
Jemand litt schreckliche Schmerzen.
Ich weiß nicht, warum ich hinlief. Aber ich tat es. Ich folgte dem Schrei, der die Dunkelheit zerteilte und mir eine Gänsehaut verursachte. Kurz verebbte das Kreischen, doch dann schwoll es wieder an, wie ein Todesruf. Ich erreichte eine Lichtung und blieb stehen. Denn dort, in einer Pfütze aus Mondlicht, lag der größte Vogel, den ich je gesehen hatte. Ein Pfeil ragte aus seiner Brust. Sein Gefieder erzitterte, als er Atem schöpfte, mühevoll, keuchend. Vorsichtig näherte ich mich.
Ich konnte den Vogel nicht beruhigen, so wie eine Mutter ihr Kind. Menschliche Laute verängstigten Tiere eher, als sie zu beschwichtigen, es sei denn, es handelte sich um ein geliebtes Haustier oder ein treues Pferd. Und vor mir lag weder das eine noch das andere. Der Vogel hob den weißen Kopf. Seine schwarzen Augen richteten sich auf mein Gesicht, misstrauisch und verzweifelt zugleich. Seine Schwingen zuckten, als ob er wegfliegen wolle, aber er war am Ende seiner Kraft.
Es war ein Adler, ein majestätisches Tier, das man gewöhnlich nur aus der Ferne bewundern kann, wenn überhaupt. Die Spitzen seines samtig schwarzen Gefieders schimmerten blutrot. Ich wagte nicht, ihn zu berühren. Nicht etwa aus Furcht vor ihm, sondern weil ich ihn nicht erschrecken wollte. Gewiss würde er wegfliegen wollen, wenn ich ihm zu nahe kam, und dadurch noch mehr Schmerzen erleiden. Ich kniete neben ihm nieder und versuchte herauszufinden, ob ich ihm helfen konnte.
Vorsichtig hob ich meine Hand über seine ausgebreitete Schwinge. Dann schloss ich die Augen und schob ihm ein Wort zu. Durch meine Gedanken versuchte ich, ihm Kraft zu geben. Auf diese Weise teilten die Tiere sich mir mit, und ich nutzte diese Art der Kommunikation, wenn ich meinen Willen durchsetzen wollte, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg.
Sicher, sagte ich ihm stumm. Sicher.
Seine Schwinge zuckte nicht mehr unter meiner Hand. Ich öffnete die Augen und betrachtete ihn erleichtert.
Sicher, versprach ich erneut. Völlig reglos saß er da, den Blick auf mein Gesicht geheftet, sein Atem ging immer flacher.
Er lag im Sterben.
Der Pfeil hatte sich tief in seine Brust gebohrt, doch wenn ich ihn herauszog, würde der Adler nur noch schneller sterben. Mehr Sorge als der Pfeil bereitete mir allerdings, dass der Vogel Schmerzen litt. Außerdem befürchtete ich, dass sein Blut Raubtiere anlocken könnte, die nur darauf warteten, ihn noch vor seinem Tod zu verspeisen.
Dann gab es noch die Sache mit dem Pfeil an sich. Wo war der Schütze abgeblieben?
Ich lauschte aufmerksam mit all meinen Sinnen, doch ich vernahm nur das Flüstern der Bäume, das Summen des nächtlichen Waldes, das Rauschen des Windes. Ich nahm weder Gefahr noch Angst wahr, keinen Verfolger und auch keinen sich nähernden menschlichen Gedanken. Vielleicht war der Adler dem Schützen entkommen und noch ein ganzes Stück geflogen, ehe er vom Himmel stürzte.
Licht. Ich spürte, wie das Wort von dem Vogel emporstieg. Licht. Ich fragte mich, ob er sich nach dem Tag sehnte, als ob dieser ihn vor seinem Schicksal bewahren könnte und nur die Nacht seinen Tod brachte. Vielleicht sah der Vogel aber auch das Licht der Ewigkeit, das ihn zu sich lockte, um mit den Göttern ins Paradies zu fliegen.
Licht.
Ich beschloss, zu bleiben, bis es so weit war. Auch bis zur Morgendämmerung, wenn nötig, falls er überhaupt so lange durchhielt. Auf diese Weise konnte ich auch die Raubtiere vertreiben, bis der Zeitpunkt gekommen war, an dem er die eine Welt verließ, um in eine andere zu fliegen. Ich legte mich neben ihn und streifte mit der Hand durch sein seidenweiches Brustgefieder.
Ich berührte ihn nur leicht, doch mit der Macht meines Willens presste ich ihm nachdrücklich meinen Wunsch in seine schmerzverzerrten Atemzüge.
Linderung, sagte ich ihm in Gedanken. Trost. Ruhe. Frieden. Die Worte waren nur Balsam, keine Heilung. Ich war keine Heilerin. Aber ich gab ihm auch das Wort »Genesung«, obwohl es nur ein Wunsch war. Der Adler war so prächtig. Ich wollte nicht, dass er starb.
Boojohni würde mich suchen. Er würde grummeln, stöhnen und über seine wunden Füße und knubbeligen Knie jammern, aber er würde kommen, weil er mich liebte und sich Sorgen machen würde, wenn ich nicht bald zurückkehrte. Mein Vater hatte mich früher an sich gebunden. Mit einem Strick wie einen ungehorsamen Hund. Mein Vater hatte solch große Angst, dass mir etwas zustoßen könnte und ließ mich nie unbewacht. Später hatte er Boojohni zu meinem Aufpasser bestimmt. Er sollte dafür sorgen, dass mir nichts zustieß. Damals waren wir ungefähr gleich groß gewesen, und weil wir stets aneinandergebunden waren, wirkten wir wie zwei unartige Kinder, die ihre Strafe ausbaden mussten. Boojohni hasste das noch mehr als ich. Aber er wurde für die Mühsal und Demütigung wenigstens entlohnt. Ob ich mich gedemütigt fühlte, kümmerte niemanden.
Boojohni war ein Troll. Er ähnelte eher einem Affen als einem erwachsenen Mann. Er hatte eine flache, gummiartige Nase über einem beeindruckenden Bart in derselben Farbe wie seine unordentlichen Haare, die ihm weit in die Stirn und über den Rücken fielen. Obwohl er nur einen Meter zwanzig maß, war er bereits ausgewachsen. Er trug Kleidung, ging auf zwei Beinen und war so weise wie jeder Mensch, obwohl er nichts lieber tat, als der menschlichen Rasse aus dem Weg zu gehen.
Ich war inzwischen viel größer als Boojohni, doch er diente immer noch als mein Beschützer, obwohl ich der Leine inzwischen entwachsen war. Ich ließ mich nicht mehr in einen Käfig sperren, auch wenn mein Vater es versucht hatte. Würde seine Sorge auf Liebe gründen, wäre es leichter zu ertragen gewesen. Aber seine Sorge entstammte dem Wunsch nach Selbstschutz und war geboren aus Angst. Seit dem Tod meiner Mutter nahm die Feindseligkeit zwischen uns beständig zu.
Ich seufzte leise und stieß den Atem aus. Der Adler hörte es, hob den Kopf und betrachtete mich.
Licht. Das Wort schwebte wieder zu mir herüber. Drängend. Fragend.
Bald, beschwichtigte ich und streichelte ihm über den Kopf. Ich log. Für ihn würde es kein Licht mehr geben. Die Morgendämmerung war noch Stunden entfernt. Aber ich würde bleiben, sollte Boojohni doch jammern. Er hatte eine ebenso feine Spürnase wie die Jagdhunde meines Vaters. Wenn er wollte, würde er mich ganz leicht finden.
Ich suchte mir eine bequemere Position. Da ich leicht fröstelte, schlang ich mein Kleid um meine Beine und zog meinen Mantel enger um mich. Der Schnee war zum Glück verschwunden, und der Frühling näherte sich mit raschen Schritten. Die Bäume kleideten sich in Grün, und das Gras unter mir fühlte sich weich an. Ich legte mich schützend um den Vogel, den Kopf auf einen Arm gebettet, und streichelte das Tier, während ich versuchte, es mit meinen Gedanken zu beruhigen und zu heilen.
Ich erwies mich als schlechte Beschützerin.
Ich hatte mich so sehr darin vertieft, dem armen Adler Frieden und Erholung zu vermitteln, und meine ganze Kraft und Willensstärke aufgeboten, dass ich vor Erschöpfung fest einschlief, eingelullt von meinen eigenen Wunschgedanken.
2
Ich wachte auf, weil mir Boojohni mit seinen kleinen Pranken die Wange tätschelte. Die Morgensonne fädelte sich von Osten her durch die Bäume, und ihre goldenen Strahlen kitzelten meine Lider. Ich fühlte mich steif und fror, mein linker Arm kribbelte. Mit meiner rechten Hand umklammerte ich eine lange schwarze Feder mit roter Spitze.
Der Adler war fort. Nur Blutspritzer und ein paar Federn erinnerten noch an ihn. War er tot? Hektisch sprang ich auf. Boojohni sah mich entgeistert an. Er war nicht laut rufend durch den Wald gestapft, denn er wusste ja, dass ich ihm nicht antworten konnte. Er war seiner Nase gefolgt, außerdem kannte er meine Lieblingsplätze. Dennoch wirkte er müde und erleichtert, als er meine Hand ergriff und meine Aufmerksamkeit auf sich lenkte.
»Was is’ los?«, fragte er.
Ich deutete auf das Blut und die Federn. Adler. Verletzt.
Ich machte eine Geste mit der Hand. Ich wusste nicht, ob er die Worte, die ich in Gedanken an ihn richtete, spüren und verstehen konnte, oder ob er nur meine Gesten zu deuten wusste. Vielleicht lag es auch an der vielen Zeit, die wir miteinander verbracht hatten, dass wir uns auch ohne Worte verstanden. Womöglich war es auch eine Kombination aus allem zusammen. Wie dem auch sei, wir hatten unsere eigene Sprache entwickelt, und so primitiv sie auch war, wir konnten uns verständigen.
»Er is’ weg. Sieht aus, als hätte ihn was weggeschleift«, gab er grimmig zurück.
Bedauernd senkte ich den Kopf. Wieso hatte ich es nicht bemerkt?! Ich hätte doch Schritte hören müssen, als sich jemand genähert hatte. Womöglich war der Adler tatsächlich gestorben, und ein Wolf hatte ihn sich auf leisen, verstohlenen Pfoten geschnappt.
Boojohni bückte sich und folgte der Spur aus abgebrochenen Zweigen und platt getretenem Gras.
Wolf?
»Nein«, antwortete er, als hätte ich laut gesprochen. Das machte er oft. »Kein Wolf. Ein Mann.« Er deutete auf einen halben Fußabdruck in der Erde. »Das is’ keine Tierspur.«
Pfeil.
Boojohni sah zu mir hoch. Ich tippte mir auf die Brust und zog die Arme zurück, als ob ich einen Bogen spannen würde. Wie es aussah, hatte der Schütze seine Beute also doch noch gefunden. Ich konnte froh sein, dass er nur den Vogel gewollt hatte. Ich war extrem angreifbar gewesen.
Boojohni musterte mich mit Gewittermiene. Offenbar dachte er dasselbe. Er stützte die Hände in die Hüften, die Spur interessierte ihn nicht mehr. »Dein weiches Herz verwandelt dein Hirn in Mus«, schimpfte er. »Du hättest getötet werden können, Vögelchen. Oder Schlimmeres.«
Ich neigte zustimmend den Kopf. Aber das änderte nichts. Weder jetzt noch zukünftig. Ich würde immer wieder so handeln, und das wusste er. Ich verharrte noch einen Moment und suchte den Himmel nach dem Adler ab, doch er war nirgendwo zu sehen. Niedergeschlagen seufzte ich auf und zog mir die Kapuze meines Mantels über den Kopf. Der dicke Zopf, den ich mir um den Kopf geschlungen hatte, fühlte sich wie eine Dornenkrone an und sah vermutlich auch so aus. Ich hatte bereits ein Blatt und ein dauniges Stück Feder daraus entfernt.
Ich war bestimmt nicht eitel, aber ich wollte keine Aufmerksamkeit auf mich lenken, wenn wir zur Burg zurückkehrten.
»Ich bitte dich, hör einem alten Troll und anderen gesegneten Wesen des Waldes zuliebe damit auf, nachts im Wald herumzustreunen, als seist du eine Fledermaus, statt einer jungen Dame!« Boojohni wollte mir offenbar eine Strafpredigt halten. Seine Stimme klang knurrig, aber das Wort, das von ihm ausstrahlte, hieß Liebe. Ich hörte die Gedanken der anderen nicht so, wie sie aus ihrem Mund kamen. Ich hörte einzelne Wörter heraus, diejenigen, die den Sprechenden in diesem Moment beherrschten. Auf die gleiche Weise hörte ich auch das Leitwort, das das Leben eines jeden Lebewesens bestimmte. Das vorherrschende Wort bei Boojohni war immer Liebe und mit diesem Wissen konnte ich seine Schimpftirade gut ertragen.
Seufzend ging ich weiter. Er lief mit schnellen Schritten an mir vorbei, streckte die kurzen Arme aus und versperrte mir den Weg. Ich wich ihm aus. Nicht aus Trotz, sondern weil ich nicht streiten wollte. Außerdem konnte ich gleichzeitig zuhören und laufen. Boojohni konnte das jedoch nicht. Ihm fiel es schwer, Mund und Beine gleichzeitig zu bewegen.
Er zupfte mich am Ärmel. »Nur wenige Meilen von hier entfernt tobt der Krieg. Der Krieg! Hunderte gewalttätiger Männer und Tiere, die keine Skrupel kennen und eine Frau ohne Gewissensbisse an ihren Haaren fortschleifen würden! Vor allem eine, die in den Wäldern schläft, als sei sie ein Geschenk der Feen!«
Ich nickte, um ihm zu sagen, dass ich seine Sorge verstand. Das beschwichtigte ihn jedoch nicht.
»Dein Vater würde mir den Bart abschneiden, wenn er wüsste, wie oft du mir entwischst, um dich mit dem Wald zu unterhalten! Willst du nich’, dass der arme Boojohni die wahre Liebe und sein Glück findet? Welche Trollin nimmt mich schon ohne Bart?« Er erschauerte. Ich zupfte ihn liebevoll an seinem Bart und ging weiter.
Einen Augenblick lang schien er sich in dem Grauen seiner möglichen Bartlosigkeit zu vergessen und meine Gedanken wanderten zu dem Krieg in Jeru, den mein Vater und seine Berater gewissenhaft im Auge behielten.
Der König hatte sein Lager auf den Ländereien meines Vaters in der Nähe des letzten Schlachtfeldes aufgeschlagen. Der junge König führte das Vermächtnis seines Vaters fort und verbrachte genau wie er mehr Zeit im Sattel, um zu morden, als auf dem Thron. Dieses Mal waren die Kreaturen, die gegen ihn Krieg führten, jedoch noch schrecklicher als er.
Die Gerüchte über die Volgar waren vermutlich übertrieben, aber dennoch Angst einflößend. Manche behaupteten, dass sie töteten, um das Blut der Leichen zu trinken und ihr Fleisch zu fressen, weil sie glaubten, dadurch gingen die Kräfte der Toten auf sie über. Ihr Anführer Liesh hatte Flügel wie ein Geier und rasiermesserscharfe Klauen. Er flog über seinem Heer und dirigierte es aus der Luft.
Liesh wollte mehr Macht und glaubte, dass er durch die Eroberung von Jeru dieses Ziel erreichte, obwohl König Tiras’ Vater die Magie mit aller Härte verfolgt und vernichtet hatte. Liesh wollte Jeru, Dendar, Porta und Willa einnehmen. Porta hatte er bereits erobert. Danach Dendar. Und er hatte eine Spur der Verwüstung hinterlassen.
Nun war er in Jeru eingefallen, über die Grenze der Provinz Kilmorda, und König Tiras hatte sich mit seinen Soldaten im Tal versammelt, um gegen ihn zu kämpfen. Mein Vater schwankte zwischen Hoffnung und Loyalität. Er war ein Lord Jerus und deshalb war es auch in seinem Sinn, dass Liesh und die Volgar besiegt wurden. Er wollte aber auch gern König werden. Am liebsten wäre es ihm wohl, wenn König Tiras starb, nachdem er den Volgar Liesh und sein Bestienheer besiegt hatte. Auf diese Weise würde mein Vater sich nicht mit plündernden Monstern abgeben müssen, wenn er den Thron bestieg.
Meine Mutter hatte dem alten König prophezeit, dass er seine Seele verraten und seinen Sohn an den Himmel verlieren würde. Diese Vorhersage war bisher noch nicht eingetroffen. König Zoltev war zwar tot, doch was mit seiner Seele passiert war, blieb ungeklärt. Sein Sohn war quicklebendig. Dennoch baute mein Vater seine Zukunft auf die Hoffnung, die Weissagung meiner Mutter werde eintreffen. Er war der Nächste in der Thronfolge und wollte König werden. Ich aber wollte nur meine Freiheit und fort von ihm. Meine Mutter hatte meinem Vater prophezeit, dass ich nie wieder sprechen würde, und ihm gesagt, bei meinem Tod würde auch er sterben. Er hatte ihre Worte nie angezweifelt. Deshalb hatte ich die vergangenen fünfzehn Jahre eingesperrt und unter ständiger Überwachung verbracht. Mein Vater beobachtete mich, achtete auf Anzeichen für Krankheiten und hasste mich dafür, dass sein Schicksal mit meinem verknüpft war.
Jedes Mal, wenn mein Vater mich ansah, hörte ich fast immer den Namen meiner Mutter. Meshara. Er sah mich an und erinnerte sich an ihre Warnung. Ich hörte den Namen meiner Mutter in seiner Stimme, dann wandte er sich von mir ab. Jedes Mal.
Das tat er jedoch nicht, weil ich ihr ähnlich sah. Meine Mutter war wunderschön gewesen. Ich war es nicht. Meine Augen waren mattgrau, nicht blau wie der Himmel oder grün wie das Meer. Grau. Meine Haut war blass und meine Haare hellbraun. Den Farbton hatte meine Mutter als aschbraun bezeichnet – nicht etwa dunkelbraun oder kastanienbraun. Es war ein helles unauffälliges Braun wie das der Maus, die sich in der Ecke meiner Kammer versteckte und darauf wartete, dass ich einschlief, damit sie sich die Brotkrumen unter meinem Tisch stibitzen konnte. Meine Farben waren so zurückhaltend und unscheinbar wie ich. Fahl und fade. Und so hauchzart, dass sie sich nie ganz herauskristallisiert hatten. Ich kam mir vor wie ein kleiner, grauer Geist.
»Du bist nich’ so unsichtbar, wie du denkst, Vögelchen«, schnaubte Boojohni, als ob er meine Gedanken gehört hätte. »Ich war nich’ der Einzige, dem heute Morgen aufgefallen ist, dass du nich’ da bist. Seltsame Dinge geschehen. Der Stallbursche Mertin is’ heute Morgen nackt wie ein Neugeborenes im Heu aufgewacht. Und eins der Pferde war weg. Die graue Stute, das Lieblingspferd deines Vaters. Und dann kam Bethe schreiend in die Küche gelauf’n und hat behauptet, du wärst nich’ in deinem Zimmer, und dein Bett sei unberührt. Sie hat mir schwören müssen, dass sie nichts davon verlauten lässt, bis ich rausgefunden hab, wo du steckst, was mir ja auch ganz offensichtlich gelungen ist.«
Ich schüttelte den Kopf und seufzte. Bethe war meine Zofe. Sie brach bei jeder Kleinigkeit in Panik aus, aber das Verschwinden der grauen Stute beunruhigte mich auch. Sie war ein gutes Pferd, und ich fand den Gedanken schrecklich, dass man sie gestohlen hatte.
Ich berührte meine Augen und stellte mit den Händen eine Frage. Boojohni antwortete sofort.
»Niemand hat was gesehen, außer dem blanken Hintern von dem armen Mertin, als der aus den Ställen gerannt kam.« Boojohni kicherte.
Ich deutete auf meine Kleider, von Kopf bis Fuß. Alles?
»Ja. Alles. Stiefel, Hose, Hemd und Jacke. Ich glaub nicht, dass sich Mertin die Mühe macht, untendrunter auch was anzuziehen.«
Ich zog eine Grimasse. Ich wollte kein Bild von Mertins »Untendrunter« im Kopf. Er war ein großer, mürrischer Mann mit genug Haaren am Körper, um daraus einen kleinen Teppich zu weben. Er kannte sich mit Pferden aus, und man legte sich besser nicht mit ihm an. Ich fragte mich, wie es möglich war, dass ihm jemand die Kleidung vom Leib stehlen konnte, ohne ihn zu wecken.
»Mertin hat geglaubt, dass man ihm einen Streich gespielt hat, bis er merkte, dass das Pferd weg is’. Das fand er gar nich’ mehr zum Lachen. Ein paar Peitschenhiebe sin’ ihm sicher, weil er während seiner Wache gesoffen hat. Er behauptet, er hätte keinen Tropfen angerührt, jedenfalls nicht so viel, um davon wegzupennen. Er hat ’ne dicke Beule am Kopf, daher denk ich, es hat ihm wohl jemand eins über die Rübe gegeben.«
Das ergab mehr Sinn, und ich nickte.
»Dein Vater is’ nich’ gerade erfreut darüber. Seine Nerven liegen eh schon blank, wegen der Kämpfe an der Grenze. Wir erwähnen besser nich’, dass du letzte Nacht im Wald verbracht hast, während sich Diebe da draußen herumtreiben.«
Schweigend gingen wir weiter durch den Wald. Wir mieden die Straße, obwohl dies einen Umweg bedeutete. Boojohni schien zu verstehen, dass ich den Frühaufstehern, die bereits ihren Geschäften nachgingen, nicht unter die Augen kommen wollte. Es gab keinen Grund dafür, warum ich so früh schon unterwegs sein sollte, noch dazu in zerknitterter Kleidung, als hätte ich mich die ganze Nacht mit Mertin im Heu gewälzt.
Die Burg meines Vaters lag auf einer Anhöhe. Im Süden wurde sie von mehreren Dörfern halb umringt, im Norden erstreckten sich Felder und Wald. Die einzige Straße zur Burg führte steil bergauf. Zu beiden Seiten ragten die zerklüfteten Felsen des Gebirges auf, das den oberen Teil der Provinz Corvyn begrenzte. Das Land war fruchtbar und atemberaubend schön. Seine Unzugänglichkeit bildete einen natürlichen Schutzwall. Aber die Volgar hatten Flügel.
Klippen und Berge würden sie kaum von einem Angriff auf die Burg abhalten, wenn das Heer der Soldaten sie nicht an der Grenze zurückschlagen konnte. Nur zwanzig Meilen von uns entfernt tobte die Schlacht in Kilmorda, doch trotz seiner Sorge und der ständigen Besprechungen mit seinen Beratern hatte mein Vater bisher noch keinen einzigen Soldaten geschickt, um König Tiras im Kampf gegen die Volgar zu unterstützen.
Die Burg selbst war wie eine kleine Stadt. Es gab zwei Schmieden, einen Fleischer, eine Mühle, eine Apotheke, eine Druckerei und Schneider, Bäcker, Weber, Handwerker und Heiler – alle von der unmagischen Sorte. Handwerkliche Fähigkeiten waren akzeptabel, magisch-mystische Gaben jedoch nicht. Alle wollten stets zeigen, wie respektabel und nützlich sie waren. Folglich bestand mein einziger Wunsch darin, mich ebenfalls als nützlich und wertvoll zu erweisen.
Mir wurde weder Schreiben noch Lesen gelehrt. Das hat mein Vater nicht erlaubt. Er fürchtete sich davor, mir Worte zuteilwerden zu lassen, gleich in welcher Form, und weil ich nicht sprechen konnte, vergaßen die Menschen oft, dass ich sie trotzdem verstand, und hüteten ihre Zunge in meiner Gegenwart nicht. Durch Zuhören und Beobachten lernte ich daher eine Menge. Außerdem hatte ich viel Zeit mit den alten Frauen der Burg verbracht. Auch sie waren nie zur Schule gegangen, aber auf vielen Gebieten geschult. Von ihnen lernte ich, wie man mit Hilfe von Kräutern heilt und durch Handauflegen beschwichtigt. Ich lernte Weisheit und Vorsicht walten zu lassen, und ich lernte, mein Schicksal anzunehmen und geduldig abzuwarten. Auf was, wusste ich nicht, aber insgeheim wartete ich aus ganzem Herzen darauf, dass die Stunde, von der meine Mutter gesprochen hatte, irgendwann einmal kommen würde.
»Wir ham schon geglaubt, dass Euch ein Vogelmann verschleppt hat!«, rief Bethe, als ich mit Boojohni die Küche durch die Hintertür betrat. Ich hatte die Kapuze immer noch tief ins Gesicht gezogen und wich ihrem Blick aus. Ein tiefer Seufzer entwich mir. Ich hatte darauf gehofft, mich heimlich und ungesehen in meine Kammer zurückschleichen zu können, aber Madame Pattersley, die Wirtschafterin, und meine Zofe Bethe hielten Ausschau nach uns.
»Was soll denn so ein Volgar mit unserer kleinen Lark anfangen, hä?«, brummte Boojohni. »Sie ist ja viel zu mager. Der hätte eher dich mitgenommen, Bethe. An dir is’ viel mehr dran. Aber das wäre wohl nich’ so leicht gewesen.« Boojohni zwinkerte ihr zu und gab ihr einen Klaps auf die üppige Kehrseite. Sie schlug ihm auf die Hand und vergaß mich völlig dabei. Genau das hatte Boojohni bezweckt. Die Wirtschafterin meines Vaters ließ sich jedoch nicht so leicht ablenken. Sie nahm die Kapuze vom Kopf und zog beim Anblick meiner Haare entsetzt die Luft ein.
»Milady! Wo seid Ihr gewesen?«
Froh, nicht antworten zu können, zuckte ich mit den Schultern und fing an, den Zopf zu lösen, wobei kleine Zweige und Blätter zu Boden rieselten, die sich darin verfangen hatten.
»Ihr ward mit einem Mann zusammen!«, kreischte Bethe. »Ihr habt die Nacht mit einem Mann im Wald verbracht.«
»Hat sie nich’. Hör auf, so einen Blödsinn zu quasseln«, blaffte Boojohni, als hätte sie ihn persönlich beleidigt. Ich tätschelte dankbar seinen Kopf.
»Euer Vater muss davon erfahren, Lark. Er macht sich immer solch große Sorgen um Euch, wie Ihr wisst. So etwas kann ich ihm nicht verschweigen«, sagte Madame Pattersley selbstgerecht. Seit dem Tod meiner Mutter vor fünfzehn Jahren versuchte sie, die Zuneigung meines Vaters zu gewinnen. In dieser Hinsicht glichen wir uns, obwohl ich den Versuch bereits vor Jahren aufgegeben hatte. Sie erzählte ihm alles. Vielleicht als Ausgleich dafür, dass ich ihm nichts erzählen konnte.
»Was wollt ihr mir verschweigen?« Mein Vater stand plötzlich in der Tür.
»Lark war die ganze Nacht draußen, Milord«, verkündete Madame Pattersley. Ihre Worte hallten schadenfroh von den aufgehängten Pfannen und Töpfen wider.
Ich sah meinen Vater aufmerksam an und versuchte, ihn dazu zu bringen, meinen Blick zu erwidern, doch er sah an mir vorbei und richtete die Augen auf Boojohni. Ich konnte mich im Grau seiner Augen und den fein gezeichneten Knochen in seinem Gesicht wiedererkennen. Er war elegant, ohne weiblich zu wirken, groß, ohne schlaksig zu sein, schlank, aber nicht mager. Er war jedoch auch raffiniert statt weise, höflich statt gütig und ehrgeizig statt stark.
»Dafür mache ich euch alle verantwortlich«, sagte mein Vater leise. »Sie muss ständig beobachtet werden. Das wisst ihr doch.«
Die Frauen vollführten einen tiefen Knicks, und Boojohni verbeugte sich, aber ich spürte sein Mitleid. Es füllte den Raum zwischen uns. Ohne ein weiteres Wort drehte mein Vater sich um und verließ die Küche.
3
Den geschwätzigen Eichhörnchen gefiel unsere Anwesenheit nicht. Sie wollten, dass wir von hier verschwanden. Eine Schlange ringelte sich im Busch links von mir, und ich spürte, wie sie die Luft kostete. Ihre Lebenskraft pulsierte mit den Worten »Feind« und »warten«. Sie würde nicht beißen, aber sie verharrte reglos und beobachtete uns. Eine Kröte quakte rechts von mir; ihr schien unsere Gesellschaft nichts auszumachen. Sie schenkte uns kaum Beachtung und fürchtete sich auch nicht. Wieder quakte sie und erinnerte mich an meinen Vater, wie er zusammengesunken am Tisch saß, die Hunde zu seinen Füßen, die nur darauf warteten, dass er aufstand, damit sie sich um die Essensreste balgen konnten. Flüstern und Klackern und Summen und Brummen – die Geräusche schlichen über den Waldboden, über meine Haut und in meinen Kopf. Die Geräusche schwirrten mit der Luft davon, doch mein Begleiter schien davon nichts zu bemerken.
Ich schenkte den geschwätzigen Wesen um mich herum ebenso wenig Beachtung wie sie mir und füllte meine Schürze mit den süßen Beeren, die hier an den dornigen Büschen wuchsen. Eine Biene floh mit einem Ziel im Kopf: nach Hause. Dann war sie fort. Vor drei Tagen hatte ich den verwundeten Adler gefunden. An jedem Tag war ich hergekommen, in der Hoffnung, dass ich ihn wiedersehen würde, oder er mich. Vielleicht hatte ich auch gehofft, auf den Bogenschützen zu treffen, der ihn vom Himmel geholt hatte. Dann hätte ich seine Pfeile einen nach dem anderen zerbrochen. Die Jagd war nicht verboten, und ich wollte auch keinen Mann verurteilen, der jagte, um seine Familie zu ernähren. Mich packte jedoch hilflose Wut, wenn ich an den Adler dachte. Meine Aufregung musste sich in meinem Gesicht gespiegelt haben.
»Ihr werdet Euch stechen, Milady.« Ich hob den Kopf und begegnete Lohdis Blick. Boojohni wurde anderswo gebraucht, deshalb hatte man den jungen Lohdi, einen tollpatschigen Jungen von sechzehn Jahren, dessen Zunge keine Sekunde stillstand, beauftragt, mein Schatten zu sein und auf mich aufzupassen. Ich war lieber allein, aber ich bekam selten Gelegenheit dazu – und das ärgerte mich maßlos. Ich hob eine Schulter und tat Lohdis Sorge ab.
»Euer Vater hat gesagt, ich soll achtgeben, dass Ihr Euch nicht verletzt.«
Mit zusammengebissenen Zähnen ignorierte ich ihn und pflückte weiter. Ich war fast einundzwanzig Sommer alt. Die meisten Frauen in meinem Alter hatten bereits mehrere Kinder geboren. Ich brauchte ganz bestimmt kein Kindermädchen mehr, und schon gar keines, das jünger und entschieden unfähiger war als ich.
Lohdi trat nervös von einem Fuß auf den anderen, den Blick besorgt zum Himmel gerichtet, als ob das Blau über den Bäumen sich jeden Moment in stürmisches Grau verwandeln würde.
»Wir müssen zurück. Sie werden bald da sein.«
Erneut löste ich den Blick vom Beerenstrauch und sah ihn fragend an.
»Hat Euer Vater Euch das nicht gesagt?« Lohdi wirkte überrascht.
Ich schüttelte den Kopf. Nein. Mein Vater erzählte mir gar nichts. Er redete nicht mit mir, weil ich ihm nicht antworten konnte.
»Er erwartet Besuch. Wichtige Männer. Vielleicht sogar den König.«
Ich erstarrte und ließ vor Schreck meine Schürze los. Die Beeren purzelten zu Boden. Während Lohdi aufgeregt weiterplapperte, verkrampfte sich mein Magen. Wenn der König auf dem Weg hierher war, wollte ich ihm ganz sicher nicht im Wald begegnen. Ich wollte mich in sicherer Entfernung zu ihm im Turmzimmer meiner Mutter verstecken, wo er mich nicht finden und verletzen konnte.
Ich machte mich sofort auf den Heimweg. Lohdi passte sich meinen Schritten an und war sichtlich froh über meine hastige Rückkehr. Als wir den donnernden Hufschlag vernahmen, fingen wir beide an zu laufen. Lohdi aus Vorfreude, ich aus Furcht. Die Röcke gerafft, rannte ich zwischen den Bäumen hindurch; meine Haare wehten wie eine Fahne hinter mir her. Meine Zofe beschwerte sich ständig darüber, dass meine Haare glatt wie Seide seien. Es gelang ihr nicht, sie in Locken zu legen oder zu den ausgefallenen Frisuren aufzustecken, die den modischen Gepflogenheiten der Frauen von Jeru entsprachen. Ich hatte es längst aufgegeben, meine Haare zu bändigen, und bürstete sie lediglich. Meist trug ich sie offen.
»Milady! Wartet!«, hörte ich Lohdi rufen, aber ich konnte nichts für seine schneckenhafte Langsamkeit. Ich war vieles, aber gewiss nicht langsam. Der Hufschlag kam immer näher, die Luft vibrierte förmlich vor Energie. Ich beschleunigte meine Schritte. Als ich den Waldrand erreichte, sah ich, wie etwa zwei Dutzend Reiter mit wehenden Fahnen den Hügel des nächstliegenden Dorfes hinunterpreschten. Waldhörner kündigten ihren Besuch an. Grün und Gold, die Farben des Königreichs, zierten jedes Pferd und jeden Reiter. Sie hatten mich fast erreicht. Wie gelähmt blickte ich in ihre Richtung und stellte fest, dass sie ihr Tempo widerstrebend verlangsamten. Die Pferde widersetzten sich den Zügeln, ihr Eifer zu laufen laufen laufen strömte in Wellen von ihnen aus. Pferde kannten nur wenige Wörter: Laufen. Essen. Zuhause. Furcht.
Aber im Moment verspürte ich als Einzige Furcht, denn ich war nicht schnell genug gewesen.
Ich machte einen Schritt zurück, um wieder in den Wald zu laufen. Dort wollte ich mich in den Schatten verstecken, bis der König und sein Gefolge wieder fort waren, auch wenn mir das den Zorn meines Vaters einbringen würde. Plötzlich kam Lohdi aus dem Wald auf die gepflasterte Straße gestürmt und prallte mir in den Rücken. Ich fiel nach vorn, auf Hände und Knie, direkt vor den Soldatentrupp. Mehrere Pferde wieherten panisch auf, stampften und tänzelten und irgendwer schrie. Ich spürte einen Fuß im Rücken und landete platt auf dem Bauch im Schmutz. Lohdi hatte mich nicht nur umgeworfen, er war auch noch auf mich gefallen und trampelte nun über mich hinweg.
»Halt!«, rief jemand, und ich rappelte mich auf. Um Haaresbreite entging ich den Hufen eines sich aufbäumenden, schweißbedeckten Hengstes, der das Gebiss bleckte.
Lohdi schrie auf und versuchte, ebenfalls aufzustehen. Ich streckte die Hand aus, um ihm zu helfen, weil ich nicht wollte, dass er verletzt wurde, obwohl ich ihn am liebsten erwürgt hätte. Jemand kam mir jedoch zuvor und zog ihn am Kragen hoch. Der König war von seinem Pferd gestiegen und ragte über dem zappelnden Lohdi auf.
»König Tiras«, keuchte Lohdi und fiel ehrfürchtig auf die Knie, noch ehe er wieder auf beiden Beinen stand.
»Steh auf, Bursche«, befahl der König.
»Ja, Majestät! Tut mir leid, Euer Hoheit.« Eilfertig verbeugte sich Lohdi.
Der König ließ ihn los und wandte sich mir zu. Er durchbohrte mich mit seinem Blick. Die Augen waren so dunkel, dass sie fast schwarz schienen, und sein Gesicht war eher faszinierend als schön, Respekt einflößend, statt kalt. Gebräunte Haut betonte seine kantigen, wohlgeformten Züge. Ich glaubte fest, dass er Katzbuckeln und Ehrerbietung gewohnt war, obgleich ich ihm weder das eine noch das andere zuteilwerden ließ.
Seine Haare boten einen starken Kontrast zu seiner gebräunten Haut, denn sie waren schneeweiß wie die eines alten Mannes, obwohl er kaum älter als dreißig Sommer sein konnte. Als ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, war sein Haar schwarz gewesen. Auch sonst ähnelte er nicht mehr jenem Jungen, an den ich mich erinnerte, und ich war mir sicher, dass er mich längst vergessen hatte. Ich war fünf gewesen, als meine Mutter durch das Schwert seines Vaters starb. Er war älter als ich und gewiss hatte dieser Tag nicht denselben Eindruck bei ihm hinterlassen wie bei mir.
»Bist du verletzt?«, wollte er wissen. Ich fragte mich, ob ich so derangiert aussah, wie ich mich fühlte. Meine Haare waren zerzaust, mein Gesicht glühte. Meine Hände brannten, und mein Rock war zerrissen, aber ich weigerte mich, mir die Haare zu glätten und die Kleidung zu richten. Seine Meinung interessierte mich nicht. Ich erwiderte seinen Blick mit steinerner Miene.
»Sie redet nicht. Sie ist stumm«, erklärte Lohdi rasch. Er schaute mich entschuldigend an. »Tut mir leid, Milady.«
»Milady?«, fragte der König, die Augen unverwandt auf mich gerichtet. Ich erwiderte seinen Blick ausdruckslos.
»Sie ist Lord Corvyns Tochter, Majestät«, sagte Lohdi hastig.
König Tiras wechselte einen vielsagenden Blick mit dem Mann zu seiner Linken, einem dunkelhaarigen, breitschultrigen Soldaten, der ebenfalls abgestiegen war. Er tauschte sich kurz mit ihm aus, wobei er ihn mit dem Namen Kjell anredete, dann schweifte sein Blick wieder zu mir.
»Wenn ich von Euch also wissen will, ob Euer Vater mich erwartet, werdet Ihr mir nicht antworten können?«, fragte er, obwohl es eher wie eine Feststellung klang.
»Sie ist nicht dumm, Euer Hoheit. Sie versteht alles. Sie kann bloß nicht reden«, sagte Lohdi.
Ich wünschte, er würde den Mund halten. Ich brauchte keinen Dolmetscher.
»Verstehe.« Der König neigte den Kopf und musterte mich von Kopf bis Fuß. »Zeigt mir den Weg, Milady. Ich habe einiges mit Eurem Vater zu besprechen.« Er schwang sich in den Sattel, während ich mich gehorsam umdrehte, um seine Anweisung auszuführen.
Ich hätte ihm nicht den Rücken zukehren dürfen. Das war dumm. Aber König Tiras hatte mich nicht vorgewarnt, und ich hatte seine Absicht nicht erkannt. Plötzlich wurde ich von den Füßen gefegt und saß vor ihm im Sattel auf seinem riesigen Pferd. Erschrocken wölbte ich mich nach vorn und rammte den Ellbogen nach hinten, doch ich traf nur seinen Brustpanzer und tat mir dabei selbst weh. Als sei nichts gewesen, schloss er den Arm fester um mich, so fest, dass ich kaum noch Luft bekam.
»Ihr werdet während der Verhandlungen hier bei mir sitzen. Wenn Euer Vater nicht will, dass Ihr verletzt werdet – und vor allem, wenn Ihr nicht verletzt werden wollt –, solltet Ihr besser kooperieren und Euer Vater auch. Mir wäre es wirklich lieber, wenn ich Euch nicht fesseln und hinter meinem Pferd herschleifen müsste. Aber falls nötig, werde ich es tun. Also, gebt Ruhe und haltet still.« Seine Stimme klang barsch, und seine Haare kitzelten mich im Gesicht. Ich beschloss, zu tun, was er befahl. Allerdings fragte ich mich, ob er spürte, wie heftig mein Herz schlug. Lohdi stand wie erstarrt neben dem Pferd und glotzte mit offenem Mund. Die plötzliche Wendung hatte auch ihn völlig überrascht. Sein Blick klebte auf dem König, und sein Gesicht war zu einer Maske des Entsetzens erstarrt.
»Sag deinem Herrn, der König ist hier, Bursche«, verlangte der Mann, der Kjell hieß.
Lohdi flitzte davon und stolperte dabei über die eigenen Füße, worauf die Männer, die einen Kreis um den König bildeten, auflachten. Mein Vater wäre gewiss vor Sorge außer sich, dass ich als Geisel genommen worden war, aber nicht aus den Gründen, die sich der König erhoffte.
Jemand hatte meinem Vater und den Burgbewohnern schon Bescheid gegeben, dass der König sich mit seinen Männern näherte, denn er stand im Burghof inmitten einer wachsenden Menge von Zuschauern, in seine Wappenfarben gekleidet, leuchtendes Blau und Silber. Er hatte seine Leibgarde um sich geschart, aber keiner der Männer war so dumm und zog sein Schwert. Immerhin hatten sie es mit dem König zu tun, und wenn der König beschloss, die Tochter eines Adligen auf seine Burg zu verschleppen, würde sich ihm niemand in den Weg stellen. Ihre Blicke hafteten auf mir, doch eher aus Verblüffung denn aus Sorge. In ihren Augen war ich keine begehrte Trophäe.
»Corvyn«, grüßte König Tiras frostig. Sein Gruß strich über meine Haare und verursachte mir Gänsehaut. Er mochte meinen Vater nicht. Wie eine eisige Brise strömte seine Verachtung von ihm aus und ließ mich erschauern. Sie weckte in mir den Wunsch, mich von ihm loszureißen. Meine Unruhe übertrug sich auf das Pferd, das wieherte und zu tänzeln anfing. Eine Hand in seine Mähne gekrallt, bat ich es stumm, still zu sein, und es schien mich zu verstehen.
»König Tiras. Was hat das zu bedeuten?« Die Stimme meines Vaters klang erstaunlich fest. Er schaute mich nicht an.
»Eure Loyalität steht auf dem Prüfstand, Corvyn. Eure Männer sind nie in Kilmorda angekommen. Lord Bin Dar hat mir dreihundert Männer geschickt. Lord Gol zweihundert. Lord Janda ebenso viele. Mir wurden Männer aus allen Provinzen gesandt, um unsere nördliche Grenze gegen die Volgar zu schützen. Aber aus Corvyn kamen keine Männer.«
König Tiras’ Stimme klang neugierig. Beiläufig. Er sprach im Plauderton, doch mich konnte er damit nicht täuschen. Unwillkürlich zuckte ich zusammen.