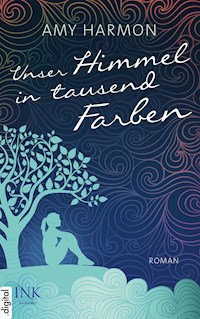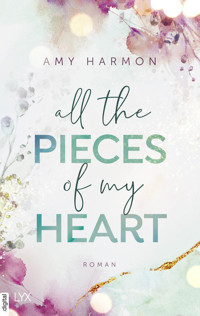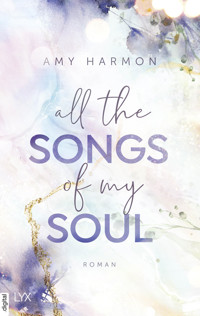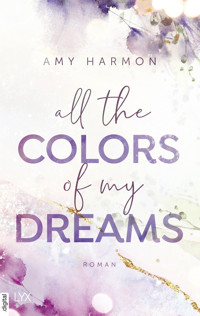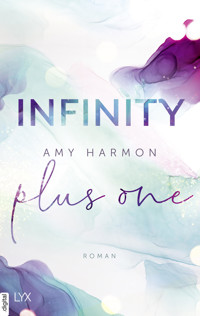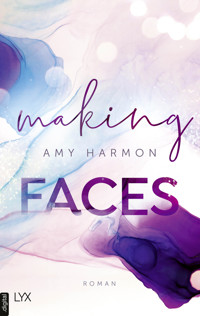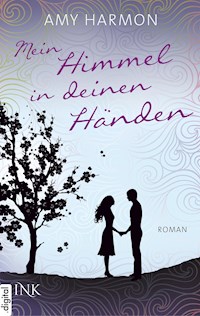
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ink.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Laws of Love
- Sprache: Deutsch
David Taggert hat nichts, wofür es sich im Leben zu kämpfen lohnt. Doch das ändert sich schlagartig, als er Millie Anderson kennenlernt, die sich als Tänzerin in seiner Bar bewirbt. Nichts an Millie ist gewöhnlich, und David ist vom ersten Augenblick an fasziniert von ihr. Auch Millie hat in ihrer Vergangenheit Dinge erlebt, an denen sie beinahe zerbrochen wäre. Und je näher sich die beiden kommen, desto mehr müssen sie sich fragen, ob es sich nicht vielleicht doch lohnt, stark zu sein - für sich selbst, aber auch füreinander ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchWidmungZitatProlog12345678910111213141516171819202122232425EpilogDanksagungLeseprobeDie AutorinAmy Harmon bei INKImpressumAMY HARMON
Mein Himmel in deinen Händen
Roman
Ins Deutsche übertragen vonCorinna Wieja
Zu diesem Buch
Drei Jahre sind vergangenen, seit David Taggert nach Salt Lake City zurückgegekehrt ist. Zwar hat er sich hier inzwischen ein neues Leben aufgebaut und leitet eine beliebte Szene-Bar, aber die schrecklichen Erinnerungen an damals begleiten ihn noch immer jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde. Einzig im Ring kann er seine Vergangenheit vergessen. Nur wenn er kämpft, fühlt er sich lebendig. Das ändert sich schlagartig, als eines Abends die junge Millie Anderson in seiner Bar auftaucht und sich als Tänzerin bewirbt. Nichts an Millie ist gewöhnlich, und David ist vom ersten Augenblick an fasziniert von ihr. Die junge Frau ist wunderschön, lustig und tough. Sie lebt in einer riesigen alten Villa und zieht ihren kleinen Bruder Henry auf, der autistisch ist. Wenn sie tanzt, wirkt sie wie ein Engel. Und wenn sie Tagg ansieht, ist es, als könne sie direkt in seine Seele blicken. Von einem auf den anderen Tag stellen Millie und Henry Taggs Leben vollkommen auf den Kopf. Bis plötzlich etwas geschieht, das Tagg vor die schwerste Entscheidung seines Lebens stellt. Und er muss sich fragen, ob er wirklich stark genug ist. Für Millie, für ihre Liebe. Aber auch für sich selbst …
Für die KämpferCody Clark,Stephenie Thomas,Richard Stowellund Nicole Rasmussen.Und all jene, die Seite an Seite mit ihnen kämpfen.
Wie lange willst du mein so gar vergessen?
Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir?
Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten
in meinem Herzen täglich?
Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben?
Schaue doch und erhöre mich.
Erleuchte meine Augen,
dass ich nicht dem Tode entschlafe,
dass nicht mein Feind rühme, er sei meiner mächtig geworden.
Psalm 13 – Ein Lied Davids
PROLOG
Moses
Gestern bekam ich einen Anruf von Millie. Tagg ist verschwunden. Er ist weg, und Millie hat keine Ahnung, wo sie ihn suchen soll, selbst wenn sie es könnte. So was sieht Tagg gar nicht ähnlich. Er weiß, dass sie ihm nicht hinterherlaufen kann, und fies ist er nicht. Noch nie gewesen.
Als ich Millie kennenlernte, merkte ich sofort, dass Tagg in ihr jemanden gefunden hatte, der ihm hilft, zur Ruhe zu kommen und ihm Halt gibt. Sie würde mit Freuden seine seelischen Knoten entwirren und ihn dazu bringen, sein Leben zu entschleunigen. Im Gegenzug würde er sie auf die ihm eigene Weise lieben. Das Schicksal schien die beiden zusammengeführt zu haben, obwohl ich an so einen Mist eigentlich nicht glaube. Auch wenn man das meinen könnte, bei all dem, was ich sehe und weiß. Aber genau dieses Wissen, dass Vieles weit über unseren Verstand hinausgeht, lässt mich an dem Konzept von Schicksal und Vorsehung zweifeln. Die Behauptung, etwas sei vorbestimmt und »solle so sein«, ist meiner Meinung nach nur eine faule Ausrede, um sich leichter damit abzufinden, wenn man etwas vermasselt hat oder vom Leben eine Wagenladung Mist serviert bekommt. Die angeblich vorbestimmten Dinge haben wir nicht verursacht. Wir haben keine Kontrolle darüber. Sie passieren einfach so, egal, wer oder was wir sind. Wie Sonnenuntergänge und Schnee und Naturkatastrophen. Ich hab nie daran geglaubt, dass Not und Leid vorbestimmt sein sollen oder Menschen füreinander bestimmt sein können. Wir haben die Wahl. Im Allgemeinen treffen wir die Entscheidungen. Wir erschaffen, machen Fehler, brennen Brücken hinter uns ab und errichten neue.
Tagg ist jedoch anders. Er soll so sein. Er ist einfach er. Ein Wirbelwind, ein Tornado, der sich nicht kontrollieren lässt. Er saugt alles in sich auf, aber im Gegensatz zu einer Naturkatastrophe lässt er nicht mehr los. Er lässt niemals jemanden fallen. Und doch hat er genau das nun getan. Ohne jegliche Vorwarnung hat er losgelassen.
Vor drei Jahren sind Tagg und ich nach Salt Lake City zurückgekehrt und geblieben. Am Anfang machte ich mir Sorgen, Tagg irgendwann ziehen lassen zu müssen, weil er eben kein sesshafter Typ ist. Er war schon immer rastlos, ein Getriebener, und langweilt sich schnell. Wenn man fast sechs Jahre lang durch die ganze Welt reist, geht einem das ins Blut über. Das Weiterziehen, das unstete, schnelle Leben, die Freiheit. Man hält es nur noch schwer für längere Zeit an einem Ort aus. Doch uns ist das gelungen. Uns beiden. Wir sind zusammen weggelaufen wie die verlorenen Jungs auf der Suche nach Nimmerland und haben es irgendwie geschafft, als Männer zurückzukehren.
Tagg hatte sich mächtig ins Zeug gelegt und einen ganzen Straßenblock zu einem Zuhause für all jene gemacht, die er im Lauf der Zeit um sich geschart und mehr oder weniger adoptiert hatte. Ich hatte mir einen Namen gemacht, meinen Kundenstamm erweitert, wäre fast ums Leben gekommen, hatte wieder Kontakt zu Georgia aufgenommen und sie schließlich dazu überredet, mich zu heiraten. Vor sechs Monaten kam unsere Tochter Kathleen zur Welt. Tagg heulte, als er sie zum ersten Mal in den Armen hielt, und scherte sich einen Dreck um sein Image als harter Kerl. Er wirkte so glücklich. So topfit und mit sich im Reinen.
Und nun hat er ohne ersichtlichen Grund losgelassen und sich aus dem Staub gemacht.
Er hat Millie fallen gelassen. Er hat das Tagg-Team, seine Geschäfte, seine Pläne für einen Titelkampf fallen gelassen. Und auch mich. Das ergab alles keinen Sinn. Falls es irgendwelche Vorzeichen gegeben hatte, hatte ich sie übersehen. Dabei bin ich der Kerl, der Dinge sehen sollte, die andere nicht sehen. Ich bin Moses Wright – Medium, Künstler, bester Freund – und ich hatte die Zeichen nicht erkannt.
Moses
Tagg hatte keine Nachricht hinterlassen, seine Wohnung war aufgeräumt. Mehr als aufgeräumt – leer, besenrein. Im Fenster hing das Schild eines Immobilienmaklers. Tagg hat einen ausgeprägten Hang zur Unordnung; das musste er ändern, falls er mit Millie zusammenziehen wollte. Daher nahm ich an, seine Haushälterin wäre da gewesen, und rief sie an. Allerdings wusste sie auch nicht mehr. Niemand wusste etwas. Tagg hatte niemandem Bescheid gegeben. Seine Wohnung steht zum Verkauf, sein Pick-up ist weg. Er war weg. Ohne eine neue Adresse zu hinterlassen.
Im Fitnessklub hatte er einen Briefumschlag mit Millies Namen hinterlegt. Darin steckte ein Schlüsselbund, an dem ihr Haustürschlüssel hing, ein Schlüssel für den Fitnessklub, einer für die Bar und einer für den Aktenschrank in seinem Büro. Wir probierten eine Weile herum, bis wir rausfanden, welcher Schlüssel in welches Schloss passte. Trotzdem hatte ich nicht den Eindruck, dass Tagg Katz und Maus mit uns spielen wollte. Auch das war nicht seine Art. Er wollte nur nicht von uns gefunden werden. Und das jagte mir eine Heidenangst ein.
In der obersten Schublade des grauen Aktenschranks stand ein Schuhkarton. Darin lagen Kassetten, beschriftet mit Taggs Namen und einer Zahl. Darunter befand sich ein Aufkleber mit kleinen aufgeprägten Punkten. Ein Kassettenrekorder, von der tragbaren Sorte, die den Lautsprecher oben hat und vorne nebeneinanderliegende Tasten wie bei einem Klavier, lag ebenfalls in der Schachtel.
Ich fragte Millie, ob sie damit was anfangen konnte. Überrascht fuhr sie mit den Fingern über Kassetten und Rekorder und nickte dann.
»Der ist von meinem Bruder Henry. Der Rekorder steht schon seit einer halben Ewigkeit in seinem Zimmer. Früher hat Henry immer Sportkommentator gespielt. Er hat sich die Spiele meines Dads im Fernsehen angeschaut und dabei seine Kommentare in den Rekorder gesprochen, als sei er Bob Costas oder so. Bevor meine Mutter starb, hat sie ihm einen Digitalrekorder gekauft. Aber Henry hebt alles auf. Bestimmt hat Tagg den Rekorder und die Kassetten von ihm.«
Tagg fasst alles gern an. Das hat er mit Millie gemeinsam. Sie muss alles anfassen, um sich ein Bild zu machen. Er muss alles anfassen, um es zu spüren und eine Beziehung herzustellen. Ich konnte mir gut vorstellen, wie er die Kassetten eingelegt und einfach drauflosgeplaudert und dabei ewig gebraucht hatte, um auf den Punkt zu kommen. Vermutlich lachte er beim Erzählen sogar, als sei alles nur ein Witz. Trotzdem konnte ich nicht richtig sauer auf ihn sein, denn ich wusste instinktiv, dass er die Bänder deshalb besprochen hatte, weil er Millie bloß auf diese Weise eine Nachricht hinterlassen konnte. Nur mithilfe der Kassetten konnte er sicherstellen, dass sie allein und ohne Publikum erfahren konnte, was er ihr zu sagen hatte.
»Du weißt, wie man das Ding benutzt, oder?«, fragte ich.
Sie nickte.
»Ich glaube, die Kassetten sind für dich bestimmt, Millie«, sagte ich.
»Er hat sie beschriftet«, flüsterte sie. »Er hat sie beschriftet, damit ich weiß, welche ich zuerst anhören muss.«
»Die Aufkleber?«
Wieder nickte sie. »Ja. Ich hab sie auf all meinen Sachen. In meinem Schlafzimmer steht eine kleine Kiste, in der sind Sticker mit Zahlen, Buchstaben und Wörtern in Punktschrift. Anscheinend hat Tagg tatsächlich zugehört, als ich sie ihm gezeigt habe.«
»Tagg hört immer zu. Man merkt es ihm nur nicht an, weil er so zappelig ist. Aber ihm entgeht nichts.«
Millies Lippen bebten, und ihre Augen schwammen in Tränen. Schnell wandte ich den Blick ab, auch wenn das unnötig war.
Ich hörte, wie sie eine Kassette einschob und auf Play drückte. Taggs Stimme füllte das stille Zimmer. Ich zuckte lächelnd zusammen, immer noch unschlüssig, ob ich sauer auf ihn sein sollte oder Angst um ihn haben musste. Eins wusste ich jedoch ziemlich genau – Tagg hätte sicher nicht gewollt, dass ich mitbekam, was er Millie zu sagen hatte. Ich ging zur Tür. Als ich sie jedoch öffnete, schaltete Millie das Band aus, und Tagg verstummte mitten im Satz über seine Bar. Ich wusste über seine Geschäfte bereits alles, was ich wissen musste. Aber Millie war anderer Meinung.
»Moses? Bitte bleib und hör dir mit mir die Kassetten an. Du kennst ihn am besten. Du bist mit ihm schon so vertraut, wie ich es gerne sein möchte. Und er liegt dir so sehr am Herzen wie mir. Ich brauch deine Hilfe, damit mir nichts entgeht. Und danach brauch ich deine Hilfe, um ihn zu finden.«
Mit achtzehn lernte ich David Taggert in einer psychiatrischen Klinik kennen. Der psychiatrischen Klinik Montlake. Bei einer Gruppentherapie sind wir uns zum ersten Mal begegnet. Ich entdeckte seine tote Schwester hinter seiner Schulter und fragte, ob er Molly kannte. So hieß sie. Molly. Seine tote Schwester. Er war wütend auf mich losgegangen und hatte mich zu Boden gerissen. Mit den Händen um meinen Hals hatte er Antworten verlangt, ehe die Pfleger ihn von mir wegziehen konnten.
Kein besonders vielversprechender Anfang für eine Freundschaft.
Wir waren aus unterschiedlichen Gründen dort. Ich war eingewiesen worden, weil man Angst vor mir hatte, und Tagg, weil er geliebt wurde. Ich sah tote Menschen, und er wollte sterben. Wir waren jung, einsam, verloren und verirrt. Ich für meinen Teil wollte auch gar nicht gefunden werden, sondern einfach nur weg, so weit wie möglich, weg von den Toten.
Tagg wollte nur Klarheit.
Vielleicht lag es an unserem jugendlichen Alter. Oder daran, dass wir beide nicht besonders scharf darauf waren, die psychiatrische Klinik wieder zu verlassen. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass Tagg mit seinem ausgeprägten texanischen Akzent und seinem Cowboygehabe so ganz anders war als ich. Egal aus welchem Grund, wir wurden Freunde. Vielleicht auch, weil er mir glaubte. Ohne zu zögern. Bedingungslos. Ohne zu urteilen. Er glaubte mir. Und das ist auch so geblieben.
Nach unserem Schlagabtausch in der Therapiegruppe durften wir unsere Zimmer drei Tage lang nicht verlassen. Am dritten Isolationstag kam Tagg in mein Zimmer gesprintet und schloss die Tür.
Finster musterte ich ihn. Ich hatte angenommen, die Tür wäre abgeschlossen, und hatte das nicht einmal überprüft. Jetzt kam ich mir dumm vor, weil ich drei Tage im Zimmer verbracht hatte, obwohl die Tür gar nicht verriegelt war.
»Die Pfleger laufen alle paar Minuten zur Kontrolle durch den Flur. Mehr aber auch nicht. Das war schon lächerlich einfach. Ich hätte viel eher kommen sollen«, sagte er und setzte sich auf mein Bett. »Ich bin übrigens David Taggert. Aber du kannst mich Tagg nennen.« Er entschuldigte sich nicht dafür, dass er mich beinahe erstickt hätte, und machte auch nicht den Eindruck, als ob er eine Prügelei anfangen wollte, was mich ein wenig enttäuschte.
Wenn er sich nicht prügeln wollte, konnte er von mir aus gleich wieder verschwinden. Wortlos wandte ich mich dem Bild zu, an dem ich gerade arbeitete. Ich spürte die Nähe seiner Schwester am Rande meines Sichtfeldes. Ihr Bild flackerte hinter meinen Schutzmauern auf, und ich seufzte schwer. Ich war Molly leid und ihren Bruder noch mehr. Beide waren unglaublich hartnäckig und anstrengend.
»Du bist ein verrückter Dreckskerl«, sagte Tagg ohne Vorwarnung.
Ich hob nicht mal den Kopf von dem Bild, das ich mit dem letzten stummeligen Rest eines Wachsstiftes zeichnete. Ich versuchte, meine Stifte so lange wie möglich zu verwenden. Meine Vorräte schwanden viel zu rasch.
»Das behaupten die Leute, oder? Dass du verrückt bist. Aber das schlucke ich nicht, Mann. Nicht mehr. Du bist nicht verrückt. Du hast Fähigkeiten. Wahnsinnige Fähigkeiten.«
»Wahnsinnig. Verrückt. Bedeutet das nicht dasselbe?«, murmelte ich. Wahnsinn und Genie lagen eng beieinander. Ich fragte mich, über welche Fähigkeiten er redete. Er hatte mich nicht malen sehen.
»Nein, Mann«, sagte er. »Das ist nicht dasselbe. Verrückte gehören an solche Orte wie den hier. Du aber nicht.«
»Ich glaub schon, dass ich hierhergehöre.«
Er lachte, eindeutig überrascht. »Du glaubst, dass du verrückt bist?«
»Ich glaube, dass ich einen Knacks habe.«
Fragend legte Tagg den Kopf schief. Als ich nicht weitersprach, nickte er. »Okay. Vielleicht haben wir alle einen Knacks. Oder sind geknickt. Ich auf jeden Fall.«
»Warum?«, fragte ich. Molly schwebte wieder im Raum, und ich zeichnete schneller, füllte unwillkürlich die Seite mit ihrem Gesicht.
»Meine Schwester ist verschwunden. Und das ist meine Schuld. Solange ich nicht weiß, was mit ihr passiert ist, werde ich den Knacks nicht kitten können. Ich werde bis in alle Ewigkeit geknickt bleiben.« Seine Stimme klang so leise, dass ich mir nicht sicher war, ob ich den letzten Teil hören sollte.
»Ist das deine Schwester?«, fragte ich und zeigte ihm widerstrebend meinen Skizzenblock.
Tagg betrachtete das Bild. Dann stand er auf. Gleich darauf setzte er sich wieder, dann nickte er.
»Ja«, brachte er erstickt hervor. »Das ist meine Schwester.«
Und er erzählte mir alles.
David Taggerts Vater machte in Texas in Öl, wollte aber schon immer Rancher werden. Als Tagg immer öfter Ärger bekam und sich jedes Wochenende besoff, kaufte sein Vater eine zwanzig Hektar große Ranch in Sanpete County, Utah, und die Familie zog dorthin. Er war sich sicher, wenn er Tagg und seine ältere Schwester Molly aus ihrem alten Umfeld herausholte, würden sie ihre Probleme in den Griff bekommen.
Die Kinder blühten jedoch nicht auf. Sie rebellierten. Molly lief von zu Hause fort und verschwand spurlos. Tagg gab sich Mühe, nüchtern zu bleiben, aber wenn er nicht trank, ertrank er in Schuldgefühlen und versuchte schließlich, sich das Leben zu nehmen. Mehrmals. Weshalb er im psychiatrischen Flügel gelandet war, in derselben Etage wie ich.
Ich hörte zu, ließ ihn reden. Ich wusste ebenso wenig über Mollys Todesumstände wie er. Solche Erinnerungen teilten die Toten nie mit mir. Sie wollten mir ihr Leben zeigen, nicht ihren Tod. Als Tagg seine Geschichte beendet hatte, sah er mich mit traurigen Augen an.
»Sie ist tot, stimmt’s? Du kannst sie sehen, also ist sie tot.«
Ich nickte, und er nickte auch, nahm meine Antwort ohne Widerrede hin und senkte den Kopf, worauf meine Achtung für ihn stieg. Also zeigte ich ihm, was Molly mir zeigte, und zeichnete die Bilder, die mir durch den Kopf gingen, wenn sie in der Nähe war.
Tagg erzählte seinem Vater von mir. Und aus welchen Gründen auch immer – Verzweiflung, Hilflosigkeit oder schlicht dem Wunsch, seinen hartnäckigen Sohn zu beschwichtigen – heuerte David Taggert senior einen Mann und seinen Suchhundetrupp an, um die von mir beschriebene Gegend abzusuchen. Rasch nahmen die Hunde Mollys Spur auf und fanden ihre Leiche. Einfach so. In einem flachen Grab, über dem sich Steine und Müll auftürmten, nur fünfzig Meter von der Stelle entfernt, an der ich ihr lächelndes Gesicht auf eine Straßenbrücke gemalt hatte, wurde die Leiche von Molly Taggert aufgespürt.
Tagg hatte mir weinend davon berichtet. Tiefe, markerschütternde Schluchzer ließen seine Schultern erbeben und mein Magen verkrampfte. Zum ersten Mal hatte ich so etwas getan. Jemandem geholfen. Jemanden aufgespürt. Zum ersten Mal war meine Gabe, wenn man das so nennen konnte, nützlich gewesen. Tagg hatte jedoch nur weitere Fragen.
Eines Nachts, nachdem die Lichter gelöscht waren, schlich er sich wie so oft ungesehen über den Flur zu mir und suchte nach Antworten, die ihm das Personal nicht geben konnte und von denen er glaubte, dass ich sie kannte. Tagg lächelte oft, geriet rasch in Wut, vergab schnell und handelte schnell. Er machte keine halben Sachen. Manchmal fragte ich mich, ob er nicht tatsächlich in der Anstalt am besten aufgehoben war, weil man ihn dort unter Kontrolle hielt. Er besaß jedoch auch eine sentimentale Seite.
»Wenn ich sterbe, was passiert dann mit mir?«
»Warum glaubst du, dass du sterben wirst?« Ich hörte mich schon wie ein Arzt an.
»Ich bin hier, weil ich mehrere Male versucht habe, mich umzubringen, Moses.«
»Ja, ich weiß.« Ich deutete auf die lange Narbe auf seinem Arm. Das war leicht zu erkennen. »Und ich bin hier, weil ich tote Leute male und jedem, dem ich begegne, eine Scheißangst einjage.«
Er grinste. »Ja, ich weiß.« Auch er wusste über mich Bescheid. Sein Lächeln verschwand jedoch sofort wieder. »Wenn ich nicht trinke, drückt mich das Leben so sehr runter, dass ich nicht mehr klar denken kann. So war das nicht immer. Aber jetzt ist es so. Das Leben ist ziemlich scheiße, Moses.«
»Willst du immer noch sterben?«, wechselte ich das Thema.
»Ab und zu. Was kommt danach?«
»Mehr«, antwortete ich schlicht. »Einfach mehr. Das ist alles, was ich dir sagen kann. Es endet nicht.«
»Und du siehst, was danach kommt?«
»Was meinst du damit?« Ich konnte nicht in die Zukunft blicken, falls er das meinte.
»Kannst du die andere Seite sehen?«
»Nein. Ich sehe nur, was sie mir zeigen«, stellte ich klar.
»Sie? Wer ist sie?«
»Diejenigen, die zu mir kommen.« Ich zuckte mit den Schultern.
»Flüstern sie dir was zu? Reden sie mit dir?« Tagg hatte die Stimme zu einem Flüstern gesenkt, als sei das Thema heilig.
»Nein. Sie sagen nie was. Sie zeigen mir nur Dinge.«
Tagg erschauerte und rieb sich den Nacken, wie um die Gänsehaut wegzurubbeln, die ihm über den Rücken kroch.
»Siehst du alles? Ihr ganzes Leben?«
»Manchmal fühlt es sich so an. Dann ist es wie eine Flutwelle aus Farben und Erinnerungen, aus der ich nur zufällig Dinge auffischen kann, weil alles so schnell durcheinanderwirbelt. Außerdem kann ich nur sehen, was ich auch verstehe. Ich bin sicher, ihnen wäre es lieber, wenn ich mehr sehen könnte. Aber das ist nicht so leicht. Es ist subjektiv. Ich sehe gewöhnlich nur Bruchstücke, Puzzleteile. Niemals das ganze Bild. Aber ich bin schon besser im Filtern geworden. Dadurch fühlt es sich mehr wie Erinnern an und weniger so, als wäre ich besessen.« Als ich lächelte, schüttelte Tagg verwundert den Kopf.
»Moses?« Tagg riss mich aus meinen Gedanken.
»Ja?«
»Bekomm das nicht in den falschen Hals, aber … wenn du weißt, dass da mehr ist und es nicht schlimm ist oder unheimlich … keine Zombie-Apokalypse, kein Fegefeuer und keine Hölle, soweit du weißt, warum bleibst du dann noch hier?« Seine Stimme klang so leise und voller Emotionen, dass ich mir nicht sicher war, ob ich die richtigen Worte finden würde, um ihm zu helfen. Ich wusste nicht, ob es darauf überhaupt eine Antwort gab. Ich dachte einen Moment nach und fand schließlich eine Antwort, die sich richtig anfühlte.
»Weil ich immer noch ich sein würde«, sagte ich. »Und du immer noch du.«
»Was meinst du damit?«
»Wir können nicht vor uns selbst flüchten, Tagg. Ob hier oder dort, ob man bis ans Ende der Welt reist oder in einer psychiatrischen Klinik in Salt Lake City ist. Ich bin Moses und du Tagg. Und das wird sich nie ändern. Also müssen wir uns unserem Selbst entweder hier stellen oder woanders. Aber wir müssen auf jeden Fall damit klarkommen. Und daran ändert auch der Tod nichts.«
Er nickte langsam, den Blick auf meine Hände gerichtet, die Bilder entstehen ließen, die keiner von uns wirklich verstand.
»Daran ändert sich nichts«, wiederholte er wie ein Echo. »Du bist Moses und ich Tagg.«
Ich nickte. »Ja. Und so sehr das manchmal auch nervt, es liegt auch Trost darin. Zumindest wissen wir, wer wir sind.«
Er fragte mich nie wieder nach dem Tod. In den folgenden Wochen legte er eine Zuversicht an den Tag, die er früher vermutlich bergeweise besessen hatte. Er schien Pläne für die Zukunft zu schmieden. Ich hatte immer noch keine Ahnung, was ich anfangen sollte.
»Wohin gehst du nach deiner Entlassung?«, fragte er eines Abends beim Essen, die Augen auf den Teller gerichtet, die Arme auf dem Tisch. Er hatte einen fast so großen Appetit wie ich. Ich war mir ziemlich sicher, dass das Küchenpersonal froh über unsere Entlassung sein würde.
Ich wollte nicht mit Tagg über meine Zukunft reden. Ich wollte gar nicht darüber reden. Also schaute ich über Taggs Kopf hinweg aus dem Fenster und teilte ihm das wortlos mit. Aber Tagg blieb hartnäckig.
»Du bist fast neunzehn. Du bist offiziell raus aus dem System. Also, wohin willst du, Mo?« Ich weiß nicht, wie er auf die Idee gekommen war, mich Mo zu nennen. Ich hatte ihm das nicht erlaubt. Aber so war er nun mal. Hartnäckig war er mir immer mehr auf die Pelle gerückt und hatte sich durch meine Schutzmauer gebohrt.
Mein Blick flackerte kurz zu Tagg, dann tat ich seine Frage mit einem Schulterzucken ab, als sei sie nicht wichtig.
Ich hatte mehrere Monate in der Klinik verbracht. Über Weihnachten, Neujahr bis in den Februar hinein. Drei Monate in einer psychiatrischen Anstalt. Und ich wünschte, ich könnte bleiben.
»Komm mit mir«, schlug Tagg vor, warf die Serviette auf den Tisch und schob sein Tablett von sich weg.
Völlig verblüfft lehnte ich mich zurück. Ich erinnerte mich daran, dass Tagg am Tag seiner Ankunft in der Klinik geweint hatte; sein Schluchzen hatte von den Wänden im Flur widergehallt. Er war fast einen Monat nach mir gekommen. Ich hatte im Bett gelegen und den Versuchen, ihn zu beruhigen, gelauscht. Damals wusste ich noch nicht, dass er es war. Erst später, als er mir verriet, warum er in Montlake war, hatte ich eins und eins zusammengezählt. Ich dachte daran, wie er damals im Gesprächskreis auf mich eingeprügelt hatte, mit Wut in den Augen und rasend vor Kummer. Tagg riss mich mit seinen Worten aus den Gedanken.
»Meine Familie hat zwar nicht viel zu bieten, aber Geld haben wir haufenweise. Und du hast einen Scheißdreck.«
Ich blieb stocksteif sitzen und wartete ab. Es stimmte. Ich hatte nichts. Tagg war mein Freund, mein erster echter Freund außer Georgia. Aber ich wollte Taggs Mist nicht. Weder den guten noch den schlechten, und Tagg hatte genug von beidem.
»Ich brauche jemanden, der aufpasst, dass ich mich nicht umbringe. Jemanden, der stark genug ist, um mich aufzuhalten, falls ich beschließen sollte, mir den Verstand wegzusaufen. Ich gebe dir den Job, jede wache Minute mit mir zu verbringen, bis ich herausgefunden habe, wie ich nüchtern bleiben kann, ohne den Wunsch zu verspüren, mir die Adern aufzuschlitzen.«
Verwirrt legte ich den Kopf schräg. »Du willst, dass ich deinen Aufpasser spiele?«
Tagg lachte. »Ja. Schlag mir ins Gesicht, drück mich auf den Boden. Tritt mir die Scheiße aus dem Leib. Stell nur sicher, dass ich nüchtern und am Leben bleibe.«
Ich überlegte, ob ich dazu in der Lage wäre, Tagg zu schlagen, ihn auf den Boden zu drücken, ihn festzuhalten, bis der Alkohol- oder Todeswunsch vergangen war. Ich war groß. Stark. Aber Tagg war auch nicht gerade klein und schwächlich. Und plötzlich klang der Vorschlag nicht mehr ganz so prickelnd. Meine Zweifel mussten sich in meinem Gesicht gespiegelt haben, denn Tagg brachte weitere Argumente vor.
»Du brauchst jemanden, der dir glaubt. Das tue ich. Es nervt irgendwann, nur Leute um sich herum zu haben, die denken, dass man einen Knall hat. Ich weiß, dass du keinen Knall hast. Du brauchst einen Ort, an den du gehen kannst, und ich brauche jemanden, der mich begleitet. Es ist kein schlechtes Geschäft. Du willst reisen. Und ich habe nichts Besseres zu tun. Ich bin lediglich gut im Kämpfen, das kann ich überall.« Er lächelte und zuckte mit den Schultern. »Ehrlich, ich traue mir nicht zu, allein zu leben. Und wenn ich nach Hause zurückkehre, werde ich trinken. Oder sterben. Also brauche ich dich.«
Er sagte das so leichthin. Ich brauche dich. Ich fragte mich, wie ein harter Kerl wie Tagg, jemand, der sich aus Spaß prügelte, so offen und leicht vor einem anderen zugeben – und selbst daran glauben – konnte, dass er Hilfe benötigte. Ich hatte nie jemanden gebraucht. Im Prinzip zumindest. Und ich hatte diese Worte nie ausgesprochen. »Ich brauche dich« hörte sich an wie »Ich liebe dich«, und das jagte mir Angst ein. Es kam mir vor, als würde ich eines meiner Gesetze brechen. Aber in diesem Moment, in dem der Morgen sich bedrohlich näherte und die Freiheit allmählich in Reichweite rückte, musste ich zugeben, dass ich Tagg vermutlich ebenfalls brauchte.
Wir gaben ein seltsames Paar ab. Der Straftäter mit gemischter ethnischer Herkunft, der nicht aufhören konnte zu malen, und der große Texaner mit dem großspurigen Gehabe und den zotteligen Haaren. Aber Tagg hatte recht. Wir steckten beide in der Klemme und wussten nicht weiter. Wir hatten keinen Halt und sahen keinen Weg vor uns. Ich wollte lediglich meine Freiheit, und Tagg wollte nicht allein sein. Ich brauchte sein Geld und er meine Gesellschaft, so traurig das auch war. Und so zogen wir los. Wir rannten förmlich. Und warfen keinen Blick zurück.
»Wir bleiben immer auf Achse, Moses. Wie hast du gesagt? Hier, dort oder am Ende der Welt? Wir können nicht vor uns selbst flüchten. Also bleiben wir zusammen, bis wir uns selbst gefunden haben, in Ordnung? Bis wir herausgefunden haben, wie wir zurechtkommen.«
Das hatte er gesagt. Das hatten wir getan. Und Tagg Taggert wurde mein bester Freund. Wenn ich ihn am meisten brauchte, hielt er zu mir. Er ließ mich nie im Stich.
Daher musste ich ihn jetzt unbedingt finden.
Am meisten Angst hatte ich davor, dass er die Antworten, die er brauchte, womöglich bereits gefunden hatte. Vielleicht wusste er ganz genau, was er tat und wer er war. Vielleicht hatte er inzwischen Klarheit gefunden. Aber wir hatten mit achtzehn einen Deal geschlossen. Und ich stehe zu meinem Wort – ein Deal ist ein Deal.
»Ich brauche jemanden, der aufpasst, dass ich mich nicht umbringe. Jemanden, der stark genug ist, um mich aufzuhalten, falls ich beschließen sollte, mir den Verstand wegzusaufen. Schlag mir ins Gesicht, drück mich auf den Boden. Tritt mir die Scheiße aus dem Leib. Stell nur sicher, dass ich nüchtern und am Leben bleibe«, hatte er gesagt. Er hatte sein Leben in meine Hände gelegt.
Und ich konnte nur hoffen, dass ich nicht zu spät kam.
Tagg
(Kassette)
Meine Bar heißt Taggs, weil sie mir gehört. So einfach ist das. Nach dem Kauf dachte ich ein paar Wochen über einen Namen nach. Ich suchte nach was Pfiffigem, das sich einprägt und smart klingt, aber letztendlich nahm ich dann doch meinen Namen. Ergibt Sinn, oder? Was dir gehört, bekommt deinen Namen.
Es mag masochistisch erscheinen, dass ich als trockener Alkoholiker eine Bar besitze, aber ich hab sie mir nicht wegen der Sauferei gekauft. Ich hab sie erworben, weil ich mich jedes Mal stark und mächtig fühle, wenn ich dort bin und meine Runde bei den Gästen drehe oder als Barkeeper die Gläser fülle. Es kommt mir dann so vor, als hätte ich meine Dämonen besiegt oder als könnte ich sie zumindest in Schach halten. Außerdem bin ich ein Mann, und eine Bar ist wohl der männlichste aller Männerspielplätze. Der Innenraum ist in separate Bereiche für unterschiedliche Sportarten unterteilt. An den Wänden und an der Decke hängen Flachbildschirme, damit die Gäste mehrere Spiele gleichzeitig im Blick behalten können. Wenn du einen bestimmten Boxkampf oder ein spezielles Footballspiel sehen willst, wird es auf einem der Bildschirme extra für dich eingeschaltet. Der Duft von teuren Zigarren und Leder hängt in der Luft, von Piniennadeln und Geldbündeln, alles testosterongeschwängerte Düfte, in denen man als Mann gerne schwelgt. Das Dekor besteht aus Steinwänden, dunklem Holz, warmer Beleuchtung und hübschen Kellnerinnen. Ich bin extrem stolz darauf.
Mir gehört nicht nur die Bar, sondern praktisch der gesamte Block. Die Bar an der Ecke, daneben die kleine Arena, in der jeden Dienstagabend und jeden ersten Samstag im Monat Kampfveranstaltungen der örtlichen MMA-Szene stattfinden, der Fitnessklub dahinter und das Sportgeschäft am Ende der Straße, in dem man Zubehör und Kleidung meiner Tagg-Team-Marke kaufen kann. Über dem Fitnessklub befinden sich meine Wohnung und zwei Apartments, in denen Freunde von mir wohnen. In diesem Straßenblock spielt sich mein ganzes Leben ab. Er ist wie eine eigene Welt, die ich mir selbst erschaffen habe. Alle Geschäfte sind miteinander verbunden, greifen ineinander über und unterstützen sich gegenseitig.
An veranstaltungsfreien Abenden werden die Sitze in der Arena durch Ziehharmonikatüren abgetrennt, und der Kampfkäfig wird zur Hinterzimmerbühne mit einem Dutzend kleiner Tische und Nischen. Die Bar befindet sich gleich um die Ecke, und die Kellnerinnen sorgen dafür, dass die Gäste sich wohlfühlen und bleiben. An vier Abenden in der Woche spielt sich hier eine völlig andere Show in einem ganz anderen Sport ab. In der Mitte des Käfigs wird eine Stange angebracht, statt Kampfsportlern treten Frauen an. Im Takt der pulsierenden Musik, die dank der Schalldämmung im restlichen Gebäude nicht zu hören ist, winden sie sich akrobatisch an der Stange. Ich achte auf Stil und Klasse – so stilvoll wie Poledancestangen und halb nackte Frauen eben sein können. Die Mädchen tanzen, sie strippen nicht, und sie mischen sich auch nicht unter die Gäste. Dennoch ist die Show so heiß und pikant, dass mir ein separater Raum dafür lieber ist. Dieses Hinterzimmer dient für Verhandlungen – dort schließe ich mehr Geschäfte ab als anderswo. Und die Show ist sozusagen die Kirsche auf der Sahne eines Etablissements, in dem hart arbeitende Männer fröhlich ihren Feierabend genießen.
Das Taggs hat vor zwei Jahren aufgemacht; zur selben Zeit brachte ich meine eigene Bekleidungslinie auf den Markt und hatte meinen ersten großen Kampf. Damals besiegte ich einen Kontrahenten, den ich nicht hätte besiegen dürfen. Ich schlug ihn k. o. und wurde dadurch zum heiß gehandelten Geheimtipp. Mein Timing war perfekt, ich baute auf einem Erfolg auf, um einen weiteren zu starten. Aus einem reichen Kind war ein Geschäftsmann geworden, ein Cowboy, der auf einer Welle der Bewunderung ritt statt auf einem Pferd. Ich wollte es lieber mit der Kampfsportwelt aufnehmen, als Nachfolger meines Vaters zu werden. Auch dieser Weg hätte mir offengestanden, eine goldene Zukunft voller Privilegien. Aber diesen Weg hatte ich mir nicht selbst geebnet. Ich war fest davon überzeugt, dass man niemals richtig glücklich werden konnte, wenn man den Weg eines anderen ging. Einen Weg, der nicht für einen selbst bestimmt ist. Um wahrhaft glücklich zu werden, muss man sein Glück selbst schmieden, auch wenn der Weg dorthin holprig ist. Selbst wenn man Brücken bauen, Berge überqueren und Tunnel graben muss. Nichts fühlt sich besser an, als sich seinen eigenen Weg zu ebnen.
Vor drei Jahren war ich nach Salt Lake City gekommen, um mir meinen Weg zu bauen. Ich hatte Geld – ein Teil davon gehörte mir, das Geld, das ich gemeinsam mit Moses verdient hatte, der andere Teil war geliehen. Ich war zwar der Sohn einer reichen Familie, aber nicht blöd. Ich wusste, dass ich Kapital benötigte, um mir ein Imperium aufzubauen. Manchmal braucht es Geld, um Geld zu verdienen. Daher nahm ich das Geld von meinem Vater an und versprach mir selbst, dass ich es ihm vor meinem Tod oder meinem dreißigsten Geburtstag zurückzahlen würde, je nachdem, was zuerst eintrat.
Mit sechsundzwanzig blieb mir nicht mehr viel Zeit und Spielraum, um mein Versprechen einzuhalten, aber ich war auf dem richtigen Kurs, und die Bar lief hervorragend. An jenem Montagabend bekam ich auch gleich den Beweis dafür geliefert. Gewöhnlich ist der Montag der mieseste Abend der Woche – aber diesmal waren die Stühle und Tische allesamt besetzt, und ein Stimmengewirr zufriedener, gut gelaunter Gäste empfing mich. Die Bar brummte, und mein Herz schlug fröhlich im Takt der Musik. Zwei Kellnerinnen stolzierten vorbei, gekleidet wie Nummerngirls in Tagg-Team-Shorts und Bustiers, und verteilten Runden, statt sie anzukündigen. Sie schenkten mir ein identisches Lächeln und warfen ihre Haare über die Schulter, als gehöre das zum Job. Vielleicht sollte so was tatsächlich in der Stellenbeschreibung stehen. Möglicherweise sagte ihnen aber auch schon der gesunde Menschenverstand, dass man den Chef immer anlächeln sollte.
Ich war jedoch nicht zum Flirten hier, obwohl ich das Lächeln automatisch erwiderte. Rasch schätzte ich die Stimmung im Laden ein, überschlug, wie viele Kerle an der Bar und an den Tischen saßen, wie schnell der Alkohol floss und wie effizient mein Servicepersonal die Gäste bediente. Als ich mir den Weg zur Bar bahnte, um meinen Geschäftsführer Morg zu begrüßen, spürte ich das gedämpfte Wummern der Musik aus dem Hinterzimmer am Ende des dunklen Flurs.
»Wer tanzt heute Abend?« Eigentlich war es mir egal.
»Justine. Lori. Und das neue Mädchen.« Morgan grinste verschmitzt. Sofort wurde ich misstrauisch. Als ich mich setzte, stellte er eine Cola vor mich. Ich nahm einen großen Schluck, ehe ich antwortete.
»Aha. Deinem blöden Grinsen nach zu urteilen, möchtest du mir wohl unbedingt etwas über das neue Mädchen erzählen.«
»Nee. Gar nicht. Sie sieht klasse aus. Eine tolle Tänzerin. Tolle Figur. Sie tanzt schon seit zwei Wochen hier, aber du hast sie immer verpasst. Sie ist stets pünktlich und redet nicht viel. Sie tanzt, trinkt nicht, flirtet nicht. Sie ist genau so, wie du die Mädels magst.« Wieder dieses anzügliche Grinsen.
»Ach ja?« Ich schob meine Cola weg und stand auf. Besser, ich schaute mal nach, was er nun wieder ausgeheckt hatte. Morgan war es zuzutrauen, dass er einen meiner Tagg-Team-Kämpfer im Bikini durch den Käfig spazieren ließ. Er liebte solche Scherze. Aber er war ein verdammt guter Barkeeper … auch wenn er mich mit seinen Faxen in den Wahnsinn trieb.
Ich begrüßte ein paar Stammkunden, schüttelte Hände, küsste Stormy im Vorübergehen auf die Wange, während sie eiskalte Bierflaschen servierte, und winkte Malcolm Short zu, der offensichtlich keine Zeit gefunden hatte, sich nach der Arbeit umzuziehen, und in seinem schnieken Anzug und der Utah-Jazz-Kappe ziemlich lächerlich aussah. Aber er schien guter Laune zu sein. Wie angewachsen saß er auf dem Barhocker, die Augen auf den Bildschirm fixiert, und verfolgte voller Enthusiasmus das Spiel. Er gehörte zu den Tagg-Team-Sponsoren, und ich freute mich, wenn er zufrieden war.
Ich war beinahe so gut darin, meine Runde zu drehen und gut Wetter bei den Gästen zu machen, wie beim Kampf im Oktagon, wobei ich den Kampf jederzeit vorziehen würde. Als ich den Raum durchquerte und hinter dem Türbogen verschwand, der das Hinterzimmer vom Rest der Sportbar trennte, kreisten meine Gedanken jedoch ums Geschäft. Mein Blick flog sofort zum Käfig, und ich rechnete schon mit dem Schlimmsten. Zu meiner Erleichterung arbeitete jedoch Justine an der Stange und beendete gerade ihre Nummer mit ein paar lasziven Drehungen. Hüftwackelnd und winkend, als hätte sie die nächste Runde angekündigt, verließ sie die Bühne. Gleich darauf gingen die Lichter aus.
Als die Scheinwerfer wieder aufleuchteten, stand das neue Mädchen im Oktagon, die Hände an der Stange, den Kopf gesenkt. Als die Musik losdröhnte, begann es mit ihrem akrobatischen Tanz. Verwundert runzelte ich die Stirn. Das Mädchen war schlank und gelenkig, geschmeidige Muskeln spielten unter straffer Haut. Ihr schnurgerades dunkelbraunes Haar schimmerte seidig im Licht, ihr eingeölter Körper glänzte, und Shorts und Bikinitop waren genauso knapp wie die der anderen Mädchen. Ich beobachtete sie eine Weile, in der Hoffnung, dass ich den Witz noch kapierte. Irgendwo musste doch die Pointe lauern.
Sie war eine Schönheit – zierlich, mit Stupsnase, rosigem Schmollmund und herzförmigem Gesicht. Plötzlich durchzuckte mich die Befürchtung, sie könnte womöglich minderjährig sein. Doch ich verwarf den Gedanken sofort wieder. Morgan spielte zwar gern den Clown, war aber kein Idiot. Ein solcher Streich könnte die Bar ruinieren und ihn den Job kosten. Und Morgan mochte seinen Job, auch wenn er mich manchmal ebenso wenig mochte wie ich seine Scherze.
Nein. Sie war mindestens einundzwanzig. So lautete meine Bedingung. Ich presste die Lippen zusammen und legte den Kopf schräg, um sie genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie machte sich so gut an der Stange wie die anderen Mädchen, vielleicht sogar besser, aber ihr Tanz war eher akrobatisch als anzüglich und sexy. Die Augen hatte sie geschlossen, auf ihren Lippen lag ein leichtes Lächeln, was man als verführerisch deuten konnte, da sie für ein fast ausschließlich männliches Publikum tanzte. Quatsch, von wegen »fast«. Das Publikum bestand ausschließlich aus Männern. Und ihr Lächeln wirkte eigentlich nicht verführerisch. Eher … verträumt, als ob sie sich vorstellte, irgendwo anders zu sein, eine kleine Ballerina, die ihre Pirouetten in der Schneekugel eines Kindes dreht und bis in alle Ewigkeit allein tanzt. Ihr leichtes Lächeln blieb unverändert, und sie öffnete kein einziges Mal die Augen; ihre dichten, dunklen Wimpern formten Halbmonde auf ihren porzellanweißen Wangen.
Die Beleuchtung hatte Strategie; sie verbarg die Zuschauer und setzte die Tänzerinnen ins Rampenlicht. Vielleicht blendete sie das Licht. Vielleicht war sie auch bloß schüchtern. Ich grinste. Äh … nee. Eine schüchterne Poledancerin war ein ebenso großer Widerspruch wie ein ängstlicher Kampfsportler. Irgendjemand sollte aber wohl mal ein paar Takte mit ihr reden und sie aufklären. Die Männer im Publikum hatten gern das Gefühl, dass die Tänzerinnen sie ansahen. Obwohl die Mädchen sich nicht unter die Gäste mischten, zumindest nicht in der Bar, gehörte Flirten zum Job. Ich fragte mich, ob Morgan auf den fehlenden Blickkontakt anspielen wollte. Falls der Witz darin bestehen sollte, war er nicht gut in Form.
Als das Lied endete und die Lichter ausgingen, verließ ich das Hinterzimmer. Von neun bis Mitternacht tanzten jeweils drei Mädchen je eine Viertelstunde lang. Danach gab es eine Viertelstunde Pause. Wir waren schließlich in Utah, nicht in Vegas. An zwei, manchmal drei Abenden pro Woche hatten die Tänzerinnen frei. Immer dann, wenn Kampfveranstaltungen oder Klubabende stattfanden und das Oktagon anderweitig gebraucht oder ganz abgebaut wurde, um für eine Tanzfläche Platz zu machen. Vier – inzwischen fünf – Tänzerinnen standen auf meiner Lohnliste, und für die Mädchen war das Poledancing kein Vollzeitjob. Die meisten hatten tagsüber noch eine andere Arbeit und verdienten sich an Kampfabenden mit dem Ankündigen der Runden noch ein paar Extradollar dazu.
»Und was sagst du, Chef?« Morgan grinste mich an und schob einem wartenden Gast ein Glas zu, während ich wieder vor ihm auf dem Hocker Platz nahm.
Ich richtete den Blick auf einen der Deckenmonitore, um den Spielstand festzustellen, und verweigerte Morgan die gewünschte uneingeschränkte Aufmerksamkeit. »Zu was?«, fragte ich beiläufig.
»Zu dem neuen Mädchen.«
»Hübsch.« Die anderen Adjektive, die mir bei ihrem Tanz durch den Kopf geschossen waren, brauchte er nicht zu wissen.
»Ach ja?« Morgan hob die Augenbrauen, als ob ihn meine einsilbige Zusammenfassung überraschte.
»Ja, Morg.« Ich seufzte. »Willst du mir vielleicht was sagen? Ich versteh’s nämlich nicht.«
»Nein, Sir. Will ich nicht. Nicht die Bohne.«
Ich schüttelte den Kopf und stöhnte. Morgan führte definitiv was im Schilde.
»Wie viele Wochen noch, Chef?«
»Acht.« Acht Wochen bis zum Kampf gegen Bruno Santos. Dem Duell, das mir einen Titelkampf in Las Vegas einbringen konnte. Der Kampf, der die Marke Tagg-Team in die Wohnzimmer in ganz Amerika katapultieren würde. In diesen acht Wochen musste ich mich voll konzentrieren – keine Ablenkung, keine Entscheidungen über den einen Kampf hinaus. Nach meinem Sieg würde ich weitersehen. Von mir aus konnte danach die Welt untergehen. Aber erst mal musste ich gewinnen.
»Hey, Chef, Lou hat sich krankgemeldet. Eigentlich ist es seine Aufgabe, die Mädchen zu ihren Autos zu bringen. Kannst du für ihn einspringen, wo du schon mal hier bist?«
Mein weibliches Personal wird grundsätzlich nach der Schicht zum Auto gebracht. Ausnahmslos. Die Gegend ist zwar schon besser geworden, aber trotzdem nicht ungefährlich. Das Taggs liegt in der Nähe des alten Bahnhofs in einem sanierten Bezirk, der immer noch irgendwo zwischen Restaurierung und Verfall steckt. Zwei Blöcke weiter nördlich steht eine Reihe Häuser aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts, zwei Blöcke weiter südlich gibt es eine Ladenzeile, deren Schaufenster allesamt vergittert sind. Ein schickes Wellnesscenter befindet sich links an der Ecke des Blocks und ein Obdachlosenheim zwei Blocks weiter rechts. Das Viertel ist eine Verschmelzung von allem Möglichen, und gewisse Risiken gibt es immer. Ich fühle mich für meine Angestellten verantwortlich, vor allem für die Mädchen. Deshalb hatte ich ein paar Regeln aufgestellt, auch wenn man mich deswegen manchmal als gluckenhaft, sexistisch und altmodisch beschimpft.
»Ja, kann ich machen.«
»Gut. Das war der letzte Auftritt. Ich würd’s ja übernehmen, aber die Gläser füllen sich nicht von selbst, wie du weißt. Kellis Freund hat sie vor zehn Minuten abgeholt, und Marci und Stormy machen mit mir gemeinsam zu, die beiden kann ich rausbringen. Du musst dich nur um Justine, Lori und Amelie kümmern.«
»Ah-mö-lie?«, wiederholte ich wie ein Papagei und hob die Augenbrauen.
»Ja. Die neue Tänzerin. Amelie. Hab ich ihren Namen nicht erwähnt?«
»Nee. Hast du nicht. Ist sie Französin?«
»So was in der Art«, antwortete Morg knapp. Ich sah, wie er sich ein Lachen verkniff. »Sie wohnt ganz in der Nähe und läuft immer nach Hause. Lou beschwert sich ständig darüber, aber es ist wirklich gleich um die Ecke. Ich sag ihm immer, dass die Bewegung seinem fetten Hintern nur gut tut.«
»Hm.« Das war also der Witz bei der Sache. Ich sollte das neue Mädchen nach Hause bringen, und es fing gerade an zu schneien. Das Mädchen mit dem französischen Namen. Von mir aus. Ich war eh zu zappelig, um zu schlafen. Ich hatte schon überlegt, ob ich noch eine Weile den Punchingball verdreschen sollte, bis ich müde genug war, um ein paar Stunden abzuschalten.
Wie aufs Stichwort tauchten Justine und Lori im Bogen zwischen der Lounge und der Bar auf, die Wintermäntel zugegürtelt, Sporttaschen in der Hand.
»Wo ist Amelie?«, fragte Morgan und schaute über die beiden hinweg.
»Sie wartet vor der Tür auf Lou«, antwortete Justine.
»Lou ist heute Abend nicht da. Tagg bringt euch raus. Stimmt’s, Chef?«
»Stimmt, Morg.« Ich kämpfte meinen Ärger hinunter, als Morgan wieder lachte und den Mädchen zuzwinkerte.
Ich brachte Justine und Lori zu ihren Autos im hinteren Teil des Parkplatzes und sah ihnen nach, bis sie weggefahren waren, dann lief ich außen rum zur Vorderseite des Gebäudes. Ich vermied den Weg durch die Bar, weil ich keine Lust hatte, Morg noch mal zu begegnen. Gleich als ich um die Ecke bog, entdeckte ich das neue Mädchen auf dem Gehsteig. Sie hatte den Kopf in den Nacken geneigt und ließ sich die fetten Schneeflocken genießerisch aufs Gesicht fallen. Sie schien keine Eile zu haben, aus der Kälte herauszukommen. Ihre Hände umschlangen einen langen Stock, und in dem weichen Licht, das aus den Fenstern der Bar fiel, wirkte sie wie eine Schäferin bei einer Weihnachtsparade.
»Hallo?« Ihre Stimme klang fragend, als ich mich näherte. Sie schob den Stock ein Stück nach vorn und stieß damit gegen meinen Fuß. »Lou?«
»Lou ist krank, ich bringe dich nach Hause.« Meine Antwort kam stockend, denn als sie sich zu mir umdrehte, traf mich der Blitz der Erkenntnis. Ich verspürte einen überraschenden Stich irgendwo hinter meinem Herzen. Sie hatte wunderschöne Augen. Groß und glänzend, umrahmt von schwarzen Wimpern, die über ihre Wangen strichen, wenn sie die Lider schloss. Aber ihr Blick war starr und leer, was mich unerklärlich traurig machte. Daher konzentrierte ich mich auf ihren Mund und die braunen Haare, die sich um ihr Gesicht schmiegten und über ihre Schultern fielen. Sie lächelte, und erneut bohrte sich ein Stich durch meine Brust und nahm mir den Atem.
»Ah, dieses Zögern. Das kenn ich schon. Meine Mom hat behauptet, ich sei hübsch«, sagte sie in sarkastischem Ton, »aber für den Fall, dass ich es nicht bin, würdest du mich bitte anlügen? Was mein Aussehen betrifft, möchte ich in allen Einzelheiten belogen werden.« Ihr Ton klang heiter. Ohne Verbitterung. »Du hast also das Blinde-Mädchen-Heimbring-Los gezogen, was? Du musst mich nicht nach Hause bringen. Schließlich bin ich auch ganz alleine hergekommen. Ich mach das nur, weil Morgan gesagt hat, es sei eine unumstößliche Regel. Der Chef besteht wohl drauf.«
»Da hat er recht. Das Viertel ist schön, aber du weißt sicher genauso gut wie ich, dass es an manchen Ecken immer noch ein wenig rau zugehen kann.« Ich kämpfte gegen das Gefühl der Verlegenheit an und gegen den Drang, mich bei ihr für mein Starren zu entschuldigen.
Sie streckte die Hand aus.
»Na, dann stell ich mich mal vor. Ich bin Amelie. Und ich bin blind.« Ihre Mundwinkel zuckten und verrieten mir, dass sie ebenso sehr über sich lachte wie über mich. Ich ergriff ihre Hand. Sie trug keine Handschuhe, ihre Finger waren eiskalt, weshalb ich sie auch nicht sofort wieder losließ. Sie war also keine Französin, sondern blind, und aus irgendeinem unverständlichen Grund fand Morg das überaus witzig.
»Hallo, Amelie. Ich bin David. Und ich bin nicht blind.«
Wieder lächelte sie. Unwillkürlich erwiderte ich das Lächeln. Das mitleidige Ziehen in meinem Inneren ließ beträchtlich nach. Ich wusste nicht, warum ich mich ihr als David vorgestellt hatte. So nannte mich inzwischen kein Mensch mehr. Der Name gab mir immer das Gefühl, versagt zu haben, weil ich mich nicht genügend angestrengt hatte. Es war der Name meines Vaters. Und der seines Vaters. Und der hatte ihn von seinem Vater. David Taggert war ein Name mit Gewicht. Und dieses Gewicht hatte mich schon früh schwer belastet. Irgendwann hatten meine Freunde mir den Spitznamen Tagg verpasst. Tagg gab mir Freiheit. Der Name erlaubte mir, jung zu sein, ein Freigeist. Allein das Wort weckte in mir Bilder vom Davonlaufen. Ich bin Tagg … du kannst mich nicht einfangen.
»Deine Hände sind ganz schwielig, David.«
Eine seltsame Bemerkung, wenn man jemandem zum ersten Mal die Hand gab, aber Amelie spürte mit den Fingerspitzen den rauen Hügeln in meiner Handfläche nach, als würde sie Blindenschrift lesen.
»Training?«, riet sie.
»Äh, ja. Ich bin Kampfsportler.«
Fragend hob sie eine schmale Augenbraue, aber ihre Finger strichen immer noch ziemlich vertraulich über meine Hand. Es fühlte sich gut an. Und merkwürdig. Mein Gaumen begann zu kribbeln, und ich krümmte unwillkürlich die Zehen.
»Die Schwielen sind vom Hanteltraining. Und Klimmzügen. Solche Sachen eben.« Ich hörte mich an wie ein Idiot. Wie ein dämlicher Möchtegern-Rocky. Genauso gut hätte ich »Hey, Adrian!« schreien können.
»Macht dir das Spaß?«
»Der Kampfsport?«, fragte ich und versuchte, den Faden nicht zu verlieren. Sie plänkelte nicht herum wie die anderen Mädchen, die ich kannte. Sie war sehr direkt und nahm kein Blatt vor den Mund. Vielleicht musste sie so sein. Sie verfügte nicht über den Luxus, Dinge durch Beobachtung herauszufinden.
»Ja. Der Kampfsport. Macht dir das Spaß?«, hakte sie nach.
»Ja. Schon.«
»Warum?«
»Ich bin breitschultrig, stark und rebellisch«, erklärte ich aufrichtig und grinste.
Sie lachte. Ich stieß die Luft aus, die ich die ganze Zeit angehalten hatte. Ihr Lachen war nicht mädchenhaft schrill oder gekünstelt. Es war rau, herzlich, die Art von Lachen, die aus dem Bauch kommt und nichts zurückhält.
»Du riechst gut, David.«
Ich schnappte nach Luft und lachte auf, einmal mehr überrascht, doch sie redete gleich weiter.
»Ich weiß jetzt also, dass du breitschultrig, stark und rebellisch bist und gut riechst. Und groß bist du auch, denn deine Stimme kommt von über meinem Kopf. Du stammst aus Texas und bist noch recht jung.«
»Woher weißt du, dass ich jung bin?«
»Alte Männer machen keinen Kampfsport. Und deine Stimme hat es mir verraten. Als du vorhin auf mich zugekommen bist, hast du einen Song von Blake Shelton gesummt. Wärst du älter, wäre es wohl eher was von Conway Twitty oder Waylon Jennings gewesen.«
»Songs von denen sing ich auch.«
»Wunderbar. Du kannst ja beim Laufen singen.« Sie gab ihrem Stock mit geübter Hand einen Schnick, und er klappte sich ordentlich zusammen. Den Stock unter den linken Arm geklemmt, schlang sie ihre rechte Hand um meinen Bizeps, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Langsam spazierten wir im Schneetreiben durch die stillen Straßen, während die Nässe in unsere Schuhe drang. Gewöhnlich fiel es mir nicht schwer, mit anderen zu plaudern, aber dieses Mal war ich komplett sprachlos.
Amelie schien das nichts auszumachen, und sie fing auch kein Gespräch an. Arm in Arm schlenderten wir durch die Dunkelheit, wie ein Liebespärchen aus einem alten Film. Heutzutage gehen Männer und Frauen nicht mehr Arm in Arm. Ausgenommen Väter, die ihre Töchter zum Altar führen, oder Pfadfinder, die einer alten Dame über die Straße helfen. Mir gefiel es jedoch. Ich kam mir vor wie ein Gentleman aus einer längst vergangenen Ära, in der ein Mann eine Frau noch nach Hause begleitete, und zwar nicht, weil sie allein aufgeschmissen gewesen wäre, sondern weil der Mann die Frau respektierte und eine Frau beschützt und umsorgt werden sollte.
»Vor langer Zeit war die Welt mal schöner.« Die Worte purzelten mir einfach so aus dem Mund. Dabei hatte ich gar nicht laut denken wollen.
»Was meinst du damit?« Sie schien erfreut über meine Bemerkung. Daher setzte ich zu einer Erklärung an.
»Also, wenn du dir alte Gemälde anschaust …« Ich verstummte peinlich berührt, denn mir wurde plötzlich klar, dass sie sich gar keine alten Gemälde anschauen konnte.
Sie rettete mich jedoch galant. »Wenn ich mir alte Gemälde anschauen könnte, was würde ich dann sehen?«
»Sie hatten weniger. Aber auch mehr. Mir kommt es so vor, als hätten die Leute damals mehr Wert auf ihren Besitz und ihr Aussehen gelegt. Die Frauen machten sich schick, und die Männer hatten Anzüge an. Die Menschen trugen Hüte und Handschuhe und wirkten elegant. Sie redeten anders miteinander, irgendwie achtsamer, kultivierter. Dieselbe Sprache und trotzdem total anders. Auch die Häuser und die Möbel waren schön – gute Handwerksarbeit mit viel Liebe zum Detail. Ich weiß nicht … Die Welt hatte einfach mehr Stil und Klasse. Vielleicht ist es das.«
»Ah, die gute alte Zeit, als die Männer noch nicht für ihren Lebensunterhalt Kämpfe ausfochten und Frauen nicht an Stangen tanzten«, sagte sie mit einem Lächeln in der Stimme.
»Männer haben schon immer gekämpft und Frauen schon immer getanzt. Wir sind total altmodisch«, gab ich zurück. »Wir sind zeitlos.«
»Nett gerettet«, kicherte sie, und ich lachte leise.
Wir gingen ein paar Minuten in einvernehmlichem Schweigen weiter, bis mir einfiel, dass ich keine Ahnung hatte, in welche Straße wir überhaupt mussten.
»Wo wohnst du?«
»Keine Sorge, Großer. Ich weiß, wo wir sind. An der nächsten Ecke müssen wir nach rechts. Dann sind es noch dreißig Schritte bis zu meinem alten Haus.«
»Du lebst in einer der alten Villen?«
»Ja. Mein Ururgroßvater hat sie erbaut, in einer Zeit, als die Welt noch schöner war. Mein Haus ist vermutlich nicht mehr so schön wie früher in seiner Glanzzeit, aber in meinem Kopf sieht es wundervoll aus. Blinde-Mädchen-Bonus.«
»Dreißig Schritte? Zählst du etwa die Schritte?« Ich hörte die Verwunderung in meiner Stimme und fragte mich, ob ihr das auch aufgefallen war.
»Meistens schon. Wenn ich jedoch begleitet werde, bin ich nicht so aufmerksam. Ich weiß, wo der Gehsteig endet, wo die Bäume stehen und kenne auch die Schlaglöcher.«
»Das ist erstaunlich.«
»Na ja, ich bin hier aufgewachsen und konnte früher sehen. In meinem Kopf kann ich das immer noch. Es wäre schwieriger, wenn ich an einem mir unbekannten Ort noch mal neu anfangen müsste.«
»Was ist passiert?«
»Eine seltene Krankheit mit einem komplizierten Namen, den du vermutlich vergessen würdest, noch ehe ich ihn ganz ausgesprochen habe. Wir haben nicht gemerkt, was passiert, bis es zu spät war. Und selbst wenn wir es früher bemerkt hätten, hätte man wohl nichts dagegen machen können.«
»Wie alt warst du?«
»Elf.«
Ich schluckte schwer. Auch mein Leben hatte sich mit elf verändert. Aber auf völlig andere Weise. Bevor ich meine Sprache wiedergefunden hatte, blieb Amelie stehen.
»Da sind wir. Das ist mein Haus.« Sie ließ ihren Stock wieder aufklappen und streckte ihn vor sich aus, während sie sich einem kleinen Schmiedeeisenzaun zuwandte. Als ihr Stock dagegen schlug, blieb sie stehen und ließ meinen Arm los, um nach dem Riegel zu tasten und ihn zu öffnen. Das Haus war alt, um die Jahrhundertwende erbaut, wenn nicht gar älter, und immer noch imposant, obwohl der Schnee und die Dunkelheit den Hof und die große Veranda bedeckten, die zweifellos schon bessere Tage gesehen hatte. Licht fiel aus den oberen Fenstern; der Weg und die Treppe waren schneefrei. Amelie schien kein Problem damit zu haben, allein weiterzugehen, daher blieb ich am Tor stehen, um zu warten, bis sie sicher im Haus verschwunden war. Auf halbem Weg drehte sie sich noch mal zu mir um.
»David?« Sie erhob leicht die Stimme, als sei sie sich nicht sicher, ob ich noch da war.
»Ja?«
»Danke fürs Nachhausebringen.«
»Gern geschehen.«
Ich wartete, bis sich die Haustür hinter ihr schloss, ehe ich zurückging. Es hatte aufgehört zu schneien. Die Nacht war so ruhig, dass ich ein Lied sang, um die Stille zu vertreiben. Hin und wieder schloss ich die Augen, zählte meine Schritte und fragte mich, wie es wohl wäre, überhaupt nichts sehen zu können, und wunderte mich, wie ein blindes Mädchen als Tänzerin in meiner Bar gelandet war.
(Ende der Kassette)
Moses
Millie griff nach dem Kassettenrekorder und glitt mit den Fingern über die Tasten, bis sie die richtige erreichte. Sie drückte drauf, und Taggs Stimme verstummte. Sie umklammerte den Rekorder so fest, als wolle sie sich an der Erinnerung festhalten. Das Zimmer war erfüllt von einer hoffnungsvollen, erwartungsfreudigen Atmosphäre. Sie hatte in Taggs Stimme durchgeschimmert, in der Ausführlichkeit, mit der er seine Erinnerungen schilderte. Ich spürte förmlich seine Verwunderung auf dem Rückweg von Millies Haus. Er hatte mich in den Bann gezogen, und ich hatte einen Augenblick lang vergessen, wo ich war. Nun aber stieg Verlegenheit in mir auf, und ich kam mir vor wie ein Spanner. Am liebsten hätte ich mir die Ohren zugehalten.
»Ich hab ständig an ihn denken müssen, und dieser Blake-Shelton-Song ging mir nicht mehr aus dem Kopf«, sagte Millie leise. »Er war nett. Und stark. Ich konnte seine Kraft spüren, als er neben mir herging. In dieser Nacht habe ich tatsächlich davon geträumt, wie sich sein Arm in meiner Hand angefühlt hat. Nach dem Verlust meiner Sehkraft hab ich anfangs immer noch in Bildern geträumt. Das war schön, weil ich das Gefühl hatte, ich könnte wieder sehen, wenn ich schlafen ging. Aber im Laufe der Zeit ähnelten meine Träume immer mehr meiner Realität. Manchmal träume ich immer noch in Bildern, aber viel öfter träume ich in Gerüchen und Gefühlen, in Geräuschen und Empfindungen.«
Millies Stimme klang so leise, als spräche sie mit sich selbst, als hätte sie vergessen, dass ich noch da war. Ich überlegte, ob ich mich bemerkbar machen sollte, ehe ihr noch etwas allzu Vertrauliches herausrutschte, aber sie wechselte unvermittelt das Thema.
»Ich hatte ein paar Blind Dates.« Sie lächelte in meine Richtung und ließ mich wissen, dass sie meine Anwesenheit nicht vergessen hatte, und ich lachte, was sie vermutlich mit ihrer Bemerkung bezweckt hatte.
»Blinde Blind Dates, meine ich. Ein paar Mal war ich mit blinden Männern aus meiner Bekanntschaft aus. Einer dieser Männer hatte darauf bestanden, sehgeschädigt genannt zu werden.« Amelie malte Anführungszeichen in die Luft. »Das kann ich nicht so recht begreifen. Da könnte man einen Weißen ja auch als melaningeschädigt bezeichnen. Die Menschen sind merkwürdig. Ich bin ein weißes, blindes Mädchen. Ein einundzwanzigjähriges, weißes, blindes Mädchen. Warum kann man die Dinge nicht so nennen, wie sie sind?«
Ich lachte erneut und fragte mich, worauf sie hinauswollte, aber ich ließ sie gern reden. Kurz überlegte ich, ob sie wusste, dass ich schwarz war. Es war ein ziemlich gutes Gefühl, zu wissen, dass meine Hautfarbe ausnahmsweise mal keine Rolle spielte.
»Ich bin auch mit Männern ausgegangen, die sehen konnten – du weißt schon, die sehungeschädigten.« Sie schmunzelte über das Etikett. »Nicht mit vielen. Aber einigen schon. Meine Cousine Robin macht die Verabredungen meist für mich aus. Und ich bin mir sicher, dass jeder Einzelne von ihnen nicht besonders attraktiv gewesen ist. Hässlich, seltsam, verwarzt und von anderen Frauen keines Blickes gewürdigt. Was okay ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Männer atemberaubend gut aussehen, und werde den Unterschied nie bemerken. Das Bild in meinem Kopf ist das einzige, was zählt, oder? Einmal hat mir Robin jedoch ein Date mit einem gehörlosen Mann ausmachen wollen, da hab ich mich geweigert. Nicht wegen seiner Gehörlosigkeit. Aber wie hätte ein Gespräch zwischen uns denn möglich sein sollen? Robin scheint manchmal zu glauben, dass ich aufgrund meiner Behinderung nur mit anderen körperlich eingeschränkten Menschen ausgehen kann. Weil mich natürlich sonst niemand haben will, stimmt’s?« Millies Stimme brach, und sie lächelte leicht. »Oh-oh. Das ist wohl mein wunder Punkt.«
»Dass dich niemand haben will, stimmt nicht«, sagte ich herausfordernd.
»Manchmal schon«, entgegnete sie leise. Ganz offensichtlich fragte sie sich, ob Tagg ihre Blindheit nicht länger hatte ertragen können.
»Insgeheim hab ich gehofft, dass David kein gut aussehender Kerl ist. Ich hab es gehofft, weil sein Aussehen für mich unerheblich war und er weniger attraktiv für andere Frauen gewesen wäre, wenn er nicht ganz so gut aussehen würde. Ich dachte mir, wenn er ein Durchschnittstyp wäre, dann würde er sich mit jemandem wie mir vielleicht eher einlassen.« Sie stieß langsam, fast traurig den Atem aus.