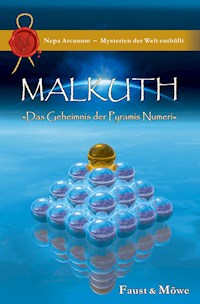
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: NEPA
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Malkuth« spielt im Jahr 569 v. Chr. und in unserer Zeit. Der namenlose Ich-Erzähler führt zunächst ein gänzlich unspektakuläres Leben als Physiker und forscht an den Grundlagen für Zeitreisen. Doch schon bald überschlagen sich die Ereignisse: Er gehört unvermittelt zu einer Geheimorganisation, die das Ziel verfolgt, die gesamte Menschheit auf bevorstehende Veränderungen vorzubereiten. Gemeinsam mit anderen »Auserwählten« gelangt unser Held auf die Insel »Babel«, deren Bewohner in einer idealen Gesellschaftsform leben.Etwaige Ähnlichkeiten mit Thomas Morus’ Insel »Utopia« sind durchaus gewollt. Hier besteht für den Protagonisten die Möglichkeit, seine Forschungen fortzusetzen. Ganz nebenbei erhält er Einblick in die ihm völlig fremde Welt der Geheimlehren und gewinnt die Liebe einer hinreißenden Frau. Dann reißt ihn ein Laborunfall weit in die Vergangenheit – und auf einmal bekommt auch die Uhr seines Großvaters, die sich niemals reparieren ließ, ihren Sinn. Nun wird unser Hauptakteur in Geheimnisse eingeweiht, die Bedeutung für sein übriges Leben und die weitere Existenz »Babels« haben werden. Aber was hat es mit der geheimnisvollen »Pyramis Numeri« auf sich, deren Zeichen immer wieder seinen Weg kreuzen? Nehmen Sie teil an einer fantastischen Reise durch die Zeit erleben Sie spannende Abenteuer hautnah mit und erfahren Sie Geheimnisse von wahrer Tragweite! Ein Buch, das Sie nur schwer aus der Hand legen können, bevor Sie das letzte Wort gelesen haben!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 663
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander Faust & Jonathan Möwe
Malkuth
Das Geheimnis der Pyramis Numeri
NEPA VERLAG
FRAUENSEE
2012
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.nepa-verlag.de
3. Auflage 2012 – erstmals vollständig überarbeitet
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
1. Digitale Auflage 2012 Digitale Veröffentlichung: Zeilenwert GmbH
© NEPA Verlag, Frauensee, 2010 Der Nepa Verlag ist ein Unternehmen der BigKahoona UG (haftungsbeschränkt), Sünna
Umschlagillustration: © artSILENSEcom - Fotolia.com Umschlaggestaltung: Alexander Heiderich
Lektorat und Satz: Lektorat Nowack, Rudolstadt
ISBN 978-3-9815242-2-2
Faust & Möwe
MALKUTH
Das Geheimnis der Pyramis Numeri
Roman
Über die Autoren:
Alexander Faust und Jonathan Möwe wurden beide in den späten 1970er Jahren im thüringischen Wartburgkreis geboren. Eine weitere Gemeinsamkeit ist ihre Liebe zur Literatur, die ihnen immer wieder Zuflucht und Informationsquelle zugleich war.
Auf der Suche nach Antworten auf ihre Fragen und der Ergründung des Sinnes hinter dem Handeln der Menschen fanden die beiden zueinander und es entstand eine tiefe Freundschaft – geprägt von gegenseitiger Anziehung und Respekt. So entstanden im Laufe der Zeit die Fundamente und die philosophischen Standpunkte, welche diesem Buch zugrunde liegen.
Inhaltsverzeichnis
I. Vergangenes
II. In den Karpaten
III. Freunde und Riten
IV. Die Insel
V. Liebe und Pferde
VI. Montezuma und die alte Welt
VII. Experimente
VII. Feuer und Fisch
IX. Ein Lehrer
X. Hasenjagd
XI. Alter Freund, neuer Feind
XII. Willkommen und Abschied
Das Geheimnis der Pyramis Numeri
»Ti sophotaton?«
»Chronos, anheuriskei gar panta.«
»Was ist am Weisesten?«
»Die Zeit, denn sie allein kennt die Wahrheit.«
I. Vergangenes
Nebel liegt über dem Tal. Der Ruf einer Lerche unterbricht die morgendliche Stille, um der erwachenden Natur die Ankunft des Tages zu verkünden. Dieser Frieden hier draußen, die reine Luft, das erquickende Plätschern des Baches, der sich an Bernards alter Blockhütte vorbeischlängelt, um sich im kristallklaren Wasser des Bergsees zu verlieren, sind ideale Umstände für mich, um die Geschichten meiner Reisen niederzuschreiben. Viel habe ich erlebt in den vergangenen Jahren. Ich habe Abenteuer und Prüfungen bestanden, von denen die meisten Menschen nicht einmal zu träumen wagen und die sicher sogar Zweifel an der Authentizität meiner Ausführungen aufkommen lassen. Sollte jemand eines Tages – in einer hoffentlich besseren Welt – diese Zeilen lesen, möge er sich entspannt zurücklehnen und den Inhalt dieses Buches vorbehaltlos genießen. Doch der Skeptiker unter den Lesern ist aufgefordert, den Wahrheitsgehalt meiner Worte zu prüfen, Fakten zu sammeln und zu vergleichen. Denn unter jedem Stein, den er aufheben wird, verbergen sich unzählige andere Steine, die den Weg zur Wahrheit weisen werden. Es gibt viele Erzählungen vieler Leute in vielen Sprachen. Die Welt ist voll von ihnen. Auch meine Geschichte wird sich in diesen Kreis einreihen und vielleicht irgendwann, irgendwo von irgendwem erzählt werden. Dies ist die Geschichte einer Vision, einer großen Aufgabe und von Menschen, die bereit waren, ihr Leben zu opfern, um die Menschheit in eine goldene Zukunft zu führen.
Der Anfang meiner Erzählung liegt im verschwommenen halbdunkel der Zeit. Jener Zeit, die unser ständiger Begleiter ist, ein Freund an Tagen der Freude, manchmal aber auch ein Raubtier, welches den Sand unserer Lebensuhr unaufhaltsam verschlingt. Dieses Raubtier nahm mir früh, im Alter von kaum drei Jahren, beide Elternteile durch einen tragischen Unfall. Vielleicht aber war es die Zeit, die mir geraubt wurde. Zeit, die ich nicht mehr hatte – nicht haben durfte. Da ich noch sehr jung war, habe ich nur noch vage und schemenhafte Erinnerungen an meine Mutter und meinen Vater. Mir fehlte einfach die Zeit, jene Menschen kennenzulernen, die am wichtigsten für mein Leben hätten sein sollen. So wuchs ich im Hause und in der Obhut meiner Großeltern auf, die stets versuchten, mir all das zu geben, was auch meine Eltern mir gegeben hätten – und manchmal sogar noch ein bisschen mehr.
Bereits als kleines Kind faszinierte mich das Zusammenspiel all der Dinge, die uns umgaben. Ich machte mir Gedanken über das Wetter, die Erde oder das Universum. Ich wollte schon immer herausbekommen, wie all das funktionierte, und fragte besonders meinen Großvater häufig die größten Löcher in seinen Bauch. Ich erinnere mich an Tage meiner Kindheit, da saßen mein Großvater und ich während so mancher Sommergewitter auf unserem überdachten Balkon, sahen uns die Blitze an und philosophierten über die Kräfte der Natur und des Universums, über Vergangenheit und Zukunft. Die größte Faszination ging für mich allerdings von etwas ganz anderem aus. – Es war die Zeit, die es mir angetan hatte. Irgendwo hatte ich einmal aufgeschnappt, dass ein Insasse eines Flugzeugs, das über den Atlantik fliegt, langsamer altert als sein Bruder, der am Boden geblieben ist. Zwar konnte mir damals niemand in meinem Umfeld dieses Phänomen erklären, ich hatte aber bereits ›Blut geleckt‹ und ich ersann mir einfach meine eigenen Erklärungen.
Wie oft stellte ich mir vor, eine Reise durch die Zeit unternehmen zu können. Ich träumte davon, wie ich mit Rittern zechte oder mit Indianern, Seite an Seite durch die unberührte Prärie ritt. Weitere Nahrung erhielten meine Träume durch die Ruine einer alten Raubritterburg in der Nähe meiner Heimatstadt – ein ideales Spielparadies für junge Helden wie mich. – Wie gerne hätte ich mich in der Zeit zurückversetzt, um das Treiben der damaligen Bewohner dieser Festung hautnah erleben zu können. Aber meine Fantasie wurde ebenso angeregt durch die Vorstellung, in die Zukunft zu reisen und mit einem Raumschiff fremde Welten zu entdecken. Und in diesen Fantasien gab es keine Grenzen. In meiner Welt war alles möglich!
Immer wieder starrte ich nachts zum Firmament in die unendlichen Weiten des Alls. Der Gedanke, dass zahlreiche der Sterne, die ich sah, eventuell seit vielen Jahren nicht mehr existierten, da deren Licht Jahre, Jahrzehnte oder noch länger benötigte, um zur Erde zu gelangen, ließ mich erschaudern. Jeder Blick zu den Sternen war ein Blick in die Vergangenheit. Mir wurde klar, dass jedes kostbare Gut, jede Pflanze, jeder Gedanke und alles, was uns umgab und umgibt, vergänglich ist. Doch damit wollte ich mich nie abfinden. In meinen Träumen waren Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ständig präsent und ich fühlte, dass es nur eines einzigen Schrittes bedurfte – wie den hinein in einen anderen Raum – um mich durch das Fluidum der Zeit bewegen zu können.
Meine Träume und Fantasien zogen sich durch meine gesamte Kindheit und Jugend. Die Jahre vergingen und ich wurde langsam erwachsen. Nachdem ich das Gymnasium mit dem Abitur verlassen hatte, begann ich am theoretisch-physikalischen Institut der Universität meiner Heimatstadt zu studieren. Noch immer von den Gedanken an Raum und Zeit beseelt, studierte ich Physik und Astronomie. Irgendwann wollte ich schließlich die Antworten auf meine Fragen finden. Und wenn mir diese niemand geben konnte, wollte ich wenigsten in der Lage sein, meine eigenen Behauptungen überprüfen zu können. Selbstbewusst und euphorisch, wie ich war, träumte ich schon vom Nobelpreis für eine, von mir aufgestellte, vereinte Feldtheorie. Doch nicht immer, so stellte sich heraus, war das Studium leicht für mich. Ich hatte anfangs in einigen Fächern erhebliche Schwierigkeiten, boxte mich aber stets irgendwie durch.
Während meiner Studienzeit teilte ich ab dem zweiten Semester mein Zimmer mit Niclas, dem Sohn eines Großindustriellen. Niclas’ Vater war Vorstandsmitglied zweier Raumfahrt- und Computerkonzerne und er, Niclas, sollte dereinst wohl einmal ein fantastisches Erbe antreten. Leider aber war Niclas aus einem ganz anderen Holz geschnitzt, als ich. Lernen war absolut nicht seine Berufung und Verantwortung war ein Fremdwort für ihn. – So dachte ich zumindest zum damaligen Zeitpunkt.
Wir hatten eine Menge Spaß miteinander. Unsere Studentenbude war sicher die Schlimmste von allen. Ordnung war weder Niclas’ noch meine Stärke; vielleicht einer der Gründe unserer gegenseitigen Sympathie. Des öfteren saßen Niclas, drei weitere Kommilitonen und ich in gemütlicher Runde beisammen, tauschten unsere Gedanken aus und sinnierten über die weltlichen und geistigen Aspekte des Lebens. Einer unserer Freunde beschäftigte sich intensiv mit dem Studium der Geschichte von verschiedensten Geheimlogen. Er eröffnete mir mit dem, was er mir erzählte, so manchen neuen Blickwinkel in der Betrachtungsweise politischer Ereignisse. Auch Niclas überraschte mich oft mit Wissen über Daten und Fakten von Verschwörungen und Geheiminstitutionen, welches ich ihm zunächst nicht zugetraut hatte. Durch diese Gespräche ging mir so manches Licht auf. – Doch es stand mir erst noch bevor, diese Mächte besser kennenzulernen.
Ich beendete mein Studium mit einer Diplomarbeit mit dem Titel »Vierdimensionale Modelle der Krümmung der Raumzeit innerhalb stabiler Wurmlöcher und dabei auftretender Paradoxa« und wurde für meine Anstrengungen mit der Auszeichnung »SUMMA CUM LAUDE« belohnt. Zwar wusste ich noch nicht, in welche Richtung mich mein Weg nach meiner Zeit als Student führen sollte, ich entschied jedoch, die Sache langsam angehen zu lassen.
Doch die überraschung war perfekt, als Niclas’ Vater Joshua mir während unserer Abschlussfeier völlig überraschend einen Praktikumsplatz am europäischen Kernforschungslabor CERN in Genf anbot. Dort wurde mir die Mitarbeit an einem der größten Teilchenbeschleuniger ermöglicht. Teilchenbeschleuniger sind die vielleicht wichtigste Voraussetzung für die experimentelle Elementarteilchenphysik. Viele Entdeckungen auf diesem Gebiet sind nur durch den Einsatz von Teilchenbeschleunigern möglich geworden. Mit großer Freude nahm ich das Angebot an, denn plötzlich hatte ich Möglichkeiten, von denen zuvor ich nie zu träumen gewagt hatte.
Nachdem ich die Chance eingeräumt bekam, drei volle Jahre in Genf zu bleiben und diese natürlich gleich beim Schopf packte, schaute ich mich doch bald nach Alternativen um, die es mir ermöglichen sollten, bis zu einem gewissen Maße auch meine eigenen Forschungen voranzutreiben. Mein großes Ziel – angetrieben durch meine Kindheitsträume – war es, nach Möglichkeiten zu suchen, ein stabiles Wurmloch zu erzeugen, um Reisen durch die Zeit zu ermöglichen. In der theoretischen Astrophysik definiert sich ein Wurmloch folgendermaßen: ›Wurmlöcher, auch Einstein-Rosen-Brücken genannt, sind Röhren in der Raumzeit, die weit entfernte Regionen des Universums miteinander verbinden.‹
Um dieses Phänomen für jedermann anschaulich zu beschreiben, bemühe ich mich um ein einfaches Beispiel: Nehmen wir also an, das Universum wäre zweidimensional, wie ein Blatt Papier. Wir denken uns einen Start- und einen Zielpunkt. Als Startpunkt wäre die Erde angemessen, als Ziel wählen wir den 4,5 Lichtjahre entfernten Stern Alpha Centauri. Mit unserer heutigen Technik ist es schier unmöglich, diese Entfernung zurückzulegen. Selbst das Licht, welches sich mit fast 300.000 Kilometern pro Sekunde bewegt, benötigt dafür 4,5 Jahre.
Auf unserem Blatt Papier befindet sich nun die Erde an der linken oberen Ecke und Alpha Centauri an der Ecke rechts unten. Aufgrund der Annahme, das Weltall sei durch den Einfluss großer Massen nicht geradlinig, sondern gekrümmt, könnten also zwei Punkte im Raum sehr nahe beieinanderliegen, obwohl uns die Entfernung bedeutend weiter erscheint. Wir könnten beispielsweise unser Blatt Papier so krümmen, dass sich die beiden Ecken sehr nahe kommen. Eine Ameise, welche sich darauf bewegt, müsste allerdings trotzdem die volle Entfernung über das Blatt beschreiten, um von einem Punkt zum anderen zu kommen.
Ein Wurmloch würde theoretisch einen Tunnel durch den Raum zwischen Start- und Zielpunkt bilden. So könnte man eine Entfernung, welche optisch 4,5 Lichtjahre beträgt, durch eine 5 Millimeter lange Röhre zurücklegen. Den Raum, durch welchen unsere Röhre verliefe, bezeichnet man übrigens als Hyperraum.
Wenn es also gelänge, ein Wurmloch künstlich zu erzeugen, könnte man interstellare Reisen viel schneller als mit Lichtgeschwindigkeit bewältigen. Nun gibt es einen Effekt, der als Zeitdilatation bekannt ist. Dieser Begriff sagt aus, dass die Zeit an Bord eines sich sehr schnell bewegenden Raumschiffs gedehnt wird. Die Dilatation sorgt dafür, dass die Zeit für den Insassen dieses Gefährts langsamer voranschreitet, als für den Beobachter auf der Erde.
Selbstverständlich vergeht die Zeit für den Raumschiffinsassen Stunde um Stunde, wie er das immer gekannt hat; ebenso wie für den Beobachter auf der Erde. Würde aber das Raumschiff, welches sich mit drei Vierteln der Lichtgeschwindigkeit bewegt, nach einer Reise von etwa 20 an Bord gemessenen Jahren zurückkehren, könnten auf der Erde 30.000 Jahre vergangen sein. Unser Raumschiff hätte sich also ungewollt in eine Zeitmaschine verwandelt.
Nach dieser klassischen Theorie könnte man aber in der Zeit nicht zurückreisen. – Ein Wurmloch würde sich meines Wissens dagegen womöglich völlig anders verhalten.
Wenn ich eine Entfernung von 4,5 Lichtjahren im Tausendstel einer Sekunde überwinden könnte, wäre ich viel früher am gewünschten Zielort, als es durch den normalen Raum möglich wäre. Da dies einer Reise mit überlichtgeschwindigkeit entspräche, würde die Zeit nicht gedehnt, sondern gestaucht werden. Könnte ich nun durch die öffnung dieses Wurmlochs von der Erde zu Alpha Centauri reisen und physisch nur wenige Zentimeter dabei zurücklegen, tatsächlich aber mehrere Lichtjahre, würde ich mit einem Schritt in die Vergangenheit gelangen.
Mein Ziel sollte nun sein, ein künstliches Wurmloch zu erzeugen, bei dem sich eine öffnung mit einer sehr hohen Geschwindigkeit von der anderen wegbewegt, dessen Röhre allerdings eine konstante Länge von einem Meter aufweist. Wäre die erste öffnung in meinem Labor, so müsste sich die andere irgendwo in der Vergangenheit befinden. Könnte ich nun die zweite öffnung direkt neben der Ersten platzieren, so könnte ich in die Vergangenheit reisen, ohne wirklich den Ort der Abreise zu verlassen. Das funktioniert natürlich nur unter der Voraussetzung, dass sich der Weg – und nicht Start und Ziel – stetig mit Fastlichtgeschwindigkeit verlängert.
Davon träumte ich schon zu Zeiten meines Studiums gemeinsam mit Niclas, wenn wir abends in unserem Zimmer lagen. Ich offerierte ihm meine Ideen zur technischen Umsetzung und er malte sich aus, wie wir in die Vergangenheit reisen würden, um geschichtliche Fehler zu korrigieren. Zuerst analysierten wir immer die Fehler der heutigen Systeme und versuchten, die Erkenntnisse mit auf unsere Zeitreise zu nehmen. In der Vergangenheit angekommen wollten wir dann den Grundstein zu einer neuen besseren Gesellschaft legen. Es waren fantastische Träumereien fernab der Realität. Und doch oder gerade deswegen hatten wir immer wieder das starke Gefühl in uns, dass unser Plan funktionieren könnte. Wir spannen unsere Ideen immer weiter, experimentierten gedanklich mit neuen Energiequellen und erfanden neue Arbeits- und Organisationsmöglichkeiten. Wir waren uns einig, dass mit Kapitalismus und Machtbündelung unsere Traumwelt unmöglich zu realisieren war. Zeitweise muss sich dieser Debattierklub angehört haben, wie eine kommunistische Verschwörung oder eine islamistische Terrorgruppe. Wir hielten uns nicht an die Grenzen herkömmlicher Weltanschauungen. Im Gegenteil, wir mixten sie so lange, bis wir glaubten, die optimale Mischung gefunden zu haben.
Mein Aufenthalt in Genf neigte sich fast seinem Ende zu, als mich die Nachricht vom plötzlichen Tod meiner Großmutter ereilte. Das bedeutete einen sehr schweren Verlust für mich.
Ich reiste daraufhin sofort nach Deutschland, um Vorbereitungen für die Beisetzung und die Trauerfeier zu treffen und um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Alles, was mir von ihr blieb, war dieses nunmehr leere Haus und die Erinnerungen an die Liebe und Fürsorge, die sie mir stets entgegengebracht hatte.
Ich organisierte eine schöne, aber leider kleine Trauerfeier. Ich hatte keine Verwandten und Angehörigen mehr und so waren nur die wenigen noch lebenden Freunde meiner Großmutter anwesend. Die Pastorin hielt eine ergreifende Trauerrede. Sie würdigte darin die Kraft, welche meine Großmutter nach dem Verlust ihrer Tochter und später ihres Mannes aufbrachte. Sie hob die Liebe hervor, mit der meine Großmutter mich aufzog und ihre aufopferungsvolle Arbeit in der Kirchengemeinde.
Meine Großmutter hinterließ mir nicht viel. Außer dem Haus, in dem ich meine Kindheit verbracht hatte, hinterließ sie mir nur eine alte Taschenuhr meines bereits Jahre vorher verstorbenen Großvaters. Die hatte er im Ersten Weltkrieg von einem sterbenden Kameraden geschenkt bekommen.
Erst als ich noch einmal – nun zum allerletzten Mal – das Haus meiner Großeltern betrat, bevor es mich wieder in die Schweiz zog, bemerkte ich, dass mit meiner Großmutter auch ein großer Teil meines bisherigen Lebens von mir gegangen war.
Ich muss einige Stunden in dem großen, dunkelgrünen Ohrensessel meines Großvaters gesessen haben – seine alte Taschenuhr hielt ich in der Hand. Ich dachte sehr viel nach über meine Vergangenheit, mein Schicksal, über das, was aus mir geworden war und ich dachte an diese goldene Uhr und ihre Geschichte, wie sie mir Großmutter oft erzählt hatte, als ich schon etwas älter war:
Als mein Großvater noch ein junger Mann war, überzog gerade das Gewitter des Ersten Weltkriegs das Antlitz Europas. Und auch er wurde, wie Millionen anderer Männer auch, zum Dienst an die Front geschickt. Doch anders als bei so vielen anderen ließ ihn das Ungeheuer mit einem blauen Auge davonkommen. Ein blaues Auge bedeutete in seinem Fall eine zerschossene Lunge und ein Minensplitter in der Hüfte. Es hat lange gedauert, bis ich den Gehfehler meines Großvaters als Fehler in seiner Gesamtheit wahrnahm und verstand. Bis dahin war das Hinken so typisch für ihn, wie der Geruch der Wohnung meiner Großeltern typisch für diese Wohnung war. Ein anderes optisches Merkmal an ihm war die alte, goldene Taschenuhr, die für ihre Größe unverhältnismäßig schwer war und über die er eine bewegende Geschichte zu erzählen hatte:
Im Oktober 1915 war mein Großvater als Soldat in Frankreich stationiert und erlebte in seinem siebzehnten Lebensjahr das Grauen des ersten technischen Krieges. An seiner Seite diente seit den ersten Tagen in Frankreich auch ein Inder, mit dem zusammen er zahllose Gefahren und Abenteuer erlebt und überlebt hatte. So zeigte sich zwischen ihnen sehr bald das Phänomen der Kameradschaft, wohl eine der intensivsten emotionalen Beziehungen, derer ein Mensch fähig ist.
Es wurden also auch persönliche Informationen getauscht, es wurde gegenseitig von zu Hause erzählt, miteinander geträumt und gebetet. Dieser Inder hieß Yaahngwi Ralfalgur, war kaum älter als mein Großvater, aber im Gegensatz zu diesem bereits Familienvater; gesegnet mit einer Frau und zwei Kindern. Mein Großvater jedoch war als lediger Student zum Militärdienst eingezogen worden. Er hatte bis auf einige delikate Liebschaften mit den sogenannten ›Truppenbetreuerinnen‹ mit der Familienplanung zu dieser Zeit noch nichts am Hut. Diese Unterschiede taten der Freundschaft aber keinen Abbruch – ganz im Gegenteil! Die Gespräche schienen so erst die richtige Mischung zu erhalten und jeder erfuhr Neues vom anderen, wenn dieser von zu Hause erzählte.
Aber auch wenn man sich natürlich im alltäglichen Leben durchaus zu verständigen wusste, zeigte sich bei ernsthafteren und ausführlichen Gesprächen immer wieder, dass die Sprachbarriere ein Problem war. So erzählte Yaahngwi eines Tages, dass er einen Talisman in Form einer goldenen Uhr bei sich trug, den er stets in seiner linken Brusttasche verwahrte. Und immer, wenn er ihn berührte, schien er mystische Beschwörungsformeln zu murmeln. Er hatte die Uhr von seinem Vater geerbt, das glaubte jedenfalls mein Großvater verstanden zu haben, wenn er sich dabei auch nicht sicher war.
Irgendwann begann für sie der letzte Kriegstag. Ihre Einheit wurde auf einen Berg verlegt und ihr kleiner Zug machte sich auf den Weg. Erst war die Straße breit und gut befestigt. Man befand sich im Hinterland und es erinnerte eher an einen Wanderausflug, als an Krieg und Töten. Wenn da nur nicht das Gepäck und das unüberhörbare Gewummer der Front gewesen wären. über allem lag wie eine greifbare und feste Materie der Geruch des Schlachtfeldes, bestehend aus verbranntem Fleisch, öl und Fäulnis. Je näher sich der Zug dem Schlachtfeld näherte, umso intensiver wurde dieser Geruch. Doch nach den ersten zehn Kilometern war auch das schon fast normal.
Bis zum Fuße des Berges war der Weg übersichtlich und man marschierte in Kolonnen zu je 50 Mann. Doch nun begann sich ein schmaler, zertretener Pfad den Berg heraufzuwinden. Man veränderte die Marschformation, was meinen Großvater und seinen Freund in die Vorhut spülte, und alle begannen daraufhin den Aufstieg. Irgendwo auf halber Strecke erreichten sie ein kleines Gehöft, das völlig zerstört war.
Es war alles ruhig und niemand schien dort zu sein. Langsam tasteten sie sich voran, spähten um Ecken und fanden – nichts. Ein Einweiser für nachfolgende Truppen wurde zurückgelassen und der weitere Aufstieg begann. Der Weg verengte sich noch mehr und führte nun durch eine enge, glitschige Felsschlucht dem Gipfel entgegen. Das strengte an. Mit 40 Kilo Marschgepäck auf dem Rücken, dem Helm auf dem verschwitzten Kopf und diesem unsäglich schweren Gewehr in der Hand, das einige vor Erschöpfung schon am Riemen über der Schulter trugen, ging es weiter und weiter. Und es ist nur allzu verständlich, dass die Wachsamkeit und die Vorsicht – genauso wie die körperliche Verfassung – unter der Anstrengung des Marsches immer weiter litt. So fluchten viele ungehalten vor sich hin und waren eher mit ihren körperlichen Gebrechen als mit den Gefahren des Krieges beschäftigt. Einzig die Hoffnung blieb, schon bald das Ziel zu erreichen.
Doch auf einmal tat sich die Hölle auf. Die Welt schien zu zerbersten, als ein Soldat durch einen unbedachten Schritt einen versteckten Trittzünder eines eingegrabenen Minennetzes auslöste. Innerhalb weniger Sekunden krepierten 15 Minen und töteten 28 von 31 Männern der Vorhut. Nur Großvater, Yaahngwi und ein weiterer MG-Schütze lebten noch. Sie waren alle sehr schwer verletzt und lagen in einer riesigen Blutlache, umgeben von zerfetztem und dampfendem Menschenfleisch, das sogar die Felswände bedeckte. – Es muss ein grauenhafter Anblick gewesen sein.
Yaahngwi war so stark getroffen, dass er bereits zu spüren schien, wie ihn das Leben verließ. Er fingerte schwach an seinem Glücksbringer herum, sagte etwas Unverständliches auf Hindi und starb in den Armen meines verletzten Großvaters.
Seit diesem Tage besaß Großvater die Uhr. Im Lazarett versuchte zwar ein Sanitäter, sie zu stehlen, doch irgendetwas schien ihn zu bewegen, sie wieder zurückzubringen. Jedenfalls lag sie am Tag nach der Operation wieder im Nachttisch meines Großvaters und er ließ sie seit diesem Tage nicht mehr aus den Augen.
Sie waren ein komisches Paar, der hinkende Invalide und die kaputte Uhr. Denn an jenem Tage, als mein Großvater sein blaues Auge verpasst bekam, wurde auch die Uhr beschädigt. Zumindest nahm er dies an. Trotz aller Bemühungen, dieses für ihn kostbare Stück Technik wieder zum Laufen zu bringen, gelang ihm das nicht. Kein Uhrmacher hatte jemals ein ähnliches Modell in den Händen gehalten.
Solcherart Gedanken ließen mich noch einige Zeit verweilen. Dann stand ich auf, sah mich ein letztes Mal im Haus um, atmete ein letztes Mal den altvertrauten Geruch ein, der wie ein unsichtbarer Schleier alles in diesem Gebäude bedeckte, und ging. Ich wusste nicht, ob ich jemals wieder an diesen Ort zurückkehren würde, ob ich jemals wieder das vertraute Quietschen der knorrigen, alten Eingangstüre hören würde, die gerade hinter mir ins Schloss gefallen war, oder das Knarren der alten Dielen, wenn jemand über den Flur lief. Ich wusste, dass mir nie wieder der Duft des frischen Zuckerkuchens, den meine Großmutter oft extra für mich gebacken hatte, in die Nase steigen würde. Nie mehr würde ich das vertraute Klackern von Großmutters Stricknadeln vernehmen. – Und vielleicht könnte ich niemals mehr eine solche Geborgenheit fühlen, wie sie mir in diesem Haus zuteilwurde.
II. In den Karpaten
Zu jener Zeit hatte ich das untrügliche Gefühl, als stehe eine gewaltige Veränderung in meinem Leben bevor. In diesen Tagen – ich war ge-rade wieder in Genf angekommen – bekam ich überraschend einen Anruf von Niclas’ Vater Joshua. Dieser erkundigte sich sehr ausführlich über meinen derzeitigen Wissensstand und meine weiteren Pläne. Es interessierte ihn auch besonders, ob ich noch immer an dem Gedanken festhalten würde, ein Wurmloch zu erzeugen, um dieses als Portal durch die Zeit zu nutzen, oder ob ich derart fantastische überlegungen längst verworfen hätte. Er zeigte sich hoch erfreut, als er von mir hörte, dass ich mich bereits nach Möglichkeiten umsah, meine eigenen Forschungen voranzutreiben. Er versprach, dass er mich bald in Genf besuchen würde, um mir ein Angebot zu unterbreiten, das vielleicht meinen Vorstellungen entspräche.
Die Wochen vergingen und ich stürzte mich wieder in meine Arbeit. Doch immer wieder zog ich mich zurück, nahm die Uhr meines Großvaters zur Hand und gedachte der alten Zeiten. Diese Uhr war alles, was mir geblieben war. Zwar war es meinem Großvater nie gelungen, sie wieder zum Ticken zu bringen, dennoch konnte dieser kleine Makel niemals den Wert der Uhr für mich herabsetzten. So war es nur logisch, dass ich sie immer nah an meinem Herzen trug. Viele Stunden verbrachte ich mit aussichtslosen Versuchen, sie wieder zum Laufen zu bringen, oder wenigstens die Inschriften und merkwürdigen Gravuren zu entziffern, um so vielleicht etwas über den Hersteller oder die Funktion zu erfahren. Doch die Inschriften waren dermaßen verziert oder sonst wie verschnörkelt, dass keine Buchstaben oder andere bekannten Zeichen erkennbar waren. Hin und wieder redete ich mir auch ein, dass ich diese Uhr, selbst wenn sie funktionieren würde, niemals ablesen könnte, da nicht einmal ein herkömmliches Ziffernblatt vorhanden war.
Also begnügte ich mich mit ihrer Funktion als Glücksbringer. Wenn ich mich auch immer wieder in manch ruhiger Stunde damit beschäftigte, der Uhr ihr Geheimnis zu entlocken. Natürlich ist es nicht einfach, jemand anderem solche Umstände schnell und einfach zu erklären. Und so musste ich manch spottende Bemerkung meiner Kollegen über mich ergehen lassen, was mich jedoch nur noch mehr mit meiner Uhr verband.
Meinem Großvater ging es damals ähnlich, jedoch wurde das Gespött durch seine eigene Versehrtheit ganz besonders gewürzt. Was wiederum meine Großmutter nicht hinderte, sich in meinen Großvater zu verlieben. Nicht zuletzt wegen der Uhr und des Verhältnisses, das mein Großvater im Umgang mit eben jener pflegte.
Für mich war das mehr als nur verständlich. Ja, es war nach meiner Ansicht sogar zwingend, sich Erinnerungen zu bewahren. Auch ich hatte den Spleen, manch alte und rostige Sache aufzuheben. Nicht der Funktion oder des Aussehens wegen; vielmehr gedachte ich durch sie der Umstände, in denen ich sie erwarb, oder an Personen, mit denen ich etwas gemein hatte. Nicht zuletzt eine riesige Pinnwand in meinem Flur erinnerte mich tagtäglich an die wichtigsten Abenteuer und Erlebnisse. Sie war gespickt mit Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Fotos, Autogrammen und Eintrittskarten. Doch das Wichtigste in dieser Sammlung war eben jene Uhr, die mein Großvater so lange bei sich trug. Und auch mir sollte sie oft der einzige Begleiter sein. So waren mein Großvater und ich uns immer sehr ähnlich, auch wenn es bei mir länger dauerte, bis die Uhr ihre volle Wirkung entfaltete. Denn eines Tages hatte meine Großmutter mir in einer ruhigen Minute anvertraut, dass sie die unverbrüchliche Treue zu einem defekten, wenn auch schönen Gerät ganz besonders berührt hatte; zeigte es doch, auf welche Werte mein Großvater achtete. Irgendwann hatte er sie auch überzeugt, dass diese Uhr magisch war und über besondere Kräfte verfügte. Sie erzählte mir, dass es Tage gab, an denen die Uhr zu leben schien. Sie wurde auf einmal warm und fing sogar manchmal an, zu vibrieren. Immer wieder versuchten sie zwar, den Mechanismus zu verstehen oder doch wenigstens den Auslöser für die Aktivität der Uhr zu finden. Doch war es so unregelmäßig, dass es nur eine mögliche Erklärung für meine Großeltern gab: Es war Magie.
Einer meiner Kollegen spottete des öfteren über mich, wenn ich mal wieder gedankenversunken meine Uhr in der Hand hielt. Dieser Kollege nun offenbarte mir eines Tages eine Möglichkeit, meinen Glücksbringer vielleicht doch wieder zum Laufen zu bringen. Isidore, so war der Name dieses Spötters, erzählte mir, dass es in seiner rumänischen Heimat ein Kloster gäbe, das in dem Ruf stand, sämtliche Uhrmechanismen zu beherrschen. Angetrieben von der Hoffnung auf die Instandsetzung meines geliebten Kleinodes nahm ich mir einige Tage frei und trat die Reise in die Karpaten an.
Mein Weg führte zuerst über den Schienenweg und ich genoss das sorglose Fahren im Zug, das monotone Rattern der Waggons, während draußen die Welt wie im Kino an mir vorbeizog. Die Berge stiegen allmählich an und wurden immer höher und steiler; die großen Wälder wurden von immer spärlicherer Vegetation abgelöst und irgendwann war in der Ferne der erste schneebedeckte Gipfel erschienen. – Das war also Osteuropa vom Zug aus! Sonst war ich stets mit dem Pkw oder dem Flugzeug unterwegs. Es ist daher nur verständlich, dass die Eindrücke viel intensiver waren, als ich das gewohnt war. Die hohen Berge, die die Schluchten eng begrenzten, ließen mich ob ihrer sagenhaften Majestät erschaudern. Ihr bezaubernder Anblick erinnerte mich an Popstars auf einem Titelblatt, die versuchten, sich gegenseitig den besten Platz auf der Titelseite streitig zu machen. Doch je weiter es bergan ging und je näher ich dem Ende meiner Zugreise kam, desto mehr fielen die ersten Gipfel zurück und schienen nun die Manege den echten Stars überlassen zu wollen.
Irgendwann hatte der Zug seine Endstation erreicht und ich bereitete mich auf meine Weiterreise per Kutsche vor. Isidore hatte mir derart genaue Instruktionen mit auf den Weg gegeben, dass es mir ein Leichtes war, mich in diesem fremden Land zurechtzufinden.
Da mir der Abfahrtstermin noch ein wenig Zeit ließ, wollte ich mir noch ein wenig die steif gewordenen Beine vertreten und machte mich auf den Weg, den kleinen Ort zu erkunden. Der Ort war nur eine Ansammlung kleiner bis winziger Hütten, die sich an einen eng gewundenen Bergpfad schmiegten. Sie waren mit dicken Schichten von Schnee bedeckt und schienen mir schon Jahrhunderte alt zu sein. Nach ein paar Kurven fand ich ein Gasthaus und schickte mich an, dort einen Kaffee zu trinken und einen Happen zu essen.
Ich hatte gerade eben meine Bestellung aufgegeben, als ich meine Uhr in die Hand nahm und darüber sinnierte, wohin mich dieses kleine Stück Technik nun geführt hatte. Doch als ich ihren Deckel aufklappte, fing sie plötzlich an, sich zu regen. Sie schien zu vibrieren und sich zu erwärmen. Ich war völlig perplex und versuchte, den Auslöser dieser Aktivität zu finden. Sollte es möglich sein, dass der Grund meines Hierseins bereits ausreichte, um den Uhrmechanismus in Gang zu bringen? Ich verwarf diesen Gedanken sogleich wieder und gedachte Großmutters Berichten, wonach auch in ihrem und Großvaters Besitz solch unerklärliche Ereignisse vorkamen. Ich musste mir wohl eingestehen, dass manche Dinge mit dieser Uhr in Zusammenhang standen, die einfach nicht erklärbar waren. – Vielleicht war es wirklich Magie?
Nachdem ich etwas gegessen hatte, beschloss ich, es dabei zu belassen, denn die Zeit wurde knapp. Also hielt ich es für ein gutes Zeichen, dass meine Uhr in der Nähe der von mir gesuchten Werkstatt von allein wieder anfing, zu leben. So dachte ich seinerzeit und fühlte mich durch dieses Zeichen ganz wunderbar bestätigt.
Also lenkte ich meine Schritte zur Post, um meine Kutsche zu erreichen, in der Gewissheit, der Lösung des Rätsels sehr nahe gekommen zu sein. Auf einmal spürte ich eigenartigerweise beobachtende Blicke in meinem Rücken. Ich drehte mich um und sah vor der Wirtschaft einen Mann in einem hochgeschlossenen Mantel, der mir, so glaubte ich, freundlich zunickte. Leider war für ein Gespräch keine Zeit mehr, denn nicht weit vor mir stand die Kutsche zur Abfahrt bereit. Sogar mein Gepäck konnte ich schon auf dem Dach erkennen und der Kutscher winkte aufgeregt, mir signalisierend, dass es an der Zeit wäre, loszufahren. Kaum war ich eingestiegen, schnalzte der Kutscher und die Pferde zogen an. Die Kutsche fuhr denselben Weg durch den kleinen Ort, den ich gerade zu Fuß zurückgelegt hatte, und wir kamen noch einmal an der Wirtschaft vorbei. Davor stand noch immer der mysteriöse Mann, der beim Vorüberfahren leicht zu mir herübernickte und die Hand an den Hut nahm.
Die Uhr war noch immer warm. Diese Wärme verlor allerdings einiges an Intensität, als ich ihren Deckel wieder schloss. Dennoch wurde es jetzt fast unerträglich heiß an meiner Brust. Ob dies nun an der Uhr lag oder an dem geheimnisvollen Fremden, vermochte ich nicht zu deuten. Doch nun sollte ich ja bald am Ziel meiner Reise sein. Also ließ ich mich zufrieden in den Sitz sinken und schenkte meine weitere Beachtung der vorbeiziehenden Landschaft.
Nach einer zweistündigen Fahrt über verschneite und steile Wege hielt die Kutsche vor dem Kloster und ich konnte es kaum erwarten, endlich einem Uhrmacher von meinem Problem zu berichten. – Hier also würde Großvaters alte Uhr wieder in Ordnung gebracht werden und ich könnte endlich all ihre Geheimnisse verstehen. Kaum ausgestiegen sah ich mich um. Das Kloster, das komplett aus Holz erbaut war, umfasste ein Torhaus, einen Glockenturm, eine Kirche und ein mehrstöckiges Haus mit Zellen für die Mönche. Nachdem der Kutscher mein Gepäck unsanft vom Wagen geworfen hatte, begab ich mich zum Tor des Stiftes. Dort fragte mich der Pförtner in schlechtem Englisch nach meinem Begehr. Ich berichtete ihm vom Grund meiner Reise, worauf er mich einließ und zum Vorsteher führte. Dieser eröffnete mir aber, dass der Uhrmacher, der sich meiner Uhr und meiner Seele annehmen sollte, erst am folgenden Morgen das Kloster erreichen würde.
Bis dahin sollte ich mich ausruhen und mir ein wenig die Zeit vertreiben. Natürlich war ich etwas enttäuscht, doch würde ich diesen einen Tag auch noch überstehen. Ich besichtigte die Gebäude und das kleine Uhrenmuseum, in dem sich unzählige Uhren jeglicher Machart befanden. Doch unter all den verschiedenen Uhren fand ich keine Einzige, die der Meinigen auch nur im Ansatz ähnlich war oder auch nur ähnliche Inschriften, wie mein Glücksbringer trug. Doch davon ließ ich mich nicht entmutigen, war ich doch sicher, die Zeichen richtig gedeutet zu haben. Morgen würde der große Tag sein und so ging ich früh zu Bett, um dem nächsten Morgen ausreichend erfrischt zu begegnen.
Gegen acht Uhr erwachte ich, kleidete mich nach der Morgentoilette an und sprang beschwingt und voller Tatendrang die Treppen hinunter. Leider vergaß ich dabei, dass ich mich in einem Kloster befand. Dort wurde es nicht sehr gerne gesehen, wenn man sich laut und schnell durch Flure und Treppen bewegte. Nach der zweiten Treppe wurde ich durch das mahnende Gesicht eines Mönches abrupt gestoppt. Der sorgte anscheinend für Ruhe und Ordnung im Kloster und brachte mich mit mehr oder weniger freundlichen Worten und Gesten zur Räson. Also setzte ich ein würdiges Gesicht auf und ging gemessenen Schrittes weiter, innerlich jedoch vor Freude weiterbebend und hinter dem Rücken des geistlichen Ordnungshüters manche Grimasse schneidend.
Nach dem Frühstück, das ich gemeinsam mit den anderen Mönchen im großen Speisesaal einnahm, begab ich mich umgehend zum Klostervorsteher. Er empfing mich freundlich und mit einem leichten Grinsen auf dem Gesicht. Hatte mein morgendlicher Frühsport in dem sonst so stillen Kloster also doch für Aufruhr gesorgt und mich wohl zum Top-Thema des Tages gemacht.
Der Vorsteher eröffnete mir, dass der Spezialist bereits anwesend sei, und brachte mich persönlich in dessen Werkstatt. Doch welche überraschung erwartete mich hier, als ich den mysteriösen Mann, dem ich gestern zweimal vor dem Gasthaus gesehen hatte, in der Werkstatt entdeckte. Auch wenn es mich nach der gestrigen Geschichte nicht wirklich überraschte, passte es doch gut zu meiner Deutung der Zeichen. Trotzdem war mir nicht wohl zumute.
Nachdem wir miteinander bekannt gemacht wurden, verließ uns der Vorsteher und ich war mit Robert – so nannte sich der Mann – und der Uhr alleine. Er ließ sich von mir die Geschichte der Uhr erzählen. Und während ich erzählte, glaubte ich, mehrmals eine besondere Anspannung bei ihm bemerkt zu haben, wenn ich von ihren Besonderheiten berichtete. Bald hatte ich ihm alles mitgeteilt, was ich von der Uhr wusste. Und so fragte ich Robert, ob er sich auf das Ganze einen Reim machen und sie wieder reparieren könne.
Er schien nicht gleich zu wissen, was er mir darauf antworten sollte, stand auf und krämerte in einer Werkzeugkiste herum. Er brummelte irgendetwas vor sich hin, spannte die Uhr in eine Halterung ein, knipste einen Strahler an und begann mit seiner Untersuchung. Ich unterdrückte meine Nervosität und blieb still, damit ich ihn nicht störte.
Er holte immer mehr Werkzeuge aus einem großen, alten und massiven Schrank, doch hatte ich den Eindruck, dass keines passte. Nach gefühlten Stunden schweigsamen Probierens erhob Robert die Stimme und erläuterte mir, dass er sich außerstande sähe, das kostbare Stück instand zu setzen. Er habe noch nie von solch einer Uhr gehört und die Konstruktion sei für ihn ein Buch mit sieben Siegeln. Er hätte zwar noch die Möglichkeit, sie gewaltsam zu öffnen und sie vielleicht dann zu verstehen, doch gäbe es dafür keine Garantie. Außerdem wäre das Gehäuse dann beschädigt und es sei nicht sicher, dass er es wieder reparieren oder neu anfertigen könne. Diese Nachricht hatte ich so gar nicht erwartet und ich bat ihn, mich kurz zu entschuldigen, um das weitere Vorgehen zu überdenken. Er nickte und tat sein Bedauern kund, dass er mir keine bessere Nachricht überbringen könne. Ich ging hinaus. – Sollte ich also wieder einmal gescheitert sein? Musste ich mich so kurz vor dem nahe geglaubten Ziel vor unüberwindbaren Mauern stehend geschlagen geben? – Dahin war die überschwängliche Stimmung vom Morgen, dahin der Optimismus und die Kleine-Jungen-Freude, die doch so stark war, dass sie sich – selbst von dem die Ruhe liebenden und mit Nachdruck schützenden Mönch – nicht hatte dämpfen lassen. Das alles schien mir mittlerweile so weit weg, als würden inzwischen Wochen vergangen sein. – Aber hatte ich es nicht doch vorher insgeheim gewusst und wollte es mir bloß nicht eingestehen? Ich versuchte zwar, mir das einzureden, musste dann aber doch einsehen, dass ich von meinem sonstigen Skeptizismus nichts behalten hatte. – Nicht zuletzt wegen der Zeichen am Wegesrand, die ein Scheitern meines Vorhabens für mich undenkbar gemacht hatten.
Doch all das Jammern nützte nichts. Ich musste mich entscheiden und die wenigen verbliebenen Möglichkeiten akzeptieren. Sollte ich das Risiko eingehen und in Kauf nehmen, dass mein Talisman nach der gewaltsamen öffnung nur noch ein Haufen Einzelteile sein könnte? Was, wenn sie von einer völlig anderen Machart wäre, als alle hier bekannten Uhren? – Doch was war eigentlich mit der Inschrift? Robert hatte sich hierzu noch nicht eindeutig geäußert.
Ich ging zurück in die Werkstatt, wo dieser – inzwischen Tee trinkend und sinnierend – vor der Uhr saß. Als ich eintrat, schaute er kurz auf, wies mit der Hand auf eine dampfende Teekanne in der Ecke und den Hocker an seiner Seite. Ich schenkte mir also etwas ein und setzte mich neben ihn auf den Hocker. Der Tee hatte einen intensiven Geruch, den ich nicht deuten konnte. Aber schon beim ersten Schluck schien er eine beruhigende Wirkung auf mich zu haben. Er linderte zwar nicht die Enttäuschung, half mir aber, mich besser zu konzentrieren.
Ich fragte Robert, ob er die Inschriften habe entziffern können und ob in diesen vielleicht ein Hinweis verborgen war. Er erklärte mir, dass er keine Ahnung habe, was diese Zeichen bedeuten könnten. Er erlaubte mir aber, sein Werkzeug zu benutzen, um mich selbst an der öffnung des Gehäuses zu versuchen. Außerdem entzöge er sich damit jeglicher Verantwortung, sollte die Uhr dabei zerstört werden.
Ich sagte ihm, dass ich ihn nicht kränken wolle und schon gar nicht an seiner Kompetenz zweifele, aber trotzdem sein Angebot gerne annehmen würde. Da ich aufgrund des ideellen Wertes der Uhr für mich verzweifelt nach jedem Strohhalm griff, wollte auch ich nochmals Hand anlegen. Nicht zuletzt deswegen war ich doch schließlich in den Karpaten.
Robert schmunzelte, als er meine Rechtfertigungsversuche hörte, und machte mir Platz.
Ich rückte an den Tisch, schaltete die Beleuchtung wieder ein, rückte alles zurecht und untersuchte – nun wohl zum tausendsten Mal – die Uhr und ihre Konstruktion. Nach einer halben Stunde gab ich auf, bedankte mich bei Robert und verabschiedete mich von ihm.
Dem Klostervorsteher deutete ich das Misslingen kurz an und bat ihn, mir die Kutsche zu rufen. Ich wollte nach Hause, um mich mit meiner Enttäuschung dort zu verstecken.
Zwei Tage später war ich wieder in der Schweiz und schwor mir, von nun an die Uhr so zu akzeptieren, wie sie war. Ich wollte nun nicht mehr mein ganzes Geld für hoffnungslose, aber aufwendige Aktionen aus dem Fenster zu schaufeln. Seit dieser Zeit war das Verhältnis zu meiner Uhr ein anderes. Sie war ähnlich wie ein Mensch, den ich so oft und verzweifelt versucht hatte, zu ändern. Doch welche Taktik ich auch anwandte, mit welchen Tricks ich auch versuchte, etwas zu erreichen – nichts gelang. Genauso wie meinem Großvater, schien sie sich auch mir zu verweigern. Doch nun wollte ich es akzeptieren, ihr und mir den nötigen Freiraum gönnen und meine freizeitlichen Aktivitäten ernsthafteren Zielen zuwenden.
Es dauerte zwar doch noch eine Weile, bis auch die Spötter verstummten, aber es zeichnete sich doch eine Entspannung ab. Nach und nach wurde ich gewahr, wie besessen ich von dieser Uhr war und es tat mir unheimlich gut, mich weniger mit ihr zu beschäftigen. Schon nach ein paar Monaten war sie mir zwar nicht völlig egal, aber sie war doch nur noch ein Objekt wie viele andere, die mich an etwas erinnerten, ohne eine Funktion oder gar ein Geheimnis zu haben. Von diesem Moment an war sie nichts weiter, als ein Erinnerungsstück an meinen Großvater und ein mich ständig begleitender Talisman.
Kurz, nachdem ich im CERN meine Arbeit wieder aufgenommen hatte, meldete sich auch Joshua wieder bei mir, um seinen Besuch anzukündigen. Wir verabredeten uns für den darauf folgenden Mittwoch ins »Café du Soleil«, einer der ältesten Gaststätten Genfs, mit dem wohl besten Fondue der Schweiz. Jedem, der einmal nach Genf reisen möchte und kulinarisch interessiert ist, kann ich dieses Etablissement nur wärmstens empfehlen.
III. Freunde und Riten
Ich kam einige Zeit zu spt zu meiner Verabredung mit Joshua. Mein Taxifahrer wollte mit aller Schlue und seiner zwanzigjhriger Erfahrung den Berufsverkehr und eine zu diesem Termin angesetzte Demo der WTO-Gegner umfahren, indem er dem Trubel durch die Außenbezirke auswich. Leider jedoch hatte er die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Aber wer konnte schon ahnen, dass direkt vor unseren Augen ein Milchtransporter umkippen wrde, dessen Fahrer versucht hatte, einem unaufmerksamen Radfahrer auszuweichen. Beim Umkippen dieses Milchlasters ergoss sich seine Ladung auf der Straße und versperrte uns den Weg. Zu allem bel befanden wir uns in einer Einbahnstraße. So kam es, dass der von hinten nachdrckende Verkehr die Falle endgltig zuschnappen ließ. Ich zahlte und stieg aus und gnnte meinen Fßen ein wunderbares Milchbad. Es dauerte eine ganze Weile, ehe ich erneut ein Taxi auftreiben konnte, das mich dann zu meinem Treffpunkt brachte. Leider eine gute halbe Stunde zu spt.
Als ich im Café ankam, war nichts von Joshua zu sehen. Der Kellner, den ich fragte, ob er denn einen großen, schlanken Mann, Anfang 50, mit grau meliertem Haar gesehen htte, zuckte nur unwissend mit den Schultern. Also nahm ich an einem der Tische Platz und positionierte mich so, dass ich den Eingang des Restaurants gut im Blickfeld hatte. Meine Fße waren noch immer ganz nass von der Milch und begannen wegen der Hitze schon ein wenig merkwrdig zu riechen. Mir wurde ganz bel, da ich Milch ohnehin nicht mag und warme Milch schon gar nicht. Darum steckte ich mir eine Zigarette an, da ich befrchtete, der Geruch der warmen Milch inklusive der meiner Fße knnte die anderen Gste belstigen. Allerdings schien es mir pltzlich, als wrde der Qualm meiner Zigarette einen weitaus hheren Belstigungsfaktor aufweisen. Ich bildete mir ein, hren zu knnen, wie am Nachbartisch ber mich getuschelt wurde. Gerade als ich meine Ohren etwas in Richtung der flsternden Gesellschaft spitzen wollte, flog die Tr der Kche auf und Joshua kam hereingestrzt. Er machte mir mit wilder Gestik klar, dass ich mich vom Eingangsbereich entfernen und zu ihm kommen sollte. Seiner Aufforderung Folge leistend ging ich zgig zu ihm. Worauf er mich sofort am Arm packte und mich durch die noch immer ruhelos pendelnde Kchentre hinter sich her zog.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























