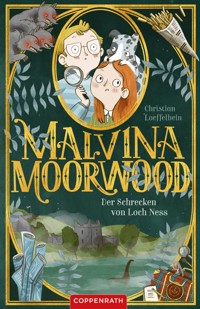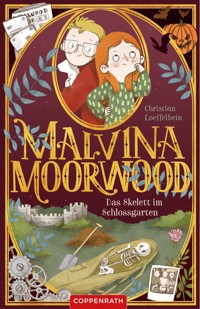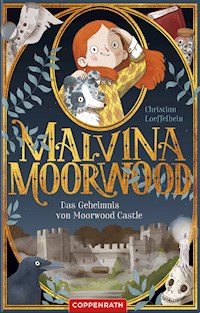
11,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Coppenrath Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Malvina Moorwood ist clever, vorlaut und ziemlich fix – und das nicht nur, wenn es darum geht, den Nachtisch zu verputzen. Als ihre Eltern beschließen, das alte Familienschloss zu verkaufen, steht für Malvina sofort fest: Das kommt gar nicht in die Tüte! Mit Spürsinn, Geschick und einer gehörigen Portion Verwegenheit stürzt sie sich zusammen mit ihrem Freund Tom in ein haarsträubendes Abenteuer zur Rettung Moorwood Castles. Dabei stolpert sie nicht nur über einen waschechten Geist und einen alten Familienfluch, sondern auch über eine Karte, die einen vielversprechenden Schatz in Aussicht stellt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Für Christina
eISBN 978-3-649-63371-6
© 2021 Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG, Hafenweg 30, 48155 Münster
Alle Rechte vorbehalten, auch auszugsweise
Text: Christian Loeffelbein
Illustrationen: Julia Christians
Lektorat: Jutta Knollmann
Satz: Sabine Conrad, Bad Nauheim
www.coppenrath.de
Die Print-Ausgabe erscheint unter der ISBN 978-3-649-63134-7.
Christian Loeffelbein
MALVINA MOORWOOD
Das Geheimnis von Moorwood Castle
Mit Illustrationenvon Julia Christians
Malvinas Name ist ein Ort.
Seht ihr ihren Schatten dort?
Seht ihr die Schatten an der Wand?
In Moorwood geht ein Geist durchs Land.
Inhalt
Kapitel 1 Der schlimmste Tag meines Lebens
Kapitel 2 Ich lasse eine Bombe platzen
Kapitel 3 Rettung in höchster Not
Kapitel 4 Ich starte meine Karriere als Detektivin
Kapitel 5 Der Blutige Schinken
Kapitel 6 Der Fluch des Hauses Moorwood
Kapitel 7 Der graus’ge Geist
Kapitel 8 Heimliche Telefonate
Kapitel 9 Die Schwarzpest
Kapitel 10 Das Fluchtuch
Kapitel 11 So große Raben gibt es nicht!
Kapitel 12 Der Geheimcode
Kapitel 13 Das gibt’s doch nicht!
Kapitel 14 Magische Tomatenklopse
Kapitel 15 In allen vier Ecken soll Glück sich verstecken
Kapitel 16 Die Auserwählte
Kapitel 17 Gefangen in der Dunkelheit
Kapitel 18 Das Labyrinth
Kapitel 19 Die Katakomben von Moorwood Castle
Kapitel 20 Flucht durch den Schlosspark
Kapitel 21 Böse Überraschung
Kapitel 22 Das letzte Stündlein
Kapitel 23 Die Nacht des Schreckens
Kapitel 24 Ich bin sprachlos
Über den Autor
Kapitel 1
Der schlimmste Tag meines Lebens
Der 16. Juli hätte ein wunderbarer Tag sein können.
Die Schule war aus, drei Stunden früher als geplant, die Sommerferien gingen los und es war so heiß wie noch nie.
In vier Tagen hatte ich Geburtstag und würde elf Jahre alt werden.
Alles war super.
Während ich mit meinem besten Freund Tom den Heckenrosenweg entlangschlenderte, sammelte ich ein paar flache Kieselsteine auf. Ein kleiner Wettkampf war jetzt genau das Richtige.
»Wetten, dass ich dich zuerst treffe?«, rief ich Tom zu und hielt ihm eins meiner Wurfgeschosse unter die Nase, damit er gleich verstand, was Sache war.
»Treffen?«, fragte Tom. »Wo denn? Und nach welchen Regeln?«
Tom musste immer alles ganz genau wissen. Sein Lieblingssport war Denksport, und er verbrachte Stunden damit, im Internet Knobelaufgaben zu lösen. Außerdem war Tom der totale Streber. Er hatte nur Einsen und ging freiwillig zu den Lateinkursen von Mr Brix. Nichts gegen die Lateinkurse von Mr Brix, aber hin und wieder musste man einem Besserwisser wie Tom schon mal zeigen, wo das Leben wirklich spielte.
Ich feuerte einfach drauflos und erwischte Tom an der Brust. Eine große Kunst war das allerdings nicht, denn er war ziemlich breit und trug noch dazu trotz der Hitze eine Windjacke, die ihm ein paar Nummern zu groß war.
»He!«, rief Tom, machte aber keine Anstalten zurückzuwerfen. Er hatte noch nicht mal einen Kieselstein in der Hand.
Spielverderber.
Ich spähte durch die Hecke. Wir waren gleich beim Spielplatz von Moorwood, den man außer durch das Tor etwas weiter südlich auch über einen schmalen Geheimgang gleich vor unserer Nase erreichen konnte. Geheimgänge liebte ich über alles.
Natürlich waren Tom und ich für Spielplätze schon viel zu alt, aber nicht für eine Mutprobe, die man hier machen konnte. Die war nämlich richtig gefährlich.
Und sie ging so:
Ich stellte mich auf die eine Seite der Wippe. Tom kletterte in der Zwischenzeit auf den Holzturm, der sich gleich daneben befand. Und dann musste er von dort aus auf die andere Seite der Wippe springen, was dazu führte, dass ich in hohem Bogen durch die Luft katapultiert wurde.
Wenn Tom nicht richtig sprang, tat er sich ziemlich weh. Und ich mir noch viel mehr, wenn ich nicht richtig landete.
Ich fand, dass ein bisschen Nervenkitzel immer gut war, aber Tom fand das nicht. Das erkannte ich an dem kritischen Blick, mit dem er stets die Wippe musterte.
Weil Tom jedoch mein bester Freund war, ließ er sich jedes Mal von mir überreden. Ich war nämlich nicht nur im Abspringen und Durch-die-Luft-Fliegen gut, sondern auch darin, andere Leute zu bequatschen.
Gerade als ich den Mund öffnen wollte, um loszulegen, hob Tom die Arme. »Schon gut, Malvina. Ein Sprung! Ein einziger. Aber dann ist erst mal Schluss. Bis Weihnachten. Mindestens!«
»Bis zum Ende der Ferien«, sagte ich.
»Bis November«, erwiderte Tom.
»Oktober!«
»Okay, okay.« Tom verdrehte die Augen und machte sich auf den Weg zum Holzturm. Ich kletterte vergnügt auf die Wippe und wartete auf meinen Einsatz. Und der kam schneller als gedacht. Normalerweise trödelte Tom immer ziemlich, aber diesmal sprang er sofort los und ich segelte Richtung Himmel und brach dabei meinen Hoch-durch-die-Luft-segel-Rekord. Es kribbelte im Bauch, mein Herz schlug wie verrückt und ein bisschen Angst hatte ich auch. Aber nur ein bisschen. Alles in allem genau die richtige Mischung.
Tom war nicht gerade für große Gefühlsausbrüche bekannt, aber nach dieser gemeinsamen akrobatischen Leistung hob selbst er seine linke Hand und ließ sie gegen meine ebenfalls erhobene rechte klatschen.
»Kommst du heute Nachmittag zu mir?«, fragte ich. »Wir können uns den Gruselfilm angucken, den du im Laden von deiner Mutter gefunden hast.«
Wenn es um Gruselfilme ging, musste man Tom nicht lange überreden. Er mochte spannende Aktivitäten hauptsächlich dann, wenn sie sich in einem sicheren Umfeld erledigen ließen. Und wenn sie etwas mit einer weichen Sitzgelegenheit zu tun hatten.
»Geht nicht«, entgegnete er. »Der Film ist auf einer alten Videokassette aus dem letzten Jahrhundert.«
»Lass dich überraschen.« Statt weiterer Worte blinzelte ich ihm diesmal nur geheimnisvoll zu.
»Okay«, sagte Tom. »Um vier bei dir.« Dann trottete er davon.
Bevor er bei der Bäckerei um die Ecke bog, drehte er sich noch mal um und rief: »Um vier!«
Tom hatte sichtlich gute Laune.
Ich nickte zufrieden. Es war ein schönes Gefühl, wenn jemand, den man mochte, sich freute.
Wie gesagt, es hätte ein wunderbarer Tag sein können.
Ich fuhr mit dem Bus nach Hause und hielt ein kleines Schwätzchen mit meinem Lieblingsbusfahrer Bernie. Während der Fahrt setzte ich mich nicht hin, sondern stand schräg hinter Bernies Fahrerecke, die ein bisschen so aussah wie die Kommandobrücke eines sehr alten Raumschiffs. Bernie versorgte mich mit Gummibärchen, die er aus einer großen gelben Tüte angelte. Süßigkeiten vor dem Mittagessen waren immer gut für die Stimmung.
Bernie konnte noch mehr quatschen als ich und ich lauschte seinem Redeschwall. Dabei betrachtete ich die kleinen Figürchen und den anderen Krimskrams, der an einer Schnur an dem Spiegel hing, mit dem Bernie den hinteren Teil des Busses im Auge haben konnte. Einiges davon stammte aus Überraschungseiern, aber das meiste musste er aus einer anderen, sehr viel geheimnisvolleren Quelle haben. Zum Beispiel die kleine Flöte, die aussah, als wäre sie aus einem Knochen geschnitzt. Oder der gelbe Totenkopf darunter. Ein gelber Totenkopf mit rosafarbenen Haaren, die steil zu Berge standen, und mit riesigen Kulleraugen, die in allen Regenbogenfarben schimmerten.
»In den nächsten Tagen wird es noch heißer werden«, erzählte Bernie. »Und dann soll es Gewitter geben und vielleicht sogar einen Wirbelsturm.«
»Super«, sagte ich. Denn im Gegensatz zu Tom war ich gern mittendrin, statt nur dabei.
Dann hielt Bernie bei der Bushaltestelle am alten Torhaus und ich stieg aus. Ich winkte zum Abschied.
Das alte Torhaus hieß so, weil es hier früher einmal ein großes Eingangstor und eine Zugbrücke gegeben hatte, aber wie alles auf unserem Grundstück waren Tor und Brücke alt und verfallen.
Also genau richtig.
Das sahen die Fahrer der Autos, die in unserem Schlossgraben gelandet waren, natürlich anders. Und weil solche Autofahrer mehr zu sagen hatten als fast elfjährige Mädchen wie ich, hatte mein Vater das Tor abgerissen und die Brücke durch einen Betonklotz ersetzt.
Nur das Torhaus moderte noch in stiller Würde vor sich hin. Weil sich dort drinnen ein alter Trafo vom Elektrizitätswerk befand, war es dem Abriss entgangen.
Im Park traf ich Poldi, unseren Hund. Er hatte versucht, Kaninchen zu jagen, aber natürlich keinen Erfolg gehabt. Poldi war schon ziemlich alt und Kaninchen waren viel zu schnell für ihn. Ich pflückte ein paar kleine grüne Birnen und warf sie durch die Luft. Kleine grüne Birnen waren viel leichter zu fangen als Kaninchen. Poldi sprang wild umher und bellte jedes Mal glücklich, wenn er eine Birne erwischte.
Dann fiel uns beiden das Mittagessen ein und wir liefen um die große verwilderte Haselnusshecke auf unser Schloss zu. Mit dem sommerlichen Park drum herum und dem blauen Himmel darüber sah der alte Kasten noch hässlicher aus als sonst und erinnerte mehr an eine heruntergekommene Fabrik als an ein Schloss. Das hieß, dass die schiefen Türme, die bröckelige Außentreppe und das graue Mauerwerk ganz besonders auffielen, weil alles andere so hübsch und romantisch wirkte.
Das Schloss hieß übrigens Moorwood Castle und es war uralt. In Butlers Burgen- und Schlösser-Lexikon hatte ich einmal gelesen, dass es zu den zehn hässlichsten Bauwerken Großbritanniens gehört, aber das ist natürlich Quatsch. Moorwood Castle gehört nicht zu den zehn hässlichsten Bauwerken Großbritanniens, es ist das hässlichste. Mit Abstand. Und gerade deswegen ungeheuer liebenswert. Wenn wir in der Schule einen Ort malen sollten, an dem wir besonders glücklich waren, dann malte ich immer unser Schloss. Auch wenn meine Eltern meinten, dass es kurz davor war zusammenzukrachen.
Poldi und ich wetzten am Hauptportal vorbei, das mit Brettern vernagelt war. Auch die Fenster links und rechts vom Portal waren verriegelt und verrammelt. Das hatte natürlich Papa gemacht. Papa war der Earl of Moorwood und wie viele englische Landadlige war er bettelarm. Deswegen wohnten wir auch nicht direkt im Schloss, sondern in einem Anbau, in dem früher einmal die Kutschen und die Knechte untergebracht worden waren. Natürlich gab es schon lange keine Kutschen und erst recht keine Knechte mehr bei uns. Wir machten alles selbst und zum Herumkutschieren hatten wir Opas alten Landrover und Mamas neuen Mini. Mama war Zahnärztin und hatte eine Praxis im Städtchen Moorwood, ganz in der Nähe vom Krimskramsund Geschenkartikelladen von Toms Mutter.
Ich atmete tief ein. Es roch nach Sommer, nach Pferden und nach Tante Fridas Schweinebraten mit Apfelsoße. Das war mein Leibgericht.
Sagte ich bereits, dass es ein wunderbarer Tag hätte sein können?
Schweinebraten mit Apfelsoße! Und mein Geburtstag stand vor der Tür! Aber leider auch mein Bruder Tristan.
Also, er stand wirklich vor der Tür, der Küchentür nämlich. Das erste nicht so schöne Ereignis an diesem bislang perfekten Tag.
»Was machst du denn hier?«, fragte Tristan.
»Ich wohne hier«, sagte ich.
»Oh Mann«, knurrte er. »Was du jetzt schon hier machst.«
»Feststellen, dass du mal wieder vom Pferd geflogen bist«, sagte ich.
»Bin ich nicht«, log Tristan.
Ich hätte ihn darauf hinweisen können, dass die Quarz-Sandspäne aus der Reithalle, mit denen seine Hose, sein Hemd und sein Reithelm paniert waren, eine andere Geschichte erzählten, aber ich tat es nicht und entgegnete stattdessen: »Schule war früher aus. Hab schon Bescheid gesagt. Deswegen gibt’s jetzt Schweinebraten mit Apfelsoße. Hat Tante Frida extra für mich gemacht.«
»Igitt«, sagte Tristan, der Apfelsoße nicht mochte.
Und genau das war das Problem. Wenn etwas auf den Tisch kam, was er nicht gern aß, wurde mein großer Bruder zum schlimmsten Miesmacher der Welt.
Zum Glück bimmelte in diesem Moment Tristans Handy. Bestimmt Onkel Bob, der Tristan zurück in den Stall beorderte. Der gehörte übrigens auch zu unserem Schloss, also der Stall. Papa betrieb zusammen mit Onkel Bob eine Reitschule und eine Pferdepension.
Ich hörte, wie Onkel Bobs laute Stimme aus dem Gerät Befehle erteilte. Der Hengst sollte beschlagen werden, und Tristan sollte helfen, das wilde Tier festzuhalten. Außerdem mussten mindestens drei der Pensionspferde auf die Weide hinter dem Stall gebracht werden und drei andere Pferde wieder von der Weide herunter, weil die sich nicht gut miteinander vertrugen.
Tristan wollte nicht und fing an zu diskutieren, aber gegen Onkel Bob hatte er keine Chance. Wenn man es genau betrachtete, war Tristan eigentlich so etwas wie der Knecht von Onkel Bob. Allerdings war das jetzt nicht mein Problem.
Ich huschte an meinem hilflosen Bruder vorbei in die Küche. Tante Frida empfing mich mit einer ihrer üblichen warmherzigen Umarmungen und wie immer schnupperte ich dabei an ihrer Bluse. Tante Frida duftete nämlich geheimnisvoll. Obwohl sie viel in der Küche stand, roch sie nie danach, keine Ahnung, wie sie das machte. Sie war die sehr viel jüngere Schwester von Opa und hatte eine Zeit lang in Ingolstadt gelebt, einer Stadt im Süden von Deutschland, wo es noch echte Hexen gab – jedenfalls versicherte das Tante Frida. Und ich glaubte ihr. Sie hatte dunkle, glatte Haare und riesengroße grüne Augen, und sie sah aus wie fünfundzwanzig, obwohl sie schon sechzig war oder vielleicht sogar noch älter, das wusste keiner so genau. Tante Frida war übrigens die Frau von Onkel Bob.
»Tristan kommt später, er muss noch mal in den Stall«, sagte ich und Poldi bellte zur Bestätigung. »Kann ich schon essen? Ich sterbe vor Hunger«, behauptete ich und verschwieg, dass ich mir gerade noch eine nicht unerhebliche Menge Gummibärchen reingepfiffen hatte. Poldi behauptete vorsichtshalber dasselbe, indem er erneut laut bellte.
Tante Frida ließ sich erweichen, obwohl gemeinsames Essen bei ihr hoch im Kurs stand. »Dann lass es dir mal schmecken, meine Süße. Du kannst ja eine ordentliche Portion vertragen.« Sie rollte vielsagend mit den Augen.
Das mit der Portion sagte sie immer. Ich bin nämlich nicht gerade voluminös – die Einschätzungen schwanken zwischen klapperdürr (Tristan) und zart gebaut (Mama) – und Tante Frida meinte stets, dass ich zu wenig essen würde, was jedoch nachweislich nicht stimmte.
Aber was sollte das mit dem Augenrollen bedeuten?
»Alles in Ordnung, Tante Frida?«, fragte ich.
»Gewiss, gewiss.« Sie nickte und verteilte großzügig Soße über den Braten und den Knödel auf meinem Teller.
Wenn ich in diesem Moment genau hingeschaut hätte, statt mit Messer und Gabel zu hantieren, dann hätte ich bemerkt, dass Tante Frida ein wenig flunkerte. Die richtige Antwort auf meine Frage hätte nämlich lauten müssen: »Nein, keineswegs. Unheil naht.«
Aber verfressen, wie ich war, bekam ich das nicht mit und ging weiter davon aus, mich mitten in einem perfekten Tag zu befinden.
Ich hatte den besten Schweinebraten der Welt plus einen Extraknödel gerade verspeist, als mein Bruder in die Küche gepoltert kam. Perfektes Timing. Ich schnappte mir meine Schultasche, sauste aus der Küche, flitzte durch den Flur, rannte die Treppe nach oben und stürmte in mein Zimmer. Dafür brauchte ich vierundzwanzig Sekunden. Zwei weniger als gestern. Perfekte sportliche Leistung. Ich begann, meine Schulsachen ganz weit unten in meinem Kleiderschrank zu verstauen und dabei eine ganze Menge T-Shirts, Hosen und Pullis zu finden, die ich schon seit Ewigkeiten gesucht hatte.
Mitten in mein Gewühle hinein klingelte es. Das konnte nur Tom sein, den die Neugier früher als erwartet zu mir getrieben hatte. Ich sprang auf, stürmte hinunter und öffnete die Haustür.
»Ist der Wirbelsturm schon losgegangen?«, erkundigte ich mich, denn Tom sah ziemlich zerzaust aus.
»Was für ein Sturm?« Tom wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Bin gerannt«, erklärte er dann.
Er sah mich an, und das Glitzern in seinen Augen verriet, dass er jetzt nicht weiter über das Wetter sprechen wollte – sondern über den Gruselfilm, der in seinem Rucksack steckte.
»Und du hast also echt ein Abspielgerät gefunden?«, fragte er.
Ich machte ein geheimnisvolles Gesicht und flüsterte: »Wart’s ab.«
Dann schwärmte ich Tom von Tante Fridas Schweinebraten vor, entwarf einen Plan dafür, im alten Torhaus ein Geheimversteck für uns beide einzurichten, und lotste Tom währenddessen die Treppe nach oben in den ersten Stock. Dort bogen wir in einen langen Korridor ein, der zu der kleinen Wendeltreppe führte, über die man in den zweiten Stock schlich, wenn man nicht wollte, dass es jemand mitbekam.
»Wo führst du mich denn hin?«, fragte Tom.
»Pst!«, antwortete ich und hielt ausnahmsweise selbst ebenfalls den Mund, um ein gutes Beispiel abzugeben.
Ich ging mit Tom im Dunkeln einen weiteren Korridor entlang. Am Ende angekommen, schaltete ich die Taschenlampenfunktion meines Handys ein und leuchtete in eine Nische.
»Da steht ein Gummibaum«, stellte Tom fest. Besonders begeistert klang er nicht. »Ich dachte, wir gucken uns den Gruselfilm an und keine Zimmerpflanzen, die …«
»Abwarten«, unterbrach ich ihn. Letztens hatte ich nämlich herausgefunden, dass sich hinter dem Gummibaum ein schmaler Durchgang befand – ein Durchgang zu unserem Schloss! Wenn man die Pflanze mitsamt dem großen Übertopf ein wenig beiseiteschob, konnten sich zwei kleine dünne Kinder dort hindurchquetschen. Okay, Tom war weder klein noch dünn, aber er war immerhin ein Kind und musste dann eben den Bauch einziehen. Er fand das nicht so toll, doch schließlich hatten wir es geschafft.
»Jetzt sind wir gleich da«, raunte ich Tom zu und knipste das Licht an. Weil die Fenster mit Brettern vernagelt waren, konnte uns keiner auf die Schliche kommen.
»Sag bloß, wir sind jetzt in Moorwood Castle«, schnaufte Tom.
»Blitzmerker«, erwiderte ich.
»Aber …« Tom sah sich um. »Aber ist das nicht verboten?«
»Du meinst, hierherzukommen?« Ich winkte ihm zu, mir zu folgen.
»Ja«, sagte Tom, »ich dachte, es ist gefährlich, weil das Schloss einstürzen kann.«
»Ach was«, murmelte ich, was natürlich keine richtige Antwort war, aber ich wollte jetzt keine Diskussion um Verbote aufkommen lassen. Denn leider hatte Tom mit seiner Frage mitten ins Schwarze getroffen. Wir befanden uns im Ostflügel von Moorwood Castle und die Zimmer dort waren tatsächlich verboten – während die Zimmer im Haupthaus und im Westflügel strengstens verboten waren und der Dachboden allerstrengstens. Und der Keller war so dermaßen streng verboten, dass es dafür gar kein Wort mehr gab. Angeblich war dort vor dreißig Jahren der letzte Gärtner, der je für die Familie Moorwood gearbeitet hatte, von einem herabstürzenden Mauerstein erschlagen worden. Und seitdem war es dort nicht mehr geheuer. Das hieß, dass es dort unten spuken sollte – jedenfalls behauptete das mein Bruder Tristan.
Aber das war natürlich Unsinn. Warum sollten sich Gespenster, die durch Wände und geschlossene Türen schweben konnten, auf den Keller beschränken? Die geisterten natürlich durchs ganze Schloss! Und selbstverständlich gab es in so einem uralten Gemäuer wie Moorwood Castle nicht nur ein einziges armseliges Gärtner-Gespenst. Hier hausten noch jede Menge andere Spukgestalten. Der rote Baron zum Beispiel und der Henker Harry. Die Spinnen-Lady und die weiße Wasserleiche. Das kriechende Kind und der tanzende Totengräber.
Gesehen hatte ich von diesen gruseligen Gesellen allerdings noch keinen. Leider.
Da Tante Frida meine Begeisterung für unheimliche Dinge aller Art teilte, hatten wir beide eine E-Mail an den Verlag von Butlers Burgen- und Schlösser-Lexikon geschrieben und darauf aufmerksam gemacht, dass Moorwood Castle nicht nur das hässlichste Schloss Englands war, sondern auch das, in dem es am meisten spukte. Na ja. So ganz genau wussten wir das natürlich nicht. Was wir allerdings ganz genau wussten, war, dass man sich im alten großen Ballsaal keine fünf Minuten aufhalten konnte, ohne eine Gänsehaut zu bekommen. Und dass aus dem Klo im zweiten Stock des Anbaus, in dem wir wohnten, manchmal merkwürdige Röchelgeräusche kamen, obwohl gar keiner drin war. Und dass man in das Astloch der alten Eiche im Garten Spielsachen hineinwerfen konnte, die dann spurlos verschwanden.
Vielleicht würden die vom Verlag so etwas wie einen Spuk-Beobachter schicken, also jemanden, der richtig Ahnung davon hatte. Mit dem könnte ich dann gemeinsam auf Geisterjagd gehen. Darauf freute ich mich schon sehr.
Aber jetzt freute ich mich erst mal darauf, Tom zu überraschen.
Der Ostflügel war übrigens bis kurz vor Tristans Geburt noch von meiner Familie genutzt worden, natürlich ohne zugenagelte Fenster. Onkel Frank hatte hier gewohnt, bevor er nach London gezogen war, um ein berühmter Schauspieler zu werden. Mama und Papa hatten ebenfalls hier gelebt, kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten, aber Mama fand das nicht so toll, weil sie alte Häuser nicht mochte. Kaum zu glauben, aber wahr: Mama träumte davon, in einem kleinen Appartement mit Zentralheizung zu wohnen. Vielleicht lag es daran, dass ihr einmal beim Schlafen ein Teil der Stuckverzierung von der Decke aufs Gesicht gefallen war. Keine Ahnung, warum sie sich wegen ein bisschen Gipsstaub so anstellte, aber so war Mama halt. Für sie musste immer alles tipptopp sein.
»Hier entlang«, sagte ich zu Tom und winkte erneut. Diesmal energischer, weil Tom nur noch zögerlich einen Fuß vor den anderen setzte.
Ob er Angst hatte?
Ein wenig unheimlich war es hier nämlich schon. Die Wandbeleuchtung flackerte, und die Tapete des Flurs, den wir entlanggingen, war aus dem vorvorigen Jahrhundert und hatte wahrscheinlich auch schon damals keine besonders heitere Stimmung verbreitet. Die verschlungenen Muster sahen aus wie grinsende Totenköpfe, und ich konnte mir gut vorstellen, dass Henker Harry hier gern um Mitternacht herumstreunte.
Ich führte Tom zu Papas altem Arbeitszimmer und knipste das Licht im Flur wieder aus. Für eine Weile standen wir in der schwülwarmen Dunkelheit.
Tom schnaufte erneut, während ich mich zu Papas Schreibtisch vortastete. Dort machte ich die Lampe an und gab dann ein übermütiges »Ta-ta-ta-ta!« von mir. Gleichzeitig zeigte ich mit beiden Händen auf den alten Fernseher neben dem Schreibtisch. Er stand auf einem Rollwagen, zusammen mit dem Abspielgerät für Videokassetten. Der Fernseher sah aus wie ein Backofen und das Videogerät wie ein Metallklotz vom Schrottplatz.
Tom riss die Augen auf.
»Nicht schlecht«, sagte er anerkennend und holte die Videokassette aus seinem Rucksack. Dracula verkündete eine blutrote Schrift auf dem Titelbild, das außerdem eine verfallene Burg und einen höhnisch grinsenden Vampirfürsten zeigte. Sehr vielversprechend und genau der richtige Film für den letzten Schultag.
»Funktioniert die Anlage denn auch?«, fragte Tom.
Ich nickte, denn ich hatte die beiden Geräte aus der Steinzeit schon einmal mit Tristan ausprobiert.
Aber gerade in dem Moment, als ich den Fernseher einschalten wollte, fiel mein Blick auf den Papierkram, der auf dem Schreibtisch lag.
Neuer Papierkram.
Papierkram, der bei meinem letzten Besuch noch nicht da gewesen war.
Papierkram, der nichts Gutes bedeutete, das spürte ich sofort, denn es gab einen ganz bestimmten Grund, warum er hier herumlag und nicht in Papas normalem Arbeitszimmer neben der Küche:
Es war Papierkram, den ich nicht sehen sollte. Und vermutlich Tristan und meine beiden Schwestern auch nicht.
»Was ist denn los?«, fragte Tom. Er klang besorgt.
Ich murmelte etwas Unverständliches vor mich hin, weil ich damit beschäftigt war, den Papierkram anzustarren. Den Papierkram, den keiner sehen sollte.
Tom trat neben mich und half mir beim Starren. Ich war froh, dass er da war, denn ich fühlte mich plötzlich so, als hätte mir jemand in den Magen geboxt und mich gleichzeitig mit eiskaltem Wasser überschüttet.
»Verdammte Axt«, flüsterte Tom, ein Ausdruck, den er von seinem Vater aufgeschnappt hatte und den er nicht leichtfertig einsetzte. Verdammte Axt war für außergewöhnlich schreckliche Dinge reserviert.
Dinge wie diesen Papierkram.
»Weißt du, was das bedeutet?«, flüsterte Tom.
Ich nickte.
Natürlich wusste ich es.
»Dein Papa hat euer Schloss verkauft«, sagte Tom.
Ich holte tief Luft, damit ich nicht anfing zu heulen. »Allerdings«, sagte ich.
»An einen gewissen Mr Bommel.«
Der 16. Juli hätte ein wunderbarer Tag sein können.
Aber es war der schlimmste Tag meines Lebens.
Kapitel 2
Ich lasse eine Bombe platzen
Zum Abendessen gab es eine kalte Version von Tante Fridas Schweinebraten und diesmal waren alle Familienmitglieder in der Küche versammelt. Allerdings nicht um den Tisch herum, sondern im Raum verstreut. Das war nicht unüblich bei uns, wenn eine Art Buffet serviert wurde.
Papa hatte ein Stück Schweinebraten in der einen Hand und unsere alte, klapprige elektrische Heckenschere in der anderen. Er versuchte, das Teil auf ein Stück Zeitung zu legen (also die alte, klapprige elektrische Heckenschere, nicht den Schweinebraten), wobei ihm Poldi fortwährend in die Quere kam.
Onkel Bob scherzte am Herd mit Tante Frida, wobei er abwechselnd ein riesiges Stück Käse und ein Glas Rotwein zum Mund führte und laut lachte. Offenbar hatte das mit den Hufeisen und unserem Hengst geklappt, denn sonst wäre Onkel Bob nicht so gut drauf gewesen.
Tante Frida rührte konzentriert in einem Topf, in dem sich ihre berühmte rote Grütze aus Erdbeeren, Himbeeren und Johannisbeeren befand. Hin und wieder sagte sie Sachen wie »Aha«, »Na, so was« und »Ist ja nicht zu fassen« (Tante Frida interessierte sich nicht besonders für Pferde).
Mama saß mir gegenüber am Esstisch, knabberte gedankenverloren an einer Mohrrübe und ging irgendwelche Rechnungen durch (Mama interessierte sich nicht besonders fürs Essen).
Amalia und Georgina (meine beiden großen Schwestern, wie immer gleich angezogen und geschminkt und mit dem gleichen nervigen Wir-sind-Zwillinge-und-etwas-Besseres-Blick) tippten auf ihren Handys herum, während sie in der Mitte der Küche und Tristan im Weg standen. Der versuchte nämlich gerade, eine geöffnete Flasche Cola, ein geöffnetes Glas Erdnussbutter, eine Packung Toastbrot, zwei Bananen und einen Teller zum Esstisch zu balancieren, und kam an den beiden nicht vorbei.
Genau der richtige Moment, um die Bombe platzen zu lassen.
Tom hatte mir zwar davon abgeraten, aber man kann nicht immer auf seine Freunde hören. Und der schlimmste Tag meines Lebens sollte auch für meine Familie (und vor allem für meinen hinterhältigen Papa) nicht angenehm enden.
»Ich habe heute so einen Typen in Moorwood getroffen«, sagte ich.
Tante Frida schaute an Onkel Bob vorbei zu mir. Sie hob die Augenbrauen und eventuell bewegte sie den Kopf ganz leicht von links nach rechts, das konnte ich aus dem Augenwinkel nicht so genau sehen. Ansonsten reagierte keiner.
Papa untersuchte das Kabel der Heckenschere, das offenbar defekt war. Onkel Bob wedelte mit Käse und Rotwein herum, Mama knabberte, die Zwillinge kicherten und Tristan versuchte weiter, sich an ihnen vorbeizuschieben.
»Hat gesagt, dass er zu wissen glaubt, wer ich bin, der Typ«, fuhr ich fort.
Tante Frida zog die Augenbrauen noch eine Spur höher. Papa drehte den Kopf in meine Richtung, und Mama hörte mit dem Knabbern auf, nicht aber damit, die Rechnungen durchzuschauen.
»Hat gefragt, ob ich die kleine Lady Moorwood bin«, sagte ich.
Tante Frida hob jetzt zusätzlich zu ihren Brauen auch noch ihren Kochlöffel. Mama hörte auf, in ihren Rechnungen zu blättern.
»Und wer war dieser Gentleman, Liebes?«, fragte Papa.
»Hat gemeint, dass er Mr Bommel heißt«, sagte ich.
Der erste Teil der Bombe war explodiert und die Wirkung nicht schlecht.
Tante Fridas Kochlöffel zitterte in der Luft, Onkel Bob bekleckerte sich mit Rotwein, Papa wurde so bleich wie das Stück Käse, das Onkel Bob inzwischen fallen gelassen hatte, und Mama holte zischend Luft und hüstelte. Die Zwillinge stellten ihr Gekicher ein, weil sie merkten, dass irgendetwas vor sich ging (sie waren zwar hochnäsig, aber nicht blöd). Nur mein Bruder machte ungerührt mit seinem Geeiere weiter und versuchte jetzt, links an Amalia vorbeizukommen.
»Hat erzählt, dass er unser Schloss gekauft hat, der Mr Bommel«, sagte ich.
Kawumms! Volle Ladung!
Tante Fridas Kochlöffel verschwand in der Grütze. Onkel Bob begoss das am Boden liegende Stück Käse mit dem Rotwein. Papa riss die Heckenschere an ihrem Kabel nach oben und ließ sie dann gleich wieder fallen, wobei sie um ein Haar Poldi den Schwanz abrasiert hätte. Poldi fing an, klagend zu bellen, aber das war nichts gegen den Lärm, den Tristan mit dem Erdnussbutterglas, der Colaflasche und dem Teller veranstaltete. Ich hätte nie gedacht, dass es derart laut werden kann, wenn Glas und Porzellan auf dem Küchenfußboden zerschellen. Die Zwillinge kreischten »Igitt!« und »Äh!«, weil sie von einer Erdnussbutter-Cola-Scherben-Mischung getroffen wurden, und Mama legte ihre angeknabberte Möhre auf einen Teller und sagte: »Dieser Vollidiot.«
Tristan wollte protestieren, weil er diese wenig schmeichelhafte Bezeichnung auf sich bezogen hatte, aber dann merkte er, dass es gar nicht um ihn ging, und hielt den Mund.
Überhaupt war es plötzlich ganz still in der Küche. Poldi bellte nicht mehr und die Zwillinge hörten auf zu kreischen. Niemand gab einen Laut von sich, bis auf die rote Grütze, die in ihrem Topf vor sich hin blubberte.
»Stimmt das?«, fragten Amalia und Georgina nach einer Weile wie aus einem Mund.
»Nein«, sagte mein Vater.
»Lügner!«, rief ich und verlor dabei leider die Beherrschung. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen. »Du hast unser Schloss an diesen Mr Bommel verkauft. Unser schönes, altes Schloss.«
»Echt jetzt?«, wollte Tristan wissen und nutzte die Dramatik der Ereignisse dazu, sich nicht weiter um die Schweinerei zu kümmern, die er auf dem Küchenfußboden angerichtet hatte.
Papa machte das, was er immer tat, wenn er nicht weiterwusste. Er streichelte Poldi und sah Hilfe suchend zu Mama.
»Nein«, sagte Mama.
»Ihr lügt«, kreischte ich. »Alle beide! Mr Bommel hat es mir gesagt. Ihr lügt! Ihr lügt!! Ihr lügt!!!«
Natürlich log ich auch, aber das war in diesem Fall erlaubt, hatte ich entschieden. Tatsächlich hatte ich diesen Mr Bommel ja gar nicht getroffen, sondern nur seinen Namen auf der Verkaufsurkunde in den verbotenen Zimmern des Ostflügels gelesen, und auch das nicht besonders deutlich.
»Wir lügen nicht«, sagte Mama und reichte mir ein Taschentuch. Keine Ahnung, wo sie das plötzlich herhatte.
»Der Name des Herrn wird übrigens französisch ausgesprochen und er heißt Beaumel und nicht Bommel. In der Tat interessiert sich Mr Beaumel dafür, Moorwood Castle zu erwerben«, fuhr Mama fort. »Aber wir hatten mit ihm vereinbart, darüber Stillschweigen zu bewahren.«
»Krass«, stellte Tristan fest. »Ihr wollt die Hütte also echt verticken.«
»Für wie viel?«, fragten Amalia und Georgina – erneut im Chor.
»Das spielt doch überhaupt keine Rolle!«, rief ich mit viel zu schriller Stimme. »Unser Schloss ist unverkäuflich. Es gehört uns, nur uns und niemandem sonst, und man darf es nicht verkaufen, weil es seit Jahrhunderten unserer Familie gehört, und Opa würde niemals …«
Ich wusste nicht mehr weiter. Wo steckte Opa überhaupt? Erst jetzt und leider etwas zu spät fiel mir auf, dass er gar nicht in der Küche war, als ich die Bombe hatte platzen lassen. Nicht auf Opa zu warten, war natürlich ziemlich dämlich von mir, denn er wäre bestimmt super sauer auf Papa und auf meiner Seite gewesen.
»Was ist denn hier los?«
Na, wer sagt’s denn – da kam Opa gerade noch rechtzeitig durch die Küchentür, mit einem Schraubenschlüssel in den ölverschmierten Händen. Vermutlich hatte er mal wieder an der Heizung herumgewerkelt, die war nämlich des Öfteren kaputt, obwohl sie dringend gebraucht wurde, auch im Sommer. Von der Hitze draußen kam so gut wie nichts in unsere Räume hinein. Wegen der dicken Mauern und der schmalen Fenster.
»Papa will unser Schloss verkaufen, an einen Typen, der Mr Bommel heißt«, berichtete ich schnell, ehe jemand etwas anderes behaupten konnte. Und natürlich sprach ich den Namen von diesem schmierigen Typen nicht französisch aus.
Jetzt würde es gleich ein Donnerwetter geben, das sich gewaschen hatte. Opa war zwar nicht so der zornige Typ und er war ja auch nicht mehr der Jüngste, aber er war unglaublich stark, stärker noch als Onkel Bob. Und früher war Opa mal Soldat gewesen und hatte in einem echten Krieg mitgemacht, wegen irgendwelcher Inseln bei Argentinien, glaube ich. Keine Ahnung, ob damals auch richtig geschossen wurde, aber in unserer Küche würde es auf jeden Fall gleich noch mal richtig rumsen.
Dachte ich.
Tatsächlich schlenderte Opa nur zum Herd, wich mit einem eleganten Seitwärtsschritt dem Käse auf dem Fußboden aus und verkündete:
»Stachelbeerkompott, das ist mein Lieblingsnachtisch.«
»Es gibt rote Grütze, Georgy«, sagte Tante Frida.
»Noch besser«, bemerkte Opa und saß keine fünf Sekunden später mit einem Teller dampfender Grütze vor seiner Nase neben mir.
»Unser Schloss«, jammerte ich. »Unser Schloss, Papa hat es verkauft!«
Jetzt musste Opa mich gehört haben. In seinem Gesicht bildeten sich Falten.
Vielleicht wurde er sogar so wütend, dass er den Teller mit der Grütze nach Papa schmiss.
Schon wieder falsch gedacht.
Die Falten, das waren Lachfalten.
Opa sah mich mit einem verschmitzten Grinsen an.
»Hat dieser Bommel also tatsächlich zugeschlagen?«, raunte er mir verschwörerisch zu.
»Nein, das hat er noch nicht«, mischte sich nun Mama ein. »Und der Mann heißt Beaumel. Er hat lediglich eine Absichtserklärung unterschrieben und sich damit ein Vorkaufsrecht gesichert.«
»Na, immerhin«, freute sich Opa und löffelte vergnügt rote Grütze.
Ich verstand die Welt nicht mehr.