
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Cianos Welt
- Sprache: Deutsch
Ciano ist ein Scheidungskind. Mama und Papa haben sich getrennt, weil sie komplett verschiedene Vorstellungen von einem glücklichen und zufriedenen Leben hatten. Mama hat eines Tages ihre Koffer gepackt, ist einfach verschwunden und hat große Karriere als Direktorin eines riesigen Unternehmens gemacht. Und Papa, der sich für einen Ururenkel eines Piraten hält, lebt mit fünf Kumpanen in einer Seeräuberburg auf einer südpazifischen Insel. Ciano wächst bei ihm auf. An seine Mutter kann er sich nicht erinnern, aber er sehnt sich nach ihr, ohne zu wissen warum eigentlich. Einer der "Piraten" lässt in einem Männergespräch über Cianos Mutter locker den Satz fallen: "Die lebt doch auf dem Mond!". Ciano nimmt diese Worte ernst. Und damit beginnt das größte Abenteuer seines bisherigen Lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mama lebt auf dem Mond
Mama lebt auf dem MondEinführungUnd das ist die Geschichte...Alle Weg führ’n zum MondÜber den AutorImpressumMama lebt auf dem Mond
Hans K. Stöckl Mit Bildern von Hans K. Stöckl
Für Luciano und alle, die ihn lieben
Einführung
Es war ein eigenartiger Tag gewesen. Einer von denen, wo man denkt, man hätte getrost auf ihn verzichten können. Es war nicht etwa irgendeine sensationelle Schrecklichkeit passiert, es war auch keine unsensationelle Annehmlichkeit passiert. Ach was! — Es war überhaupt nichts passiert! Das war es eben. Es war — außer stinklangweilig — einfach gar nichts! Und jetzt saß ich da vor meinem Dachstubenfenster, starrte geistesabwesend in den orangefarbenen Vollmond und dachte an alles gleichzeitig. Also an nichts Besonderes. Ich weiß nicht, wie lange ich damit zugebracht hatte, an nichts zu denken, ich merkte nur mit einem Mal, wie mir der Nacken wehzutun begann. Das kam daher, dass ich unwillkürlich beim in-den-Mond-Starren den Kopf mit ihm mitgedreht hatte, wie er da während Stunden so über den Himmel gezogen war. Aber ich bin nun einmal kein Vogel und ich kann meinen Kopf nicht nach hinten drehen! Und haargenau in dem Moment, als ich „Vogel“ dachte, landete Flirr flügelflatternd dicht vor meinem Gesicht. „Me nao, Professor...!“ keuchte er atemlos. Und er sah in seiner Mitleid erregenden Erschöpftheit gar nicht aus wie ein „Lachender Hans“, der er ja war. „Me nao, mein Freund!“ antwortete ich und bemühte mich, meiner Stimme einen beruhigenden Klang zu verleihen. Dabei stellte ich ihm sein Wasserschälchen hin und wartete geduldig, bis er sich gestärkt hatte. Es war schon eine ziemlich lange Zeit her, dass Flirr mich besucht hatte und ich war sehr gespannt, was mir mein Vögelchen diesmal flüstern würde. Was mochte es Neues geben auf Floripace, der winzigen Paradiesinsel im fernen indischen Ozean? Wie mochte es meinem alten Freund Renzo Floriani gehen, und was machte der kleine Held Ciano, dessen Vater so gerne Seeräuber gewesen wäre...? Und war die schreckliche Schatzsuchmaschine nun endgültig ein Stück missglückter Vergangenheit? „Trink nicht so hastig!“ mahnte ich Flirr sanft. Aber er war von der gigantischen Flugleistung über unzählige See- und Landmeilen so durstig, dass er das ganze Schälchen in einem leer trank. Danach kippte er fast um, taumelte hin und her und drohte beinah’ vom Fenstersims zu stürzen. Ich fing ihn gerade noch rechtzeitig ab und trug ihn in meine Stube hinein. Dort legte ich ihn behutsam auf das Kopfkissen meines Bettes und holte mir einen Stuhl heran. Dann griff ich nach Papier und Bleistift, weil ich wusste, dass er augenblicklich zu plappern beginnen würde, wenn er erwachte. Und so war es dann auch. Mir tun heute noch die Fingergelenke weh vom vielen Schreiben. Denn Flirr erzählte und erzählte und ich gab es bald auf, mich über seine erstaunliche Fähigkeit, scheinbar ohne Atem zu holen, ganze zweiunddreißigeinhalb Stunden ununterbrochen reden zu können, zu wundern. Und erst als ich die Notizen viel später, als Flirr längst wieder fort war, ins Reine schrieb, erkannte ich, dass dieser eigenartige, ereignislose, langweilige Tag mir die wohl aufregendste und ungewöhnlichste Geschichte beschert hatte, die ich je für Dich aufgeschrieben habe.
Und das ist die Geschichte...
Floripaces Strand, die Palmwipfel und Hügelkuppen glänzten im satten Gold der Abendsonne. Das Rauschen der sanften Brandungswellen mischte sich mit dem Schnarren der Zikaden und den Schlafliedern der Vögel. Silberne Pfeilchen schnellten dann und wann aus den schlagobersgekrönten türkisfarbenen Wogen. Auf dem Stein, der ihm das erlaubt hatte, saß der alte Professor Renzo Floriani und hielt Wobari, den sprechenden Kieselstein, in der linken Hand. Die Rechte hielt die Schreibfeder, welche der Albatros Leno aus einem seiner Flügel gezupft und ihm geschenkt hatte. Auf einem selbst gebastelten Tischchen lag Renzos Tagebuch, und daneben stand der unvermeidliche Kokosnussbecher mit Kiwisaft. Das wochen-, ja monatelange Training mit Wobari hatte sich bezahlt gemacht. Er sprach zwar immer noch sehr, sehr langsam, aber der alte Mann war ein geduldiger und aufmerksamer Zuhörer. „Du sagst also“ fasste er kurz zusammen, was ihm der Kieselstein während der letzten paar Tage erklärt hatte, „dass du ein Bruder aller Sterne des Alls seist...“ Das Mooskleid Wobaris wurde feucht, weil ihm die Anstrengung des Sprechens den Schweiß aus allen Ritzen trieb. Dann begann er mit seiner kaum hörbaren und eigenartig tonlosen Stimme von neuem: „Wir sind alle Geschwister. So wie Du und die Palme, oder die Zikade und das Meer. Oder die Möwe und der Wal. Wir gehören alle zur selben Familie. Zur Familie, die ihr Gelehrten das Universum nennt. Dieser unser kleiner Planet Erde kreist um einen Stern, der Sonne heißt. Aber in der ungeheueren Masse von Sternen, die ihr Menschen Milchstraße getauft habt, gibt es 100 Milliarden anderer Sonnen, und im ganzen Universum gibt es wiederum viele Millionen von Milchstraßen. Und wer weiß, wie viele Universen es gibt...“ Renzo Floriani nickte langsam und sehr ernst, weil er daran dachte, wie klein doch der Mensch ist, und wie wenig er über diese unvorstellbaren Wunder weiß. Und wie wenig er diejenigen Wunder, die er erforscht und kennen gelernt hat, respektiert und wie sehr er sich in Streit und Zank um Nichtigkeiten verloren hat. Blutrot färbte jetzt die Sonne bereits Meer und Himmel und senkte sich in den schmalen Dunststreifen über dem Horizont. Renzo schien nichts davon zu bemerken, denn Wobari, dem die Zeit absolut nichts bedeutete, fuhr fort zu erzählen: „Ihr habt viel gelernt, ihr Menschen. Ihr habt viel berechnet und ausgemessen. Ihr seid bereits zu den Sternen unterwegs, um auch sie euch untertan zu machen. Aber ihr wisst nichts über sie; bloß über ihre Zusammensetzung, ihre Entfernungen zueinander, ihre Bahnen und ihr Alter wisst ihr Bescheid. Zumindest eurem menschlichen Verstand nach. Aber dass sie Lebewesen sind wie ihr, dass sie fühlen und leiden können... davon habt ihr keine Ahnung.“ Glitzernde Schweißperlen rieselten zu Boden, aber Wobari schien heute nicht müde zu werden. So viel hatte er noch an keinem Tag gesprochen. Langsam stieg hinter dem Hügel die bleiche Scheibe des Mondes empor und sein Silberglanz polierte das Sonnenblut aus der paradiesischen Landschaft. „Sieh ihn dir an!“ sagte Wobari noch leiser als gewohnt, und Renzo legte sein Ohr an das Moos. Die Stimme schien aus unendlicher Ferne zu kommen und war dennoch so nah. „Ihr Menschen wisst zwar, dass der Mond unserer Erde immer nur sein Gesicht und niemals den Rücken zuwendet, aber wisst ihr auch, warum das so ist?...“ Renzo wollte zu einer wissenschaftlichen Erklärung ansetzen, dass der Mond eben durch sein geringes Gewicht und seine fehlende Luftschicht, für eine einzige Umdrehung 27,3 Tage benötige und exakt genauso lang für eine Erdumrundung und dass deshalb..., aber Wobari unterbrach ihn: „Siehst du! Außer wissenschaftlichem Geschwafel weißt auch du nichts.“ Es klang absolut nicht böse und es war auch nicht böse gemeint. Renzo schaute unwillkürlich dem kleinen Erdbegleiter mitten in sein Silbergesicht, und mit einem Mal schien ihm dieses seltsam traurig und von unsäglichem Gram erfüllt. „Es ist einigermaßen lang her...“ sinnierte Wobari, und Renzo hatte alle Mühe, die unglaublich leise Stimme noch zu hören. „Ihr Menschen, die ihr alles in Maßeinheiten zerhacken müsst, sagt, es seien 4,5 Milliarden Jahre... Wie auch immer; damals, als sich das große Chaos zu ordnen begann und die Sterne zur Ruhe fanden, da trafen sich Erde und Mond zufällig auf ihren noch nicht festgelegten Bahnen. Der Mond, zu jener Zeit noch ein schöner, feuriger Planetenjüngling voller Tatendrang, war von der unglaublichen Schönheit der Erde so fasziniert, dass er sich augenblicklich unsterblich in sie verliebte, ihr nicht mehr von der Seite wich. Wohin sie auch flog, er war stets in ihrer Nähe. Er war im wahrsten Sinne des Wortes von ihr gefangen. Sie aber wollte nichts von ihm wissen, denn sie war völlig von der strahlenden Herrlichkeit der Sonne geblendet. Ihr wollte sie gehören und so kreiste sie fortan nur noch um sie. Der arme Mond schmolz vor unerfüllter Sehnsucht nach seiner geliebten Erde dahin. Er schenkte ihr alle seine Blumen, er versuchte, mit der Sonne um die Wette zu strahlen und verbrauchte dabei seine ganze Kraft. Er verlor zusehends seine Atmosphäre und mit der Zeit wurde er grau und die Erde meinte schon, er sei gestorben. Der arme Mond indessen ist keineswegs tot; er verzehrt sich in unverminderter schmerzlicher Liebe nach seiner Angebeteten. Und sein scheinbar so kaltes Herz pulsiert immer noch mächtig . Während sich die Erde einmal um ihre Achse dreht, schlägt es vier Mal. Und immer sendet es all seine Magnetkraft aus. Viele von euch Menschen können sie spüren. Die wandern dann in Nachthemden auf Dächern herum, während sie schlafen, oder sie werden streitsüchtig, oder besonders traurig, jedenfalls aber unruhig. Die Erde selbst tut so, als beeindrucke sie das alles überhaupt nicht. Nur ihre Meere haben tiefes Mitleid mit dem unglücklich verliebten Graukopf dort oben. Alle sechs Stunden, wenn sein sehnsüchtiges Herz einen seiner magnetischen Schläge tut, schwellen sie an und wollen förmlich über sich selbst hinauswachsen. Streben dem Mond zu und sinken ermattet wieder in ihre Betten zurück, wenn die Pause zwischen den Mondherzschlägen eintritt. Ihr Menschen sagt zu diesem Vorgang einfach Ebbe und Flut...“ Renzo hatte schon seit geraumer Zeit aufgehört sich Notizen zu machen, zu sehr war er von Wobaris Erzählung fasziniert und tief bewegt. Der Mond stand bereits hoch über ihm, denn bei Wobaris Sprechtempo waren für seine Erzählung mehrere Stunden vonnöten gewesen. Jetzt war der kleine moosbedeckte Kieselstein so ermattet, dass er übergangslos in tiefen Schlaf fiel. Sein grünes Kleid trocknete rasch und Renzo legte ihn zärtlich zu Boden neben seine Brüder, die anderen Steine. „Wir reden morgen weiter.“ sagte er leise, nahm einen tiefen Schluck Kiwisaft und lehnte sich zurück an den Stamm des goldenen Baumes. Dessen Glöckchenblätter glitzerten in freundlichem Wettstreit mit den sanften, glucksenden Meereswellen. „Es ist Ebbe...“ sagte Renzo langsam vor sich hin. Er hob den Kopf und schaute in die silberne Scheibe über ihm. Nach einer langen Weile flüsterte er: „Mein armer Freund — mein armer, armer, rastloser Freund!“ Ciano war schon seit ein paar Tagen nicht mehr auf Floripace gewesen. Er baute an einem Segelschiffmodell und die Arbeit nahm ihn voll in Anspruch. Den Rumpf hatte er aus einem einzigen Stück Holz geschnitzt, weil er wusste, dass die Schwimmfähigkeit davon abhing, wie tief der Schwerpunkt des ganzen Schiffes lag. Die Masten ganz gerade zu bekommen war keine leichte Aufgabe gewesen, weil es auf der Pirateninsel nur knorrige und krumme Gehölze gab. Nun war er gerade dabei die Reling aufzusetzen und sägte eifrig an den winzigen Verzierungen, die er sich ausgedacht hatte. Der alte Papagei Profax schaute ihm interessiert zu und gab dann und wann seine Kommentare ab. Seit Cianos Vater, der sich nach wie vor für einen direkten Nachfahren des legendären Piraten Claude de Forbin hielt, Profax im Tausch gegen die vermeintlich letzte Wahrheit um das Weltengeheimnis von seiner Kette befreit hatte, war diesem das Fliegen gar nicht mehr so wichtig. Wie sehr er sich vordem auch danach gesehnt hatte, „nur ein einziges Mal rund um die Burg zu fliegen“, so sehr hatte ihm das große Abenteuer der missglückten Schatzsuche sozusagen die Flügel gestutzt. Dass sie alle, El Forbinio, seine fünf Kumpane und er, Profax selbst, damals nur knapp dem Tod entronnen waren, hatte ihn gelehrt, dass es wohl das Beste sei, die Sterne dort zu lassen, wo sie hingehörten und nicht nach ihnen zu greifen. Er war auch nicht mehr so missmutig und zynisch wie früher. Er war zu einem wirklich weisen, alten Papagei von immerhin bereits hunderteinundzwanzig Jahren gereift. Die meiste Zeit des Tages verbrachte er in Gesellschaft Cianos, vorausgesetzt der war nicht gerade bei seinem großväterlichen Freund Renzo Floriani und lernte von diesem die Wahrheiten und Geheimnisse des Lebens und der Welten. Dann und wann flog Profax selbst noch die drei Meilen von der Pirateninsel hinüber auf Floripace, um sich mit Renzo Floriani zu unterhalten, oder einen Schwatz mit Flirr zu halten, den als guten Freund er gewonnen hatte. „Zinggg!“ machte es in diesem Augenblick und Cianos Laubsägeblatt war entzwei. „Verflixt!“ rief der Junge aus, „Das war mein letztes! Und ich hab noch drei Schnecken für die Bugverzierung zu sägen!“ „Der Alte hat sicher noch ein paar Sägeblätter unten in seiner Werkstatt!“ riet Profax beruhigend. „Meinst du?“ sagte Ciano. „Na, schön, ich werd’ ihn einmal fragen.“ Er stand auf und lief zur Tür. Als er die steinerne Wendeltreppe hinunter stieg hörte er bereits nach drei Windungen Stimmengemurmel. Er konnte nur Bruchstücke von Sätzen und wenige Worte verstehen, aber am Tonfall der Stimmen erkannte er, dass Vaters Kumpels anscheinend an irgend einer Art Verschwörung arbeiteten. Er hielt inne und lauschte. Der alte Versammlungsraum, in welchem die „Piraten“ rund um den gewaltigen Zedernholztisch ihre Konferenz abhielten, lag aber zwei Stockwerke tiefer, und das Echo ihrer Stimmen brach sich an den steinernen Wänden der Stiegenhausschnecke so rasch, dass ein Verstehen der Diskussion unmöglich war. Ciano war weit entfernt davon, etwa zu spionieren, aber dann stach plötzlich Tonios Stimme aus dem Gewirr heraus und er vernahm die Worte: „... braucht doch seine Mutter!“ Ciano fühlte, wie sich sein Magen plötzlich ein wenig zusammen zog, und der Puls begann zu hämmern. Ohne es zu wollen, wie an unsichtbaren Schnüren gezogen, bewegte er sich vorwärts, die Stiegen hinunter. Er wusste aber, dass er nicht weiter als höchstens noch ein Stockwerk tiefer steigen durfte, weil nach der nächsten Kurve die Stiegenhausbeleuchtung seinen Schatten an die Wand werfen würde, und der war dann vom Versammlungsraum aus zu sehen. Er setzte sich auf eine Stufe und hielt den Atem an. Zu verstehen war immer noch sehr wenig, aber er konzentrierte sich und merkte mit großer Verwunderung, dass sich das Gespräch um ihn zu drehen schien. Doch dann tauchte immer wieder das Wort „Mutter“ auf.... Ciano drehte sich alles vor den Augen. „... wo sie sein könnte...“ Das war Gilbert, der Matrose. Dann ging wieder alles ein paar Minuten wild durcheinander. Danach trat einige Sekunden Stille ein, und plötzlich klang Vaters Stimme ganz deutlich und Ciano verstand jedes Wort: „... sie wollte immer ein wenig hoch hinaus. Ich konnte machen was ich wollte, sie fühlte sich hier nie so richtig wohl...“ „... hast sie ja auch eingesperrt...“ glaubte Ciano Paco, den Spanier, zu vernehmen. Neues Wirrwarr setzte ein, dazwischen fielen Worte wie: „... ihr eigenes Leben...“, und dann rief Dimitri, der Bulgare, schrill: „... Mann und Kind im Stich gelassen!“ „... war doch noch so jung, damals!...“ dröhnte Wambos Bass. Cianos Herz raste. Kalter Schweiß bedeckte seine Stirn. „Mutter!“ hörte er sich krächzend flüstern. Seine Mutter war nur ein ferner Traum für ihn. Er wusste nicht einmal wie sie aussah. El Forbinio hatte alle Bilder und Fotografien in eine Truhe gesperrt und er sprach auch niemals ein Wort über seine Frau. Ciano wusste nur von Renzo, dass Mutter eine wunderschöne und äußerst kluge Frau sei, die den wilden und von allerlei Fantasien erfüllten El Forbinio vor langer Zeit im fernen Europa kennen — und lieben — gelernt hatte, und dass sie damals mit ihm auf diese Insel hier im Indischen Ozean gezogen war. Er hatte sie vergöttert und versucht, ihr jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Er hatte Tag und Nacht geschuftet und gerackert, um ihr das schönste Leben zu bereiten, das es seiner Meinung nach gab. Aber sie fühlte sich in den engen Burgmauern wie eingekerkert, hatte bald Sehnsucht nach dem Trubel einer Stadt, nach Freunden, und vor allem nach einer sinnvollen Betätigung. Sie wollte ihr Studium der Technikwissenschaften fortsetzen und einen interessanten Beruf ausüben. El Forbinio fühlte mit großem Kummer, dass sie sich innerlich immer weiter von ihm entfernte und verdoppelte seine Anstrengungen, sie glücklich zu machen. Eines Tages war sie dann verschwunden. Und er hatte an seiner Schatzsuchmaschine gebaut wie ein Besessener, wohl auch von der falschen Vorstellung getrieben, wenn er erst der reichste Mann der Welt sein würde, dass seine geliebte Frau dann zu ihm zurückkehrte. Nun, die Schatzsuchmaschine gab es ja, gottlob, nicht mehr. Vater hatte eingesehen, dass alle Schätze dieser Welt kein Glück, und schon gar keine Liebe, erkaufen können. Aber Mutter liebte er immer noch, und mit einem Mal wurde Ciano klar, dass all das brummige und schroffe, manchmal auch jähzornige, Verhalten seines Vaters seine Ursache in der Trauer um seine verlorene Frau hatte . Tränen schossen über Cianos Wangen, und sein Hals war wie zugeschnürt. Wo mochte Mutter nur sein? Wo, auf dieser riesigen Welt, sollte man zu suchen anfangen? Da hörte er Tonios Stimme: „... sie will auf ihre Weise glücklich sein!...“ Wieder murmelten alle Stimmen gleichzeitig durcheinander, dann verstand Ciano mit Riesenschrecken die Worte Gilberts: „... Ach, die lebt einfach auf dem Mond!“ Ciano wurde schwarz vor Augen. Sein Blut gefror fast zu Eis und das Herz drohte stillzustehen. Er raffte sich hoch und wankte keuchend die Treppe wieder hinauf in seine Stube. Profax fuhr aus einem Nickerchen hoch. „Was ist denn mit dir passiert?“ krächzte er erschrocken. „Du bist ja bleich wie ein Gespenst und schwitzt wie Wobari, wenn er ‚guten Morgen` sagen muss...!“ Ciano lehnte sich stöhnend an die Steinmauer neben dem Türstock. „Meine... meine... mei...“ brachte er mühsam hervor, „... Mutter ... sie... sie lebt... sie lebt...“ „Na wunderbar!“ rief Profax freudig. „... Sie lebt... auf ... DEM MOND!“ schrie Ciano und brach in heftiges Schluchzen aus. Profax legte den Kopf schief und raspelte mit dem Schnabel, weil er nachdenken musste, und immer mit dem Schnabel raspelte, wenn er nachdachte. Ciano schluchzte immer noch und schließlich sagte Profax langsam: „Kann ich mir schwer vorstellen, weißt du...?“ „Warum...?“ fragte Ciano, tränennass. Und so etwas wie ein Hoffnungsschimmer wollte sich ihm zeigen.



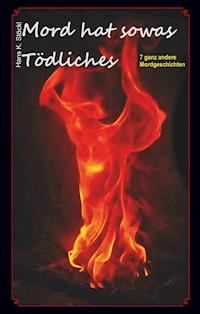














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










