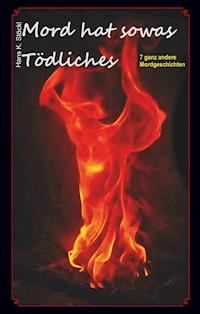
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Irgendwo wird eine Leiche gefunden, der Herr Kommissar, Inspektor, oder Privatdetektiv taucht auf, beginnt herum zu schnüffeln, fragt möglichst vielen Leuten Löcher in die Bäuche, um möglichst viele Möglichkeiten zu eröffnen, wer denn am Ende als Täter entlarvt werden kann, und immer ist es dann eine oder einer mit dem man nicht gerechnet hat. Nicht immer der Gärtner, manchmal ist es auch der Butler, oder die Gouvernante. Aber es ist immer das gleiche Rätsel nach genau dem gleichen Schema. Hans K. Stöckl geht einen ganz anderen Weg bei seinen Geschichten. Ihm geht es nicht um die Auflösung eines Rätsels. Ihn interessiert bei einem Verbrechen das Wie, das Warum, und vor allem, was dazu geführt hat, dass Konflikte letztendlich in einer unumkehrbaren menschlichen Katastrophe geendet haben. Was hat die Spirale in Gang gesetzt, die die Beteiligten in einen Strudel gerissen hat, aus dem es kein Entkommen mehr gab? In Stöckls Geschichten gibt es keinen Oberschlauberger, der am Ende einen Täter präsentiert, sondern die Leserin / der Leser wird vom ersten Satz weg detailliert, und eben ohne verschleierndes Geheimnis, mit der Vorbereitung zur Tat, und letztlich mit deren Durchführung konfrontiert. Die Spannung ergibt sich nicht in der Erwartung einer konstruierten Auflösung eines Falles, sondern aus dem unmittelbaren Miterleben der Ereignisse aus der Täterperspektive, bzw. der an der Tat beteiligten Protagonisten. Alles in allem, eben ganz andere Mordgeschichten als gewohnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sämtliche in diesem Buch beschriebenen Begebenheiten, sowie handelnde
Personen und Schauplätze sind vom Autor völlig frei erfunden.
Sollten sich im realen Leben Ähnlichkeiten mit lebenden oder
toten Personen, oder mit relevanten Ereignissen ergeben, wäre dies
rein zufällig, und vom Autor in keiner Weise beabsichtigt!
Inhalt
Tödliche Kopie
Eine Mauer bricht ihr Schweigen
Himmlische Gerechtigkeit
Brüderlicher Tod
Selbst ist der Mord
Eine Lüge zu viel
Diese alten Geschichten...
Tödliche Kopie
„Es war kurz vor 2 Uhr früh,“ schilderte der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr in den ersten Fernseh-Frühnachrichten, „da wurden wir zu einem Gebäudebrand in der Stierzeile in Stranzendorf gerufen. Bei unserem Eintreffen stand der große Stadel, wo ein Maleratelier drin war, bereits in Vollbrand.“
Seine Bemühung Hochdeutsch zu sprechen und vorschriftsmäßig zu formulieren wirkte bei allem Ernst der Angelegenheit in seiner steifen Verkrampftheit etwas komisch. Der gute Mann war ein hervorragender Feuerwehrmann, der weder Tod noch Teufel fürchtete, wenn es galt sich für Leib und Leben Anderer einzusetzen. Aber er bekam rote Ohren, wenn er öffentlich reden sollte.
Die Hörer, denen weder dieses Gebäude, noch die Ortschaft Stranzendorf ein Begriff waren, schmunzelten denn auch mehr über die Ausführungen des wackeren Florianijüngers, als dass sie Entsetzen oder Bedauern über den Verlust eines Stadels empfunden hätten.
„Wegen der starken Rauchentwicklung“, fuhr der Feuerwehrmann fort, „war es vorerst nicht möglich den Brandherd zu lokalisieren. Alsdann mussten zwei Atemschutztrupps vor geschickt werden, die was feststellten, wo er lag, der Brandherd. Trotz Einsatz von zwei Drehleitern und intensiver Brandbekämpfung war das Gebäude zum Schluss nicht zu retten. Die undurchdringlichen schwarzen Rauchmassen sind durch das Verbrennen von Chemikalien, besonders Leinöl, Spiritus und Terpentin, sowie mehrerer Kisten voller Ölfarben entstanden. Als schließlich der gesamte Dachstuhl einstürzte, entstand durch den Luftdruck eine plötzliche Sauerstoffzufuhr, wodurch die Flammen wie ein starker großer Blitz aufleuchteten, und da sahen wir, dass in dem Gebälk eine menschliche Gestalt an einem Strick gehängt ist! Der Strick war aber kein Strick... also, kein Hanfstrick, sondern ein Drahtseil, das was sich, wie es durch das Feuer zu glühen begonnen hat, in das Fleisch vom Hals eingeschnitten hat, von vorne bis auf die Wirbelsäule durch... Ich selbst habe in meiner ganzen Zeit als Feuerwehrmann so etwas noch nie erlebt gehabt... Das war für uns alle ein mörderischer Schock.“
Er schluckte, und man sah diesem großen, kräftigen Mann an, dass ihn trotz der langjährigen Erfahrung dieser Einsatz mehr mitgenommen haben musste, als man es von den hart gesottenen Feuerwerkern zumeist annimmt.
Die grunddumme Reporterfrage „Wie haben Sie sich dabei gefühlt?“ überging er. Er schluckte, und berichtete weiter: „Wir haben dann noch bis in der Früh alle unsere Kräfte eingesetzt um den Brand unter Kontrolle zu bekommen, und ein Übergreifen auf die Nachbargebäude zu verhindern.“
„Und weiß man schon Näheres über den Toten?“ fragte der Reporter. „Ist es wirklich Gernot Prebichler,... also, Ger-Schwer-Not-Sonnenstrahl, wie wir ihn alle unter seinem Künstlernamen kannten?“
Der Feuerwehrmann antwortete nicht gleich. Er atmete einmal tief ein, dann sagte er: „Als wir den Brand soweit unter Kontrolle hatten, dass wir zu dem Gehängten vordringen konnten, da war das nur ein...“, er suchte nach Worten, „es war gar nicht mehr als Mensch zu erkennen!... Nur noch ein zusammengekrümmtes, total verkohltes...“.
Nun waren auch jene Zuhörer ernst geworden, die vorhin noch über die Aussprache und Ausdrucksweise des Feuerwehrmannes gegrinst hatten.
Im weiteren Tagesverlauf wurden dann von Nachrichtensendung zu Nachrichtensendung immer mehr Details bekannt.
Brandermittler Ing. Josef Fraisinger schloss bereits nach ersten Ermittlungen einen technischen Defekt, wie Kurzschluss eines Heizgeräts oder ähnliches aus. Ebenso schied eine achtlos liegen gelassene Zigarettenkippe als Brandursache aus.
Nachdem schon die erste Begehung ergeben hatte, dass es in dem Stadel nicht nur einen, sondern mehrere Brandherde gegeben hatte, schloss der Experte dass es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um eine „subjektive Handlung“ als Brandursache handeln musste.
Auf gut Deutsch, dass das Feuer gelegt worden war.
Was die Identität der verkohlten Leiche betraf, waren sich die Ermittler sicher, dass es sich nur um den Besitzer des Stadels, also, um den Maler Gernot Prebichler, alias Ger-Schwer-Not-Sonnenstrahl handeln konnte. Um wen wohl sonst?
An den verkohlten Resten der Eingangstür fand sich das Türschloss samt Schlüssel. Der Schlüssel steckte in der zum Hausinneren zeigenden Seite. Der Schlossriegel befand sich im doppelten Schließzustand. Das heißt, die Tür war von innen durch zweimaliges Drehen des Schlüssels versperrt gewesen.
Der Maler hatte ganz offensichtlich alles Brennbare, wie Farben, Verdünnungen, Fixierer, Öle und Reinigungsmittel als Brandbeschleuniger im Stadel verschüttet, dann angezündet, und sich zuletzt in die vorbereitete Schlinge fallen lassen.
Eine ungeheure Inszenierung!
Er hatte zu seinem Selbstmord ein gewaltiges Schauspiel komponiert, das allerdings kein Publikum gefunden hatte. Womöglich hatte er noch „Der Weg nach Walhall“ aus dem Requiem von Richard Wagner aufgelegt! Das konnte aber nicht festgestellt werden, weil auch die Stereoanlage nur noch ein Klumpen zusammengeschmolzenen und verkohlten Kunststoffs war.
Wie später die Psychologen erklärten, entsprach aber genau das dem Seelenzustand des Malers. Er befand sich offenkundig schon vor seinem ersten Selbstmordversuch vor drei Jahren in einem Zustand eingeengten Tunneldenkens. Er lebte in einer Fantasiewelt, die mit der realen nicht in Kontakt stand.
Die Kommunikation mit Menschen seiner Umgebung geschah rein mechanisch und beschränkte sich auf eingelernte Verrichtungen, wie Einkaufen, Abwicklung von Bankgeschäften und all das. Aber diese Dinge berührten sein Inneres nicht. Er lebte in seiner eigenen, ganz anderen Welt. Und in dieser Welt fanden die großen Tragödien statt, wie er sie auch in seinen Bildern so genial zum Ausdruck brachte.
Diese Bilder hatten ihn einmal reich gemacht. Er war von einer Preisverleihung zur nächsten gereicht worden, hatte Verdienstkreuze und Würdigungen erfahren, wie kaum ein Anderer vor ihm, und ist an seiner Berühmtheit und an all den Huldigungen zerbrochen, wie einst etwa Elvis Presley oder Marylin Monroe.
So verstanden es die gelehrten Diplom-Seelendeuter.
Gernot Prebichler war ein typisches Kind von 68er Eltern. Er hatte seinen Vater, seit er sprechen konnte, nur „Kumpel“ genannt, und es war für ihn völlig normal, dass seine Mutter weder kochen konnte, noch jemals einen Knopf an ein Hemd oder auch an die eigene Bluse zu nähen imstande war, dafür aber die besten Joints zwischen Gramatneusiedel und New Orleans kurbeln konnte, und noch mit 40 ihre Rastalocken verfilzen ließ.
Er hatte nie ein wirkliches Talent zum Zeichnen gehabt, seine Beobachtungsgabe war auch nicht die beste; er konnte einen Würfel nicht von einem Quader unterscheiden und eine Pyramide nicht von einem Kegel.
Farbenlehre war ihm völlig egal, genauso wie Perspektive oder Anatomie. Ornamente waren ihm ein Gräuel, weil er jedwede Gesetzmäßigkeit verabscheute.
Sein „Ding“, wie er es nannte, war der Aktionismus. Die komplette Anarchie in der Kunst. Regellos, zügellos, kompromisslos, talentlos, arbeitslos, Brieflos.
Seine Bilder entstanden meist während wilden Partys, bei denen allerlei verbotene Substanzen das Buffet ersetzten.
Da wurde beispielsweise der Hintern einer willfährigen jungen Dame dick mit verschiedenen Farben beschmiert, und dann wurde sie sitzend auf der auf dem Boden ausgebreiteten Leinwand auf und ab bewegt. Ihr farbiges Gesäß wurde so zum Stempel, mit dem die Farbe auf die Leinwand gedrückt wurde. Dazu wurde mit einem großen runden Pinsel aus gerade greifbaren Dosen unter dem Gejohle der Partygäste Farbe verspritzt. Das Ergebnis taufte er dann „Heilige Marille Mutter Gottes“.
Sein wahres Talent bestand aber in seiner teuflisch suggestiven Rednergabe, in seiner unübertrefflichen Fähigkeit Menschen vom Gegenteil dessen zu überzeugen wovon sie noch vor einer Minute begeistert geschwärmt hatten, und vice versa.
So hatte er seine erste Galeristin schon nach Minuten davon überzeugt, dass seine Bilder alles übertrafen was es bisher an Aussageintensität, an explosiver Verinnerlichung und tiefst innerer Offenbarung kosmischer Geheimnisse je gegeben hatte.
Dann hatte er ihr noch eine weiße Straße aufgelegt, und nachdem sie sie gemeinsam tief eingesogen hatten, und er ihr das Pulverkrönchen von der Nasenspitze geküsst hatte, verschaffte er ihr mehrere multiple Orgasmen, und sich selbst eine namhafte, unbezahlbare Galeristin, die ihn in der Szene bald zum glühend ersehnten Messias machte.
Und er erzielte seine ersten fünfstelligen Preise.
Und weil die Frau Galeristin selbst alles andere als eine Heilige Marille war, und sich ihre Kettenorgasmen auch anderswo in der Szene besorgte, multiplizierte sich der Ruhm Gernot Prebichlers so massiv wie einst die sieben Plagen.
Frau Olga Radkow-Böhmer verstand nicht nur viel von Männern, sondern sehr wohl auch von ihrem Geschäft.
„Mit diesem Namen kann ich Dich nie nach New York bringen!“ hatte sie schon nach der ersten gemeinsam eingesogenen Straße erklärt. „Du brauchst was völlig Abstraktes! Was total Abgefahrenes. Es muss so nichtssagend sein wie Deine Bilder. Nur wenn die Leute etwas vorgesetzt bekommen mit dem sie gar nichts anfangen können, weil sie keinen Durchblick haben, bleibt es für sie interessant. Nur dann kannst Du ihnen alles einreden! Da kannst Du behaupten, Du kämest vom Planeten Zwirsch, und sie würden es sofort glauben. Nichts liebe ich mehr als diesen gewissen Kuhblick auf den Vernissagen!“, sie lachte schallend, „Wenn sie vor den Bildern stehen, diese Rindviecher, blöde glotzen, weil sie absolut null Ahnung haben; und wenn sie dann zu schwadronieren anfangen, lach’ ich mich schief!“.
Sie schlang die Beine um seinen Hals und ließ sich zurück sinken.
„Du bist haargenau der Scharlatan den diese Epoche braucht!“ sagte sie mit einer Leichtigkeit und überzeugenden Selbstverständlichkeit, die jedes gegenteilige Argument ausschloss.
Es war ihm vollkommen egal dass sie ihn Scharlatan nannte, und seine Bilder nichtssagend. Er wusste vom ersten Moment an, dass diese Frau sein goldenes Kalb war. Oder besser, seine goldene Kuh, die er fürderhin kräftig zu melken gedachte.
Schon beim Frühstück ging sie daran einen Künstlernamen für ihn zu konstruieren, der genau diese verschwommene, gar nichts sagende Pseudogeheimnisbotschaft darstellen sollte, die ihr großes Verkaufsargument werden würde.
Und ihr Konzept schlug voll ein! Ger-Schwer-Not-Sonnenstrahl wurde ein Markenzeichen. Es wurde für jeden, der diesen Namen einmal gehört hatte, zu einer Art Ohrwurm, oder Gedankenwurm. Man wurde diese kuriose Wortschöpfung nicht mehr los.
Und wenn man jemals eines dieser Schütt- Sprungpinsel-Kreuzquer-Bilder im Zusammenhang mit dem Namen Ger-Schwer-Not-Sonnenstrahl zu Gesicht bekam, war man überzeugt, dass es etwas ganz besonders Mystisches, Gralhaftes bedeutete.
Dazu hatte ihm Frau Olga Radkow-Böhmer auch noch ein optisches Erscheinungsbild verpasst, das den Eindruck des Hohepriesters und Messias nur noch bestätigte: Meister Ger-Schwer-Not-Sonnenstrahl trat in der Öffentlichkeit nur noch in einer ultramarinblauen, mit fahnenroten Borten eingesäumten Toga auf. Und meistens trug er dazu einen leuchtend grünen, gestutzten Zylinder und glänzend schwarze Reitstiefel.
Sie frühstückten nicht nur gemeinsam, sie scheffelten auch gemeinsam Geld!
Eine Party folgte auf die andere, Sex, Drugs and Barock ‘n’ Roll wurde ihr gemeinsamer Lebensinhalt.
Alles was in der Stadt glaubte irgend eine bedeutende gesell schaftliche Wichtigkeit darzustellen, sah es als Adelsprädikat an, bei Maestro Ger-Schwer-Not-Sonnenstrahl einmal persönlich eingeladen zu werden.
Politiker rauften sich förmlich darum, in Wahlzeiten mit ihm gemeinsam fotografiert zu werden.
Und dafür hängten sie ihm eine Ehrenmedaille nach der anderen um, und laudierten bei den Ehrungsfestivitäten um die Wette. Und bald wussten nur noch die vollkommen Ungebildeten, dass diese Bilder nichts als Schmierereien waren, wie sie jedes Affenbaby zuwege brachte.
Ger-Schwer-Not-Sonnenstrahl, vulgo Gernot Prebichler, hielt Vorträge auf der Akademie, und selbst die konservativsten Professoren hingen gebannt an seinen Lippen.
Seinem singulären Redetalent war keine noch so fundierte Kritik gewachsen.
Es gab nur einen einzigen Zeitungsjournalisten namens Albert Otter, der es wagte gegen den Strom zu schreiben. Er war vor einigen Jahren einmal bei einer dieser frühen Orgienpartys dabei, als noch niemand Ger-Schwer-Not-Sonnenstrahl kannte, weil dieser noch Gernot Prebichler hieß. Und da wurde gekifft, gekokst, und geschluckt was die Dealer hergaben.
Es hatte nicht lange gedauert, und alle waren nackt. Der große Künstler hatte den ganzen Raum mit Malerleinwand ausgelegt, und überall kleine Batzen Farbe verteilt. Ein Musikstudent hatte sein Saxophon ausgepackt und erging sich im Aufheben jeglicher Tonalität, erfand spontan die Dreizehntonmusik und erklärte das Geräusch zum Klang.
Dazu begannen die Anwesenden, die allesamt optisch wie akustisch keine klaren Konturen mehr erkennen konnten, mit ihren nackten Körpern die Farbbatzen auf den Leinwänden zu verteilen, indem sie sich kopulierend auf dem Boden wälzten.
Der Journalist, noch einigermaßen jung, und nicht so sehr auf Drogen aus, dem gemäß nüchtern genug, nahm die Geschehnisse mit wachsendem Staunen auf. Er hatte derlei zuvor noch nie gesehen, und schrieb daher seinen Bericht voll von Emotionen, so als wäre er Zeuge des Garagenmassakers vom Valentinstag in Chicago gewesen.
Besonders erschüttert hatte ihn die Beobachtung dass der Maler Prebichler die wild beschmierten Leinwände nach und nach unter den nackten Menschenknäueln hervor zog, und sorgsam in den Nebenraum trug.
Und als er Prebichler darauf ansprach, erklärte ihm dieser: „Na, sind sie nicht fantastisch? Ein Bild schöner als das andere! Ich muss sie nur noch signieren!“.
Albert Otter, der junge Journalist, hielt das anfangs für einen Scherz, für einen Partygag, aber als ihn Prebichler fragte: „Na, was hast Du gedacht, wie ich meine Bilder mache?“, dämmerte ihm so einiges.
Aber als er dem Chefredakteur seinen Artikel vorlegte, und ihn dieser kurz überflogen hatte, musste er sich eine 10-minütige Belehrungsrede anhören. Die Quintessenz daraus lautete:
„Junger Mann, ich sehe, Sie müssen noch vieles lernen, wenn Sie in diesem Beruf was weiterbringen wollen! Denkmäler stürzt man erst um wenn das Regime wechselt, sonst fallen sie einem auf den Kopf!“
Albert Otters Artikel durfte nicht erscheinen, er legte ihn auf den Stapel der anderen abgelehnten in seinem Archiv, und vergaß in der Folge diese wüste Orgie und diesen wüsten Maler.
Die Zeit fuhr mit der Geschichte Achterbahn, und Albert Otter reifte zu einem ziemlich abgebrühten und mit allen Tinten gewaschenen Reporter des Satans heran.
Eine Zeit lang hatte er es als Gesellschaftsreporter versucht, trieb sich auf allen nur denkbaren Events herum, besuchte große Bälle, Empfänge, Premieren, und immer wieder Partys der gesamten Schickeria und haute volée.
Eines Tages hatte er genug von dem ganzen faulen Zauber und all den Narzissten und neurotischen Selbstdarstellern, und er wechselte ins investigative Fach.
Da musste er aber bald feststellen, dass sich die Protagonisten von seiner vorigen Klientel nur unwesentlich unterschieden.
Dann begab er sich für drei Jahre als Auslandskorrespondent nach New York, hatte auch das bald ziemlich satt, kehrte nach Hause zurück und war seither als Ressortleiter für Innenpolitik und Gesellschaft beim Wochenmagazin „Tagtuell“ tätig.
Für Kunst hatte er privat immer viel übrig gehabt, für den Kunstmarkt aber gar nicht.
Und am wenigsten für die Marktkunst.
Die weitere Karriere Gernot Prebichlers hatte er seit seinem abgelehnten Artikel nicht mehr verfolgt; die Werke Prebichlers hatte er noch nie für Kunst gehalten, und das Theater das um den großen Maestro Ger-Schwer-Not-Sonnenstrahl gemacht wurde, war ihm zutiefst zuwider.
Wie der ganze Mensch Gernot Prebichler, mit seiner egozentrischen narzisstischen Eitelkeit, und seinem präpotenten Zynismus gegenüber Konkurrenten, Kollegen, und natürlich Kritikern.
Die Kollegen von der Regenbogenpresse hingegen liebten ihren Ger-Schwer-Not-Sonnenstrahl.
Je weniger einer von ihnen von „moderner Kunst“ verstand, desto mehr schwafelte er in seinem Blatt über den „begnadeten Jetzt-Propheten“. So hatte ihn Michael „Mike“ Kopetzky vom monatlich erscheinenden Red-Carpet-Magazin genannt.
Dafür bekam er seine monatliche Einladung zu Meister Ger-Schwer-Not-Sonnenstrahls Schneeparty und durfte den Jetzt-Propheten duzen und „Geri“ nennen.
Albert Otter war in der Vorstadt aufgewachsen, stammte aus einfachen Verhältnissen, und empfand für diese hohle, aufgeblasene Event-Gesellschaft mit ihrem karikaturhaften, genäselten und immer fadisiert klingenden Schönbrunnerdeutsch nichts als Verachtung.
Der schreckliche Tod des großen Künstlers stürzte ihn nicht gerade in tiefe Trauer, oder verursachte etwa ein „tiefes Bewegtsein“, oder eine „schmerzliche Erschütterung“, wie seine Yellow-Press-Kollegen von sich behaupteten.
Nein, Albert Otter war nicht erschüttert, und nicht bewegt! Für ihn war alles ausschließlich von journalistischem Interesse.
Und so machte er sich auf den Weg nach Stranzendorf, um, wie es seine journalistische Gewohnheit war, und wie es sein Berufsethos verlangte, die Dinge an Ort und Stelle zu recherchieren, sich selber ein umfassendes Bild zu machen, und so viele Zeugen des Hergangs zu befragen wie nur möglich.
Die Beamten von der Spurensicherung waren gerade beim Einpacken, sie hatten ihre Arbeit abgeschlossen, alles fotografiert, dokumentiert, nummeriert, eingesackt und beschriftet.
Albert Otter zeigte seinen Presseausweis. „Darf ich mich schon umsehen?“ fragte er, und der leitende Beamte zuckte die Schultern. „Sehen Sie sich um, so viel sie wollen! Sie werden da außer Holzkohle und Asche nichts mehr finden! Der ganze Holzschuppen hat gebrannt wie Zunder.“
Otter hatte sich seinen zusammenklappbaren Feldspaten aus dem Auto geholt und begann, langsam wie eine Schnecke, die erst einmal feststellen muss ob nicht eventuell irgendwo ein Fressfeind lauert, mit kleinen Halbschritten, das immer noch leicht rauchende Trümmerfeld, das vor etlichen Stunden ein wunderschöner alter Heustadel gewesen war, zu durchwandern. Zwei kleine Schritte, dann blieb er stehen. Wieder ein, zwei Schritte, wieder Pause.
Den Kopf hielt er gesenkt und betrachtete jeden Quadratzentimeter eingehend. Hin und wieder schob er mit dem Spaten ein Stück verkohltes Brett oder ein noch dampfendes Stück von einem Balken zur Seite, schob Aschenhaufen auseinander, und sprach zwischendurch Notizen in sein Smartphone.
„Suchen Sie was Bestimmtes?“ rief schließlich der Einsatzleiter, der eigentlich schon gehen wollte. Otter hob den Kopf und sagte: „Wo sind die Bilder?“
„Was meinen Sie?“ fragte der Beamte.
„Haben sie irgendwo Reste von Bildern gefunden? Der Mann war ein bekannter Maler! Und er hat enorm viele Bilder... nun ja,...gemalt. Ich sehe nirgends eine Spur die auf einen Keilrahmen oder auf verkohltes Malerleinen schließen ließe! Er hat sicher ein paar hundert seiner Bilder hier gelagert gehabt. Wo sind die hin gekommen?“
Der Forensiker kam näher. „Naja,“ begann er, „das Feuer hat immerhin ein paar Stunden Zeit gehabt, und es war sehr heiß! Da bleibt von einem Fichtenholzrahmen und einem Stück bemalter Leinwand nichts übrig. Da müssten wir noch einmal gezielt nachschauen, und uns explizit auf Reste von Bildern konzentrieren. Aber, danke für den Hinweis! Ich werde das in meinem Bericht erwähnen.“
„Ich gehe davon aus,“ sagte Otter, „dass er hier mindestens zweihundert seiner großartigen Werke in Regalen aufbewahrt hat...“
„Was? So viel?“ rief der Beamte erstaunt. „Da muss einer doch Tag und Nacht malen...!“
„Na, bei seiner, ... äh, ... rationellen Maltechnik...“ grinste Otter, „kamen oft schon während einer einzigen Stunde zwanzig Bilder zustande!“
„Ach!“ lachte der Forensiker, „So eine Art Maler war das! Dann kann ich mir schon vorstellen dass es hier ein größeres Lager gegeben haben müsste. So wie Sie das sagen, müssten die Keilrahmen eng aneinander gereiht in einem Raum gestanden sein. Und selbst wenn das Feuer sehr heiß war, sagen wir bis 1.200 Grad, würde nicht alles zu Asche zerfallen. Man müsste auf alle Fälle wenigstens noch die Form des verbrannten Gegenstandes erkennen. Um welches Material es sich gehandelt hat, kann man im Labor leicht feststellen. Also, mit Öl- oder Acrylfarben bemaltes Leinen lässt sich sozusagen aus der Asche ganz einfach heraus lesen! Aber, wie gesagt, bei einem normalen Brand, so wie wir es hier vorgefunden haben, ist nicht anzunehmen dass sich alles in feines Aschenpulver verwandelt hat. Und ich kann mit Sicherheit sagen, dass mir während der gesamten Spurensicherung nichts aufgefallen ist das irgendwie an ein verbranntes Gemälde erinnert hätte. Wer weiß, wo er seine Bilder aufbewahrt hat!“.
Die Forensiker zogen endlich ab, und Otter stöberte noch eine gute Stunde weiter in den Aschenhaufen und Schlacken herum, wusste am Ende gar nicht mehr wonach er eigentlich suchte, aber eines wusste er mit Sicherheit: In dem ganzen Atelier hatte sich zu Beginn des Brandes kein einziges Bild befunden!
Und Albert Otter juckte immer mehr seine Nase...
Er suchte sich die Nummer von Olga Radkow-Böhmer heraus, und rief sie an.
„Ich habe schon lange keinerlei Verbindungen mehr zu Geri!“ sagte die Stimme aus dem Hörer. Sie klang keine Spur „erschüttert“ oder „tief betroffen“ über den Tod des ehemaligen Geliebten, es war wie der Tonfall der Telefonauskunft. Kühl, sachlich, ein wenig gestresst, weil sie den Termin beim Frisör nicht verpassen wollte. „Aber fragen Sie doch bei der Helga nach. Die macht jetzt seine Galeriegeschichten...“
„Helga?“ fragte Otter „Und wie weiter?“
„Na, die Steininger! Helga Steininger.“ sagte Frau Radkow-Böhmer, und jetzt klang ihre Stimme schon ein wenig gereizt. „Ich dachte, Sie kennen sich in der Szene aus!“.
„Ach so, die Steininger!“ sagte Otter, und hatte keine Ahnung wer das war. „Ah, die macht jetzt seine Galeriegeschichten?“.
„Ja, sie ist zehn Jahre jünger als ich, und hat einen größeren Arsch, wenn Sie es so genau wissen wollen! Und mehr Silikon in der Bluse!“
„Nein.“ sagte Otter ungerührt. „So genau will ich es gar nicht wissen.“
„Ja, was wollen Sie denn dann wissen? Wieso interessiert es Sie, wo das verblichene Genie seine Schmierereien gebunkert hat? Das Zeug wird hoffentlich mit ihm mit verbrannt sein! Dann bleibt der Welt dieser Anblick erspart!“.
Otter sah ein, dass ihn das Gespräch mit der offenbar eifersüchtigen Ex-Geliebten nicht weiterbringen würde und verabschiedete sich kurz und bündig.
„Also, Helga... Steininger.“ murmelte er, während er den Namen in eine Suchmaschine eingab.
„Ah, da haben wir sie ja!“
Er wählte die angegebene Nummer, aber es meldete sich niemand. Nach fünfmaligem Läuten sagte eine Stimme, dass er sich in der Mailbox der Nummer sowieso befinde, und eine Nachricht hinterlassen könne.
Er gab seinen Namen und Beruf an, und bat höflich um einen Rückruf.
Es erfolgte aber keiner. Nicht am nächsten, und auch nicht am übernächsten Tag.
Als er schließlich nach vier Tagen noch einmal die Nummer wählte sagte die Automatenstimme dass unter dieser Nummer kein Teilnehmer existiere.
Aha! Sehr interessant!
Er setzte sich ins Auto und fuhr zur Schlesingerstraße 28. Auf einem Messingschild neben dem Haustor prangte in eleganter Schreibschrift der Firmenname „Galerie Steininger“, und darunter „1. Stock / Lift“.
Er hatte nicht erwartet dass auf sein Klingeln jemand öffnen würde, wollte eigentlich nur Eindrücke sammeln. Wie sah diese Galerie aus? Was für Art Galerie war es?
Gut, die Adresse war durchaus präsentabel, und das alte Patrizierhaus sah auch einigermaßen nobel und teuer aus. Die Miete für eine Wohnung in dem Gebäude würde sicher mindestens doppelt so viel kosten wie sein gesamtes Monatsgehalt.
Der uralte Jugendstilaufzug kam majestätisch ächzend herauf gefahren, die metallisch laut schnappenden Geräusche widerhallten im Stiegenhaus.
Er wollte soeben wieder gehen, da öffnete sich die Aufzugstür und ein gut gekleideter Herr mittleren Alters, mit einem Aktenkoffer an der Hand trat heraus.
Albert Otter grüßte ihn höflich und fragte: „Verzeihen Sie, wohnen Sie hier im Haus?“
„Nein.“ sagte der Herr, „Ich habe hier nur mein Büro. Aber, ich sehe, Sie wollten wohl in die Galerie?“
„Ja,“ antwortete Otter, „Wissen Sie wann ich hier jemanden erreichen kann?“
Der Herr schaute automatisch auf seine Armbanduhr, was aber mit den Öffnungszeiten der Galerie nichts zu tun hatte; er schaute auf die Uhr weil er es eilig hatte. Dann sagte er: „Die Frau Steininger dürfte die Galerie dicht gemacht haben. Als die Nachricht vom Tod ihres Partners, dieses Malers, kam, da standen am selben Tag zwei Lastautos einer Spedition vor dem Haustor, und mehrere kräftige Burschen räumten alles aus was sich in den Räumlichkeiten der Galerie befunden hatte. Sämtliche Möbel, Beleuchtungskörper, Küchengeräte, einfach alles!“
Otter atmete tief ein, dann fragte er: „Und Bilder? Haben sie auch Bilder mitgenommen? Es müssen doch sicher eine ganze Menge vorhanden gewesen sein!“.
Der Herr schüttelte langsam den Kopf. „Das war ja irgend wie seltsam. Den ganzen Vormittag stand jede Menge Krempel unten auf dem Gehsteig herum, bis die das endlich verluden, aber ich habe keine Kisten gesehen, in denen sich Bilder befunden haben könnten! Die müssen wohl in einem anderen Depot gelagert sein.“
Otter kratzte sich das Kinn. „Oder sie haben sie schon vorher weggeschafft...“
„Tja, möglich ist alles.“ sagte der Herr, „Aber, entschuldigen Sie mich, ich hab’ absolut keine Zeit! Eine Klientin wartet auf mich. Auf Wiedersehen!“
Und er verschwand hinter der Eingangstür mit der Aufschrift „Rechtsanwalt Dr. Gerulf Wedekind“.
„Sie haben sie schon vorher weggeschafft...“ murmelte Albert Otter noch als er sein Auto startete.
*
Wenn Albert Otter noch eine halbe Stunde gewartet hätte, wäre er Zeuge einer dramatischen Amtshandlung geworden, die ihm erklärt hätte, warum nirgends Bilder des großen Meisters, oder wenigstens deren Reste zu finden waren.
Vor dem Haus hielt ein Dreieinhalbtonner Kastenwagen, und dahinter ein grauer VW-Kombi, sowie ein Polizeiauto. Dem großen Lastauto entstiegen drei Männer, die man für Wrestling-Superstars hätte halten können. Ihre Muskelpakete drohten die Hemden zu sprengen.
Aus der VW-Limousine kletterten drei Herren in Anzügen und Krawatten, bewaffnet mit Aktenmappen und Aktentaschen, sowie strengen Amtsmienen.
Und schließlich gesellten sich noch die beiden Uniformierten aus dem Polizeiauto zu der Gruppe.
„Erster Stock!“ sagte einer der Aktentaschenträger.
Er hieß Mag. Bruno Penzig und war seines Zeichens ein „gerichtlich bestelltes Vollzugsorgan“, mit der gerichtlich angeordneten Aufgabe eine „Beschlagnahme von privaten und betrieblichen Gütern“ der Galerie Steininger durchzuführen.
Die beiden anderen Herren waren Anwälte. Der Eine, Dr. Günter Mosbacher, vom Gericht bestellt, der Andere, Dr. Anton Grabner-Mayer vertrat die Galeristin, und hatte vom Gericht die Verständigung über den heutigen Termin erhalten. Da er in einer anderen Sache ohnedies im Gericht zu tun gehabt hatte, hatte er sich gleich den beiden Kollegen angeschlossen, und war im Dienstwagen des Mag. Penzig mit gefahren.
Der ganze Tross setzte sich in Bewegung und erklomm zu Fuß den ersten Stock.
Mag. Bruno Penzig drückte den Zeigefinger auf den Klingelknopf, man hörte von drinnen das mehrfache Echo eines dreitönigen Gongs.
Alle warteten mehr oder weniger gespannt, aber es geschah nichts. Mag. Penzig drückte noch ein paarmal auf den Klingelknopf, und schließlich sagte er, an die Polizisten gewandt: „Meine Herren, schreiten Sie zur Tat! Nehmen Sie meinetwegen ein paar Handgranaten!“.
Die Polizisten grinsten.
„Da brauchen wir einen Schlosser!“ sagte der Größere der beiden, und der Andere meinte: „Das ist eine Sicherheitstür, da wird ein Aufsperrdienst, oder ein einfacher Schlosser genau so viel Glück haben wie wenn wir das selber probieren!“
Mag. Bruno Penzig sagte unwirsch: „Ich habe hier die gerichtliche Vollmacht, mir – ich zitiere – notfalls unter angemessener Gewaltanwendung Zutritt zu den Räumlichkeiten... zu verschaffen!“.
„Herr Magister,“ erklärte der größere Polizist, „diese Tür hier kriegen Sie nicht so einfach auf! Da brauchen wir wirklich Fachleute!“.
Es dauerte ganze zwei Stunden, bis endlich ein Trupp bestens mit Werkzeug ausgestatteter Einbruchspezialisten zur Stelle war.
„Das haben wir gleich!“ versicherte der Partieführer.
Er sollte sich irren.
Als der Spezialist erst einmal die Bohrmaschine über dem Türschloss ansetzte und sich die ersten winzigen Stahlspiralen bildeten, ging plötzlich ein höllischer Alarmton los. Es heulte in einer infernalischen Lautstärke und hallte vielfach wieder in dem wunderschönen alten Stiegenhaus.
„Herrgott! Drehen Sie das doch ab!“ schrie Mag. Penzig.
„Können vor Lachen!“ brüllte der Partieführer. „Da müssen wir die Sicherungen ausschalten!“
„Na, so machen Sie das doch!“ drängte Penzig und hielt sich die Ohren zu.
„Ja, was weiß ich wo da der Sicherungskasten ist!“ rief der Spezialist, „Vielleicht im Keller? Gibt’s da keinen Hausmeister? Geh. Karl, schau einmal ob’s da einen Hausmeister gibt!“
Da öffnete sich die Tür zur Rechtsanwaltskanzlei, und der Herr Doktor Gerulf Wedekind kam persönlich heraus. „Um Gottes Willen, was treiben Sie denn hier?!“ schrie er durch den Lärm.
„Gibt’s hier einen Hausmeister?“ brüllte Mag. Penzig.
„Einen was?“
„Hausmeister! Wegen der Sicherungen...!“
„Wo gibt es denn in Wien noch einen Hausmeister?“ sagte Dr. Wedekind.
„Aber, der Sicherungskasten ist doch hier!“ Er deutete auf eine mit Wandfarbe übermalte Blechklappe an der Wand neben dem Treppenaufgang. „Warten Sie, ich hole einen Schlüssel!“
Die Einbruchspezialisten, die Polizisten, die Möbelpacker, und die drei Juristen standen da, lauschten dem anhaltenden Sireneninferno und warteten bis der Herr Doktor Wedekind mit einem Schlüsselbund wieder erschien. Große, kleinere und ganz kleine Schlüsseln der verschiedensten Art waren von einem Patentring zusammengehalten, und Dr. Wedekind probierte einen nach dem anderen aus. Der vierzehnte passte.
Die Klappe schwang auf, und ein großes an die Nischenwand geschraubtes Brett wurde sichtbar, in dem etwa zwanzig verstaubte und von Spinnweben eingehüllte Porzellansicherungen eingeschraubt waren. Unter jeder war auf einem Papieretikett mit Tintenbleistift, kaum noch lesbar, eine Ziffer geschrieben.
Der Obereinbruchspezialist trat herzu und begann kurzerhand eine nach der anderen heraus zu schrauben. „Eine muss es ja sein!“ sagte er grimmig.
„Um Gottes Willen, mir stürzen meine Computer ab, wenn der Strom unterbrochen wird!“ rief Dr. Wedekind und hetzte zurück in seine Kanzlei.
Zwei Minuten später waren alle Sicherungen herausgeschraubt, aber der Alarm plärrte unbeeindruckt weiter.
„So ein Blödsinn!“ sagte der kleinere der beiden Polizisten zu seinem Kollegen, „Diese Sicherungen sind seit Jahren tot! Die sind doch schon ewig verboten! Der neue Sicherungskasten muss wo anders sein. Wahrscheinlich wirklich im Keller.“
Der Große tippte den Einbruchspezialisten an der Schulter an und brüllte ihm ins Ohr: “Gehn’s, kommen’s einmal mit! Die Sicherungen sind wahrscheinlich im Keller. Wo sollen sie sonst sein?“
Endlich, alle hatten bereits Kopfschmerzen von dem schrecklichen Alarmgeheul, gelang es, die Kellertür, die mit einem einfachen Schloss gesichert war, zu öffnen, und da fand sich tatsächlich gleich hinter der Tür der moderne Plastik-Sicherungskasten. Den zu öffnen war kein Kunststück. Die neuen Schaltersicherungen waren alle ordentlich beschriftet, und genau nach Wohnungseinheiten bezeichnet.
Klack, und der Lärm war zu Ende! Alle atmeten erleichtert aus.
Wieder oben angekommen, sagte der Einbruchmann: „So, und wo stecke ich jetzt meine Maschinen an?“
Der große Polizist sagte: „Na, beim Rechtsanwalt! Der hat sicher auch ein Verlängerungskabel.“
Mit einem schweren Winkelschleifer, einem Gasschweißgerät, Bohrmaschine mit Diamantbohrer, etc. gelang es schlussendlich doch noch, an die verdeckten Scharniere der Sicherheitstür heran zu kommen, und sie schließlich zu zerschneiden.
Jetzt konnte die Tür nach innen aufgedrückt werden.
„Na bitte!“ triumphierte der Partieführer. „Wer kriegt die Rechnung? Das Gericht? … Ui, das wird wieder dauern, bis die zahlen!“.
Die Einbruchspezialisten rückten ab, und allen voran marschierte Mag. Penzig über die Türschwelle ins Innere der riesengroßen ehemaligen Herrschaftswohnung. Wunderschöne, sehr hohe Räume, überall Parkettböden, Stuck an Plafond und Wänden, Doppelflügeltüren, weiß lackiert, mit zarten Goldrähmchen rund um die Füllungen.
„Wie in einem Palast!“ sagte einer der Möbelpacker. Dann wandte er sich an seine Kollegen: „Aber, wir können wieder gehen, Burschen. Für uns gibt’s da nix zu tun!“.
Die ganze Großraumwohnung war vollkommen leer. Lediglich ein paar kleine Staubfahnen tanzten in der Zugluft.
*
Die Monate vergingen, die pompösen Begräbnisfeierlichkeiten samt Trauerreden hoher Politiker, waren noch eine Zeit lang im Internet als Videomitschnitt zu bewundern, die letzten Schlüpfrigkeiten aus Maestro Ger-Schwer-Not-Sonnenstrahl Privatleben erschöpften sich und die Leserschaften mit der Zeit; und ein blonder Tennisspieler plus schwarzem Verlobtem rückte auf die Titelseiten der Regenbogenblätter.
Aus den verkohlten Resten des Stadels in Stranzendorf sprießten die Brennnesseln und der Löwenzahn. Da und dort auch ein paar Klatschmohnblüten.
Das Motiv hätte Gernot Prebichler gefallen. Es hatte sowas Chaotisch-Archaisches und Anarchistisches.
Gernot Prebichler hatte keine Nachkommenschaft, keine lebenden Verwandten, welcher Art auch immer. Weder nah, noch entfernt.
Alle Gläubiger mussten sich mit dem Betrachten der Landschaft zwischen ihren gespreizten Fingern zufrieden geben. Sogar das Finanzamt.
Und eines Tages kamen dann die Bagger, das Grundstück wurde gesäubert, und bald darauf ein Fundament für ein Einfamilienhaus in die Baugrube betoniert.
Das Grundstück war mangels Erben oder Rechtsnachfolger versteigert worden, der Erlös wurde nach einem behördlich festgelegten Schlüssel auf die Gläubiger aufgeteilt, und der neue Besitzer ließ sich einen Energiesparwürfelbunker hinstellen. Sah aus wie ein platt gedrückter Flakturm, genauso hässlich, war aber angeblich gesünder zum Wohnen.
Im Dorf wurde nirgends eine Erinnerungstafel angebracht, das Grab des großen Genies befand sich auf dem Wiener Zentralfriedhof, hin und wieder legte jemand eine rote Rose neben die Grablaterne, aber die Zeitabstände wurden immer länger, und zum Schluss vertrocknete die letzte Rose, und es kam keine neue mehr.
Es hatte insgesamt nicht einmal ein Jahr gedauert, und Ger-Schwer-Not-Sonnenstrahl war zu einem Begriff geworden, den kaum jemand mehr in einem Quizspiel erriet.
Die Steuerbehörde hatte Frau Helga Steininger ja eine Zeit lang vergebens mittels eingeschriebener Ultimaten zur Begleichung einer Gesamtschuld im sechsstelligen Bereich aufgefordert, und nach dem großen Exekutionsfiasko unter der Leitung des Mag. Bruno Penzig letztendlich bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.
Seither lief eine Fahndung nach der Galeristin.
Das heißt, in Wahrheit kümmerte sich kein Mensch mehr um ihren Verbleib. Niemand suchte — im Sinn des Wortes — nach ihr. Lediglich ihr Name schien in diversen Listen auf, die bei den Zollstellen auf Bahnhöfen und Flughäfen gespeichert waren.
Es hätte schon ein Zufall sein müssen, dass einem Zoll- oder Grenzbeamten an einer ausreisenden Österreicherin irgend etwas aufgefallen wäre, das ihn veranlasst hätte ihren Pass mit den Fahndungslisten abzugleichen.
Sie war nicht prominent, hatte einen unauffälligen, typisch österreichischen Namen, hatte auch nichts Fremdländisches an sich, ein sympathisches und sicheres Auftreten, konnte überaus charmant sein, und sah noch dazu gar nicht schlecht aus. Also, wurde sie überall freundlich weiter gewinkt, und war dem gemäß sicher bereits irgendwo!
Das konnte Mauritius genauso gut sein wie Amsterdam, Wladiwostok oder Djibouti.
Höchst wahrscheinlich aber ein Land, mit dem Österreich keinen Auslieferungsvertrag wegen Steuerschulden hatte.
Und sie war ja nicht einmal gerichtlich verurteilt, also auch nicht vorbestraft.
Dort wo sie jetzt war, war sie mit absoluter Sicherheit sicher. Zumindest vor österreichischen Behörden.
Was in Österreich niemand ahnte, ja, niemand ahnen konnte, das war das sukzessive Auftauchen von Gemälden eines gewissen Ger-Schwer-Not-Sonnenstrahl in den großen Villen und Palästen von Marokko bis Saudiarabien.
Besonders begehrt waren Exemplare aus seiner Sonnen-Phase.
Die Scheichs waren geradezu süchtig danach, und Geld spielte für sie keine Rolle.
Für Frau Steininger schon.
Und sie erzählte den Herren in den bodenlangen weißen Kleidern alles was sie gerne hören wollten; welche Magie in den Bildern stecke, und welche unglaubliche Entstehungsgeschichte jedes einzelne Sonnenbild hatte.
Anfangs hatte sie sich noch sehr beherrschen müssen, um nicht laut los zu lachen, wenn sie eines ihrer Märchen auftischte. Sie wusste ja nur zu gut, wie die „Sonnen“-Bilder tatsächlich entstanden waren.
Geri, wie auch sie das „Malergenie“ genannt hatte, konnte ein richtig obszönes Ferkel sein, wenn er seine Besäufnis- und Bekiffungs-Koks-Orgien zelebrierte.
Und so hatte er in der „Sonnenphase“ gerade eine ganz andere Phase: Die Gesäße seiner Modelle wurden förmlich zur Obsession für ihn. Und so musste ihm jede der jungen Damen ein diesbezügliches Andenken hinterlassen. Dazu breitete er ein Stück Leinwand über einen Tennisball, patzte ein Häufchen gelber, oranger, oder roter Farbe oben drauf, und das Opfer musste sich mit ganzer Kraft darauf setzen, sodass sich der Tennisball überall dazwischen zwängte, wo das Fleisch nachgab.
Dann musste die junge Frau dem Meister das „bedruckte“ Stück Leinen aushändigen, und er spannte es auf einen Keilrahmen, und nannte das Ergebnis „Sonnige Erleuchtung“, oder „Einsame Sonne“, oder „Scheinsonne“ und so weiter.
Und als alle Sonnen untergegangen waren, das heißt, als jeder Scheich die seine in der Stube hängen hatte und keine mehr auf Lager waren, da folgte Frau Helgas nächster Streich.
„Die Schneeblüten“!
Das war für die Wüstensöhne überhaupt der ultimative Sinnenkick!
Frau Steininger fabulierte buchstäblich die Eiszapfen von den ägyptischen Pyramiden herunter, und die weiß betuchte Kundschaft erschauerte bei so viel Mystik und Eiseskälte.
Dabei waren sämtliche Bilder nichts Anderes als die sehr gebrauchten Leintücher (Bettlaken) der Betten, in welche die körperbemalten Partygästinnen nach dem Konsum mehrerer Schneestraßen und den daraus resultierenden Ekstasen gekippt waren.
Der große Meister hatte auch diese Tücher am jeweils darauf folgenden Tag zugeschnitten, auf Keilrahmen gespannt, mit Firnis überzogen und „Tanz der Schneeköniginnen“, „Sommerschnee“, oder „Glühender Schneesturm“, etc. getauft und deutlich sichtbar signiert.
Für fünfstellige Dollarbeträge im obersten Bereich waren die kleineren Bilder schnell weg, und die großen Schinken, um durchaus auch sechsstellige Summen brauchten zwar ein wenig länger, gingen aber schließlich auch alle weg.
Frau Helga Steininger hätte sich mit ihren 32 Jahren fast schon zur Ruhe setzen können und von den Bankzinsen auf ihren Konten ein angenehmes Leben führen können, aber dafür hatte sie viel zu viel Quecksilber im Blut, und viel zu viel Gier im Charakter.
Und was sie vor allem hatte, das war eine ganz bestimmte E-Mail-Adresse, mit der sie in regem Austausch stand. Allerdings unter dem Nicknamen „Strawinsky“.
Sowohl ihre als auch die Empfänger-Adresse war nicht rückverfolgbar, weil sie einen eventuellen Fahnder ausschließlich auf falsche Anmeldedaten zurück führte.
Und so packte Frau Helga Steininger, um einige Millionen reicher, eines Tages in einem Hotelzimmer in Kairo ihre Koffer, checkte aus, und begab sich zum Flughafen al-Qāhira ad-duwalī.
In ihrem Pass stand aber jetzt nicht der Name Helga Steininger, sondern Gabriele Wecker.
Sie hatte sich für Wecker entschieden, weil das leichter zu merken war als Schwenninger-Otzlich.
Das wäre der andere Pass gewesen, den ihr der Mann in der engen Gasse des Chan-el-Chalili für 200 Dollar angeboten hatte.
Frau Gabriele Wecker verließ Kairo an einem strahlenden Sommermorgen in einer Triple Seven-Maschine der Egypt-Air, und ließ Frau Helga Steininger für immer im Land der Pharaonengräber zurück.
*
Der internationale Kunstmarkt beschränkt sich im wesentlichen auf eine überschaubare Anzahl von wirklich bedeutenden Galerien, von denen wiederum nur eine Handvoll Länder übergreifend in mehreren Kunstmetropolen der Welt vertreten ist. Die meisten mittleren und kleineren Galerien bleiben in ihren Ländern und nähren sich mehr oder weniger redlich. Verglichen mit den New Yorker Galerien waren österreichische Unternehmen, wie das von Helga Steininger, oder auch Olga Radkow-Böhmer Zwerge. Ihre Nahmen kannte in den Staaten kein Mensch.
Um dort anerkannt zu werden und Fuß zu fassen musste man rackern wie eine Herde Wasserbüffeln, und es dauerte mitunter Jahre, bis man nur ein wenig mitreden durfte.
In der obersten Liga allerdings kennt „man“ sich untereinander. Die Kollegenschaft ist gleichzeitig Konkurrenz, Kunde und Käufer.
Böse Zungen sprechen von einem Inzestklub.
Das Zauberwort in Amerika, das alle Sesams öffnet, heißt aber nun einmal Geld! Geld, und immer nur Geld!
Wer genug davon hat, der kann sich alle Freunde kaufen die er braucht, um sogar Präsident des Landes zu werden.
Frau Olga Radkow-Böhmer war nicht reich. In Österreich hätte man sie als sehr gut situiert bezeichnet. Aber, um sich in der New Yorker Galerie-Szene einkaufen zu können, hätte sie wenigstens zehnmal so viel Geld gebraucht als sie hatte.
Als sie fünf Jahre nach den tragischen Ereignissen von Stranzendorf im Taxi über die Williamsburg Bridge kommend den Eastriver überquerte und der Chauffeur auf die Delancey Street hinunter lenkte, schaute sie sich mit skeptischem Blick die Häuserfassaden an.
„Keine Luxusgegend!“ dachte sie, und als hätte irgend ein Geist ihre Gedanken erraten, sprang ihr über einem kleinen Geschäftsportal ein Schild ins Auge: „BIG STORE FOR RENT!“.
Darunter war die Fläche in Feet angegeben, und Frau Olga versuchte es in Quadratmeter umzurechnen, gab es aber bald auf, weil auch die Dollaranzahl pro Quadratfuß keinen Sinn ergab.
„Downtown...“ Der Schlager fiel ihr ein. „Überall Chinesen... Eine miese Gegend. Verdammt laut, dreckig, und trotzdem teuer wie Salzburg oder Velden!“.
Das Taxi fuhr jetzt die Essex Street hinunter und sie fühlte immer mehr Abneigung gegen diese Stadt. Überall lautes Gehupe, und andauernd aus einer anderen Richtung Sirenengeheul von Polizei- oder Rettungsautos oder beidem gleichzeitig.
Als sie das letzte Mal in New York gewesen war, auf Einladung eines Kunden, hatte sie nur das elegante New York gesehen. Die Glitzerwelt. Die Viersternewelt.
„Well, ma’am,“ rief der Taxler, „here we are!“. Er nannte den Fahrpreis und machte keine Anstalten, ihr beim Aussteigen und mit dem Gepäck zu helfen.
Erst als sie ihm den Fuhrlohn samt Trinkgeld in die Hand drückte, kam Bewegung in ihn. Er stieg aus, ging um das Auto herum, öffnete den Kofferraum und stellte ihr mit Schwung ihre zwei Koffer und die beiden Taschen vor die Füße.
Dann drehte er sich um, tippte sich mit Zeige- und Mittelfinger salutierend an den Mützenrand, stieg wieder ins Auto, gab Gas, und weg war er.
Olga Radkow-Böhmer stand da, schüttelte den Kopf und murmelte zu sich selber: „Also, du machst Sachen! Wenn das nur gut geht!“
Dann holte sie ihre Geldbörse noch einmal hervor, entnahm ihr Notizbuch, studierte die eingetragene Adresse, als lese sie sie zum ersten Mal, und schaute sich dann in der Straße nach der entsprechenden Hausnummer um.
Es war das gegenüberliegende Haus. Der Taxler hatte nicht zufahren können, weil er sonst gegen die Einbahn hätte fahren müssen.
„Na schön.“ sagte Olga, gab sich einen Ruck und griff nach ihrem Gepäck. In jeder Hand einen Koffer und eine Tasche, das war allerhand Gewicht, und sie schwankte beträchtlich, als sie alles auf einmal über die Straße schleppte.
Die Autos hupten, einige Fahrer schrien im Vorbeifahren Unfreundlichkeiten aus ihren Fenstern, und fast hätte sie ein besonders Eiliger gerammt.
Aber schließlich schaffte sie es doch mitsamt ihren verdammt schweren Gepäckstücken das rettende Ufer zu er reichen.
Als sie vor der Hauseinfahrt stand und noch einmal die Nummer überprüfte, schoß ihr gleichzeitig noch einmal der Gedanke durch den Kopf, der sie seit dem Zeitpunkt wo sie ihre Unterschrift unter den Vertrag gesetzt hatte, periodisch alle paar Stunden immer wieder ein wenig Adrenalin kostete: „Auf was habe ich mich da eingelassen?“.
Zu spät! Rückzieher kommt nicht in Frage! Geht auch gar nicht mehr! Jetzt musst Du da durch, Olga! Und Du schaffst es! Verdammt, ja! Du musst es einfach schaffen!
Steven Roshinsky war ein Mann um die 50, einen halben Kopf kleiner als Olga, dafür doppelt so umfangreich.
„Welcome im großen Apfel!“ rief er, und umarmte Olga. Küsschen rechts, Küsschen links, dann sagte er fröhlich: „Willst Du was trinken? Wodka, Gin-Tonic, Bier, Coke?“
Olga war total außer Atem von der Kofferschlepperei, es war heiß, und sie schwitzte. Was ihr äußerst unangenehm war.
Dennoch musste sie das umfangreiche Begrüßungsritual höflich mit zelebrieren.
„Ein Bier wäre nicht schlecht.“ sagte sie und ließ sich in einen der abgewetzten Lederfauteuils fallen.
„Das ist recht! Eine Frau, die Bier trinkt, ist so gut wie jeder Mann!“ lachte Mister Roshinsky und öffnete den riesigen Kühlschrank, der über und über mit kleinen Magnetknöpfen bedeckt war, die alle möglichen Notizzetteln fest hielten.
Er holte zwei Bierdosen heraus, öffnete beide mit lautem Klack, und überreichte Olga eine davon. „Cheers! Auf unser Geschäft!“ trompetete er und stieß mit der Bierdose an.
Er fragte nicht, wie der Flug war, nicht wie es ihr ginge, rein gar nichts Persönliches.
Er kam ohne Umschweife zur Sache: „Also, was bringst Du mit?“
Olga hatte Probleme mit der Sprache. Ihr Englisch war nicht sehr umfangreich, und wenn Roshinsky schnell sprach, was er immer tat, verstand sie maximal die Hälfte, und die ganze Bedeutung entsprach meist nicht dem verstandenen Teil.
Sie versuchte ihm das klar zu machen, und er versprach darauf Rücksicht zu nehmen, sprach im nächsten Moment aber schon wieder wie ein Maschinengewehr.
Es war ungemein mühsam für sie. Sie sehnte sich nach einer Dusche, und hätte sich nur zu gern wenigstens für eine halbe Stunde auf ein Bett gelegt. Die elf Stunden im Flugzeug waren eine Tortur gewesen.
Aber Mister Roshinsky war unerbittlich. Er fragte ihr Löcher in den Bauch, und es war wie ein Verhör: Was der jeweilige Künstler für Reputationen hätte, wie man seinen Stil einordnen könne, ob er eine akademische Ausbildung hätte, wann und wo er bereits ausgestellt hätte, und so weiter, und so weiter.
Olga brachte insgesamt 14 österreichische Nachwuchstalente mit in die Geschäfts-“Ehe“ mit Mister Roshinsky.
Es war alles in allem ein abenteuerlicher Drahtseilakt.
In Wahrheit hatte sie gar nichts über Roshinsky gewusst, als sie mit ihm in Kontakt getreten war.
Auf einer ihrer Vernissagen hatte ein deutschstämmiger Amerikaner namens Thomas Mertens, der lediglich als Tourist zufällig herein geschneit war, mit ihr geplaudert. Er sprach sehr gut Deutsch, aber mit typisch amerikanischem Akzent.
Und als New Yorker, der immerhin in Manhattan, Upper Eastside, ganz in der Nähe der Carnegie Hall, ein paar Minuten vom Central Park, lebte, schilderte er ihr die dortige Kunstszene als unmittelbarer Insider.
Er sprach von den ganz großen und einflussreichsten Galeristen, wie Gavin Brown’s Enterprise, Howard Greenberg Gallery, und natürlich Blumarts, und Lumas NY-Soho, und was es so an weltweiten Spitzengalerien gab. Natürlich schilderte er auch was sich bei Sotheby’s und Guggenheim abspielte, aber das war natürlich alles eine Liga, die man ebenso kannte wie den Buckingham Palast in London, in dem man auch nicht zum Tee eingeladen wurde.
Aber dann erzählte Mister Mertens von den Backstage-Galleries, von der zweiten und dritten Garnitur, die alle in der internationalen Bedeutungslosigkeit rangierten, aber dennoch sehr gutes Geld verdienten. Im Vergleich zu europäischen Verhältnissen ein Vielfaches.
„Sie müssen verstehen, der Amerikaner, wenn er Geld hat, konsumiert Kunst genauso wie seine Hamburgers!“ er grinste. „Wenn ihm der Chicken-Burger eines Tages nicht mehr schmeckt, wirft er ihn weg, und kauft sich einen Speck-Burger! That’s America! Mit Bildern machen sie es genauso! Und wir Amerikaner sind ein Nomadenvolk!“ er lachte. „Wir ziehen immer dem Geld hinterher. Wenn eine Goldmine kein Gold mehr gibt, ziehen wir weiter, und bohren nach Öl! Und immer bauen wir schnell ein Haus in die Landschaft, hängen ein paar Bilder an die Wand, und wenn wir weiter ziehen, verkaufen wir den ganzen Plunder an einen anderen Nomaden, der gerade angekommen ist.“
Olga hörte ihm interessiert zu und saugte versonnen mit ihrem Trinkhalm den Prosecco leer.
Und Mister Mertens fuhr fort: „Und dafür gibt es die kleineren Galerien. Die verkaufen keine Picassos, eben nur Meiers und Müllers, aber dafür permanent! Und manchen Meier und Müller verkaufen sie sieben Mal. Und wenn sie ihn zum achten Mal verkaufen, kostet er bereits das fünffache! Und irgendwann landet Meier und Müller dann ja doch bei Sotheby’s oder bei Howard Greenberg. Es sind ja ständig die Headhunters unterwegs... Äh, möchten Sie noch einen Drink?“
„Wie bitte?...Ah, ja, bitte!“ Olga gab ihm ihr Glas, und er verschwand im Gewühl, kehrte aber schon nach ein paar Minuten mit einem vollen Proseccoglas zurück.
Olga klimperte ein wenig mit ihren langen Wimpern, lächelte ihr Verführerinnenlächeln und schenkte ihm das Gefühl für den Moment ihr Favorit zu sein.
Sie smalltalkten noch eine Zeit lang über dieses und jenes herum, Olga verstand es perfekt, einem Gegenüber Vertrautheit zu suggerieren, und je nachdem, wie sensibel derjenige war, fasste er das früher oder später als kumpelhafte Verschworenheit auf.
Mister Mertens hatte nicht lange dafür gebraucht. Er hätte ihr ohne Bedenken die Codes für seine Bankkonten anvertraut.
Und schon schilderte er ihr in allen Details die nicht immer hundertprozentig koscheren Geschäftspraktiken eines mit ihm befreundeten Kunstmaklers in Lower Manhattan.
Und, wie es in den Staaten durchaus üblich ist, sagte er ihr auch dessen öffentlich bekannten durchschnittlichen Jahresumsatz.
„Sie können davon ausgehen, dass es in Wahrheit mindestens das Dreifache ist!“ fügte er augenzwinkernd hinzu.
Naja, und dann gab er ihr die Adresse und Telefonnummer, die E-Mail-Adresse, den Skype-Namen dieses Freundes, und Olga saß Tags darauf bereits vor dem PC, nahm ihr gesamtes Schulenglisch zusammen und schrieb eine E-Mail an Mister Steven Roshinsky:
„Dear Mister Roshinsky, ich bin eine Österreichische Galeriebesitzerin mit bester Wiener Innenstadt-Adresse und ebensolchen Referenzen. Ich vertrete ganzheitlich 14 österreichische Maler, deren Marktwert ich innerhalb von drei Jahren um 300 % steigern konnte. Ich habe aus vertraulicher Quelle erfahren dass Sie fallweise Interesse an ausbaufähigen europäischen Künstlern haben...“
Das war der Anfang. Mister Roshinsky antwortete prompt und verlangte umgehend Fotos und Biografien der entsprechenden Künstler. Olga lieferte ebenso prompt.
Die nächste Kontaktaufnahme erfolgte bereits über Skype, und da konnte Olga natürlich voll Gas geben. Sie setzte alles an weiblicher Überzeugungskraft ein, was sie im Laufe ihres Berufslebens gelernt hatte. Typen wie dieser Roshinsky gingen ihr auf den Leim, schneller als sie ihren Namen sagen konnten. Sie war etwas über 40, und kannte alle Feinheiten der Funktion weiblicher Waffen.
Es erstaunte nur Außenstehende, dass sich die Beiden schon nach ein paar Wochen einig waren, dass sie gemeinsame Sache machen wollten. Roshinsky drängte sich samt „Haus und Hof“ geradezu auf, und Olga übergab die Sache ihrem Notar, der mit den Kollegen in New York alles an Papierkram abwickelte.
Dann brauchte Olga nur noch ein Visum und ein Flugticket.
Und da war sie jetzt. In einem ziemlich abgewohnten, schäbigen Wohnblock in Lower Manhattan, und einem Mann mehr oder weniger ausgeliefert, mit dem sie bis jetzt nur via Bildschirm kommuniziert hatte, und von dem sie nicht viel mehr wirklich wusste, als dass er ein geschäftlich mit allen Wassern gewaschenes Schlitzohr war.
Aber jetzt, wo sie ihm da gegenüber saß, wurde ihr klar, dass es ihr über kurz oder lang nicht erspart bleiben würde auf seine Annäherungsversuche der animalischen Art irgendwie reagieren zu müssen.
Sie betrachtete ihn unter halb geschlossenen Lidern und es entfuhr ihr ein kleiner Seufzer.
Es würde zu ertragen sein, dachte sie. Zur Zigarette nachher einen guten Martini, und einfach vergessen. Es hatte schon schlimmere Typen gegeben.
Das Apartment, das Steven Roshinsky für sie bereitgestellt hatte, war relativ sauber, nicht besonders geräumig, und mit Aussicht auf eine Tag und Nacht verkehrsdurchflutete Straße mit einem Geräuschpegel wie im Wiener Wurstelprater in der Hochsaison.
Sie stellte sich endlich unter die Dusche, schaffte es nach einigen vergeblichen Versuchen, die Wassertemperatur halbwegs erträglich einzustellen, und blieb erst einmal 10 Minuten nur so stehen. Und wieder hämmerte der Gedanke durch den Kopf, worauf, um alles in der Welt, sie sich da eingelassen hatte.
An das permanente, alles durchdringende Sirenengeheul der Polizeifahrzeuge werde ich mich nie gewöhnen, dachte Olga während sie ihre Koffer auspackte. Sie schloss das Schiebefenster.
Oh Gott! Ich halte diese Stadt jetzt schon nicht aus, dachte sie wütend auf sich selbst!
Und dann beschloss sie, sich mit einer Rosskur von ihren Ängsten zu befreien.
Sie machte einen langen, ausgedehnten Rundgang durch Lower Manhattan.
Die ganze Atmosphäre war erdrückend. Fremder als sie es sich jemals vorgestellt hatte. Ein Gewirr verschiedenster Sprachen und Kulturen, ein Chinesenladen neben einem polnischen und danach einem italienischen.
Sie erfuhr, dass es sogar ein deutsches Viertel gab!
Sie winkte einem Taxi, und sagte einfach, weil ihr nichts besseres einfiel „Zum Times Square, bitte!“. Dort stieg sie aus und stand völlig erschlagen minutenlang nur da. Schaute auf dieses gigantomanische Durcheinander von Riesenplakaten, Leuchtreklamen, Laufbildern, schrillen Geschäftsportalen, tausenden aneinander vorbei hastenden Menschen, und diesem allgegenwärtigen dichten Autoverkehr. Die Yellow Cabs fuhren geradezu in Rudeln von einer roten Ampel zur nächsten, und wieder weiter. Riesige dreiachsige Autobusse kurvten mit gewagten Manövern ihren Zielen entgegen, es war ein Gehupe und Getöse, dass sie meinte bereits Kopfschmerzen zu haben.
In der Fußgängerzone war der Lärmpegel um nichts geringer.
Die größenwahnsinnigen Hochhausquader, wo einer immer aussah wie der Klon vom anderen, wie hundertmal vergrößerte Getreidesilos, die jemand außen mit einem schwarz-grauen Rastergitter bemalt hatte. Und alle waren mit scheußlichst geschmacklosen, monströsen Geschäftsportalen, riesigen Werbetafeln und Leuchtreklamen zugepflastert.
Für Olga sah das alles aus wie eine maßlos überdimensionierte Karikatur der Hamburger Reeperbahn. Ein unbeschreiblich erbärmlich dilettantisch zusammengepappter Jahrmarkt der Hässlichkeit. Laut, anmaßend, vulgär und über die Maßen primitiv! Und alles immer krankhaft groß!
Die untersten Instinkte bedienend.
Hier werde ich nicht alt, dachte Olga. Ich werde absahnen was abzusahnen geht, und dann auf dem Absatz kehrt machen, und nichts wie weg!
Sie stieg ins nächste Taxi und nannte ihre neue Adresse.
*
Mit Mister Steven Roshinsky kam sie besser aus als sie gedacht hatte.
Die nächsten Wochen vergingen wie im Flug. Sie stürzte sich mit aller Vehemenz in die Arbeit. Von allen ihren Schützlingen hatte sie professionelle Fotos von deren Werken, ihre Lebensläufe und Erfolge mitgebracht. Die Texte hatte sie sich noch in Österreich ins Englische übersetzen lassen; jetzt ging sie daran einen Katalog zu gestalten. Roshinsky half ihr beim Layout, und er stellte sich in allem als überraschend geschickter und flexibel denkender Mensch heraus.
Olga gewöhnte sich langsam an seine schnelle Sprechweise und ihr englischer Sprachschatz vermehrte sich während der Arbeit ganz von selbst.





























