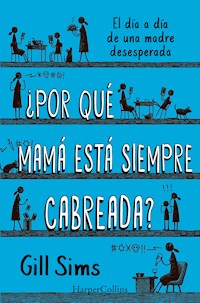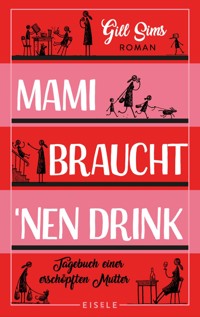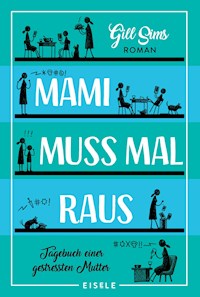9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eisele eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Mami-Reihe
- Sprache: Deutsch
Jetzt ist Mami dran! Mami ist begeistert! Aus Peter und Jane sind junge Erwachsene geworden, die nicht mehr wie zwei ausgehungerte Hyänen auf der Suche nach dem nächsten Snack den Kühlschrank plündern und alles ›voll peinlich‹ finden, was Ellen macht. Anstatt fluchend hinter ihnen her zu räumen und gegen den Schlechte-Laune-Teenager-Wahnsinn anzukämpfen, kann Mami es sich endlich mal wieder mit einem gut gefüllten Glas Pino Grigio auf dem Sofa gemütlich machen. Doch so richtig will sich das befreiende Gefühl nicht einstellen. Wie ging das noch mal, Zeit für sich haben? Während Mami damit beschäftigt ist, sich wieder selbst zu finden und dem neuen attraktiven Nachbarn Avancen zu machen, hat sie in der Arbeit mit Umstrukturierungen zu kämpfen, und Simon nervt mit seiner neuen Freundin. Verunsichert blickt sie in eine einsame Zukunft, in der ihr Rat und ihre Fürsorge nicht mehr gebraucht werden. Oder vielleicht doch? »Absolut lesenswert.« Welt am Sonntag über Mami braucht ´nen Drink »Sehr unterhaltsam!« DONNA über Mami braucht ´nen Drink
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Freitag, 1. März
Heute ist es so weit: Jane wird achtzehn. Mein kleines Mädchen darf nun nicht nur wählen und offiziell Alkohol trinken, sondern kann auch Abgeordnete werden und ohne Einverständnis eines Erziehungsberechtigten heiraten. Rein theoretisch dürfte sie sich jetzt auch FSK-18-Filme ansehen, aber dank Internet und Netflix ist die Altersfreigabe ohnehin längst kein Thema mehr. Ich hatte ja die vage Hoffnung, dass ich mich mit dem heutigen Tag von der Bürde meiner mütterlichen Verpflichtungen befreit fühlen würde, dass wir für einander künftig nicht mehr Mutter und Tochter sein würden, sondern coole Freundinnen, aber bis jetzt kann ich keine Veränderung in dieser Hinsicht feststellen. Ich bin nach wie vor uncool, und, O-Ton Jane: »Nur Loser sind mit ihrer Mum befreundet, Mutter.«
Die Autorin
Gill Sims ist die Autorin der Bestseller MAMI BRAUCHT ’NEN DRINK, MAMI MUSS MAL RAUS und MAMI KANN AUCH ANDERS, die ganz Großbritannien im Sturm eroberten. Mit Witz und Verve schildert sie darin ihr turbulentes Familienleben, den ganz normalen Wahnsinn im Alltag als Ehefrau und Working Mum. MAMI WILL AUCH MAL ist der vierte und letzte Teil der Mami-Memoiren, der in England erneut die Bestsellerlisten anführte. Mit ihrem Mann, zwei Kindern und einem schwer erziehbaren Border Terrier lebt Gill Sims in Schottland.
GILL SIMS
Tagebuch einer entfesselten Mutter
ROMAN
Aus dem Englischen von Ursula C. Sturm
Besuchen Sie uns im Internet:
www.eisele-verlag.de
Die Originalausgabe »Why Mummy’s Sloshed.
The Bigger the Kids, the Bigger the Drink« erschien 2020
bei HarperCollins Publishers Ltd, London.
ISBN 978-3-96161-128-7
1. Auflage 2021
© 2020 Gill Sims
© Coverillustration: Tom Gauld / Heart Agency
© Coverdesign: HarperCollins Publishers Ltd 2020
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München
© 2021 der deutschsprachigen Ausgabe
Julia Eisele Verlags GmbH, München
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Freitag, 25. Januar
Ich leerte zufrieden meine Teetasse und stellte sie in die Spülmaschine. Obwohl ich nur wenig und unruhig geschlafen hatte, geplagt von Albträumen, in denen bunte Clown-Autos in Schlangenlinien wie wild auf mich zurasten, lief alles nach Plan: Die Hunde waren gefüttert und draußen gewesen, und ich trug bereits meine Bürokluft und hatte es geschafft, meine holden Kinderlein aus ihren Zimmern zu locken und ihnen ihr nahrhaftes Frühstück vorzusetzen, das sie selbstredend verweigert hatten. Ich hatte mir sogar eine zweite Tasse Tee gegönnt und dabei die wichtigsten Promi-News und Modetipps in der Daily Mail überflogen und fragte mich nun, ob ich, um mir einen neuen Freund zu angeln, »Bein zeigen« oder lieber »meine Kurven in Szene setzen« sollte. Am besten wäre wohl, wenn ich mir nicht länger das Gehirn mit der Lektüre solcher Käseblätter ruinierte, sonst ertappte ich mich womöglich demnächst dabei, dass ich Good Morning Britain guckte und der gleichen Meinung war wie Piers Morgan.
Was habe ich früher von einem derart straff durchorganisierten Morgen geträumt, etwa, während ich meinen widerspenstigen Sprösslingen ihre aufgeweichten Frühstücksflocken einflößte, wobei sich besagte Sprösslinge lieber darauf konzentrierten, den Brei an den Plafond zu katapultieren, statt sich artig füttern zu lassen (Hat irgendjemand da draußen eine Ahnung, wie mühsam es ist, eingetrocknete Cerealien von der Decke zu kratzen? Unverwüstlicher als dieser asbesthaltige Strukturputz von Artex, das verfluchte Zeug!). Oder aber, wenn ich versuchte, die Füße meines Töchterchens, das »vergessen« hatte, wie man sich die Schuhe anzieht, in selbige zu bugsieren, während ich meinem Sohnemann erklärte, ja, die Hose müsse sein, und nein, halbnackt könne er nicht in die Kita, auch wenn Donald Duck und Konsorten immer »unten ohne« rumlaufen.
Natürlich geht es bei uns morgens nicht immer so ruhig und gesittet zu. Meist muss ich ziemlich viel rumschreien (»Woher soll ich wissen, wo dein Turnbeutel ist? Such ihn gefälligst selber! Und nein, mit suchen meine ich nicht, dass du dich in deinem Zimmer einmal im Kreis drehst und behauptest, du könntest ihn nicht finden!«) und mich dazwischen halblaut vor mich hin fluchend in meinen ParentPay-Account einloggen, um mal wieder einen Batzen Geld zu überweisen.
Gut, dass ich Peter und Jane in weiser Voraussicht schon gestern Abend gezwungen hatte, ihre Schulsachen einschließlich Turnbeutel und Malsachen zusammenzupacken, denn heute durfte es weder Stress noch Gezeter geben, Jane trat nämlich gleich zur Fahrprüfung an, und da sollte sie fokussiert und konzentriert sein. Mit einem Anflug von Selbstgefälligkeit, weil es mir tatsächlich gelungen war, für die nötige Ruhe und Gelassenheit zu sorgen, schnappte ich mir Schlüsselbund, Jacke und Handtasche, verabschiedete mich von den Hunden und rief »Jane! Wir müssen los!«
Zwanzig Minuten später stand ich immer noch am Fuße der Treppe und schrie mir die Kehle aus dem Leib, dabei hatte ich bereits mehrmals an Janes Tür gehämmert (einzige Reaktion: ein gedämpftes Grunzen) und gedroht, ohne sie loszufahren, sollte sie nicht in EINER MINUTE auftauchen (zugegebenermaßen eine sinnlose Drohung – warum sollte ich ohne sie zu ihrer Führerscheinprüfung fahren?).
Allmählich wurde ich heiser. »Jane? JANE! Beeil dich, wir kommen zu spät! Hast du gehört, Jane? Herrgott noch mal, Jane, nun komm endlich runter! Wir müssen LOS!«
Die Tür zu Peters Zimmer schwang auf. »Mum, ich bin mitten in einem Game, könntest du bitte aufhören, rumzuschreien? Das ist echt peinlich, alle meine Freunde können dich hören!«
»Dann sag deiner Schwester, sie soll mal einen Zahn zulegen!«
»Ich kann nicht, Mum, ich bin beschäftigt!« Mein Sohnemann stülpte sich wieder die Kopfhörer über und verschwand in seinem Zimmer, um sich weiter von einem seiner grauenhaft geistlosen Computerspiele die sensiblen Teenager-Synapsen lahmlegen zu lassen.
»Peter!«, rief ich. »PETER! Lass gefälligst das Gedaddel, sonst kommst du noch zu spät! Ich kann dich nicht zur Bushaltestelle fahren, du musst zu Fuß gehen. Peter! Hast du mich gehört?«
Auch diesmal vernahm ich lediglich ein Grunzen, das »Ja, ich hab’s gehört« bedeuten oder irgendein Teenager-Kommunikations-Code sein konnte – oder das Geräusch, das sein PC von sich gab, wenn im Spiel eine Prostituierte ermordet wurde. Dummerweise überragt mich Peter mittlerweile um einen halben Kopf, weshalb ich bloß wüste Drohungen ausstoßen und gelegentlich das WLAN-Passwort ändern kann, damit er meinen Befehlen Folge leistet.
»JANE!«, schrie ich erneut und fragte mich, wie viel Zeit meines Lebens ich wohl schon damit zugebracht hatte, hier an der Treppe zu stehen und sinnlos herumzubelfern, bis mein geliebter Nachwuchs endlich aus seinen Löchern gekrochen kam. Bestimmt waren es insgesamt nicht bloß Tage, sondern eher Monate, wenn nicht gar Jahre – ein ebenso deprimierender Gedanke wie der, wie viele Wochen seines Lebens man so auf der Toilette zubringt. Wobei ich finde, dieser Wert sollte etwas differenzierter betrachtet werden, soll heißen, nach Geschlechtern getrennt. Mir ist nach wie vor schleierhaft, wieso Männer ungefähr fünfzehn Mal länger auf dem Thron hocken als Frauen, obwohl sich ihr Verdauungsapparat doch eigentlich nicht groß von unserem unterscheidet. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass die Statistiken, laut denen wir angeblich im Durchschnitt zweihundertdreizehn Tage unseres Lebens mit Kacken verbringen, total verzerrt sind – in Wahrheit sind es bei den in dieser Hinsicht deutlich effizienteren Frauen insgesamt garantiert kaum mehr als drei Tage, und der Rest der Zeit entfällt auf die Männer.
Ich wurde jäh aus meinen Überlegungen gerissen, als ich ENDLICH Janes Zimmertür zuschlagen hörte.
»Wurde ja auch Zeit!«, sagte ich zu meiner Tochter, die gemächlich die Treppe herunterkam. »Was hast du denn so lange getrieben?«
»Na, was wohl? Ich hab mir die Haare gemacht.«
»Verstehe.« Wie naiv von mir, anzunehmen, es könnte in Janes Leben etwas geben, das wichtiger war als ihr heißgeliebter Lockenstab.
»Okay, nun aber flott, sonst verpasst du deine Prüfung«, sagte ich.
»Jetzt chill mal, Mum. Dass du immer so eine Hektik verbreiten musst, ey! Damit tust du dir echt keinen Gefallen. Du kriegst noch einen Herzinfarkt! Und überhaupt haben wir noch massig Zeit.«
»Nein, haben wir nicht!«
»Und wenn schon. Dann fahre ich eben ein bisschen schneller. Kein Grund zur Panik.«
»Vergiss es, Jane. Du willst doch nicht, dass man dich auf dem Weg zur Führerscheinprüfung wegen überhöhter Geschwindigkeit drankriegt, oder? Vom ganzen anderen Ärger einmal abgesehen, nimmt dich dann garantiert keine Autoversicherung, und außerdem bringst du damit auch mich als deine Begleitperson in Schwierigkeiten.«
»Nachdem du das Thema Versicherung anschneidest, kann ich wohl davon ausgehen, dass du mir ein Auto kaufst, wenn ich die Prüfung bestehe?«
»Was? Nein, davon war nie die Rede!«
»Also, wenn du mir kein Auto kaufst, kann mir die Versicherung ja egal sein. Und wie soll ich dann bitteschön in die Schule kommen?«
»Na, mit dem Bus, so wie bisher! Und überhaupt ist das alles rein hypothetisch, weil du die Prüfung ja noch nichtbestandenhast, und wenn wir jetzt nicht auf der Stelle losfahren, wirst du sie verpassen, und das war’s dann!«
Jane stieg in den Wagen (nicht ohne sich mit aufmüpfiger Miene das kunstvoll gelockte Haar über die Schulter zu schnippen), und dann konnte es endlich losgehen. Ich kauerte auf dem Beifahrersitz, umklammerte den Türgriff so fest, dass meine Fingerknöchel weiß hervortraten und versuchte tunlichst, nicht bei jeder Kreuzung angstvoll nach Luft zu schnappen oder Jane aus der Ruhe zu bringen, indem ich »Bremsen! BREMSEN!« kreischte, wann immer ich vor uns ein anderes Auto erspähte, oder alternativ »BLINKEN! Du musst BLINKEN, verdammt noch mal!«
Auch die Ermahnung »Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick!« vor dem Losfahren (das Einzige, was mir von meinen Fahrstunden in Erinnerung geblieben ist) muss ich mir neuerdings verkneifen. Wir hatten einen hässlichen Streit deswegen, nachdem mich Jane darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich mich selbst nicht an diese Regel halte, was ihrer Ansicht nach auch der Grund dafür war, dass ich den Wagen eines Nachbarn ein gaaaanz klein wenig touchiert habe (so nenne ich es, Jane sagt im Zusammenhang mit dem Zwischenfall hartnäckig »Als du mal wieder den Wagen zu Schrott gefahren hast, MUTTER.«).
Sie würgte unterwegs bloß zwei Mal an einer Kreuzung den Motor ab, und dann waren wir auch schon am Ziel. Die heutige Prüfung war ihr zweiter Versuch. Den theoretischen Teil hat sie schon vor einer Weile mit Bravour bestanden. Selbst bei dem Abschnitt, in dem es um potenzielle Gefahren im Straßenverkehr geht, erreichte sie die volle Punktzahl, was etwas verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass sie, wenn sie am Steuer sitzt, sämtliche tatsächliche Gefahren übersieht. Sie hatte darauf bestanden, recht bald danach auch die praktische Prüfung zu absolvieren, und war höchst erbost gewesen, als sie vom zitternden Prüfer vorzeitig wieder an der Fahrschule abgeliefert wurde, weil sie versucht hatte, falsch herum in einen Kreisverkehr einzufahren. »Das ist total unfair!«, hatte sie unter Wutgeheul und mit Zornestränen in den Augen gezetert. »Das kann doch jedem Mal passieren!«
Folglich habe ich auf unseren »Übungsfahrten« tunlichst darauf geachtet, Strecken mit Kreisverkehren zu meiden, und ich habe nach wie vor so meine Zweifel, was ihre Fahrkünste angeht, aber ihr Fahrlehrer ist mittlerweile zu der Überzeugung gelangt, jetzt sei sie so weit. Ich widersprach nicht, zumal ich für die Fahrstunden allwöchentlich einen Betrag in der Höhe des Bruttoinlandsprodukts von Luxemburg hinblättern und zudem weitere Übungsfahrten über mich ergehen hätte lassen müssen, bei denen ich den Türgriff umklammerte und den Gott des Getriebes anflehte, er möge den Kelch an meiner bedauernswerten Gangschaltung vorübergegen lassen. Ich hegte ja insgeheim den Verdacht, dass der Fahrlehrer nur deshalb darauf drängte, Jane solle die praktische Prüfung baldmöglichst ablegen, damit sie nicht länger seine Gangschaltung malträtiert. Aber vielleicht hat er auch bloß ihre sarkastischen Bemerkungen, begleitet von enerviertem Augenrollen satt.
Ich konnte mich in der Angelegenheit noch nicht einmal mit Simon, meinem Ex beraten, denn der hatte unsere Tochter während seiner einzigen Übungsfahrt mit ihr derart zur Weißglut gebracht, dass sie nach knapp drei Kilometern eine Vollbremsung hingelegt hatte und mit den Worten »Mit dir fahre ich nie wieder irgendwohin!« ausgestiegen und zu Fuß nach Hause gelaufen war. Fairerweise muss ich zugeben, dass ich selbst auch schon an dem Punkt war, allerdings mit dem Unterschied, dass ich bereits den Führerschein hatte, weshalb es damals Simon war, der aussteigen und zu Fuß nach Hause laufen musste. Er ist echt ein unglaublich nerviger Beifahrer. Alle dreißig Sekunden schnappt er entsetzt nach Luft, tastet mit dem rechten Fuß hektisch nach einer imaginären Bremse und zischt dann »Puh, das war haarscharf!« Mit Vorliebe ermahnt er mich auch, langsamer zu fahren: »Langsam, Ellen, da ist ein Auto vor uns. LANGSAM, hab ich gesagt! Siehst du das AUTO da vorne nicht?« Ehrlich gesagt wundert es mich bisweilen, dass ich nicht schon viel früher die Scheidung eingereicht habe. Wobei er die Kritik an meinem Fahrstil schlagartig eingestellt hat, nachdem er damals im Regen sechs Kilometer zu Fuß nach Hause gehen musste.
Bedauerlicherweise bekam Jane den gleichen Prüfer wie beim ersten Versuch zugewiesen, und mir entging nicht, wie verkrampft der arme Kerl sein Klemmbrett umklammerte, und wie blass er wurde, als Jane unverdrossen auf ihn zuhopste.
Ich setzte mich in das Café auf der gegenüberliegenden Straßenseite, dessen Fensterscheiben so beschlagen waren, dass ich mich unwillkürlich an »Steamy Windows« von Tina Turner erinnert fühlte. Hm, das wäre eigentlich ein passender Name für ein Porno-Café. Gibt es so etwas überhaupt? Wenn, dann in Amsterdam, da geht man mit derlei Angelegenheiten ja deutlich entspannter um. Hierzulande würden die Behörden von den Betreibern angesichts der Kombination von brühheißen Getränken und entblößten Genitalien vermutlich eine umfangreiche Risikobewertung fordern, von den Hygieneauflagen ganz zu schweigen. So gesehen überrascht es mich nicht, dass mir noch nie ein Porno-Café untergekommen ist. Dafür schießen derzeit die Katzen-Cafés wie Pilze aus dem Boden. Warum gibt es eigentlich keine Hunde-Cafés? Im Gegensatz zu Katzen lieben Hunde ja die Gesellschaft des Menschen, einmal abgesehen von meinem schon etwas in die Jahre gekommenen miesepetrigen Border Terrier Judgy, bei dem ich mir im Übrigen ziemlich sicher bin, dass er zumindest zu einem Teil Katzengene in sich trägt. Alle anderen Hunde könnten sich vermutlich nichts Schöneres vorstellen, als von einer endlosen Reihe wildfremder Cafébesucher hinter den Ohren gekrault und unter dem Tisch heimlich mit Kuchen gefüttert zu werden.
Natürlich grübelte ich nur über Katzen- und Porno-Cafés (unter dem Namen Pussy Café könnte man ja sogar beides kombinieren!) nach, um mich von einer beunruhigenden Frage abzulenken, die da lautet: Wie zum Teufel kann ich schon so alt sein, dass meine Tochter demnächst hochoffiziell Autofahren, und obendrein hochoffiziell Alkohol trinken darf? Zugegeben, ich gestatte Jane im Sinne meines »liberalen« Erziehungsansatzes (den die Daily Mail vermutlich als »lax« bezeichnen würde) bereits seit etlichen Jahren, Erfahrungen mit dem Konsum von Alkohol in einem verantwortungsvollen Maß zu machen, soll heißen, sie darf auf Partys ein paar Dosen Cider mitbringen, und ich stelle mich blind, wenn sie tags darauf einen höllischen Kater hat, weil sie zusätzlich Wodka und Mad Dog 20/20 getrunken hat. Wer hätte gedacht, dass quietschbunter Likörwein bei den Jugendlichen offenbar nun wieder in ist? Mittlerweile gibt es sogar allerlei exotische Sorten wie »Electric Melon«, nicht bloß Erdbeere wie zu meiner Zeit. Hm, oder war es Pfirsich? Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, es ist schon viel zu lange her. Shit, ich bin eine alte Schachtel mit einer erwachsenen Tochter! Ich kann nur hoffen, dass sich Jane noch mindestens zehn Jahre nicht schwängern lässt. Ich bin definitiv noch nicht bereit, Granny Ellen zu werden, obwohl es durchaus sein könnte, dass meine Mutter endlich ins Gras beißt bei der Vorstellung, Urgroßmutter zu werden. Aber selbst das wäre ein schwacher Trost, sollte ich tatsächlich Großmutter werden, ehe ich fünfzig bin.
Die Kinder werden echt beängstigend schnell erwachsen, und nachdem ich so viele Jahre lang vorrangig damit beschäftigt war, die beiden zu füttern und am Leben zu erhalten, finde ich den Gedanken, bald nicht mehr für sie verantwortlich zu sein, ganz schön seltsam. Als sich Jane vor Weihnachten um einen Studienplatz bewarb – eine ausgesprochen nervige Angelegenheit – kam es mir so vor, als hätte ich das erst gestern selbst getan. Genervt war übrigens nur ich, weil ich Jane mehrfach daran erinnern musste, und als ich sie zum x-ten Mal bat, mir die ausgefüllten Formulare zu zeigen, informierte sie mich, sie habe sie bereits alle abgeschickt – ohne dass sie mir vorher ihr Motivationsschreiben vorgelegt hätte! Am Ende nannte sie mir widerstrebend die Universitäten, an denen sie sich beworben hat. Zu meiner Überraschung ist Edinburgh ihre erste Wahl, und das, obwohl Simon und ich dort studiert haben, weshalb ich angenommen hatte, es würde von vornherein ausscheiden. Doch anscheinend gehören die dortigen Institute für Geschichte und Politikwissenschaft zu den besten des Landes, und genau das will sie studieren, und außerdem »ist Edinburgh voll weit weg, du würdest also wenigstens nicht andauernd bei mir auf der Matte stehen, Mum«.
Ich holte mir eine schöne Tasse Tee und ein Rosinenbrötchen (herrje, ich bin bereits eine Granny!) und ließ mich an einem Tisch nieder, um an meinen Fingernägeln kauend auf Jane zu warten. Ich war hin und her gerissen, was das Prüfungsergebnis anging. Bestand Jane, dann müsste ich nicht mehr für sie Taxi spielen, sondern könnte mich von ihr sogar in den Pub kutschieren lassen. Andererseits müsste ich ihr dann meinen Wagen leihen und würde bei der Vorstellung, sie könnte zwischen verbeulten Metallteilen eingekeilt in einem Straßengraben liegen, nachts kein Auge zutun vor Angst.
Als sie viereinhalb war, fuhr ich mit ihr und Peter zu meiner besten Freundin Hannah, deren Sprösslinge Emily und Lucas praktischerweise auch die besten Freunde meiner Kinder sind und einen kleinen elektrischen Jeep besaßen, ein Spielzeug, das Peter und Jane über die Maßen begeisterte. Darin mal eine Runde drehen zu dürfen, war für sie das Größte überhaupt.
Irgendwie schaffte es Peter, der damals erst zweieinhalb war, als Erster ans Steuer. Hannah zerstreute meine Bedenken mit den Worten »Wetten, er bringt das Ding gar nicht zum Laufen?« Tja, sie täuschte sich; er schlug sich wacker, fuhr um Kurven und sogar rückwärts und stellte den Jeep schließlich schwungvoll wieder ab.
Als nächstes war Jane dran. Sie bestand darauf, von Emily begleitet zu werden, und ihre Freundin nahm bereitwillig auf dem Beifahrersitz Platz.
Dann stieg Jane auch schon vor Vergnügen quietschend aufs Gas, und der Jeep schoss durch die Hecke und geradewegs auf die Straße, genau wie bei Ein Duke kommt selten allein. Wir hechteten hinterdrein, und ich hörte, wie Jane juchzte: »Das Auto hat ja sogar ein Telefon! Wollen wir so tun, als würden wir Lara anrufen, Emily?«, während der Jeep in Schlangenlinien die Straße entlangschlingerte. Ich brüllte: »JANE! JANE! HALT AN! HALT AN!« und machte Anstalten, mich vor das Gefährt zu stürzen, doch meine Tochter beachtete mich nicht – sie »telefonierte« mit Lara und plauderte zugleich mit Emily, eine Hand am Lenkrad, den Fuß weiter fest auf dem Gas. Das Bremspedal war in ihren Augen ganz offensichtlich bloß ein überflüssiges Plastikteil.
»JAAAAAAANE!«, kreischte ich verzweifelt, als der Jeep auf einen nur wenige Meter entfernt geparkten, auf Hochglanz polierten BMW zusteuerte, und da drehte sich Jane endlich zu mir um. »Ja, Mami?«, sagte sie und nahm im Zuge dessen gottlob den Fuß vom Gaspedal.
Ich machte einen Satz nach vorn, warf mich in Rugbyspielermanier auf den Mini-Jeep und verhinderte so in letzter Sekunde, dass er ungebremst den glänzenden und zweifellos unfassbar teuren BWM rammte. Selten war ich so erleichtert gewesen wie in diesem Moment – wenn meine Tochter im zarten Alter von viereinhalb Jahren einen Autounfall mit zweifellos verheerenden finanziellen Folgen verursacht hätte, dann hätten wir uns garantiert auf unzählige pseudowitzige Kommentare von Simon zum Thema »Frau am Steuer« gefasst machen müssen.
Die Stunde verstrich nur langsam, während ich an meiner Rosinensemmel knabberte und an meinem Tee nippte. Vor siebzehn Jahren war es mir schier unvorstellbar erschienen, dass ich einmal in einem Café sitzen und gespannt abwarten würde, ob Jane ihre Fahrprüfung bestand oder nicht. Was habe ich vor siebzehn Jahren getrieben? Einmal abgesehen davon, dass ich mich mit meinen damals einunddreißig Jahren wie ein steinaltes, vertrocknetes Weib gefühlt hatte, quasi eine Tattergreisin, was mir im Nachhinein betrachtet absolut lächerlich vorkommt. Inzwischen bin ich achtundvierzig, und Frauen in den Dreißigern sind für mich Stubenküken, die, hoffnungsvoll, unschuldig und naiv, wie sie sind, nicht die geringste Ahnung haben, wie viele Marotten und Falten da draußen auf sie warten. Vorerst sind sie alle noch mit ihren Podcasts und Instagram-Posts beschäftigt, in denen es um Bulletproof Coffee und Kimchi und diverses anderes Zeug geht, von dem ich keinen blassen Schimmer habe. Na, egal. Vor siebzehn Jahren war ich am Freitagvormittag mit Jane beim Babysingen. Ich saß mit anderen Müttern im Kreis auf dem harten, kalten Boden eines Pfarrsaals, trällerte hirnlose Texte zu nervigen Melodien und versuchte, dabei in die Hände zu klatschen wie die anderen selig lächelnden Mütter und dabei das sich windende Kind auf meinem Schoß zu bändigen.
Was habe ich damals sonst so getrieben? Ehrlich gesagt erinnere ich mich kaum mehr daran. Ich weiß noch, dass ich andauernd spazieren war, stundenlang, oder alternativ im Park, um Jane auf der Babyschaukel anzuschubsen oder die Enten zu füttern, was ja heutzutage verboten ist. Shit, ich ertappe mich schon jetzt dabei, dass ich meine Aussagen mit den Worten »Zu meiner Zeit …« einleite, genau wie meine Großmutter es tat. Was kommt als nächstes? Werde ich in der Öffentlichkeit beiläufig rassistische Bemerkungen vom Stapel lassen und, wenn ich deswegen zu Recht gerügt werde, schulterzuckend entgegnen: »Naja, das hat man zu meiner Zeit eben so gesagt«? Ich seh’s schon vor mir: Man wird mich in der Daily Mail zitieren, in einem dieser unsäglichen Artikel über »total übertriebene Political Correctness«, und sowohl mein Alter als auch den Schätzwert meines Hauses falsch angeben. Ein Horror.
Ach ja, ich habe endlos Gemüse püriert und eingefroren, dessen Verzehr Jane hinterher verweigert hat. Nach einer Weile lernte ich dazu: Je nachdrücklicher diese verfluchte Annabel Karmel von einem ihrer unappetitlichen Pürees behauptete, alle Kinder würden es lieben, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass Jane es nicht einmal würde kosten wollte. Eines Tages sah ich schließlich rot beim Anblick ihrer Visage, die mich vom Kochbuch-Cover anstrahlte. Nachdem ich eine Stunde vergeblich versucht hatte, Jane die widerliche, nur mit meinen Frusttränen gewürzte Pampe einzuflößen, deren Zubereitung – schälen, schneiden, dünsten und pürieren – eine halbe Ewigkeit gedauert hatte, pfefferte ich das Buch in hohem Bogen durch das Fenster in den Garten. Und dann stürmte ich hinterher und trampelte, allerlei Obszönitäten kreischend, darauf herum. Danach ging es mir deutlich besser, weshalb ich mir auch gleich noch Das zufriedene Baby dieser bescheuerten Gina Ford vornahm.
Als Jane ein halbes Jahr alt war, fing ich wieder an zu arbeiten, und mich plagte lediglich deshalb das schlechte Gewissen, weil ich so gar keine Gewissensbisse verspürte, wenn ich sie in der Kinderkrippe ablieferte, um sie »von wildfremden Menschen aufziehen zu lassen« wie meine Mutter es formulierte. Mum hätte es viel angemessener gefunden, wenn ich wie meine Schwester Jessica eine Vollzeit-Nanny eingestellt hätte. Meine Mutter fürchtete nämlich, Jane könnte von den schrecklich gewöhnlichen anderen Kindern allerlei schlechte Umgangsformen annehmen, die sie nie wieder ablegen würde. Was für Umgangsformen das sein sollten, konnte sie mir nicht genau sagen, und sie antwortete ebenso ausweichend auf meine Frage, mit welchem Geld ich eine Vollzeit-Nanny bezahlen sollte. Ich erinnere mich noch, wie gut es tat, Jane ein paar Stunden in der Obhut der Krippenbetreuerinnen zu lassen, während ich in ins Büro ging, wo ich endlich wieder mit Erwachsenen reden, mein Gehirn verwenden und ein Sandwich verzehren konnte, ohne dass jemand kreischend forderte, einen Bissen abzubekommen, nur um mir selbigen dann ins Gesicht zu spucken.
Nichts lässt einen die Gesellschaft von Arbeitskollegen – und seien sie sozial noch so unbeholfen – mehr wertschätzen als ein Kleinkind. Selbstverständlich war es ein logistischer Alptraum, aber das nahm ich gern in Kauf, und sei es nur, weil ich wieder ein klein wenig das Gefühl hatte, ich selbst zu sein. Und natürlich schlug mir von allen Seiten Missbilligung entgegen: Die Mütter, die zu Hause blieben, hatten keinerlei Verständnis dafür, dass ich mein Kind einfach anderen Leuten überließ, die Vollzeit arbeitenden Mütter fanden, alle Teilzeitangestellten sollten froh sein, dass sie eine ruhige Kugel schieben können, und die Mütter, die wie ich in Teilzeit arbeiteten, argumentierten, ihre Jobs seien viel stressiger als meiner, und überhaupt wisse kein Mensch, wie schwer es für sie sei, Job und Familie unter einen Hut zu bringen.
Was hat Simon vor siebzehn Jahren gemacht? Weiß der Geier. Ich erinnere mich vage, dass er ganz selbstverständlich erwartete, bekocht zu werden und in einer Tour jammerte, er sei müde, weil Jane in den ersten achtzehn Monaten ihres Lebens kaum je eine Nacht durchschlief. Wobei er nie das Bett verließ, wenn sie weinte, weil er ja im Büro ach-so-wichtig und beschäftigt war, und daran änderte sich auch nichts, als meine Elternzeit zu Ende war und ich wieder anfing zu arbeiten. Und als ich dann mit Peter schwanger war, beschwerte sich Simon sogar, er fühle sich in seinem Nachtschlaf gestört, wenn ich nachts aus dem Bett krabbelte, um die weinende Jane zu beruhigen, dabei war ich damals so erschöpft, dass ich glaubte, mein letztes Stündlein hätte geschlagen.
Im Nachhinein frage ich mich ja, wie ich überhaupt bewerkstelligt habe, mich ein zweites Mal schwängern zu lassen. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich je Zeit oder Lust auf Sex gehabt hätte, aber irgendwann muss ich Simon wohl doch mal rangelassen haben (vermutlich zu seinem Geburtstag), denn sonst gäbe es heute keinen Peter. Ehrlich gesagt war mein zweites Kind gewissermaßen ein Unfall, auch wenn ich ihm das nie sagen würde, denn ich war nach dem ersten schon total durch. Ich kann mich nicht erinnern, dass Simon und ich uns damals je über etwas anderes unterhalten hätten als über unsere Müdigkeit. Es war ein regelrechter Wettstreit. Eines Abends, als ich in der Küche Karotten schnippelte, kam er herein und beschwerte sich über irgendetwas, und ich weiß noch, dass ich das Messer beäugte und ernsthaft in Erwägung zog, es ihm ins Herz zu rammen. Ich überlegte mir, wie viel Kraft ich wohl aufwenden müsste und rief mir in Erinnerung, auf welcher Seite sich das Herz befand, damit ich auch richtig zielte – seine linke Seite, nicht meine – doch dann fing Jane an zu weinen, und der Moment verstrich.
Was zugegebenermaßen auch sein Gutes hat, denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass Jane gerade ihre Fahrprüfung absolvieren würde, wenn ich ihren Vater ermordet und den Rest ihrer Kindheit hinter Gittern verbracht hätte. Außerdem würde Peter dann gar nicht existieren, und eine Welt ohne Peter wäre definitiv ziemlich traurig. Andererseits hätte es sich unbestreitbar positiv auf den ökologischen Fußabdruck unserer Familie ausgewirkt, wenn man bedenkt, wie viel Essen er verdrückt, wie viel Strom er mit seinem Gedaddel verbraucht und wie viel Methangas er produziert, schließlich hat er seit dem Augenblick seiner Geburt quasi durchgehend gepupst, und es sieht nicht so aus, als würde sich daran je etwas ändern. Und dann sein Klopapierverbrauch! Es ist gerade so, als würde sich Peter von dem Zeug ernähren. Andauernd ist bei uns das Klopapier alle, sodass ich ständig Nachschub besorgen und dabei darauf achten muss, im Supermarkt nicht immer bei der gleichen Angestellten zu bezahlen, sonst kommt sie womöglich noch zu dem Schluss, ich hätte irgendwelche fiesen Verdauungsbeschwerden.
Ganz zu schweigen von den Bergen an Papiertaschentüchern, die er verschleißt. Ich habe durchaus bereits in Erwägung gezogen, ihm aus Umweltschutzgründen welche aus Stoff zu besorgen, aber so leid es mir für die Eisbären da draußen auch tut, ich fürchte, ich kann mich nicht überwinden, die mit dubiosem Schleim verkrusteten Taschentücher eines männlichen Teenagers zu waschen – oder alternativ die Socken, falls mal kein Taschentuch in greifbarer Nähe ist. Ich frage mich ja, was die Herren der Schöpfung vor der Erfindung des Papiertaschentuchs benutzt haben. Kamen tatsächlich Stofftaschentücher zum Einsatz? Strümpfe? Laub? Ich gehe mal davon aus, dass Selbstbefriedigung kein ausschließlich auf die heutige Zeit beschränktes Phänomen ist, aber man kann sich mit dieser Frage ja wohl kaum an ein Museum wenden, oder? (»Sagen Sie, inwieweit ist eigentlich die Geschichte des Wichsens erforscht?«)
Bei diesem Gedanken verging mir der Appetit auf mein Rosinenbrötchen, und mein Tee war mittlerweile auch kalt geworden. Just in diesem Moment riss Jane die Tür zum Café auf. »ICH HAB BESTANDEN!«, jubelte sie. »ICH HAB’S GESCHAFFT, ICH HAB DEN FÜHRERSCHEIN, MUM! LASS UNS GEHEN!«
»Das freut mich sehr, Liebes! Ich wusste doch, dass du es schaffen würdest!«, flunkerte ich. »Und, musstest du rückwärts um die Kurve fahren?«
Jane schnaubte verächtlich. »Nein, und das werde ich auch nie wieder müssen. Ein vollkommen sinnloses Fahrmanöver.«
»Hast du es Dad schon erzählt?«, erkundigte ich mich.
»Noch nicht, ich wollte es als Erstes dir sagen.« Sie strahlte mich an. »Und ich wollte mich bei dir bedanken, Mum, weil du so viel mit mir geübt hast und so.«
Es ist selten, dass Kinder ihre Dankbarkeit oder Wertschätzung äußern. Meist ist man für sie bloß eine Kellnerin, die ihnen das Essen serviert oder ein Erwachsener, der ihnen ungefragt Ratschläge erteilt, die in ihren Augen sinnlos und falsch sind. Doch jene denkwürdigen Momente, in denen einem Teenager ganz kurz die Schuppen von den Augen fallen und wir nicht nur als Erziehende gesehen werden, sondern als Menschen, entschädigen für all die schlaflosen Nächte, für die Tonnen von püriertem Gemüse, die zugeknallten Türen und das ständige, von entnervten Blicken zur Decke begleitete »Ach, Mutter!« Na ja, fast.
»Gern geschehen, Liebes«, erwiderte ich mit einem ebenso strahlenden Lächeln und kam mir zur Abwechslung einmal vor wie eine wahre Supermami. Doch leider sind diese Augenblicke, in denen die lieben Kleinen ein freundliches, zivilisiertes Verhalten an den Tag legen und man das Gefühl hat, alles richtig gemacht zu haben, allzu vergänglich.
Auf dem Weg zum Auto verkündete Jane: »Also, nur zu deiner Information, ich nehm dann heute Abend den Wagen.«
»Ähm, meinst du nicht, du solltest mich um Erlaubnis fragen, wenn du dir mein Auto leihen willst?«
»Naja, ich müsste es mir gar nicht leihen, wenn du mir ein eigenes kaufen würdest«, konterte sie schnippisch.
Ich tat, als hätte ich es nicht gehört. »Und überhaupt muss ich mich erst um die Versicherung kümmern«, erinnerte ich sie.
»Herrgott noch mal, Mutter, warum musst du mir andauernd das Leben schwer machen?«, motzte Jane. Das war’s dann wohl mit ihrer Dankbarkeit.
»Nicht ich, sondern der Gesetzgeber«, korrigierte ich sie.
»Mir doch egal«, knurrte sie. »Erledigst du das dann gleich, damit ich abends zu Amys Party fahren kann?«
»Jane, mir ist gar nicht wohl bei dem Gedanken, dass du zu einer Party fährst und spätnachts allein nach Hause kommst. Du bist noch nicht allzu oft im Dunkeln gefahren.«
»Wer hat denn was von allein gesagt? Ich habe Sophie und Emily und Lara und Leah versprochen, sie zu fahren.«
»Was? Noch bevor du deine Führerscheinprüfung bestanden hattest?«
»Nein, ich hab ihnen auf dem Weg zum Café eine SMS geschickt.«
Na, toll, ich war also mitnichten die Erste, der sie die frohe Botschaft verkündet hatte. Ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass ich zumindest die erste Erwachsene war.
»Vergiss es, Jane«, sagte ich streng. »Ich werde dir auf gar keinen Fall meinen Wagen leihen, damit du um zwei Uhr nachts deine beschwipsten Freundinnen durch die Gegend kutschierst. Das mit der Versicherung klären wir später; jetzt musst du dringend in die Schule, und ich muss ins Büro. Ach ja, dir ist schon klar, dass du keinen Alkohol trinken kannst, wenn du fahren willst?«
»Natürlich ist mir das klar«, antwortete sie hastig, doch nach ihrer entgeisterten Miene zu urteilen war ihr bislang nicht in den Sinn gekommen, dass sich der Spaß für sie in Grenzen hielt, wenn sie sich als designierte Fahrerin auf Partys mit Coke Zero begnügen musste, während ihre Freundinnen ungeniert zechten.
»Hör zu, dein Dad und ich können uns ja mal schlaumachen, was es ungefähr kosten würde, dir einen kleinen Wagen zu besorgen, einschließlich der Versicherung, aber so etwas ist teuer, Jane, und ich habe keinen Goldesel. Zumal du ja auch bald anfangen wirst zu studieren.«
»Ich weiß!«, knurrte Jane. »Ich such mir einen Job, dann hab ich Geld für Benzin und … Öl und so weiter.«
Ich nahm mir vor, ihr in einem ernsthaften Gespräch darzulegen, was die Instandhaltung eines Fahrzeugs so alles involvierte.
»Jetzt ruf doch erstmal deinen Dad an und erzähl ihm, dass du bestanden hast«, schlug ich vor.
»Genau das hatte ich gerade vor«, ätzte Jane.
Sie tippte auf ihrem Handy herum, und Sekunden später hörte ich eine Frau am anderen Ende schnurren: »Hi, Jane, hier ist Marissa. Simon kann gerade nicht ans Telefon gehen, er fährt.«
Ächz. Marissa ist Simons Freundin – knackig, schlank und rank, jugendlich, glänzendes Haar. Okay, so jugendlich ist sie dann auch wieder nicht mit ihren achtunddreißig Jahren, aber jedenfalls deutlich jünger als ich. Mir wurde auf einmal schrecklich warm, und wie üblich überkam mich kurz die Panik bei der Vorstellung, es könnte sich um eine wechseljahresbedingte Hitzewallung handeln, aber wie sich herausstellte, war es bloß das Feuer der Wut, das diese Hexe stets in mir entfacht.
Ich weiß auch nicht, warum ich Marissa so hasse. Ich meine, nüchtern und objektiv betrachtet ist sie kein schlechter Mensch, ganz im Gegenteil sogar: Sie arbeitet für eine Firma, die ökologisch nachhaltige Alternativen zu Einweg-Plastikerzeugnissen herstellt (allerdings bloß in der Buchhaltung, sie hat nichts mit der Entwicklung der Produkte zu tun, bei denen es sich im Grunde um atemberaubend teure Wasserflaschen handelt, und um Kaffeebecher, aus denen attraktive junge Mütter nach dem Yoga ihren Latte Macchiato mit Sojamilch trinken sollen), und in ihrer Freizeit bringt sie Flüchtlingen Englisch bei. Sie macht unglaublich viel Yoga, und sie hat sogar eine dreibeinige Katze aus dem Tierheim. Es ist direkt widerlich, was für ein guter Mensch sie ist.
Aber meine Herren, ist die Frau nervig mit ihrer gönnerhaften Überheblichkeit! Sie ist mit Abstand der selbstgefälligste Mensch, der mir je untergekommen ist, und das sage ich nicht nur, weil ich sie um ihr glänzendes Haar beneide. Und um ihren perfekt durchgestylten Instagram-Account, auf dem sie Bilder von jedem einzelnen ihrer bescheuerten Yoga-Workouts postet, nebst Fotos von den ganzen Büchern, die sie mit ihren Flüchtlingen gelesen hat, und zwar »in null Komma nichts«. Vermutlich wollten die Armen es bloß möglichst rasch hinter sich bringen, weil sie es kaum erwarten konnten, diese blasierte Kuh wieder loszuwerden. Kann natürlich auch sein, dass sie ihr ausgesprochen dankbar sind und zu Hause kleine Altäre zu Ehren der Heiligen Marissa aufgebaut haben. Ich finde Marissas Selbstgefälligkeit so unerträglich, dass mich selbst die Fotos von ihrer dreibeinigen Katze auf die Palme bringen, und das will etwas heißen, weil ich nämlich ausgesprochen tierlieb bin. Wobei Judgy und Barry, meine Hunde, natürlich hundert Mal besser sind als ihre dämliche Katze. Aber die Tatsache, dass mich der Anblick ihres dreibeinigen Stubentigers ärgert, illustriert vielleicht, wie weit es diese Thusnelda mit ihrer gottverdammten Überheblichkeit treibt.
Was ist das überhaupt für ein Name, Marissa? Ich dachte, so heißen nur flippige Amerikanerinnen in den Neunzigern, Frauen mit abgefahrenen Haarschnitten und Pixie Boots. War das ein Irrtum! Insgeheim fürchte ich ja, meine Abneigung gegen Marissa richtet sich gar nicht gegen sie persönlich, sondern rührt vielmehr von stinknormalem Neid her, weil Simon eine Neue hat, während ich Single bin und damit ganz klar der Loser im spaßigen Wer-hat-die-Scheidung-besser-weggesteckt-Spiel.
Dabei hatte ich mit meinem fabelhaften Freund Jack eine Weile eindeutig die Nase vorn, und das ohne mich sonderlich ins Zeug legen zu müssen. Außerdem hat mir Simon ganz schön lange nachgetrauert. Ich war aber auch eine mustergültige Ex, etwa, indem ich vor Ort die Stellung hielt und mich praktisch im Alleingang um die Kinder kümmerte, als er vor einer Weile ein Sabbatical einlegen musste, weil sein Vater an Prostatakrebs erkrankt war. Seine Eltern leben in Frankreich, und Simon zog ein halbes Jahr zu ihnen, um sie zu unterstützen und seinen Vater zu den Behandlungen zu bringen, denn seine Mutter weigert sich, im Ausland Auto zu fahren (ich ehrlich gesagt auch, aber ich lebe ja auch nicht im Ausland). Ich habe sogar Flüge für die Kinder gebucht, damit sie ihn und ihre Großeltern besuchen konnten, und ich habe Flughafentaxi gespielt. Kein Wunder also, dass Simon bei dieser Gelegenheit schmerzlich klar wurde, was für ein großer Fehler es gewesen war, die Trennung voranzutreiben, zumal er sah, wie glücklich ich mit meinem tollen Freund Jack war.
Tja, aber wie das Leben so spielt, hat sich besagter toller Freund kurz nach Simons Rückkehr aus Frankreich verdünnisiert – ist mit einem Koffer voll Thermounterwäsche in die Antarktis gezogen, um dort seinen Traumjob anzutreten. Simon hatte der Aufenthalt in Frankreich sichtlich gutgetan; er hatte abgenommen und war braungebrannt, und dank einiger schicker neuer Outfits sah er zu meiner großen Verärgerung richtig heiß aus. Was möglicherweise auch darauf zurückzuführen war, dass er sich diese kesse Öko-Tusse angelacht hatte. Das größte Kopfzerbrechen bereitet mir ja der Umstand, dass Marissa volle zehn Jahre jünger ist als ich, sprich, sie ist im gebärfähigen Alter, und zwar noch ganz schön lange, wie meine Freundin Hannah bewies, die mit sechsundvierzig überraschend noch mal Mutter wurde und infolgedessen nun einen sehr lebhaften Sohn namens Edward hat, der mittlerweile zwei Jahre alt und eine Art menschliche Abrissbirne ist.
Ich glaube, ich müsste glatt vor Ärger platzen, wenn mir diese eingebildete Ziege erzählen würde, dass Simon sie geschwängert hat. Wetten, Marissa gehört zu den Frauen, die freudestrahlend verkünden: »Wir sind schwanger«, statt zu sagen »Ich bin schwanger«? Als Simon einmal auf einer Party »Wir sind schwanger« sagte, blaffte ich: »Wir sind mitnichten schwanger, ich bin schwanger, aber wenn du wissen willst, wie sich eine Schwangerschaft anfühlt, dann lässt sich das einrichten. Du musst dir lediglich einen Betonklotz um den Bauch schnallen, dich regelmäßig in die Blase treten lassen, eine Ewigkeit auf alles verzichten, was schmeckt, und bisweilen einen Schluck Säure trinken, um das Schwangerschaftssodbrennen nachzuempfinden. Zu guter Letzt kannst du dir noch eine Ananas quer in den Arsch schieben lassen, um sie anschließend wieder herauszupressen, und als kleines Extra reiße ich dir gern dein bestes Stück auf und nähe es von Hand wieder zu!« Dann brach ich in Tränen aus, und Simon musste mich nach Hause fahren, weil mich alle anderen Partygäste sehr befremdet musterten. Ich gehöre nicht zu den Frauen, die in der Schwangerschaft zu wahren Schönheiten erblühen. Marissa dagegen wird, sobald sie in anderen Umständen ist, garantiert anfangen, von innen heraus zu leuchten; sie wird in durchsichtigen weißen Baumwollkleidchen herumlaufen, sich zufrieden den perfekten kleinen Babybauch streicheln und keine einzige Hämorrhoide kriegen.
Seufz. Ich sollte mich nicht so über sie aufregen. Jane bat sie, das Handy auf Lautsprecher zu stellen, damit sie ihrem Vater die aufregende Neuigkeit überbringen konnte.
»Ach, das ist ja großartig!«, quiekte Marissa, bevor Simon auch nur ein Wort sagen konnte. »Gut gemacht, Jane. Wir freuen uns mit dir.«
»Äh, ja, gut gemacht, Liebes«, echote Simon.
»Mum meinte, ihr kauft mir dann ein Auto«, behauptet Jane.
»Was?«, rief Simon.
»Ich habe nichts dergleichen gesagt.« Ungehalten entwand ich Jane das Handy und hörte Marissa flöten: »Ein Auto, Jane? Also, es ist natürlich toll, dass du den Führerschein gemacht hast; Autofahren ist zweifellos eine nützliche Fähigkeit, aber wenn du dein eigenes Auto hast, wird das unweigerlich dazu führen, dass du viel häufiger als nötig damit fährst, und das wird sich auf deinen ökologischen Fußabdruck auswirken. Willst du nicht lieber ein Fahrrad? Fahrräder sind äußerst effiziente Fortbewegungsmittel, und super umweltfreundlich obendrein …«
Noch während Jane den Vorschlag mit einem rebellischen Grunzen quittierte, fiel Simon seiner Freundin ins Wort: »Wie konntest du nur, Ellen?«, fragte er vorwurfsvoll. »Du kannst Jane nicht einfach ein Auto versprechen, ohne mich zu konsultieren.«
»Ich sage doch, ich habe nichts dergleichen getan«, wiederholte ich. »Ich sagte lediglich, ich würde mal mit dir reden, um zu erörtern, ob es finanziell möglich wäre, wenn wir zwei zusammenlegen.«
»Ich kann mich auch gern beteiligen«, mischte sich Marissa erneut ein.
»Wie jetzt, du willst dich für Jane in Unkosten stürzen?«, fragte ich.
»Äh, nein, das nicht, aber ich kann euch beratend unterstützen. Ich kann euch zum Beispiel haufenweise Infomaterial darüber liefern, wie viele Quadratkilometer Regenwald für jedes neu gebaute Kraftfahrzeug abgeholzt werden. Außerdem habe ich mich zum Thema Fahrrad umfassend kundig gemacht und könnte einige passende Modelle empfehlen. Ich finde wirklich, das wäre eine viel bessere Lösung, und …«
»Ich will aber kein Fahrrad, sondern ein Auto«, nölte Jane. »Ein Fahrrad hab ich schon. Radfahren ist doof.«
»Das kommt auf das Rad an. Wenn du ein richtig tolles, hochwertiges Rad hättest, würdest du die Sache sicher anders sehen«, beharrte Marisa. »Überleg es dir, ja? Versprich mir, dass du es dir durch den Kopf gehen lässt, Jane.«
»Ich finde, Marissa hat recht«, pflichtete Simon ihr bei. »Ein anständiges Fahrrad, das klingt nach einer großartigen Idee, Liebes.«
Jane schnaubte, ohne sich weiter dazu zu äußern und stürzte sich sogleich in die nächste Schlacht: »Hör mal, Dad, Mum will mich jetzt in die Schule fahren, aber findest du nicht auch, ich sollte heute zur Feier des Tages blau machen? Warum bist du eigentlich nicht im Büro?«
Ich spitze die Ohren.
»Wir haben uns beide einen Tag frei genommen; wir sind auf dem Weg zu einem Couples’ Retreat in Dorset«, erklärte Marissa.
»Ein Couples’ Retreat?«, wiederholte Jane ungläubig. »Igitt. Und was treibt ihr da so? Flotte Dreier und Sexpartys, oder was? Das ist ja total abartig, Dad!«
»Aber nein, nichts dergleichen«, erwiderte Marissa sehr freundlich und gelassen, in einem Tonfall, der signalisierte: Ich bin die Ruhe selbst und lasse mich von jemandem, der mir geistig unterlegen ist, nicht provozieren. »Es ist eine Art Einkehrwochenende für Paare, bei dem es darum geht, die Beziehung durch die intensive Auseinandersetzung miteinander im Beisein von ausgebildeten Fachleuten zu stärken und zu vertiefen. Wir machen Vertrauensübungen und …«
»Wird da auch meditiert?«, unterbrach sie Jane.
»Wie? Jawohl, es gibt auch Paar-Meditation«, antwortete Marissa blasiert.
»Klingt, als wär’s totaler Bullshit«, stellte Jane vergnügt fest.
Marissa seufzte. »Du solltest nicht über Dinge urteilen, von denen du nichts verstehst, Jane. Es ist wichtig für Paare, dass sie an ihrer Beziehung arbeiten, sie pflegen und entwickeln. Wer die Sache nicht proaktiv angeht, steht am Ende womöglich allein da. Wenn jemand mehrere gescheiterte Beziehungen hinter sich hat, liegt das oft daran, dass sich der oder die Betreffende nicht die Mühe gemacht hat, die nötige Zeit und Energie in die Beziehung zu investieren.«
Hey, ging das etwa gegen mich? Jep, kein Zweifel. Autsch! Die Frau ist echt gut, das muss ich ihr lassen. All diese en passant hingestreuten zuckersüßen Bemerkungen, deren Gehässigkeit so subtil ist, dass man, wenn man widerspricht, garantiert als paranoid oder hyperempfindlich dasteht, und dann mustert sie einen mit fürsorglicher Miene und sagt: »Natürlich ging das nicht gegen dich, aber da du dich angesprochen fühlst, hast du damit offensichtlich ein Problem. Willst du darüber reden?« AUF GAR KEINEN FALL WILL ICH DAS, ICH BIN SCHLIESSLICH BRITIN! Und falls ich darüber reden wollen würde, dann ganz sicher nicht mit dir, du dämliche Schnepfe mit deinen glänzenden Haaren, deinem schief gelegten Kopf und deinem pseudo-mütterlichen Blick! Ich mag zwar Single sein und etliche gescheiterte Beziehungen hinter mir haben, aber solange ich die Wahl habe zwischen einem Dasein als einsame, alleinstehende Frau und einem Couples’ Retreat, bei dem es vor Leuten wie Marissa wimmelt, erscheint mir die Aussicht, den Rest meines Lebens mit ein paar diskret verpackten Sextoys von Ann Summers zu verbringen, gar nicht so unattraktiv.
»Das klingt aber ziemlich teuer«, stellte Jane fest. »Das kostet doch garantiert ungefähr so viel wie … ein Auto beispielsweise. Bestimmt könnte mir Dad ein Auto kaufen, wenn er nicht sein ganzes Geld für einen solchen Bockmist ausgeben würde.«
»Also erstens ist seelische Gesundheit unbezahlbar, Jane,« belehrte Marissa sie, »und zweitens habe ich Simon dazu eingeladen. Das war mein Geschenk an ihn zu unserem Jahrestag.«
»Der Glückliche«, ätzte Jane. »Wie dem auch sei, ich hatte Dad eine Frage gestellt, und es wäre nett, wenn du zur Abwechslung mal ihn antworten lassen würdest, Marissa.«
»In dem Ton redest du nicht mit Marissa, junge Dame!«, tadelte Simon seine Tochter. »Und wenn deine Mutter sagt, du sollst in die Schule gehen, dann gehst du in die Schule«, fuhr er streng fort.
»Jane macht dieses Jahr Abitur!«, rief ich, empört darüber, dass er wieder einmal mir den Schwarzen Peter zugeschoben hatte. »Und darauf muss sie sich vorbereiten! Der Stoff lernt sich nicht von allein!«
»Ja, schon gut, Mutter!«, keifte Jane. »Ich weiß, dass mein Abi ansteht. Wie könnte ich das vergessen, nachdem ich gerade die Probeexamen hinter mich gebracht habe und du seit fünf Monaten von nichts anderem redest? Aber gut, da meine seelische Gesundheit hier offenbar niemanden kümmert, gehe ich eben heute in die Schule.«
»Ich muss jetzt auflegen, Jane. Wir kommen gleich an eine große Kreuzung, da muss ich mich konzentrieren. Aber noch mal herzlichen Glückwunsch, Liebes. Ich melde mich heute Abend, okay?«
»Das geht nicht, Handyverbot im Retreat«, tönte Marissa aus dem Off.
»Oh Mann, stimmt ja.« Simon seufzte. »Na gut, aber wir hören uns bald, Liebes. Also, bis dann!«
»Gott, Marissa ist echt so eine verdammte Nervtusse!«, stöhnte Jane, sobald die Verbindung unterbrochen war.
Ich gab einen unverbindlichen Laut von mir.
Ich durfte auf keinen Fall den Fehler begehen, mich abschätzig über Marissa zu äußern, denn früher oder später würde mich Jane, wenn ich bei ihr in Ungnade gefallen war und sich Marissa mit Geschenkgutscheinen ihre Gunst erkauft hatte, garantiert verpetzen.
»Du sollst doch nicht so viel fluchen, Liebes.«
»Ist doch wahr! Na, egal. Jetzt mal im Ernst, Mum, warum muss ich heute in die Schule?«
»Weil das dein letztes Schuljahr ist und die Abinoten äußerst wichtig sind.«
»Die Queen hat auch kein Abitur«, wandte Jane ein.
»Das braucht sie auch nicht, weil sie verdammt noch mal die QUEEN ist!«, erinnerte ich sie. »Man wird schließlich nicht Königin, weil man Klassenbeste in der Königinnenschule war.«
»Das wäre aber deutlich demokratischer, nicht?«
»Du wirst aber nun mal nicht Königin, Jane!«, rief ich, »und diese ganzen unglaublich erfolgreichen Leute, die es ohne Abitur an die Spitze geschafft haben, die sind die absolute Ausnahme. Die wären ohnehin erfolgreich gewesen, und wahrscheinlich wäre es ihnen mit Abitur bedeutend leichter gefallen. Außerdem kommen auf jeden Millionär ohne Abitur Millionen von Leuten, die nie ihr volles Potenzial kennen und ausschöpfen werden, weil sie keinen derartigen Schulabschluss haben – und zwar in der Mehrzahl der Fälle nicht etwa deshalb, weil sie nicht genug gelernt hätten, sondern weil sie keine Gelegenheit dazu hatten. Wenn man bedenkt, dass Milliarden von Menschen auf der Welt gezwungen sind, unter lebensbedrohlichen Bedingungen für einen Hungerlohn zu schuften, weil ihnen aus dem einen oder anderen Grund eine ordentliche Schulbildung verwehrt geblieben ist – Menschen, die verdammt noch mal ihren rechten Arm opfern würden für die Bildungsmöglichkeiten, die du als völlig selbstverständlich betrachtest – ist es ehrlich gesagt eine Schande, dass du die Schule derart auf die leichte Schulter nimmst, statt das Beste für dich herauszuholen!«
Ich war ziemlich stolz auf diese kleine Ansprache. Es fehlte nicht viel, und mir wären Tränen in die Augen getreten. Irgendetwas davon musste doch zu Jane durchdringen und sie zu der Einsicht bringen, dass sie sich hinsetzen und lernen musste.
»Oh mein Gott, Mutter«, schnaubte Jane höhnisch. »War das etwa gerade das Äquivalent zum ›Iss deine Erbsen, in Afrika verhungern Kinder!’-Vortrag? Das ist ja erbärmlich!«
»Jetzt steig verflucht noch mal in den Wagen!«, fauchte ich.
Zu meiner großen Erleichterung hatte ich wenigstens keinen Anruf von der Schule erhalten, was dann wohl bedeutete, dass es Peter auf wundersame Weise gelungen war, sich von seinem Computer loszureißen und den Bus zu erwischen. Nachdem ich mein noch immer murrendes Fräulein Tochter in der Schule abgeliefert hatte, schlug ich den Weg ins Büro ein.
Ich mag meinen Job. Ich hatte weiß Gott schon deutlich schlimmere, und ich habe verflucht hart gearbeitet, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Ich bin gut in dem, was ich tue, und ich habe ein großartiges Team unter mir (kein einziger Mitarbeiter mit hyperaktiven Schweißdrüsen).
Das Einzige, was bei uns nervt, sind die ganzen diplomatischen Verwerfungen. Da gibt es Intrigen, Verleumdungen und Verrat von wahrhaft Shakespeare’schem Ausmaß im Wettstreit um den besseren Schreibtisch oder den bequemeren Stuhl, und dann dieser geradezu lächerliche Drang, sich als Tugendbold zu profilieren, den manche Leute an den Tag legen, wenn es um den Kauf des Kaffeepulvers geht! »Dieser Kaffee ist Fairtrade!« »Mag sein, aber der hier ist noch viel mehr Fairtrade.« »Aber dieser Kaffee stammt aus einer Kooperative, die von blinden, verwaisten Orang-Utans betrieben wird, deren Eltern von der bösen Palmölindustrie umgebracht wurden …« und so weiter und so fort. Teetrinker machen nie so viel Aufhebens. Es sind immer die Kaffeetrinker, die sich derart penetrant als Retter der Welt aufspielen, oder?
Wenn wir uns verdammt noch mal alle auf unsere Arbeit konzentrieren würden, statt ständig in sinnlosen Meetings zu hocken und bis zum Abwinken über die Wahl der besten Kaffeemarke zu diskutieren, wären wir bestimmt deutlich produktiver. Mehr noch, wenn gewisse Leute nicht so viel Zeit darauf verschwenden würden, sich wichtig zu machen, indem sie über Angelegenheiten labern, die absolut gar nichts mit ihrer eigentlichen Arbeit zu tun haben und sich stattdessen auf besagte eigentliche Arbeit besinnen würden, liefe unsere Firma vermutlich nicht Gefahr, einer Fusion zum Opfer zu fallen, die uns alle den Job kosten könnte.
Ich hatte meine derzeitige Stelle ja in der Hoffnung angetreten, nun endlich eine Tätigkeit ausüben zu können, die meine Leidenschaft weckt. Unsere Firma ist ein wahnsinnig trendiges Technologie-Unternehmen mit ›Think Cells‹, in denen die kreativen Köpfe »ins Blaue denken« (was immer das bedeuten mag) und die Wände bemalen können, während sie den heiß diskutierten Kaffee in sich hineinkippen. Ich bin weder trendig noch kreativ, und als Mutter von zwei Kindern verspüre ich des Öfteren den Impuls, »Böser Junge!« zu keifen und diesen bärtigen Hipstern in ihren Hochwasserhosen damit zu drohen, dass ich ihnen den Hintern versohlen werde, sollten sie noch einmal die Wände beschmieren. Wobei vor allem Daryl, der Hipster mit dem längsten Bart und den kürzesten Hosen, auf mich den Anschein erweckt, als könnte er durchaus Gefallen daran finden, wenn ihm eine Frau, die altersmäßig seine Mutter sein könnte, den Hintern versohlt.
Ich kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass ich mich seit meinem Eintritt in die Firma wacker geschlagen habe, obwohl ich Hosen in konventioneller Länge trage und es vorziehe, Bürobingo mit meiner Kollegin Lydia zu spielen, während die kreativen Jungspunde fleißig Phrasen dreschen, von wegen »Zukunftsorientiertes Handeln erfordert zum einen den Blick über den Tellerrand und die Nutzung von Synergieeffekten, zum anderen ist es unerlässlich, unter Berücksichtigung der zugrundeliegenden Systeme und mithilfe transparenter und diversifizierter Wertschöpfungsparadigmen …« Blubber, blubber, fasel, fasel. Die Jungspunde in ihren Hochwasserhosen denken sich die Dienstleistungen aus, die wir anbieten, und ich liefere ihnen mit meinem Team die nötige Software dafür. Mittlerweile bin ich sogar Abteilungsleiterin, was bedeutet, dass ich ein Büro mit Fenster und den bequemsten Stuhl habe. Es bedeutet aber auch, dass mein Kopf der erste ist, der rollt, wenn etwas schiefläuft.
Ich wäre am Boden zerstört, wenn ich meinen Job verlieren würde, und zwar nicht nur wegen der finanziellen Auswirkungen. Ich versuche mir einzureden, dass ich über zahlreiche übertragbare Fähigkeiten verfüge und problemlos eine neue Stelle fände, aber ich bin achtundvierzig, und ich habe keine Lust, noch einmal von vorn anzufangen, in einer Firma, in der ich weder weiß, wo die Klos sind, noch, dass man es wegen eines unerfreulichen Zwischenfalls bei einer Firmenweihnachtsfeier tunlichst vermeiden sollte, im Beisein von Eric aus der Marketingabteilung von After Eight zu reden.
Zugegeben, eine Entlassung wäre vermutlich eine gute Gelegenheit, noch einmal etwas ganz anderes auszuprobieren. So gern ich meinen Job mag, fände ich es doch auch schön, mich zu etwas so richtig berufen zu fühlen und jeden Morgen aus dem Bett zu springen, weil ich es kaum erwarten kann, in die Welt hinaus zu gehen und etwas zu tun, das ich liebe. Vor Jahren habe ich eine Spiele-App entwickelt, die mir einen ordentlichen Batzen Geld eingebracht hat – nicht so viel, dass ich mich gleich zur Ruhe hätte setzen können, aber immerhin genug, um meine prekäre finanzielle Situation etwas zu entschärfen. Doch dann habe ich beschlossen, mich scheiden zu lassen, und seither ist die Lage wieder etwas angespannt. Eine Zeitlang hatte ich gehofft, meine Berufung könnte darin bestehen, mir weitere Apps auszudenken, aber bedauerlicherweise haben sich all meine Bemühungen in dieser Richtung als Schnapsideen entpuppt. Es wäre toll, bei Dinnerpartys und dergleichen ausführlich die interessanten Details meiner Arbeit schildern zu können. Allerdings stelle ich mit zunehmendem Alter fest, dass sich die Tätigkeiten, die mir Spaß machen – fernsehen, Kuchen essen, schlafen, meinen Hunden allerlei Quatsch erzählen, Romane von Jilly Cooper lesen und Wein trinken – leider nicht als Berufung eignen. Mir will einfach keine Möglichkeit einfallen, mir damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen, so sehr ich mir auch das Hirn zermartere.
Ich habe auch schon in Erwägung gezogen, meine Hobbys etwas intensiver zu betreiben, um zu testen, ob in einem dieser Bereiche meine wahre Berufung liegt. Ich trinke zum Beispiel leidenschaftlich gerne Vesper Martinis; das fühlt sich so mondän an und ist zudem eine ausgezeichnete Getränkewahl für Frauen, die beim Beckenbodentraining etwas nachlässig waren. Vesper Martinis werden nämlich in sehr kleinen Gläsern serviert, sind aber sehr stark, sprich, man muss nur wenig davon trinken, um binnen kürzester Zeit ziemlich blau zu sein. Ich weiß das, weil Hannah und ich es ausgiebig ausgetestet haben, als sie kürzlich an einem Samstag babyfrei hatte. Sie hat Klein Edward seinem Vater anvertraut, damit wir uns zum Lunch treffen konnten, wie die Dame von Welt das samstags so macht, und bei dieser Gelegenheit haben wir vier Vespa Martinis gekippt, nachdem wir zu besagtem Lunch bereits Wein konsumiert hatten. Danach konnten wir nur noch lallen. Als ich nach Hause kam, bezeichnete Jane meinen Zustand als skandalös und knurrte etwas von wegen »schlechtes Beispiel«. Zu meiner Verteidigung sei gesagt, dass ich nie den Anspruch hatte, meinen Kindern mit gutem Beispiel voran zu gehen. Ich habe mich immer an die Theorie gehalten, dass ich, da ich zum guten Beispiel nicht tauge, zumindest als Warnung dienen sollte. Leider war ich am Tag der Schande nach den vier Gläsern Vesper Martini nicht mehr in der Lage, meine Tochter über meine Anstrengungen in dieser Hinsicht aufzuklären. Ich konnte nur noch nuscheln, ich hätte wohl etwas Verdorbenes gegessen und müsste ein kleines Nickerchen machen.
Natürlich bin ich bei der Suche nach meiner wahren Berufung zwischendurch auch erwachsener vorgegangen. Archäologie beispielsweise hat mich seit jeher fasziniert, und ich war lange überzeugt, es hätte durchaus meine Berufung werden können, wenn ich nicht Computerwissenschaften studiert hätte, um meiner Mutter eins auszuwischen. Mum argwöhnte damals, meine Kommilitonen wären ausschließlich Brillen tragende Jungs in Windbreaker-Anoraks aus Nylon und fragte sich besorgt, wie ich angesichts dieser Tatsache einen anständigen Ehemann finden sollte, und überhaupt: Welcher Mann würde eine Frau heiraten wollen, die ein derart männliches Studium absolviert hat? Ihrer Ansicht nach hätte ich mich lieber für englische Literatur einschreiben sollen, wie es sich für ein nettes Mädchen gehört, und mir möglichst rasch einen Jurastudenten angeln, oder vielleicht einen sympathischen Mediziner. Insgeheim hoffte sie, da ich in Edinburgh studierte, wo bekanntermaßen die piekfeinen Jungs studieren, die in Oxford und Cambridge abgelehnt wurden (jedenfalls war das so, bevor sich Prinz William für Saint Andrews entschieden hat), ich würde mir einen Adeligen anlachen, oder zumindest einen angehenden Anwalt oder Arzt. Oder sonst irgendeinen sympathischen jungen Mann, der eine Karriere in London anstrebte. Dass ich rein zu Bildungszwecken und mit dem Ziel, selbst Karriere zu machen, studieren könnte, kam ihr offensichtlich nie in den Sinn. Was Mum angeht, gibt es für Frauen nur einen Grund, die Universität zu besuchen, nämlich die Suche nach einem Mann, der so reich ist wie mein Stiefvater.
Doch unvernünftig, wie ich war, vertat ich meine Chancen bei den Anwälten und Ärzten in spe, indem ich mich mit Nerds in beigefarbenen Anoraks umgab (wobei meine Kommilitonen ehrlich gesagt ausgesprochen nett und normal waren und mitnichten beigefarbene Anoraks trugen). Deshalb war meine Mutter sehr erleichtert, als meine Wahl auf Simon fiel, der immerhin Architekt war. Ich für meinen Teil ärgerte mich darüber, dass ich im Grunde ihrer Empfehlung gefolgt war, indem ich an der Universität einen netten jungen Mann kennengelernt und ihn geheiratet hatte. Zu meiner Verteidigung kann ich anführen, dass ich, wie ich vermute, deutlich mehr Gelegenheitssex hatte als sie in ihrem ganzen Leben, und als ich mich schließlich Hals über Kopf in Simon verliebte, erschien es mir als der logische nächste Schritt, ihn zu heiraten – selbstverständlich wollten wir den Rest unseres Lebens miteinander verbringen, warum also sollten wir nicht heiraten?
Aber ich hatte wie gesagt auch seit jeher mit dem Gedanken gespielt, Archäologin zu werden, und nachdem sich herausgestellt hatte, dass Simon und ich doch nicht den Rest unseres Lebens miteinander verbringen würden, fungierte ich vor etwas mehr als einem Jahr als freiwillige Helferin auf einer archäologischen Ausgrabungsstätte in unserem Dorf. Leider war auch die Archäologie nicht meine Berufung. Ich hatte mir vorgestellt, ich würde behutsam Artefakte von unschätzbarem Wert sichten und früher oder später an der Seite eines wettergegerbten, aber attraktiven Archäologen (der natürlich ein Tweed-Sakko mit Lederflicken an den Ellbogen trug) ein paar Abenteuer à la Indiana Jones erleben. Ich hatte eine vage Vision von mir selbst mit strengem Dutt und intellektuell wirkender Brille, aber eines Tages würde ich die Brille ablegen und den Dutt lösen, und dann würde der Indiana-Jones-Verschnitt hingerissen hervorstoßen: »Miss Green! Sie sind ja die reinste Augenweide!«, und von da an würden wir andauernd rumknutschen und dazwischen allerlei Bösewichte bekämpfen, die es auf unser Amulett (oder was auch immer) abgesehen hatten.
Tja, es sollte anders kommen. Die Buddelei erwies sich als ziemlich dreckige Angelegenheit, weshalb die Archäologen tendenziell eher praktische Textilien aus Chemiefasern als Tweed-Sakkos trugen. Ein wettergegerbter, attraktiver Mann war nicht unter ihnen, aber zum Knutschen wären wir ohnehin nicht gekommen, weil sich dort zudem fünfundzwanzig rüstige Rentner tummelten, die mich ständig tadelten, weil ich meine Kelle nicht richtig hielt. Und ich musste Skizzen von Gesteinsbrocken anfertigen. Keine Ahnung, wieso ich nicht stattdessen einfach Fotos machen durfte. Ich habe den Verdacht, es handelte sich um eine Art Beschäftigungstherapie, um mich vom allzu enthusiastischen Gebrauch der Kelle abzuhalten, wobei mir ehrlich gesagt schleierhaft ist, was man dabei groß falsch machen kann. Getadelt wurde ich übrigens auch, weil ich einen Bleistift verlor. Dafür lief mir einmal eine Spitzmaus über den Weg. Ich mag Spitzmäuse. Und meine Hunde. Und meine drei Hühner, die mich inzwischen nicht mehr ganz so abgrundtief hassen, weshalb ich zwischendurch überlegt habe, ob meine Berufung vielleicht in der Zoologie liegen könnte. Aber meine Google-Recherche ergab, dass Zoologen selten den Rang und Nimbus eines David Attenborough erreichen, sondern in den meisten Fällen als Zoowärter arbeiten, und selbst mir war klar, dass man als Zoowärter in erster Linie … äh, Haufen schaufelt, und zwar ziemlich große, wenn man beispielsweise für die Elefanten oder Nashörner zuständig ist. Und schon stand ich mit meinen Überlegungen wieder am Anfang.
Freitag, 1. Februar
Es gibt Neuigkeiten: Meine Nachbarin Margaret hat vor ein paar Monaten beschlossen, ihr Cottage zu verkaufen, und als ich heute Abend auf einen Drink bei ihr vorbeischaute, erzählte sie, es habe sich ein Käufer gefunden.
»Ein junger, gutaussehender Single, meine Liebe. Ich fand sein Auftreten bei der Besichtigung sehr sympathisch, geradezu charmant.«