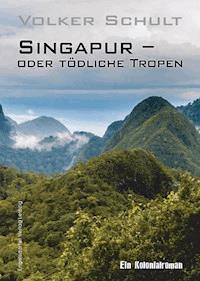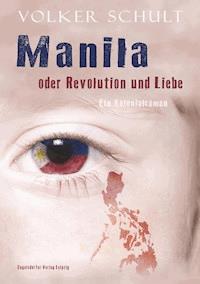
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1899. Revolution auf den Philippinen. Kriegsschiffe vor Manila. Agnes ist voller Neugier und entdeckt die Liebe. Imee ist voller Enthusiasmus und benutzt die Liebe. Wilhelm hat einen Plan, verliert sich aber in der Liebe. Vor der exotischen und tropischen Kulisse des kolonialen Manila muss der deutsche Marineoffizier Wilhelm Kurz einen Goldschatz für die Durchführung eines geheimen und verwegenen Plans sicher aufbewahren. Er findet diesen Ort. Ein todsicheres Versteck.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manila oder Revolution und Liebe
Volker Schult, 1960 geboren, studierte Englisch und Geschichte. Er promovierte in Südostasienwissenschaften und war an verschiedenen deutschen Auslandsschulen als Lehrer und Schulleiter tätig. Schult veröffentlichte zahlreiche wissenschaftliche Publikationen. Zuletzt erschien 2017 im Engelsdorfer Verlag „Singapur – oder tödliche Tropen. Ein Kolonialroman“.
Volker Schult
MANILA ODER REVOLUTION UND LIEBE
Ein Kolonialroman
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2018
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright (2018) Engelsdorfer Verlag Leipzig Alle Rechte beim Autor
Titelbild: human’s face with national flag and map of philippines. © luzitanija
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
PROLOG
„Neeeein!! Nicht schon wieder! Ich werde verrückt! Ich halte das nicht mehr aus! Oh Gott, hilf mir! Hilft mir denn keiner? Oh Gott, erbarme Dich meiner!!“
Mit sich überschlagender Stimme schreit er seine Verzweiflung heraus. Wie ein Echo werden seine Worte von den Wänden zurückgeworfen.
Er schlägt mit seinen ausgemergelten Händen zum wiederholten Mal gegen die unbarmherzigen Wände. Sie geben nicht nach.
Durch diesen Ausbruch aufgeschreckt fangen drei fast dreißig Zentimeter lange Ratten mit ihren langen, nackten, mit Schuppenringen versehenen Schwänzen an zu quicken. Sie wuseln um seine Beine herum, bevor sie sich in irgendwelchen kleinen, dunklen Löchern verkriechen. Sehen kann er sie nicht richtig. Manchmal nur ihre Schatten erahnen. Dunkelheit umgibt ihn.
Voller Ekel versucht er reflexartig seine Beine von diesen schrecklichen Viechern mit ihren spitzen Schnauzen und scharfen Zähnen fortzuziehen.
Vergebens.
Nur Kettengerassel. Er kann seine Beine kaum bewegen. Vielmehr schneiden die eisernen Ketten noch einmal tiefer in seine ohnehin schon wunden Knöchel. Ein scharfer Schmerz durchzuckt ihn.
Erschöpft will er sich in die Hocke begeben. Sofort fährt er aber wieder hoch und stößt mit immer heiserer werdender Stimme Laute der Verzweiflung aus. Laute der Hoffnungslosigkeit. Noch menschliche Laute?
Schwer zu sagen. Ähnliche Stimmfetzen, Schreie, Geräusche dringen an sein Ohr. Er ist seinem Schicksal nicht allein ausgeliefert. Aus dieser Tatsache sollte er eigentlich Mut schöpfen. Aber angesichts seiner ausweglosen Lage ist das kein wirklicher Trost.
Lebendig begraben. Ja, das ist der richtige Ausdruck denkt er: Lebendig begraben. Es gibt keinen Ausweg, keine Rettung, keine Hoffnung.
In der Kammer herrscht ununterbrochen eine solch feuchtheiße Luft, dass die Fetzen Kleidung, die er noch am Leib trägt, ständig klamm sind. Auch das Atmen fällt unendlich schwer. Dazu atmet er nicht nur diese stickige Luft ein, sondern zugleich dringt der schreckliche Geruch von Fäulnis und Verwesung in seinen Körper ein.
Vielleicht verfault er ja schon selbst bei lebendigem Leib.
Aber das wäre ihm mittlerweile auch egal. Hauptsache, die Qual ist endlich vorbei. Da er sich bereits in der Hölle wähnt, kann es nicht schlimmer kommen.
Doch so gut meint es das Schicksal nicht mit ihm. Stattdessen fängt alles wieder von vorne an. Das Wasser steigt und steigt. Er spürt es schon bis zu den Knien.
Von wegen Wasser. Eine fürchterliche Brühe, ja Kloake. Anders kann man diese stinkende Flüssigkeit nicht bezeichnen.
Schon werden seine Oberschenkel von ihr umspült.
Der Gestank nimmt zu. Abfall, Fäkalien und alle möglichen übelriechenden Gegenstände werden mit der ansteigenden Wasserbrühe unaufhaltsam in seine Kammer geschwemmt.
Immer wieder. Die ganze Zeit, seitdem er hier unten ist. Immer im gleichen Rhythmus. Dem Rhythmus von Ebbe und Flut gehorchend. Die Bracke kommt; die Bracke geht; die Bracke kommt; die …
Die Kammer füllt sich. Die Brühe drängt schon gegen seine Brust. Wie hoch wird sie dieses Mal steigen? Hört sie auf, wenn sein Hals erreicht ist? Geht sie bis zum Kinn?
Unwillkürlich stellt er sich auf die Zehenspitzen, um einige wenige Zentimeter zu gewinnen. Zentimeter, die über Leben und Tod entscheiden können.
Einen qualvollen Tod.
Einen sehr qualvollen Tod.
Nichts, aber auch gar nichts kann das Wasser davon abhalten, langsam, ganz langsam in seinen Mund einzudringen, dann in seine Nase. Alleine der Gedanke daran lässt ihn voller Panik mit seinen Armen um sich wedeln, um die Wasserkloake von seinem Gesicht fernzuhalten.
Vergebens.
Schon spürt er das Wasser an seiner Unterlippe. Etwas Weiches, Braunes, Stinkendes schwimmt an seinem Mund vorbei. Ein Stück seiner eigenen Scheiße. Wird er mit seiner eigenen Scheiße im Mund ersticken?
Womit hat er das nur verdient? Er zermartert sich sein Gehirn, aber ihm fällt kein schweres Vergehen ein, das eine solche Tortur rechtfertigen würde.
Seinen Augen quellen voller Todesangst förmlich aus ihren Augenhöhlen. Das ist das Ende. Voller Panik will er schreien, doch …
Er schreckt hoch. Schweißgebadet. Mit angsterfüllten Augen schaut er sich um.
Dann …
Erleichterung.
Vollkommen erschöpft fällt er wieder in seine Koje. Schließt die Augen. Hört das gleichmäßige Klatschen der Wellen an der Schiffswand. Hört das beruhigende, rhythmische Stampfen der Maschinen.
Ein Traum. Ein wahrer Alptraum.
Aber immerhin nicht Realität.
1. KAPITEL: DIE SEESCHLACHT
Eigentlich war es nicht das geeignete Wetter für eine Seeschlacht im Südchinesischen Meer. Der Monsun blies heftig aus Südwest und machte das Manövrieren selbst für größere Schiffe schwierig. Hinzu kam noch, dass ausgerechnet zu dieser Zeit die Pest in der britischen Kronkolonie Hongkong wütete und schon Tausende von Opfern gefordert hatte. Doch davon ließ sich der Commodore des amerikanischen Asiengeschwaders, George Dewey, nicht beeindrucken.
Ein drahtiger, kleiner, rotgesichtiger, fast sechzigjähriger Mann aus Vermont mit eisgrauem Haar und Schnurrbart kommandierte das amerikanische Geschwader. Sein autoritäres Auftreten duldete keinen Widerspruch, strahlte aber auch Zuversicht auf seine Männer aus.
Dewey ließ Anker vor Hongkong werfen und befahl, seine weißen Schiffe mit grauer Farbe anzustreichen. Die Farbe des Krieges. Spätestens jetzt war es auch dem letzten Kombüsenjungen und jedem blutjungen Seekadetten an Bord klar, dass die Lage ernst war.
Nach einigen Tagen stach der eindrucksvolle Flottenverband bestehend aus sieben modernen Kriegsschiffen, angeführt von dem Flaggschiff Olympia, einem imposanten Panzerkreuzer, von Hongkong aus in See.
Erst langsam, dann immer schneller setzten sich die Schiffe des Geschwaders in Bewegung inmitten einer Flutwelle, die am Bug der Schiffe begann und sich als unbegrenzter Wasserwall nach achtern ausbreitete. Sie fuhren in das Südchinesische Meer hinaus, vom immer wiederkehrenden Rhythmus der Hochseewellen getragen.
Der fünf Jahre alte Panzerkreuzer Olympia verdrängte fast sechstausend Tonnen Wasser. Seine beiden Gefechtstürme bestanden aus jeweils zwei 20,3 Zentimeter Geschützen, eingefasst in 10,2 Zentimeter dicken Barbetten. Das stark gepanzerte Deck schützte seine kraftvollen Maschinen, die das Schiff bei Volldampf auf enorme zweiundzwanzig Knoten brachten. Auf Deck verfügte er über zehn 12,7 Zentimeter Schnellfeuerkanonen und auf den verschiedenen Gefechtsständen über zahlreiche weitere Schnellfeuerkanonen kleineren Kalibers und vier schwere Gatling Maschinengewehre. Eine furchteinflößende Kriegsmaschine mit beeindruckender Feuerkraft.
Allerdings war nicht jeder Beobachter in Hongkong sonderlich beeindruckt von dieser Streitmacht und den unerfahrenen Yankees. Dabei hatten britische Marineoffiziere die amerikanischen Kameraden während deren Aufenthalts in Hongkong persönlich durchaus schätzen gelernt.
„Die sind ja ganz in Ordnung für solche Hinterwäldler“, bemerkte gönnerhaft Leutnant McClarke, der selbst aus einem kleinen Dorf aus dem schottischen Hochland stammte.
„Da hast du recht, Johnnie“, erwiderte sein rotgesichtiger Offizierskamerad im Britischen Klub. „Obwohl die Yanks immer nur vom Pokerspiel faseln und von Bridge absolut keine Ahnung haben. Die Mengen an Whiskey, die sie verkonsumiert haben, sind aber schon beeindruckend.“
„Ja, ja, nur Geduld. Wenn die Jungs länger hier gewesen wären, hätten wir ihnen die Zivilisation und das Bridge-Spiel schon in ihre Quadratschädel gepresst.“
Mit dieser Bemerkung erntete Leutnant Jackson ein schallendes, nicht bösartiges, sondern eher wohlgemeintes Gelächter der gutgelaunten Offiziersrunde. Manch einer schlug sich dabei auf die Schenkel. In bester Stimmung stieß man klirrend mit den Gläsern voller Scotch an.
Mit einem Kopfschütteln setzte Leutnant McClarke hinzu: „Mir bleibt es ein Rätsel, warum die Yankees den Spaniern den Krieg erklärt haben. Nur weil sie Kuba endlich unter ihre Kontrolle bringen wollen? Hoffentlich wissen die Jungs, dass auch die Philippinen seit über drei Jahrhunderten zu Spanien gehören. Dort wartet eine formidable Flotte der Dons auf die Yanks. Die haben doch seit ihrem komischen Bürgerkrieg nur noch gegen ihre Rothäute gekämpft. Und selbst da musste General Custer eine schwere Niederlage einstecken. Die armen Teufel. Jetzt stechen sie Richtung Philippinen in See. Das sind ja ganz nette Burschen, aber leider werden wir sie nie wieder sehen.“
Diese lakonische Äußerung brachte Leutnant McClarke ein allgemeines, mitleidiges Kopfnicken seiner Offizierskameraden ein. Plötzlich lag Stille in der alkohol- und nikotingeschwängerten Luft des Kasinos.
Nun könnte man das als einen typischen, überheblichen Ausspruch von britischen Offizieren abtun, die von sich behaupteten, dass ihr Land die Weltmeere beherrsche und es keiner anderen Macht zutrauten, ähnliches zu vollbringen. Und schon gar nicht diesen Yankees, die die Bewohner einer abtrünnigen ehemaligen britischen Kolonie waren. Farmerburschen aus den Wäldern und den Prärien des Mittleren Westens eben.
Wären da nicht auch einige Berichterstatter von Zeitungen an Bord des amerikanischen Asiengeschwaders gewesen, die glaubten, sich auf der Fahrt in den Rachen eines Drachen zu begeben. Sie befürchteten das Schlimmste und begannen, Abschiedsbriefe an ihre Familien zu schreiben.
Kurz nachdem das Asiengeschwader der Vereinigten Staaten von Amerika Hongkong verlassen hatte, sah es sich innerhalb kürzester Zeit schwerem Wetter ausgesetzt.
Angesichts sich gewaltig am Horizont auftürmender Gewitterwolken, die einen tropischen Taifun ankündigten, war die Idee, Abschiedsbriefe zu verfassen, nicht die schlechteste, die die Schreiberlinge hatten. Commodore Dewey aber ließ sich von nichts und niemanden beirren und hielt stur Kurs.
Ungeachtet aller Umstände näherte er sich mit seinem Geschwader unaufhaltsam seinem Ziel Manila, sechshundertundzwanzig Seemeilen von Hongkong entfernt. Obwohl er die genaue Position der gegnerischen Flotte nicht kannte, ließ er sich keinerlei Zweifel anmerken. Ihm war klar, dass zumindest er Zuversicht ausstrahlen musste.
Nach drei Tagen auf hoher See erreichte das amerikanische Asiengeschwader schließlich sein Zielgebiet.
Das erste, was die Seeleute im Mondlicht von den Philippinen sahen, war eine dunkle Landmasse, und was sie rochen, war ein übler tropischer Geruch, der von den kilometerlangen Mangrovendickichten, die sich entlang der Küste erstreckten, stammte. Dahinter konnte man von Buschwerk bewachsene Felsformationen mit spitzen, rau geschwungenen Gipfeln weiter im Inland erahnen.
Die Schiffe wurden gefechtsklar gemacht. Kisten voller Granaten lagen griffbereit, um damit die schweren Geschütze zu füttern. Netze von hartem, aber biegsamen Seilen von der Dicke eines kleinen Fingers wurden an den Bordwänden herabgelassen, um als Splitterschutz zu fungieren. Alle überflüssigen Sachen wie brandgefährdetes Gebälk, Truhen und Kisten, Tische, Stühle und sonstige Gegenstände flogen über Bord.
Vorsichtig und gefechtsbereit ließ Dewey seine Schiffe in die Bucht von Subic einlaufen. In dieser strategisch günstig gelegenen Bucht vermutete man den Feind.
Die Nerven aller waren bis zum Zerreißen gespannt. Es herrschte eine fast atemlose Stille an Bord, wäre da nicht das monotone Stampfen der Dampfmaschinen gewesen. Dann …
Nichts.
Enttäuschung machte sich breit. Wo war denn nur der Feind? Er konnte sich doch nicht in Luft aufgelöst haben.
Also weiter.
Die Spannung musste aufrechterhalten werden. Man durfte sich nicht überraschen lassen.
Dann blieb nur, dass sich die feindliche Flotte in die Bucht von Manila, also vor die Tore der Hauptstadt der Kolonie, zurückgezogen hatte. Um in die Bucht zu gelangen, mussten die Amerikaner durch die schmale Meeresenge an der Festungsinsel Corregidor, die den Eingang in die Bucht von Manila kontrollierte, fahren. Das könnte schnell einem Himmelfahrtskommando gleichkommen. Die Gewässer galten als minenverseucht, die Torpedos waren abschussbereit und die Festungsartillerie von Corregidor konnte jeden Eindringling mit ihren schweren Granaten arg zusetzen. Das amerikanische Geschwader musste mit hohen Verlusten rechnen.
Commodore Dewey aber strahlte weiterhin absolute Ruhe und Zuversicht aus.
„Sechzig Jahre habe ich auf diese Gelegenheit gewartet. Ich befehlige dieses Geschwader in vollster Überzeugung. Hinein in die Höhle des spanischen Löwen, meine Herren!“, rief er mit fester Stimme entschlossen seinen Offizieren zu.
Mittlerweile schoben sich immer wieder Wolkenbänke vor den Mond. Alles in allem blieb es eine dunkle Nacht. Immer wieder zuckten am Horizont Blitze. Leichtere tropische Regenschauer durchnässten die weißen Marineuniformen der Seeleute. Aber davon ließ sich niemand beeindrucken.
Zur Überraschung aller gelang die Einfahrt in die birnenförmige Bucht von Manila während der Nacht reibungslos. Von Minen weit und breit keine Spur. Die Artillerie von Corregidor feuerte nur äußerst ungenau.
Weiter dampften die amerikanischen Kriegsschiffe in die Bucht von Manila hinein. Immer weiter drangen sie in die fünfzig Kilometer tiefe Bucht ein. Bei Tagesanbruch konnten sie die Konturen der Hauptstadt Manila, die über drei Kilometer der Küste einnahm, sehen. Wenn sich die spanische Flotte vor den recht eindrucksvollen Küstenbatterien der Festung von Manila versammelt hätte, dann hätte die vereinigte Feuerkraft der spanischen Geschütze für Deweys Flotte eine ernsthafte Bedrohung bedeutet.
Ein heller Schein im Nordosten ließ die Stadt Manila erahnen. Dann kroch das erste Tageslicht langsam hinter der Stadt hervor. Lange Reihen weißer Häuser und grauer Befestigungsanlagen mit Türmen und Domkuppeln waren auszumachen.
Kurz darauf entdeckte Dewey in seiner weißen Uniform mit der kleinen Golfkappe auf dem Kopf durch sein Fernglas eine Reihe von Schiffen im Hafen. Sechzehn an der Zahl. Die Anspannung stieg. Nur noch zehn Kilometer war das Geschwader von Manila entfernt. Schon wollte der Commodore den Befehl zum Einnehmen der Gefechtsposition geben, als er bemerkte, dass es sich nur um Handelsschiffe handelte.
Dewey traute seinen Augen kaum. Von der spanischen Flotte wieder keine Spur. Sehr seltsam.
„Wo sind diese verdammten Dons nur?“, entfuhr es ihm.
Dann schwenkte sein Blick nach Steuerbord.
„Dort sind sie!“, rief Dewey wie elektrisiert aus. Mit voller Anspannung stierte er durch sein Fernglas.
Alle Augen drehten sich fast zur selben Zeit in die gleiche Richtung. Schon bald konnten auch die anderen Offiziere sie mit eigenen Augen sehen: Vor dem nunmehr hellen, blauen Himmel hob sich die ehrfurchtgebietende Silhouette der spanischen Schiffe ab.
Hier war sie also, die stolze spanische Flotte.
Sie ankerte vor dem befestigten Marinearsenal von Cavite, direkt gegenüber der Stadt von Manila. Geschützt durch die Kanonen von Cavite wollte sie sich zum Kampf stellen.
Mit etwas Enttäuschung mussten die Amerikaner feststellen, dass die spanische Flotte mit ihren sieben Kriegsschiffen zwar zahlenmäßig einigermaßen ebenbürtig war, aber sie bei näherem Betrachten eher altertümlich wirkten und ungepanzert waren. Anscheinend hatte der spanische Admiral Patricio Montojo seine Flotte bewusst hierher in seichte Gewässer beordert, damit die Seeleute im Ernstfall wenigstens eine Chance hätten, an die Küste zu gelangen, wenn ihre Schiffe in Grund und Boden gebohrt werden würden.
Ungerührt befahl Dewey seinen Schiffen Gefechtsformation einzunehmen. An der Spitze befand sich Deweys Flaggschiff Olympia gefolgt von den anderen Kreuzern. Das Geschwader verfügte insgesamt über dreiundfünfzig Geschütze schweren Kalibers.
Auch die Spanier waren bereit. Ihre Flotte war halbkreisförmig vor Cavite positioniert. Stolz wehten die rot-gelben Flaggen Spaniens über den Schiffen. Hochrufe auf König und Gott schallten herüber und die Flaggen zeigten Gefechtsbereitschaft an.
Anspannung pur. Alle Geschützrohre waren auf die Spanier gerichtet. Alle Mann auf Gefechtsstation. Sie warteten mit ernsten Mienen auf den entscheidenden Befehl. Nur die Maschinen stampften monoton und unbeeindruckt von der heiklen Lage vor sich hin.
Schon flogen den Amerikanern die ersten Granaten entgegen - und schlugen weit entfernt ins Meer ein. Je näher die Amerikaner kamen, desto heftiger wurde das Feuer. Aber immer noch ungenau. Dann explodierte ein Geschoß direkt über Olympia.
Alle Mann schauten erschrocken nach oben. Das aber war das Signal für Dewey.
Mit festentschlossener Stimme rief er dem Kapitän von Olympia zu: „Sie dürfen feuern, sobald Sie bereit sind, Franklin!“
Es brach ein unglaublich heißer Tag an. Windstille.
Plötzlich aus einer Entfernung von fünfeinhalb Kilometern spie das 20,3 Zentimeter Geschütz im vorderen Turm auf der Steuerbordseite seine Granate mit einer orangefarbigen Flamme aus. Unmittelbar danach schleuderten die beiden nachfolgenden Kreuzer ihre über einhundert Kilogramm schweren Granaten gegen den Feind.
Die Spanier antworteten. Nun schon genauer. Schrapnellsplitter ließen Wasserfontänen hochspritzen oder schlugen an die Außenwand von Deweys Flaggschiff. Dann flog eine Granate direkt auf die Brücke von Olympia zu.
Schrecksekunde! Alle erstarrten. Das war’s, dachten die Offiziere.
Nur einhundert Meter entfernt fiel die Granate vorher aber ins Meer.
Aufatmen! Das war knapp. Erleichterung machte sich breit.
Auf beiden Seiten wurde ohne Unterlass Granate auf Granate auf den Gegner abgefeuert. Wasserfontäne auf Wasserfontäne spritzte empor, als die Geschoße ins Meer einschlugen. Nur wenn der Qualm zu dick wurde, unterbrach man für kurze Zeit das Feuern.
Neben der tropischen Sonne setzte den Matrosen die fast unerträgliche Hitze an den Geschützen zu, die Salve auf Salve abfeuerten. Lediglich mit Unterhose und Schuhen bekleidet schoben die Artilleristen Granate auf Granate in den Schlund ihrer Kanonen. Der Pulverdampf ließ sie fast ersticken und ihre Augen tränten unaufhörlich, machte sie fast blind. Nur der festentschlossene Wille als Sieger das Schlachtfeld zu verlassen, ließ sie unermüdlich weitermachen.
Jede abgefeuerte Salve erschütterte das Schiff. Die Vibrationen waren so groß, dass die Männer sich kaum auf den Beinen halten konnten. Einige fielen um. Hitzeschlag. Die Sonne brannte unerbittlich vom Himmel. Die Matrosen mussten in die Sanitätsabteilung zur ärztlichen Behandlung transportiert werden.
Im vorderen Kojendeck stieg die Temperatur auf fast siebenundvierzig Grad Celsius. Verglichen mit dem Maschinendeck war das aber fast kühl. Hier zeigte das Thermometer noch höhere Temperaturen an. Unvorstellbar, wie das ein Mensch aushalten konnte. Es herrschte eine geradezu unmenschliche Hitze, die nur mit dem Höllenfeuer verglichen werden konnte.
Die US-Kriegsschiffe fuhren in disziplinierter Reihe mit sechs Knoten Geschwindigkeit in einem vier Kilometer großen Kreis an den spanischen Kriegsschiffen vorbei, wobei sie zunächst ihre gesamten Backbordkanonen abfeuerten und anschließend ihre Steuerbordwaffen einsetzten. Von ursprünglich fünf Kilometer Entfernung kamen sie sich bei jedem neuen Anlauf näher. Dies geschah unablässig, ohne dass die US-Schiffe auch nur ernsthaft in Gefahr gerieten.
Allerdings nahm die Treffgenauigkeit mit der Dauer des Gefechts ab, weil sich immer dichtere Rauchwolken zwischen die Schiffe schoben. Doch während der ersten zwanzig Minuten wurden die Spanier bereits schwer und wiederholt getroffen.
Außerdem fuhren die spanischen Schiffe ziellos in der Gegend herum und standen sich teilweise selbst im Weg, sodass sie das Feuer auf die Amerikaner nicht eröffnen konnten. Wenn der Weg dann mal frei war, schossen sie zahlreiche Salven ab, ohne jedoch präzise zu sein.
Die amerikanischen Kanoniere konnten bald mit bloßen Augen den Verlauf ihrer Geschosse verfolgen, da sich die Schiffe immer dichter an den Gegner heranschoben. Nackt bis zur Taille, schmutzig vom Pulverruß, ihre Köpfe mit nassen Handtüchern versehen, in Schweiß gebadet, der in immer größeren Rinnsalen über ihre schweißglänzenden Körper lief, wuchteten sie unaufhörlich Granate auf Granate, die zwischen fünfundvierzig und über einhundert Kilogramm wogen, in die riesigen Geschütze. Das alles unter einer tropischen Hitze, die das Pech in den Decks zum Schmelzen gebracht hatte.
Über zwei Stunden dauerte die Seeschlacht nun schon. Die Nerven der Männer auf allen Schiffen waren mittlerweile zum Zerreißen gespannt. Leutnant Drake vom Kreuzer Raleigh stieg in das Munitionsdepot hinab, um seinen Männern zu berichten, wie sich draußen die Gefechtslage entwickelt hatte, bevor die Männer unruhig werden würden. Während er noch die Leiter in das Schiffsinnere hinunterstieg, meinte er, Laute zu vernehmen. Als Leutnant Drake der Pulverkammer näher kam, hörte er die Klänge einer Fiedel begleitet von einer Gitarre.
Dann glaubte er seinen Augen nicht zu trauen. In der vorderen Magazinkammer standen Männer aufgereiht auf dem Deck, bekleidet mit kurzen Hularöckchen angefertigt aus Jutesäcken und vollführten eine burleske Tanzaufführung. Zu den Klängen von „There´ll Be a Hot Time in the Old Town Tonight“ sangen sie im Chor. Dieses Lied sollte schon bald einer der populärsten Songs des ganzen Krieges werden. Als die Männer den Leutnant erblickten, beeilten sie sich wie wild auf ihre Stationen zu kommen. Aber Leutnant Drake war nur hochgradig amüsiert und rief ihnen zu: „Männer, wir haben sie. Die Dons sind auf der Flucht. Ich kenne das Lied, das ihr da spielt nicht, aber es ist echt ein Mordslied. Ich will, dass die Klänge auch das Oberdeck erreichen! Also, haut in die Tasten Jungs!“
Und während der restlichen Zeit des Gefechts drang die Musik bis zu den Männern an den Artilleriegeschützen und munterte sie auf.
Das Feuer der Amerikaner konzentrierte sich zunehmend auf den ungepanzerten Kreuzer Reina Cristina, das Flaggschiff des spanischen Admirals. Mit dreitausendfünfhundert Tonnen Wasserverdrängung und sechs 18,8 Zentimeter Geschützen war es das größte Schiff der spanischen Flotte. Der Kreuzer versuchte wie ein von einem Sturm aufgeschrecktes Ross sich dem Feuer zu entziehen. Vergebens. Schon bald stand Reina Cristina bugwärts in Flammen.
Eine weitere Granate sauste auf das Schiff und traf es. Ein 15,2 Zentimeter Geschoss riss ein gezacktes Loch unter das Heck, aus dem der Rauch eines anderen Feuers drang. Direkt in diese offene Wunde schlug eine weitere Granate ein, die einen heftigen Schwall von Flammen und Rauch durch Luken und weiteren Öffnungen freisetzte. Dann schoss ein Strahl von weißem Dampf aus dem hinteren Schornstein hoch in die Luft hinaus und der Kreuzer Reina Cristina schlingerte mit Kurs auf Cavite hin und her, bis das Flaggschiff schließlich vor den Festungswällen auf Grund lief.
Die Flagge des spanischen Admirals wurde daraufhin auf dem Kanonenboot Isla de Cuba gesetzt und zahlreiche Geschütze der amerikanischen Flotte begannen sich schon auf das Schiff zu richten. Doch der weiß gestrichene, ungepanzerte und hölzerne Kreuzer Castilla bot zunächst ein noch verlockenderes Ziel. Granate auf Granate schlug in seinen Schiffsrumpf ein. Die schwarzen Rauchsäulen, die folgten, erzählten davon, dass todbringendes Feuer ausgebrochen war.
Nachdem die beiden großen spanischen Schiffe außer Gefecht gesetzt worden waren, zog sich der Rest der Flotte hinter die Mole des Arsenals von Cavite zurück, von wo es jedoch kein Entkommen mehr gab.
Völlig unvermittelt schoss ein spanisches Torpedoboot heran. Ziel Deweys Flaggschiff. Sofort richtete man dort die Schnellfeuergeschütze und die Sechspfünder aus. Sogar die Matrosen begannen mit ihren Gewehren auf das kleine wendige Schiff zu schießen. Schnell war das Torpedoboot außer Gefecht gesetzt und trieb auf die Küste zu. Im Nachhinein entpuppte sich das vermeintlich gefährliche Torpedoboot als ein harmloses, unbewaffnetes philippinisches Marktboot, das sich zur falschen Zeit am falschen Ort befand. Ein Zeichen, wie angespannt die Nerven aller waren.
Gerade in diesem Moment erreichte die dramatische Nachricht, die Munition werde knapp Commodore Dewey. Das Flaggschiff Olympia signalisierte, dass es sich aus dem Gefecht zurückziehen müsse. Dies ging einher mit der lakonischen Nachricht: „Also gut. Lasst die Leute ihr Frühstück einnehmen.“
Kurz darauf befand sich das gesamte amerikanische Geschwader außerhalb der Reichweite der spanischen Geschütze und legte eine Ruhepause ein. Die Gefechtsabsperrgitter wurden weggeräumt, verschmutzte Matrosen versammelten sich an Deck und begrüßten sich mit lautstarken Rufen wie Dämonen, die aus dem Hades freigelassen worden waren. Mit gutem Appetit wurden Sardinen, Corned Beef und Schiffszwieback verspeist.
Nachdem sich die kommandierenden Offiziere an Bord des Flaggschiffes Olympia versammelt hatten und sich die Nachricht eines knappen Munitionsstands als falsch erwiesen hatte, beschloss man, dem Feind den Gnadenstoß zu versetzen.
Den Anfang machte der Kreuzer Baltimore, der sich für zehn Minuten ein intensives Duell mit den Festungsgeschützen von Cavite lieferte. Der Kreuzer, der sich im Schneckentempo bewegte, geriet schnell in einen Strudel von unaufhörlichen Salven sowohl der eigenen als auch der feindlichen Artillerie. Manchmal war er vollkommen von Rauchschwaden umgeben und schien Feuer gefangen zu haben, während jede Granate, die er abschoss, sich in die Erdwälle bohrte, als ob man sich auf einer Schießübung befände.
Schließlich erwischte es die Cañacao Batterie der Festung. Volltreffer. Ihre Erdbefestigungen wurden emporgeschleudert, zerrissen in der Luft und fielen auf die Mannschaften, die in Panik, sofern sie es überhaupt noch konnten, auseinanderstoben. Schließlich konzentrierte sich das Feuer der amerikanischen Kriegsschiffe auf diese Befestigungsanlage.
Dann wurde die spanische Flagge eingeholt – und stattdessen die weiße Flagge gehisst.
Die Spanier in diesem Fort hatten kapituliert.
Nachdem das Kanonenboot Isla de Cuba schwere Treffer abbekommen hatte, versenkte die Besatzung das Schiff, um die Inbesitznahme durch die Amerikaner zu verhindern. Dasselbe Schicksal erlitt ihr Schwesterschiff. Nun blieb nur noch als einziger halbwegs ernstzunehmender Gegner der ungeschützte Kreuzer Don Antonio de Ulloa. Das Feuer konzentrierte sich auf das unglückliche Schiff, das buchstäblich von Geschossen durchsiebt wurde. Nahezu jedes Geschütz wurde getroffen und unschädlich gemacht. Ihre Besatzung floh auf die geschützte Seite des Schiffes, sprang über Bord und schwamm in den seichten Gewässern an Land. Das Schiff selbst schien sich vor ihren Peinigern noch kurz zu verbeugen, bis es schließlich in den Wellen versank. Damit befand sich fast die gesamte spanische Flotte auf dem seichten Meeresboden, umspült vom warmen Wasser des Südchinesischen Meeres.
Das war das Schlusszeichen. Gegen Mittag hissten die Spanier die weiße Flagge der Kapitulation über der Festung von Cavite.
Das amerikanische Asiengeschwader hatte seinen Gegner vernichtet. Die stolze spanische Flotte ging so eindrucksvoll unter wie die Mauern von Jericho fielen. Fast vierhundert Spanier wurden dabei entweder getötet oder verwundet, während es auf amerikanischer Seite neben einigen Verwundeten lediglich einen Toten durch Hitzschlag gab. Kein US-Schiff hatte auch nur ernsthafte Beschädigungen erlitten.
Erst als die Sonne über der Bucht von Manila langsam im Meer versank, wurde es den Teilnehmern bewusst, dass sie an einer der vollkommensten Siege zur See in der Gegenwartsgeschichte teilgenommen hatten.
Als wie von Zauberhand unvermittelt die tropische Nacht hereingebrochen war, leuchtete die Küste um Cavite herum hell von den Flammen der brennenden spanischen Kriegsschiffe. Reina Cristina und Castilla sahen wie Skelette aus. Die Feuer, die die Schiffe verbrannten, ließen ihre Knochen vor dem Hintergrund der weißen, heißen Hitze geradezu schwarz aussehen. Im flimmernden Licht nahmen die Zerstörungen in Cavite ein surreales Aussehen an, dem Tor in den Hades gleich. Zwischendurch explodierte ein Munitionsarsenal wie ein Vulkan und schleuderte seine brennenden Trümmer hoch in die Luft: ein grauenhaftes Bild von den Schrecken der modernen Kriegsführung.
Langsam wurde Commodore Dewey klar: Ich bin der glänzende Sieger dieser Seeschlacht. Doch was fange ich mit diesem Sieg nur an? Manila liegt mir zu Füßen, doch ich habe keine weitergehenden Befehle. In Washington war niemand auf diesen Ausgang vorbereitet. Und vor allem: Die Kabelverbindung nach Hongkong, die einzige schnelle Kommunikationsmöglichkeit von Manila mit der Außenwelt, war gekappt worden. Und noch etwas wurde Dewey bewusst: Nun war sein Munitionsvorrat tatsächlich zur Neige gegangen.
Was also sollte er tun?
2. KAPITEL: IM SÜDCHINESISCHEN MEER
1899. Einige Zeit später. Hunderte von Seemeilen entfernt.
Mit acht Knoten pflügt das Kanonenboot Iltis mit seinen beiden qualmenden Schornsteinen unter einer erbarmungslos brennenden tropischen Sonne durch die sanften, tiefblauen Wellen des Südchinesischen Meeres. Auf der Brücke schaut der Erste Offizier Hans Thomsen immer wieder besorgt an den Horizont. Mittlerweile kennt er die tropische Idylle. Sie trügt. Schon innerhalb kürzester Zeit kann das Wetter völlig unvermittelt umschlagen. Ehe man sich versieht, befindet man sich inmitten eines gefährlichen Taifuns mit meterhohen Wellen. Wenn man darauf nicht vorbereitet ist, kann es für Mannschaft und Schiff tödlich ausgehen.
Auf der anderen Seite kann Thomsen sich nicht nur auf seine Mannschaft, sondern auch auf sein Schiff verlassen. Iltis ist ein nagelneues Kanonenboot, das sich auf der mittlerweile monatelangen Reise, die hinter ihnen liegt, bewährt hat. Neben Schießübungen vor der malaiischen Insel Langkawi hat Iltis auch schon in der Straße von Malakka mit scharfer Munition erfolgreich auf Piratenschiffe gefeuert. Zwar gehört es mit seinen neunhundert Tonnen Wasserverdrängung nicht zu den großen Kampfschiffen, aber mit seinen 8,8 cm Schnellfeuerkanonen und 3,7 cm Revolverkanonen ist es ein durchaus ernst zu nehmender Gegner. Außerdem ist die knapp einhundertdreißig Offiziere und Mannschaften umfassende Besatzung bestens ausgebildet und hoch motiviert, so wie es sich für ein Schiff Seiner Majestät Kaiser Wilhelms II. eben gehört.
Trotzdem wäre Thomsen wohler, wenn sein Kapitän Wilhelm Kurz auf der Brücke wäre. Noch nie in seiner Seemannskarriere ist Thomsen, auch wenn sie noch nicht allzu lange währt, unter einem seemännisch und persönlich so anerkannten Kapitän auf hoher See gewesen. Umso ehrlicher ist Hans Thomsens Wunsch, seinen Kapitän wieder bei voller Gesundheit zu sehen.
Zwischendurch lässt Thomsen sich immer wieder vom Schiffsarzt Dr. Brandt Bericht über den Zustand seines Kapitäns erstatten. Jedes Mal völlig angespannt lauscht er den Worten des Arztes.
Dabei ging alles so plötzlich. Gerade als sie aus dem Hafen von Singapur ausliefen, passierte es. Zusammen standen sie noch auf der Kommandobrücke, als urplötzlich Kapitän Kurz an allen Gliedern zu zittern anfing. Schweiß stand ihm auf der Stirn und er begann zu wanken. Dann gelang es Thomsen nur noch geistesgegenwärtig den Sturz seines Käpt´ns zu verhindern. Sofort ließ Hans Thomsen den Schiffsarzt rufen, der veranlasste, dass Wilhelm Kurz in die Krankenstation gebracht wurde. Seitdem liegt der Kapitän dort und Dr. Brandt kümmert sich mit den recht bescheidenen Mitteln eines Bordarztes rührend um seinen Kapitän, den der Arzt auch persönlich sehr schätzt. Kapitän Wilhelm Kurz ist kein sturer Kommisskopf, sondern jemand, dem seine ihm anvertrauten Leute wirklich am Herzen liegen.
In seinem Büro im Government House in Singapur sitzt Gouverneur Sir Charles Mitchell an dem aus Mahagoni gefertigten dunklen Schreibtisch. Hinter ihm thront eine Statue von Königin Victoria. Genauso dunkel wie der Schreibtisch ist auch die Miene des Gouverneurs. Sogar die vier Brandy, die er schon zu sich genommen hat, können seine Stimmung nicht aufheitern. Dabei dauert es eigentlich noch zwei Stunden, bis die Zeit für den traditionellen Sundowner in den Tropen angebrochen ist. Die Wangen des zweiundsechzigjährigen Sir Charles haben eine glühend rötliche Farbe angenommen, die nicht nur der Tropensonne geschuldet ist.
Auch der Blick aus dem jalousieartigen Fenster, der an den standbildhaften Säulen vorbei auf die an die berühmten englischen Gärten erinnernden imposanten Außenanlagen geht, muntert Sir Charles nicht auf. Seine Stimmung ist düster, sehr düster. Seine ohnehin enganliegenden Augen mit den dunklen, dichten Augenbrauen scheinen nur noch schmale Schlitze zu sein. Immer wieder fährt er sich mit den Fingern seiner linken Hand nervös über seinen Vollbart, der mit dem Schnauzer zusammengewachsen seinen länglichen Kopf umrahmt.
Ihm gegenüber sitzt sein Stellvertreter Francis Burton, dem die Sorgenfalten auch deutlich auf die Stirn gezeichnet sind.
Mit zusammengezogenen Augenbrauen und tiefer, ernster Stimme wendet sich Sir Charles an seinen Stellvertreter: „Diese verdammten Deutschen. Davongeschlichen haben sie sich. Aus meinem Singapur“, dabei haut Sir Charles wutentbrannt mit seiner rechten Faust auf den Schreibtisch. Francis Burton schrickt hoch.
„Alle haben versagt! Jawohl, versagt!“, setzt der Gouverneur aufgewühlt seine Tirade fort.
„Fort ist er, der Geheimbericht. An Bord von Iltis. Eine verfluchte Sauerei ist das. Alle haben versagt!“, wiederholt Sir Charles, weiterhin wutentbrannt.
„Unsere Agenten, die Chinesen, die wir für teures Geld angeworben haben. Verdammte Schlitzaugen. Was soll ich jetzt nur nach London berichten? Peinliche Angelegenheit“, bei diesen Gedanken etwas kleinlauter werdend.
„Erzählt der verfluchte Kurz unserem Hafenkommandanten von Penang etwas von Schießübungen, die die Deutschen vor der benachbarten Insel Langkawi abhalten wollen. Der glaubt das auch noch und ist froh, dass das Abfeuern der Schiffsgeschütze außerhalb von Penang stattfindet und er seine Ruhe hat. Und was hat der teuflische Deutsche im Sinn?“
Die kurze Pause nach dieser Frage, die Burton zu Recht als eine rhetorische interpretiert, nutzt der Gouverneur, um an seinem Glas Brandy zu nippen.
„Natürlich, er will auskundschaften, ob Langkawi für das Deutsche Reich als Marinestützpunkt geeignet ist. In unserem Einflussgebiet. Konkurrenz zu unserem Penang. Damit die Deutschen auch den Eingang zur Straße von Malakka kontrollieren können. Und das alles für seinen angeberischen, bei jeder Gelegenheit tönenden Kaiser Wilhelm. Man darf das von einer kaiserlichen Hoheit eigentlich nicht sagen, aber ein Großmaul ist Seine Majestät schon. Jawohl!“
Und haut, wie um diese Worte zu unterstreichen, mit der Faust wieder auf den Tisch.
„Von der Empfehlung von dem Kurz hängt es ab, ob die Teutonen Langkawi in ihren Besitz bringen wollen. Wir müssen erfahren, ob er diese Insel als geeignet ansieht oder nicht, damit wir handeln können. So nahe waren wir an dem Geheimbericht schon dran. Hier in Singapur. In unserer Kronkolonie. Und dann macht der verdammte Deutsche Tabularasa und entkommt aus der Falle, die wir ihm in Chinatown gestellt haben. Serviert der Kurz doch tatsächlich die Kerle, die ihm aufgelauert haben, ab. Na gut, Respekt. Muss man ihm schon lassen. Gegen eine Übermacht. Dabei sind diese dummen Schlitzaugen dort zu Hause. Außer am Hafen stehen und der davondampfenden Iltis irgendwelche Flüche hinterher zu rufen, fällt denen dann auch nichts mehr ein. Dummköpfe!“, ruft Sir Charles unwirsch aus und schüttelt den Kopf.
Von seinem Redeschwall erschöpft, lässt er sich nach hinten an die Lehne seines Sessels sinken. Seine Arme rudern hilflos hin und her.
„Alles, was meine Agenten mir dann berichten können, ist, dass ihnen aufgefallen ist, dass in der Entourage von Prinzessin Irene, der Ehefrau von Prinz Heinrich, dem Bruder dieses Angebers Wilhelm Zwo, anscheinend jemand fehlt und nicht mit abgereist ist. Angeblich die erste Hofdame. Das fanden die sehr merkwürdig. Und hatten nichts Besseres zu tun, als mir davon zu berichten. Ja, und wenn schon. Interessiert mich nicht. Diese Luschen. Mich interessiert nur dieser verdammte Ge - heim - be - richt“. Dabei jede einzelne Silbe betonend.
Mit seinem Taschentuch wischt sich Sir Charles den Speichel aus den Mundecken und fährt anschließend mit demselben Tuch über seine schweißnasse Stirn. Mit einem weiteren kräftigen Schluck Brandy versucht er seine Nerven zu beruhigen.
Stille im Raum. Nur das hastige Atmen von Sir Charles ist zu hören. Selbst draußen stellen die Zikaden ihr ansonsten ohrenbetäubendes, scharfes schnarrendes Rasseln vorübergehend ein.
Mit betont ruhiger Stimme bemerkt Francis Burton nur: „Sir Charles, Sie haben vollkommen recht.“
Diese wohlgesetzten Worte - schließlich kennt Francis Burton seinen Chef schon lange - scheinen eine beruhigende Wirkung zu haben.
Mit leiser, ja überraschend sanfter Stimme, fragt der Gouverneur seinen Stellvertreter seufzend: „Was schlagen Sie vor, Francis?“
„Was meinen Sie?“, fragt der Erste Offizier seinen Steuermann. „Wie lange können wir diesen Kurs fortsetzen, bis wir uns entscheiden müssen, ob wir Hongkong anlaufen oder direkt nach Tsingtau fahren?“
„Nicht mehr lange, Käpt´n. Vielleicht noch drei oder vier Stunden. Dann müssen Sie eine Entscheidung treffen.“
Ruhig dampft das Kanonenboot Iltis durch die noch sanft rollenden Wellen des dunkelblauen Südchinesischen Meeres. Nur in Hans Thomsens Kopf ist es nicht ruhig. So manche Gedanken schwappen durch sein Gehirn.
Thomsen steht mit seinen Gedanken alleine auf der Kommandobrücke. Entscheidung treffen, geht es durch seinen Kopf. Die Krankheitslage seines Vorgesetzten Kapitänleutnant Wilhelm Kurz ist alleine ausschlaggebend. Wo kann er am besten behandelt werden? Die richtige Antwort steht eigentlich außer Frage. Natürlich in Tsingtau von unseren tüchtigen deutschen Ärzten.
Selbstredend.
Aber es schleichen sich Zweifel in diesen Gedankengang ein. Was ist, wenn sich der Gesundheitszustand vom Kapitän verschlechtert? Zurück nach Singapur? Noch ist Iltis nicht allzu weit entfernt. Eine Umkehr wäre jederzeit möglich. Oder doch Zwischenstation in Hongkong machen? Dort soll es auch recht gute Hospitäler und Ärzte geben. Wenn auch nur Engländer.
Quälend nisten sich diese Gedanken in Hans Thomsens Kopf ein.
Zurück nach Singapur wäre die schnellste Möglichkeit.
Kurzes Nachdenken.
Ja, das sollte, nein, das müsste Thomsen im Hinblick auf den besorgniserregenden Gesundheitszustand von Kapitänleutnant Wilhelm Kurz befehlen. Also gut. Umkehr nach Singapur.
Schon will er den Befehl geben, als ihn ein anderer Gedanke zögern lässt.
Hans Thomsen denkt noch einmal an die Abreise aus Singapur. Irgendetwas war anders, ja geradezu ungewöhnlich, wenn er jetzt genauer darüber nachdenkt.
Seit der Abreise aus Kiel im Februar des Jahres hat Hans Thomsen seinen Kapitän Wilhelm Kurz als einen ruhigen und umsichtigen Kapitän kennen und schätzen gelernt. Geradezu unaufgeregt hat er alle Beschwernisse, wie das mühselige und demütigende Kohlen im englischen Colombo auf der Insel Ceylon, hingenommen. Auch seinen Geheimauftrag zur Erkundung der Insel Langkawi als möglichen deutschen Stützpunkt am Eingang zur strategisch wichtigen Straße von Malakka hat er bravourös gemeistert. Doch dann muss irgendetwas in Singapur vorgefallen sein.
Kapitän Kurz hat sich in den Tagen in Singapur verändert. Er war kaum an Bord. Klar, als Kapitän der kaiserlich-deutschen Marine hatte er zahlreichen Verpflichtungen nachzukommen. Außerdem wollte er einen alten Schulkameraden, der bei dem dortigen Handelshaus Behn, Meyer & Co. angestellt war, treffen. Hinzu kam noch der Besuch Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Irene von Hessen-Darmstadt, Gemahlin des Kaiserbruders und Kommandeurs des Ostasiatischen Kreuzergeschwaders, Prinz Heinrich von Preußen.
Soweit ist alles nachzuvollziehen, sinniert Hans Thomsen vor sich hin. Aber dennoch.
Irgendetwas war anders.
Irgendetwas stimmte nicht.
Aber was?
Ja, schießt es Thomsen urplötzlich durch den Kopf.
Diese Koffertruhe. Auf einem Mal wurde ein kleiner Trupp Soldaten abkommandiert, um sich ins Hotel de L´ Europe zu begeben, wo Ihre Königliche Hoheit logierte. Dann kamen sie mit drei schweren Koffertruhen zurück an Bord. Auf ausdrücklichen Befehl von Kapitänleutnant Kurz musste eine sofort in den Kühlraum des Schiffes gebracht werden. Dann sollte dieser verschlossen und der Schlüssel unverzüglich vom Wachhabenden an den Kapitän nach dessen Rückkehr an Bord übergeben werden. Ausdrücklicher Befehl des Kapitäns. So hieß es klar und deutlich.
Schon merkwürdig. Eine Koffertruhe im Kühlraum.
Aber in Ordnung. Befehl ist Befehl. Außerdem gab es viele andere wichtige Dinge an Bord vor dem Auslaufen zu organisieren und zu kontrollieren. Da hatte er, Thomsen, keine Zeit, sich Gedanken zu machen.
Aber jetzt. Wenn er darüber nachdenkt. Eigentlich schon sonderbar.
Dann die doch überhastete Rückkehr von Kapitänleutnant Wilhelm Kurz. Zwar versuchte er seine übliche Haltung zu wahren, doch er schien durcheinander zu sein. Ungewöhnlich für ihn.
Anschließend der Befehl, sofort auszulaufen. Obwohl wir noch einige Tage hätten in Singapur bleiben sollen. Dringender Befehl vom Kommandeur Prinz Heinrich, so Kapitänleutnant Kurz.
Sonderbar. Es gab keinen ersichtlichen Grund für die überstürzte Abreise.
Immer wieder schaute Kapitän Kurz sich nach dem Auslaufen um. Richtung Hafen. Der Käpt´n wirkte anders, aufgekratzt, aufgewühlt. Ja, dachte Hans Thomsen, diese Worte treffen den Zustand des Käpt´ns am besten.
Und dann dieser urplötzliche Zusammenbruch auf der Kommandobrücke. Gerade noch rechtzeitig gelang es Hans Thomsen seinen Kapitän aufzufangen, bevor er zu Boden stürzte.
Seitdem liegt der Kapitän auf der Krankenstation und der Schiffsarzt kümmert sich hingebungsvoll um ihn.
Aber anscheinend ist keine Besserung in Sicht.
Also doch Umkehr nach Singapur, denkt sich Thomsen.
Schon will er den Befehl geben, da kommt der Schiffsarzt auf die Brücke und meldet außer Atem: „Kreislauf des Kapitäns stabil. Atmung wieder gleichmäßig.“
„Dr. Brandt, gute Nachricht. Bin erleichtert. Tun Sie weiterhin alles für unseren Käpt´n.“
Also doch nicht Singapur. Wäre wohl auch nicht im Sinne des Kapitäns gewesen, sagt Hans Thomsen zu sich.
„Kurs beibehalten!“, befiehlt er mit entschlossener Stimme.
„In aller Bescheidenheit erlaube ich mir, Ihnen vorzuschlagen, zweigleisig zu verfahren“, sagt Francis Burton mit sonorer Stimme.
„Mmh, zweigleisig also“, wiederholt Gouverneur Sir Charles wie abwesend.
„Zum einen sollten wir den Sachverhalt so neutral wie möglich an unseren Kolonialminister in Whitehall telegrafieren. Mit dem Hinweis, dass wir bald Genaueres mitteilen können.“