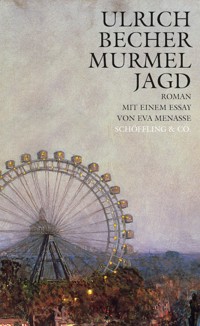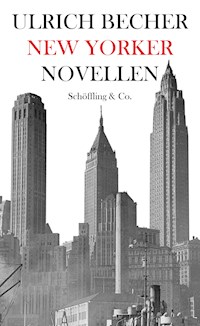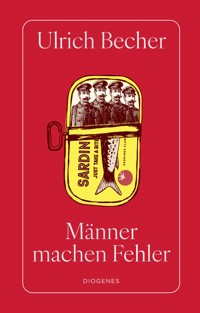
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Betrunkener wird vom Nebel verschluckt. Ein Jüngling, der den Ansprüchen des Vaters nicht genügt, sucht umsonst Trost auf einer wilden Party. Ein 50-Jähriger wird durch den Tod seines ehemaligen Lehrers aus der Bahn geworfen. Ein gelangweilter Sohn aus reichem Hause meldet sich zum Kriegsdienst. Zwei Brüder haben nur noch sich und ihre Fracks, in denen sie von einer Feier zur nächsten geraten. Und ein Künstler muss in seinem Atelier erst intensiv gesucht und dann samt seiner absonderlichen Theorien ertragen werden. Künstler, Sohn, Kavalier, Gelangweilter, Ausbrecher, Halunke – Ulrich Bechers Männer überraschen oder amüsieren in jeder der sieben Geschichten aufs Neue.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ulrich Becher
Männer machen Fehler
Mit einem Nachwort von Robert Stadlober
Diogenes
Vom Unzulänglichen der Wirklichkeit
Es mag sein, dass alles am Whisky lag. Whisky beschreibt eigenartige Kurven im menschlichen Organismus. Zuerst ist er im Mund. Vom Mund gleitet er in den Magen hinab. Vom Magen steigt er hinauf in den Kopf. Um schließlich schwerfällig vom Kopf in die Füße hinunterzusacken. Es mag sein, dass alles am Whisky lag. Doch vielleicht lag es gar nicht so sehr am Whisky. Vielleicht war an allem der Nebel schuld. Dieser sonderbare Nebel, der bisweilen die Küsten Englands umzingelt.
Das ist im Hafen von Southampton. Das ist ein Nebel heute Nacht. In ein paar Hafenkneipen habe ich zahlreiche Whiskys getrunken. Zuerst aus kleineren, später auch aus größeren Gläsern. Der Whisky zerging auf der Zunge. Jetzt brennt er im Magen. Es ist schon spät. Ich könnte zurück in mein kleines Matrosenhotel. Schlafen. Aber ich bin nicht müde. Unternehmungslustig bin ich. Ich bummle am Pier entlang. Irgendwo unsichtbar im Wasser singt eine Schiffswache. Ganz vorn an der Hafeneinfahrt soll ein Riesenboot liegen, aus Amerika. Es bleibt über Nacht in Southampton und fährt morgen weiter. Ein Mann vom Zoll erzählte es mir. Das ist ein Dampfer! Fünfzigtausend Tonnen! Maskenbälle an Bord! Schauspielerinnen und Milliardäre! Das ist ein Dampfer! Ich starre nach vorn. Wellen rauschen, aber man sieht sie nicht. Dieser Nebel hängt vor meiner Nase wie ein Vorhang. Undurchdringlich. Deshalb muss ich hinein. Da liegt aufs Steindock heraufgezogen ein Boot auf der Seite. Ein ganz kleines. Ich schiebe es ins Wasser und springe nach.
Das Boot gleitet. Ich rudere ein bisschen. Ich fühle, wie sich der Whisky in meinem Schädel lagert. Ich strecke mich aus, lasse mich treiben, blicke um mich. Luft und Wasser: Nebel. Man weiß nicht, wo das eine aufhört und das andre anfängt: Nebel. Ich stecke in einem endlosen Wattebausch: Nebel. Ich hänge mit meinem Boot in der Luft herum wie ein Engelchen auf einer Wolke. Ich – ein Engelchen? Ich muss lachen. Nebel dringt durch den lachenden Mund scharf in die Kehle. Nebel riecht wie Kokain. Stille. Nirgends starke Bewegung. Im Hafen ist der Wellenschlag matt. Irgendwo hallt ein Schrei. Wieder Stille. Ab und zu schwarze Flecke verschwommen im grauen Dunst. Schiffe vor Anker. Manche klein, manche groß. Diese Flecken werden seltener, je weiter ich hinauskomme. Hin und wieder mache ich einige Ruderschläge, um Zusammenstöße zu vermeiden. Manchmal zuckt es durch den Dunst wie blinder Lichtschein. Das ist der Leuchtturm von Woolston. Armer Leuchtturm. Du machst vergebliche Versuche, mit deinem Lichtkegel diesen gestauten Dampf zu durchdringen. Der Nachtnebel heute lässt nichts hindurch. Außer einem angetrunkenen Mann in einem Ruderboot.
Ich liege auf dem Rücken, die Hände unter dem Kopf. Der Bauch des Boots fängt kleine Wellen auf: gluck gluck gluck. Wie eine träumende Henne. Der Whisky hat sich über den Körper ausgebreitet, bis in die Füße hinab. Es lähmt und tut gut. Ich mache die Augen zu. Das ist schön. Nebel und Wasser sind weiche Dinge. Wenn es diese harten Dinge dahinten nicht gäbe: das Land und das Matrosenhotel und die Stühle darin und die Whiskygläser und die Shillingstücke! Schade, dass man nicht immer auf dem Rücken liegen darf, in eine Nebelkugel gewickelt. Aber dann könnte man ebenso gut hier sofort aussteigen, in die See hinein und ersaufen. Was nachher kommt, muss ähnlich wie Nebel sein. Irgendwoher aus der Luft tönt es zu mir hinab wie leise Musik. Ich glaube, ich schlafe ein.
Wie leise Musik. Musik – was? Zuerst hielt ich sie für eine Täuschung des Halbschlafs. Dann unterscheide ich deutlich Geigen und Trompeten. Ziemlich laut. Dann wieder entfernter und leiser. Jetzt ganz nah, von oben her. Ich schnelle in die Höhe. Verflucht! Vor mir hört der Nebel auf. Und das Meer auf. Eine starrende Riesenwand, auf die mein Boot mit Geschwindigkeit zutreibt. Verflucht! Ich reiße das Steuer herum. Im Rudergelenk quietscht es böse. Kurz vor der schwarzen Wand gelingt es mir beizudrehn. Verwirrt blicke ich auf. Die Riesenwand ist durchlöchert von vielen Reihen zahlloser kleiner Lichter. Die Lichter spiegeln im Wasser. Es ist wie ein untergegangener Sternenhimmel.
Ich werde ganz ruhig. Ich weiß Bescheid. Ich bin weit hinausgetrieben. Die kleinen Lichter sind Luken. Es ist der Amerikadampfer, von dem der Zollbeamte erzählte. Ich bin plötzlich hellwach. Merkwürdig kitzelt es in der Herzgegend. Ich fahre an der Wand entlang. Sie scheint endlos. Schließlich biege ich um das Ende des Schiffs. Im verschwommenen Schein roter Laternen, die oben angebracht sind, bläht sich das riesenhaft gewölbte Heck in den Nebel hinein wie ein Erdball in den Luftraum. Ich fahre auf der anderen Seite weiter. Um das ganze Schiff herum. Um die Insel Wight fährt man auch nicht viel länger.
Musik, die vom obersten Deck herunterschallt: Vielleicht feiern sie dort ein Maskenfest. Die reichsten Männer der Welt. Die schönsten Frauen der Welt. Es ist mir unvorstellbar, so wie mir das, was sich über dem Himmel befindet, unvorstellbar ist.
Ich klettere auf einer Strickleiter in die Höhe. Die Leiter hing ins Wasser hinein. Das Boot habe ich unten angebunden. Ich klettere. Zu beiden Seiten versinkt Schiffsluke um Schiffsluke. Ich steige am untersten Deck vorbei. Alles dunkel. Ich lasse die Mitteldecks unter mir. Ich klimme empor. Immer weiter empor. Von ganz oben zittert Licht und Musik durch den Nebel. Dort hinauf! Stufe um Stufe. Griff um Griff. Ein Toter klettert ins Paradies.
Hier bin ich. Oben … Ich habe mich geirrt. Es ist kein Paradies. Es ist ein gewöhnliches Promenadendeck erster Klasse.
So ergeht es mir immer. Paradies ist nur aus unbekannter weiter Ferne möglich. Wenn man selbst zuunterst ist und es zuoberst wähnt. Doch steigt man hinauf und langt oben an, dann hört so ein gewähntes Paradies auf, ein Paradies zu sein. Es wird zum Alltäglichen, Längstvermuteten. Es wird zum trivialen Promenadendeck erster Klasse.
Das Außendeck ist menschenleer. Ich blicke durch eines der Kajütenfenster, aus dem Licht und Musik strömt. Es ist ein stilles Licht. Und eine traurige Musik, einem Trauermarsche ähnlich. Drinnen sitzen etwa zehn Männer in Fracks gesenkten Hauptes um einen Tisch herum. Auf dem Tisch liegt steif eine alte Frau, angetan mit einem äußerst eleganten ausgeschnittenen Abendkleid. Glitzernder Schmuck fasst Hals und ärmellose Arme ein. Ihre Hände sind auf der Brust gefaltet. Ihr Gesicht ist vergilbt und zusammengerollt. Sie ist tot. Eine Leichenfeier.
Ich trete vom Fenster zurück. Merkwürdigerweise mehr enttäuscht als verwundert. Hier kann ich nicht bleiben. Soll ich hinunter in mein Schiffchen? Ich weiß, was unten ist. Oder soll ich noch weiter hinauf in den Nebel? Ich weiß nicht, was dort oben ist. Vielleicht finde ich doch noch ein Paradies, ein ganz kleines wenigstens.
Ich blicke an einem ragenden Mast entlang, der hoch im hängenden Nebel zergeht. Viele Stricke führen an ihm hinauf. Ich springe in die Höhe. Ich hänge an einem der Taue. Ich ziehe mich langsam hinauf. Ich weiß, wie man es macht. Noch von der Schule her, wo wir in den Turnstunden an Taue geklammert wie Affen aussahen, mit langen Schwänzen, die umso länger wurden, je höher wir kletterten.
Jetzt habe ich die Spitze des Mastes. Es ist viel kälter als unten. Nebelwind treibt mir Tränen in die Augen. Meine klammen Finger klammern sich um das Tau. Man könnte hinunterfallen. Da ist ein Quermast. Es ist mir unverständlich, wie ich den Mut aufbringe: Plötzlich balanciere ich auf dem Quermast entlang, der horizontal in die Luft hineinragt wie ein Sprungbrett in einer Badeanstalt. An den gespannten Seilen taste ich mich bis zum äußersten Ende des Balkens. Dort hocke ich mich nieder im Winkel zwischen Seil und Holz. Ich stiere zum andern Ende des Querbalkens hinüber. Dort sitzt etwas. Nein, nichts sitzt. Doch, es sitzt etwas dort. Im Halbdunkel des Nebels erkenne ich die Konturen einer Gestalt, die unbeweglich kauert, gleich mir zwischen Balkenende und Seil gezwängt. Es macht mich staunen, dass all dieses mich nicht erschreckt, sondern nahezu gleichgültig lässt.
Ich hocke auf meiner Stange. Und dann blicke ich hinauf: ein Nichts über mir. Oder eine Unendlichkeit. Und dann starre ich hinab wie eine Fliege vom Kirchturm: ein Nichts unter mir. Oder eine Unendlichkeit. Unendlich hoch muss ich sein. Ich fühle es an der Heftigkeit, mit der es mich nach unten zieht. Ich fühle es. Ein Gefühl. Gegen Gefühle kann man wenig machen. Man kann sie unterdrücken. Sie kehren wieder, stärker nur, pochender. Bis man ihnen erliegt. Es zieht mich: nach unten! Es drückt von oben auf mich: nach unten! Es hilft nichts mehr. Ich lasse locker.
Und falle. Ins Leere. Und falle. Langsam und gleitend, wie eine Feder fällt. Und falle. Leiser Luftzug um die Schläfen. Nirgends schlage ich auf. Es ist angenehm, so hinabzusinken. Ich habe Zeit. Ich stecke meine Hände in die Hosentaschen. So falle ich.
Es ist alles vorbei. Es gab ein Krachen. Einen hölzernen Ton. Ich erwachte. Ich liege in meinem Boot. Der hölzerne Ton ist geblieben. Er kommt von der Vorderkante. Mir ist, als ob die Jolle in kurzen Abständen irgendwo anstieße. Ich richte mich verschlafen in die Höhe. Ich reiße die Augen auf. Ich glotze offenen Mundes an einer gewaltigen Mauer empor wie an einem nächtlichen Wolkenkratzer. Kleine Wellen schlagen mein Boot leicht dagegen: der hölzerne Ton.
Fast ist es unglaublich. Vorhin schlief ich ein. In meiner Jolle schaukelnd. Irgendwo draußen im Nebel. Ich hatte zu viel getrunken. Ich träumte. Es war ein Whiskytraum. Ich träumte von absonderlichen Dingen. Von Musik aus der Luft. Von einer lichtdurchlöcherten Wand, auf die ich zutrieb. Von Klettereien auf einem Ozeandampfer. Und während ich träume, treibt mich die Wirklichkeit an selbigen Ozeandampfer heran. Und wie ich erwache: Wirklich ragt die Wand vor mir auf. Wirklich tönt aus der Höhe Musik.
Whisky betäubt. Andererseits macht es den verrosteten menschlichen Instinkt so gelenkig wie Öl eine Maschine. Im Zustand eines whiskygetränkten Schlafes wird das Vorahnungsvermögen sensibilisiert. So wird es möglich, dass Dinge im Traum erscheinen und sofort nach Erwachen in der Realität vorhanden sind. Träume dieser Art muten unheimlich an.
Ich fahre um das Schiff herum. Wirklich rote Laternen am Heck. Wirklich, dort hängt eine Strickleiter ins Wasser hinein, und Musik und Licht strömt von oben. Ich steige an der Leiter hinauf, mit pochendem Herzen. Es liegt ein unwiderstehlicher Reiz darin, seinen privaten Traum mit einer öffentlichen Wirklichkeit zu vergleichen.
Die Decks, die ich unter mir lasse, die Luken, es sind alles bekannte Dinge. Nur scheint mir Verschwommenes weniger verschwommen, scharf Konturiertes weniger scharf konturiert zu sein, als es im Traum war. Ich habe das oberste Deck erreicht. Leer. Musik klingt mir entgegen. Diesmal ist es keine traurige. Es ist Tanzmusik. Ich blicke durch das Fenster. Männer in Fracks sitzen um einen Tisch herum. Auf dem Tisch stehen Gläser und Flaschen. Sonst nichts. Im Hintergrund tanzt ein Mann mit einer Frau.
Dies also ist der Punkt, wo Traum und Wirklichkeit sich spalten. Das glaube ich. Doch täusche ich mich. Wie ich vom Fenster zurücktrete, ragt derselbe Mast vor mir auf, weit oben im Nebel versickernd wie vorhin. Ich stehe geduckt. Ich versuche, mich zu vernünftigem Denken zu zwingen: Schluss mit der Verfolgung eines läppischen Traums! Hinunter in meine Jolle! Nächtliches Mastklettern auf einem unbekannten Schiff ist verboten und halsbrecherisch! Hinunter!
Es kommt anders. Ist es der Whisky, ist es der Nebel: Dinge dieser Materie haben eine Dünstung, die Überlegungen abtötet und Gelüste aufpeitscht. Und so hänge ich denn am Seil. Und so ziehe ich mich aufwärts. Aufwärts. Und so habe ich schließlich die Spitze des Mastes erreicht. Wieder taste ich mich auf dem Querbalken bis zum äußersten Ende entlang und begreife nicht, wie ich den Mut aufbringe, da ich doch jetzt wahrhaftig wach bin. Wie zuvor sitze ich auf dem Balken, mit einem nebligen Luftraum über mir und einem nebligen Luftraum unter mir. Alles ist ebenso traumhaft. Nur die kauernde Gestalt fehlt. Oder? Ich starre zum andern Balkenende hinüber. Dort hat sich ein dunkler Flecken gebildet. Ich schließe die Augen, öffne sie. Nein, es ist nichts. Das ist gut. Dann blicke ich wieder hinüber: Doch, es ist etwas. Und bald erkenne ich deutlich die Umrisse der kauernden Gestalt.
Ich beginne an der Wirklichkeit zu zweifeln. Kann es nicht möglich sein? Kann es nicht möglich sein, dass auch dieses ein Traum ist? Kann es nicht sein, dass ich noch immer schlafend in meiner Jolle im Hafenwasser umherschaukle und träume? Es kann, es kann sein. Und nun greift wie zuvor das Gefühl von mir Besitz. Das zupfende, nach unten ziehende. Es muss noch Traum sein. Es wird noch Traum sein. Ich werde in meinem Boot erwachen. Ich kann mich ruhig fallen lassen. Ich weiß, wie schön dieses Fallen ist. Ich schnuppere in den Nebel. Es ist ein banger Augenblick. Der Nebel riecht so frisch, so wirklich. Dann gebe ich nach. Das nebelgeschwängerte Seil, an dem ich mich halte, entschlüpft meinen Händen wie ein feuchtes Reptil.
Kein Fallen, wobei Kühle leicht die Schläfen streichelt. Kein federleichtes Hinabsinken. Ein sekundenlanges Stürzen. Kein Luftzug, ein Luftdruck, der mir den Atem ausquetscht und kreischend in den Ohren heult.
Und dann spritzt Schaum. Wasser knallt. Ich werde tief ins Meer hineingepresst. Eisiges Kaltes zerreißt meine Brust. Wasser dringt in Nase, Augen und unter Achselhöhlen. Schreien will ich. Aber es ist nur ein tödlich erschrockenes Gurgeln, das schwächer wird. Das ist kein Traum mehr! Und schwächer wird. Und erstirbt …
(Ein Schiffskoch hörte den Aufschlag im Wasser. Man ließ ein Boot zur See. Man suchte mit Laternen in der nebligen Nacht. Matrosen fischten ihn heraus. Er gab kein Zeichen von sich. Schiffsärzte zwangen den leblosen Körper zu Kniebeugen und rotierenden Armbewegungen. Eine große Lache Meerwassers bildete sich auf dem Boden. Nach eineinhalbstündigen Bemühungen gelang es, ihn zum Leben zu erwecken.)
Zwei im Frack
Wir sind zwei Brüder. Wir sind aus besserer Familie. Wir haben bessere Zeiten gesehen. Dies beides ist das Einzige, was »besser« ist bei uns. Alles Übrige ist schlecht. Die Zähne, die Laune, die Verdauung, der Schlaf, alles. Manchmal ist es sogar sehr schlecht. Manchmal hungern wir sogar.
Wir sind nicht mehr jung. Beide um vierzig herum. Wir wissen, dass wir einen lächerlichen Eindruck machen. Zwei Brüder, die unverheiratet sind, zwei Brüder, die noch mit vierzig aneinanderhängen wie ein ausgefranstes Hosenbein am andern, erscheinen stets lächerlich.
Wir waren immer zusammen. Wir waren in Büros tätig. Wir wurden krank. Man entließ uns. Wir versuchten es als steppende »Brothers« an einer Schmierenrevue. Die Schmiere ging ein. Da hatten wir nichts mehr. Außer unseren Fracks. Die waren alt, aber gut. Bevor wir zur Revue gingen, ließen wir sie auf modisch umarbeiten. Jetzt sitzen sie uns wie angegossen. Wir machen in ihnen einen vertrauenswürdigen Eindruck. Sogar einen männlichen Eindruck, wenn wir wollen. Aber wir wollen nicht. Wir sind müde.
Es nützt nichts. »Morgen werden wir sie ins Leihhaus tragen«, beschließen wir am Montagabend. In der Nacht wälzen wir uns in den Betten. Jeder fühlt vom andern, dass er nicht schlafen kann, sondern überlegt. »Wir werden sie nicht ins Leihhaus tragen«, beschließen wir am Dienstag. Nachmittags kramen wir in fast leeren Schubladen. Wir stöbern unsere alten Zylinder auf. (Wir können sie auf der Nase balancieren.) Unsere beiden letzten Frackhemden sind an den Manschetten abgestoßen. Aber sie sind sauber und gestärkt. Wir werfen sie auf den Tisch. Es gibt einen hölzernen Klang, als habe man zwei Holzbretter geworfen.
Morgen ist Mittwoch. Da wird uns die Wirtin aus dem Zimmer werfen. Die Koffer– es ist nur Plunder darin – wird sie zurückbehalten. Weil wir seit Monden die Miete schulden.
Am Mittwoch erwachen wir um sechs. Kleiden uns sorgfältig in unsere Fracks, als gingen wir zu einer Soiree. Setzen unsere Zylinder auf. Stecken unsere Zahnbürsten ein. Stauben uns ein letztes Mal gegenseitig ab. Werfen einen letzten Blick in den Spiegel. Steppende Brothers? Elegante Erscheinungen? Lieblinge des Publikums? – – Nur ein bisschen zu ältlich und zu unterernährt.
Die Wirtin tritt ein. »Heraus!« Zur Tür weist ein ärmellos dicker Frauenarm, der allein schon wirkt wie ein junges Schwein. »Heraus!« Mit einer Geste wie der Erzengel.
Wir gehen schon! Wir gehen schon! Wir henkeln uns ein. Wir tänzeln an ihr vorbei. »Unser Eigentum in den Koffern steht zu Ihrer Verfügung, Madame.« Sie ist wütend. Und erstaunt, wegen der Fracks am frühen Morgen. Am liebsten würde sie sie uns ausziehen. Das macht uns gutgelaunt wie Schuljungen. Wir schlagen kräftig die Türe zu.
Wir gehen auf der Straße. Es ist noch halb dunkel. Denn wir stecken im tiefen Herbst. Wir schreiten in den frühen Morgen hinein. Arm in Arm und singen. Nicht besonders laut. Ein Arbeiter geht vorbei mit einem blauen Esstöpfchen an der Hand. Er fixiert uns böse. Er hält uns für zwei galante Bummler, die auf dem Heimweg sind nach einer prunkvoll nächtlichen Orgie. Wenn ich zur Arbeit muss, kommen diese reichen Nichtstuer betrunken grölend von ihren kostspieligen Vergnügungen nach Hause! Das denkt der Arbeiter, der soeben vorbeiging. Wenn er wüsste. Wenn er wüsste, dass wir nur unsere Zahnbürsten in der Tasche haben.
Wir schreiten singend in den frühen Morgen hinein. Wir wissen nicht, wohin. Keine Ahnung haben wir, wohin. Trotzdem ist uns wohler als diese ganze letzte Zeit. Die Straße ist leer und unbeweglich und steinern. Bis auf zwei Butterbrotpapiere. Die hüpfen planlos auf dem Damm vor dem matten Winde her. Bis auf zwei Butterbrotpapiere und zwei Herren im Frack. Jetzt ist es halb hell.
Vor einer Haustür steht ein Leichenauto. Acht befrackte Leichenträger stehen im Kreise und gähnen und schwatzen. Aus der Haustür tritt ein verweinter Hinterbliebener in langem Mantel und ruft mit näselnder Stimme: »Bitte bemühen Sie sich hinauf, meine Herren!« Der Kreis der Befrackten löst sich auf und strebt der Türe zu. Mit ihnen werden wir hineingespült ins Treppenhaus. Wir steigen die Treppe hinauf. Wir sind in einer fremden Wohnung. Wir fallen nicht auf. Die Leichenträger nehmen keine Notiz von uns. Sie halten uns für Hinterbliebene. Die Hinterbliebenen halten uns für Leichenträger. Wir haben unsere Fracks vorne zugeknöpft und die Revers hochgeschlagen, damit man nicht die unpassende weiße Weste und die weiße Krawatte sieht. So sind wir nun ganz in Schwarz, würdig, uns in einem Trauerhause aufzuhalten.
Anscheinend ist die Familie noch nicht zum Aufbruch bereit. Wir stehen müßig auf dicken Teppichen herum. Die Leichenträger stehen wieder im Kreise und gähnen und schwatzen. Wir haben noch nichts gegessen heute. Wir gehen in die Küche. Wir verlangen zu essen. Unsere Kleidung wirkt vornehm. Wir werden vom Dienstmädchen für etwas Besseres gehalten. Vielleicht für entfernte Verwandte der gnädigen Frau. Wenn jemand gestorben ist, fragt man nicht nach Einzelheiten. Man serviert uns ein umfangreiches Frühstück im Wintergarten.
Während wir speisen, wird im Nebenzimmer der Sarg hereingetragen. Wir sehen es durch die offene Tür. Wir wischen uns den Mund ab. Wir nehmen unsere Zylinder. Wir gehen ins Nebenzimmer. Dort sind alle versammelt. Wir mischen uns unter die Leichenträger. Wir stehen zunächst dem Sarg. »Kann man ihn noch einmal öffnen, nur noch ein letztes Mal!?«, sagt eine leidende Frauenstimme. Der Sarg wird geöffnet. Die Frauenstimme weint sehr laut. »Und da sagt meine Alte, die Ohrenwärmer kriegste erst zu Weihnachten«, erzählt ein Träger flüsternd dem andern.
Der Arrangeur des Begräbnisses betritt das Zimmer. Er wirft einen prüfenden Blick auf den geöffneten Sarg. »Er muss anders gebettet werden!«, sagt er mit sachverständiger Miene. »Sonst rutscht er schief, wenn er die Treppe hinuntergetragen wird. Wollen Sie bitte anfassen helfen, meine Herren!«
Wir beide stehen zunächst dem Sarg. Einer am Fußende. Der andre am Kopfende. Wir bücken uns. Wir heben den Toten heraus. Einer zu Häupten, einer zu Füßen. Während wir ihn halten, schauen wir uns plötzlich an. Und lächeln. Steppende Brothers? – Wir lächeln unmerklich. Niemand hat es bemerkt.
Mittlerweile ist ein Kissen untergelegt worden. Wir betten den Toten zurück in den Sarg. Das Kissen stopft den Sarg aus. Der Tote wird nicht rutschen, während man ihn die Treppe hinunterträgt. Die Frauenstimme weint sehr laut.
Die Treppe ist eng. Am engsten an der Treppenbiegung. Längs geht der Sarg nicht durch. Der Arrangeur gibt Befehle. Die Träger fluchen gelassen. Schließlich rafft man den Sarg der Länge nach in die Höhe. Man stellt ihn auf den Kopf. So geht es. Man überschlägt ihn langsam, stellt ihn wieder auf den Kopf. Uns wird schwindlig, wenn wir uns in die Lage des Toten versetzen.
Die Hinterbliebenen zwängen sich schlaff in eine Taxe. Sie fahren voraus. Wir helfen den Leichenmännern den Sarg in das schwarze Auto laden. Das Auto fährt an. Es fährt langsam, gemessen, im Schritt. Die Männer haben eine Kolonne gebildet. So trotten sie hinter dem Auto her. Wir sind das letzte Glied des befrackten Trupps. Zehn Zylinder wippen bei jedem Schritt, links, rechts.