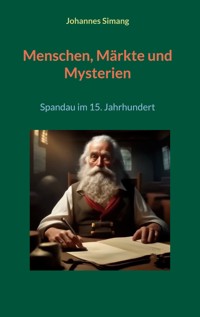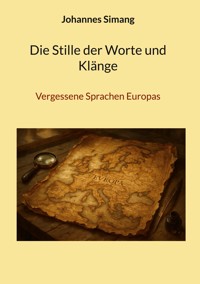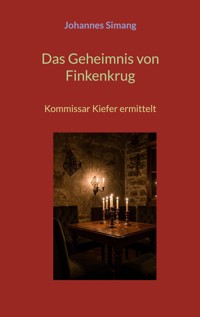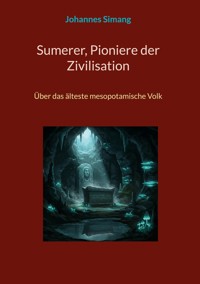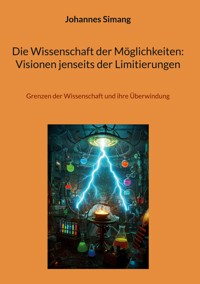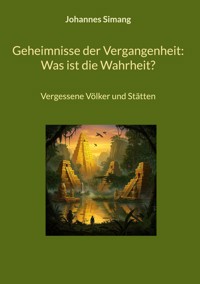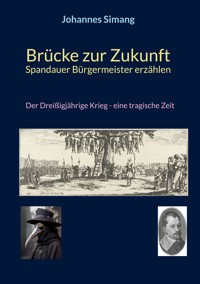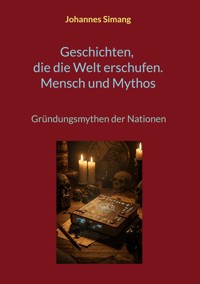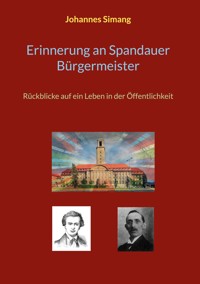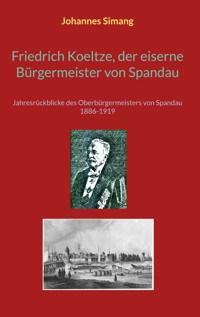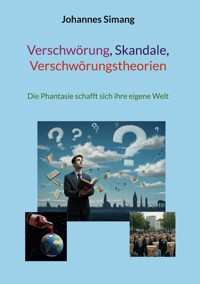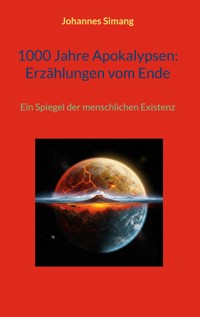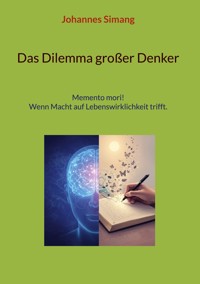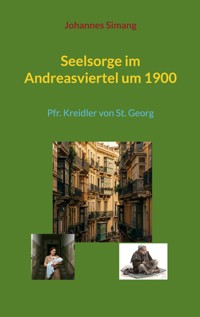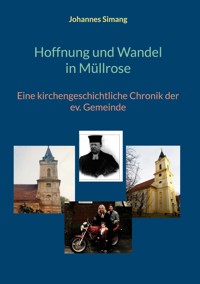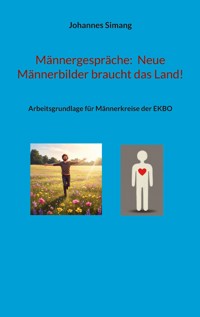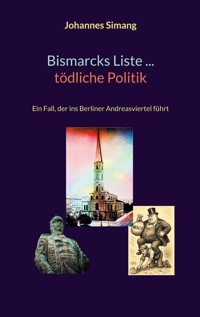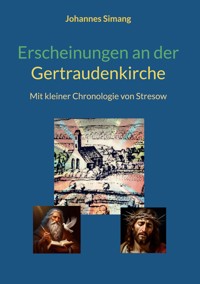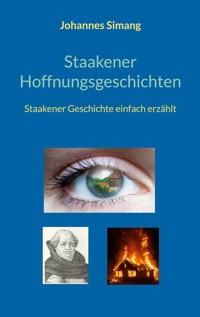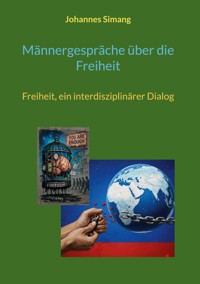Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In einer Welt, die oft von Oberflächlichkeit und schnellen Urteilen geprägt ist, suchen wir nach tieferem Verständnis und echtem Miteinander. 'Männergespräche über Empathie' nimmt uns mit auf eine Reise durch die facettenreiche Landschaft des menschlichen Empfindens. In den ehrlichen und offenen Dialogen des Männerrunde der ev. Männerarbeit der EKBO begegnen wir nicht nur den Gedanken von Philosophen und Theologen, sondern auch den Erfahrungen und Emotionen unserer Protagonisten. Empathie ist mehr als nur ein Schlagwort, sie ist eine essenzielle Fähigkeit, die uns in der heutigen Zeit oft abhanden zu kommen scheint. Die Gespräche in diesem Buch laden dazu ein, sich mit den verschiedenen Dimensionen der Empathie auseinanderzusetzen, ihre Bedeutung für zwischenmenschliche Beziehungen zu erkunden und zu hinterfragen, wie wir als Männer in einer zunehmend komplexen Welt empathisch handeln können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gewidmet:
Meinen Gesprächspartnern:
Johannes Straubing Hans Joachim Kratz Silvio Hermann-Elsemüller Volker Haby
Gottfried Wiarda
Inhalt
Teil I:
Vorwort zum Thema ‚Empathie‘
Kap. I
- Empathie: Stärke oder Schwäche?
Kap. II
- Antike Konzepte der ‚Empathie‘
Kap. III
- Empathie in der hinduistischen Lehre
Kap. IV
- Empathie in der buddhistischen Lehre
Kap. V
- Empathie im Denken chinesischer Philosophen
Kap. VI
– Denker des Mittelalters und der Reformation
Teil II Empathie psychologisch und ethisch
Kap. VII
– Empathie in psychologischer Perspektive
Kap. VIII
– Empathie aus ethischer Sicht
Teil III Empathie aus philosophischer Sicht
Kap. IX
– Erkenntnistheorie und Empathie
Kap. X
– Phänomenologie und Empathie
KAP. XI
– Sozialphilosophie und Empathie
Kap. XII
– Politische Philosophie und Empathie
Kap. XIII
– Empathie als Begriff moderner Theologie
Kap. XIV
– Männer und Frauen und Empathie
Kap. XV
– Gespräch über Empathie
Kap. XVI -
Gespräch über Empathie, genderorientierte Ethik und Berufsbildung
Vorwort
Dieses Buch ist ein Lesebuch, deshalb die große Schrift. Dieses Buch ist entstanden, als neurodiverse Gestalten wie Elon Musk und viele Fake News-Gegner wie Donald Trump u.a. ‚Empathie als Schwachpunkt der westlichen Welt‘ beschrieben. Manche sehen diese beiden als Genies. Donald Trump ist in seiner zweiten Amtszeit und wird schon nach den Zwischenwahlen in den USA auf dem Kehrichthaufen der politischen Geschichte landen. Elon Musk hat twitter gekauft und zur kommunikativen Kloake gemacht. 44 Milliarden Dollar hat er dafür bezahlt, der Wert wird heute auf 9 Milliarden geschätzt, denn welcher Werbekunde platziert seine Werbung auf der vollurinierten Herrentoilette. …
In einer Welt, die oft von Oberflächlichkeit und schnellen Urteilen geprägt ist, suchen wir nach tieferem Verständnis und echtem Miteinander. „Männergespräche über Empathie“ nimmt uns mit auf eine Reise durch die facettenreiche Landschaft des menschlichen Empfindens. In den ehrlichen und offenen Dialogen des Männerrunde der ev. Männerarbeit der EKBO begegnen wir nicht nur den Gedanken von Philosophen und Theologen, sondern auch den Erfahrungen und Emotionen unserer Protagonisten.
Empathie ist mehr als nur ein Schlagwort – sie ist eine essentielle Fähigkeit, die uns in der heutigen Zeit oft abhanden zu kommen scheint. Die Gespräche in diesem Buch laden dazu ein, sich mit den verschiedenen Dimensionen der Empathie auseinanderzusetzen, ihre Bedeutung für zwischenmenschliche Beziehungen zu erkunden und zu hinterfragen, wie wir als Männer in einer zunehmend komplexen Welt empathisch handeln können.
Die Mitglieder der Männerrunde bringen unterschiedliche Perspektiven und Lebensgeschichten mit, die nicht nur die philosophischen und theologischen Überlegungen bereichern, sondern auch die Herausforderungen und Freuden des Lebens reflektieren. Diese Dialoge sind ein lebendiges Zeugnis dafür, dass echte Gespräche über Gefühle und Empathie nicht nur möglich, sondern auch dringend notwendig sind, schon um sie für die Arbeit mit Männern fruchtbar zu machen.
Lassen Sie sich von den Gedanken und Erkenntnissen der Freunde inspirieren. Mögen die Gespräche in diesem Buch nicht nur zum Nachdenken anregen, sondern auch zu einer tieferen Verbindung zueinander führen – sowohl in der ev. Männerarbeit als auch darüber hinaus. Denn Empathie ist der Schlüssel zu einem respektvollen und verständnisvollen Miteinander, und die Bereitschaft, zuzuhören und zu verstehen, beginnt in uns selbst.
Willkommen in der Welt der Männergespräche – mögen sie Ihnen neue Einsichten und Perspektiven schenken.
Johannes Simang
Vorwort zum Thema ‚Empathie‘
Eine fundamentale menschliche Fähigkeit
Empathie ist ein zentraler Begriff in der Psychologie und der zwischenmenschlichen Kommunikation. Sie beschreibt die Fähigkeit, die Gefühle, Gedanken und Perspektiven anderer Menschen nachzuvollziehen und zu verstehen. Empathie ist nicht nur eine emotionale Reaktion, sondern auch eine kognitive Fähigkeit, die es uns ermöglicht, uns in die Lage anderer zu versetzen und ihre Erfahrungen nachzuvollziehen.
Die Dimensionen der Empathie
Empathie kann in zwei Hauptdimensionen unterteilt werden:
die affektive und die kognitive Empathie.
Affektive Empathie bezieht sich auf die Fähigkeit, die Emotionen anderer Menschen zu fühlen und emotional auf sie zu reagieren. Wenn wir sehen, dass jemand traurig ist, können wir selbst Traurigkeit empfinden. Diese Form der Empathie ist oft intuitiv und basiert auf emotionalen Resonanzen, die durch nonverbale Signale wie Mimik, Gestik und Tonfall ausgelöst werden. Affektive Empathie spielt eine entscheidende Rolle in zwischenmenschlichen Beziehungen, da sie das Gefühl von Verbundenheit und Mitgefühl fördert.
Kognitive Empathie hingegen bezieht sich auf die Fähigkeit, die Gedanken und Perspektiven anderer zu verstehen, ohne unbedingt die gleichen Gefühle zu teilen. Diese Form der Empathie erfordert ein gewisses Maß an Reflexion und analytischem Denken. Sie ermöglicht es uns, die Beweggründe und Hintergründe des Verhaltens anderer zu erkennen und zu interpretieren. Kognitive Empathie ist besonders wichtig in Konfliktsituationen, da sie dazu beitragen kann, Missverständnisse zu klären und Lösungen zu finden.
Die Bedeutung der Empathie
Empathie ist in vielerlei Hinsicht von entscheidender Bedeutung für das soziale Miteinander. Sie fördert das Verständnis und die Akzeptanz zwischen Menschen unterschiedlicher Hintergründe, Kulturen und Lebensweisen. In einer zunehmend globalisierten Welt, in der Menschen aus verschiedenen Kulturen und mit unterschiedlichen Werten aufeinandertreffen, kann Empathie als Brücke fungieren, die Barrieren abbaut und den Dialog fördert.
Darüber hinaus spielt Empathie eine wesentliche Rolle in der Erziehung und der sozialen Entwicklung. Kinder, die in einem empathischen Umfeld aufwachsen, entwickeln oft bessere soziale Fähigkeiten und ein höheres Maß an emotionaler Intelligenz. Sie lernen, dass ihre eigenen Gefühle und die Gefühle anderer wichtig sind, was zu einem respektvollen und verantwortungsbewussten Verhalten führt.
In der Arbeitswelt ist Empathie ebenfalls von großer Bedeutung. Führungskräfte, die empathisch sind, können die Bedürfnisse und Anliegen ihrer Mitarbeiter besser verstehen und darauf eingehen. Dies fördert nicht nur ein positives Arbeitsklima, sondern steigert auch die Produktivität und die Mitarbeitermotivation.
Herausforderungen der Empathie
Trotz ihrer Bedeutung kann Empathie auch Herausforderungen mit sich bringen. In einer Welt, die oft von Stress, Hektik und Konflikten geprägt ist, kann es schwierig sein, empathisch zu bleiben. Menschen neigen dazu, sich in ihren eigenen Sorgen und Nöten zu verlieren, was die Fähigkeit zur Empathie einschränken kann. Zudem kann übermäßige Empathie zu emotionaler Erschöpfung führen, insbesondere in Berufen, die stark mit zwischenmenschlicher Interaktion verbunden sind, wie beispielsweise in der Pflege oder der Sozialarbeit.
Ein weiteres Problem ist die Tendenz zur selektiven Empathie. Oft empfinden Menschen mehr Mitgefühl für diejenigen, die ihnen ähnlich sind oder die aus ihrem sozialen Umfeld stammen, während sie Schwierigkeiten haben, Empathie für Menschen aus anderen sozialen, kulturellen oder ethnischen Gruppen zu empfinden. Dies kann zu Vorurteilen und Diskriminierung führen und ist eine Herausforderung, die es zu überwinden gilt, um ein gerechteres und inklusiveres Zusammenleben zu fördern.
Empathie ist also eine grundlegende menschliche Fähigkeit, die sowohl emotional als auch kognitiv ist. Sie spielt eine entscheidende Rolle in zwischenmenschlichen Beziehungen, der sozialen Integration und der Förderung von Verständnis und Mitgefühl in einer vielfältigen Gesellschaft. Dennoch gibt es Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, um Empathie in vollem Umfang zu leben. Indem wir uns der Bedeutung und der Komplexität der Empathie bewusstwerden, können wir nicht nur unser eigenes Leben bereichern, sondern auch einen positiven Einfluss auf die Gemeinschaften ausüben, in denen wir leben. Empathie ist eine Brücke, die uns verbindet, und ihre Förderung ist von zentraler Bedeutung für eine harmonische und respektvolle Gesellschaft.
Die philosophische Dimension der Empathie ist vielschichtig und berührt zahlreiche Bereiche der Ethik, der Erkenntnistheorie und der Sozialphilosophie. Es folgen einige zentrale Aspekte, die die philosophische Betrachtung der Empathie prägen:
Empathie in der philosophischen Dimension
Ethik und Moral
Empathie spielt eine entscheidende Rolle in der ethischen Theorie und der moralischen Philosophie. Sie wird oft als Grundlage für moralisches Handeln betrachtet. Philosophien wie der Utilitarismus und die deontologische Ethik können Empathie als wesentlichen Faktor in der Beurteilung von Handlungen und deren Konsequenzen einbeziehen.
Utilitarismus: Diese ethische Theorie, die von Jeremy Bentham und John Stuart Mill geprägt wurde, legt Wert auf die Maximierung des Gesamtnutzens. Empathie kann hier dazu beitragen, die Bedürfnisse und Wünsche anderer zu verstehen und in die moralische Kalkulation einzubeziehen.
Deontologie: Immanuel Kant argumentierte, dass moralische Handlungen aus Pflicht und nicht aus dem Streben nach Glück resultieren sollten. Dennoch kann Empathie dazu beitragen, die menschliche Dimension der moralischen Pflicht zu erkennen und zu verstehen, wie unsere Handlungen andere beeinflussen.
Erkenntnistheorie
Die Frage, wie wir Wissen über die Gedanken und Gefühle anderer erlangen, berührt die Erkenntnistheorie. Empathie wird oft als eine Form des Wissens über andere Menschen angesehen, das über bloße Beobachtung hinausgeht. Philosophische Debatten über „Theorie des Geistes“ (Theory of Mind) und die Fähigkeit, die inneren Zustände anderer zu erkennen, sind eng mit dem Konzept der Empathie verbunden.
Phänomenologie
Die phänomenologische Tradition, insbesondere durch Denker wie Edmund Husserl und Maurice Merleau-Ponty, beschäftigt sich intensiv mit der Erfahrung des „Anderen“. Empathie wird hier als ein Weg betrachtet, die subjektiven Erfahrungen anderer Menschen zu verstehen und zu teilen. Diese Perspektive hebt hervor, dass Empathie nicht nur kognitive oder emotionale Prozesse sind, sondern auch eine tiefere, existenzielle Verbindung zwischen Menschen schaffen kann.
Sozialphilosophie
In der Sozialphilosophie wird Empathie als Schlüssel zur sozialen Kohäsion und zum Verständnis in pluralistischen Gesellschaften betrachtet. Philosophen wie Hannah Arendt und Martin Buber haben die Bedeutung von Empathie für das soziale Zusammenleben hervorgehoben. Buber, insbesondere in seiner Arbeit „Ich und Du“, betont die Bedeutung des Dialogs und der Beziehung zwischen Menschen, die durch Empathie gefördert wird.
Politische Philosophie
Empathie hat auch Auswirkungen auf die politische Philosophie. Sie kann als Grundlage für soziale Gerechtigkeit und Solidarität dienen. Empathische Ansätze in der politischen Theorie fördern das Verständnis für marginalisierte Gruppen und die Notwendigkeit, deren Stimmen zu hören und zu respektieren.
Kritik an Empathie
Es gibt auch kritische Stimmen, die die Rolle der Empathie in der Ethik hinterfragen. Einige Philosophen argumentieren, dass Empathie zu einer verzerrten Wahrnehmung führen kann, da sie oft selektiv ist und dazu neigt, eher für nahestehende Personen oder Gruppen empfunden zu werden. Diese selektive Empathie kann zu Ungerechtigkeiten führen, indem sie das Leiden und die Bedürfnisse anderer Menschen ignoriert.
Die philosophische Dimension der Empathie ist also vielschichtig. Sie berührt grundlegende Fragen der Ethik, des Wissens und der sozialen Interaktion. Empathie ist sowohl eine individuelle Fähigkeit als auch ein gesellschaftliches Phänomen, das entscheidend für das Verständnis und die Förderung einer gerechten und mitfühlenden Gesellschaft ist. Indem wir die philosophischen Aspekte der Empathie erkunden, können wir ein tieferes Verständnis für die Bedeutung dieser Fähigkeit in unserem Leben und in unseren Gemeinschaften entwickeln.
Weitere Aspekte der Empathie
Über die psychologische und philosophische Dimension hinaus gibt es zahlreiche weitere Aspekte von Empathie, die berücksichtigt werden können. Diese umfassen unter anderem biologische, soziale, kulturelle und neurobiologische Perspektiven.
Biologische Dimension
Empathie hat auch eine biologische Grundlage. Forschungen zeigen, dass Empathie mit bestimmten neuronalen Mechanismen und Prozessen verbunden ist.
Spiegelneuronensystem: Spiegelneuronen sind spezielle Nervenzellen im Gehirn, die aktiviert werden, wenn wir eine Handlung ausführen oder beobachten, dass jemand anderes diese Handlung ausführt. Diese Neuronen spielen eine wichtige Rolle beim Verständnis und Nachvollziehen der Emotionen und Absichten anderer.
Hormone und Neurotransmitter: Biochemische Substanzen wie Oxytocin, das oft als „Kuschelhormon“ bezeichnet wird, sind mit Empathie und sozialem Verhalten verbunden. Studien zeigen, dass höhere Oxytocinspiegel mit einem erhöhten Mitgefühl und sozialem Verhalten in Verbindung stehen können.
Soziale Dimension
Die soziale Dimension der Empathie bezieht sich auf die Rolle, die Empathie in sozialen Interaktionen und Gemeinschaften spielt:
Soziale Bindungen: Empathie fördert das Gefühl der Zugehörigkeit und stärkt zwischenmenschliche Beziehungen. Sie ist entscheidend für die Bildung von Bindungen innerhalb von Familien, Freundschaften und Gemeinschaften.
Gruppenidentität: Empathie kann sowohl innerhalb als auch zwischen sozialen Gruppen eine Rolle spielen. In intergruppalen Beziehungen kann Empathie helfen, Vorurteile abzubauen und den Zusammenhalt zu fördern, während ihre Abwesenheit zu Konflikten und Diskriminierung führen kann.
Kulturelle Dimension
Empathie ist auch stark von kulturellen Faktoren beeinflusst.
Kulturelle Normen und Werte: Verschiedene Kulturen haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was als empathisches Verhalten gilt. In einigen Kulturen wird beispielsweise das Zeigen von Emotionen als positiv angesehen, während in anderen Zurückhaltung gefördert wird.
Soziale Praktiken: Die Art und Weise, wie Empathie in einer Kultur gefördert oder gehemmt wird, kann durch Erziehung, Traditionen und soziale Praktiken beeinflusst werden. Kulturen, die Wert auf Gemeinschaft und kollektive Verantwortung legen, können eine stärkere Empathieförderung aufweisen.
Entwicklungsdimension
Empathie entwickelt sich im Laufe des Lebens und wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst:
Kindliche Entwicklung: Empathie beginnt bereits im frühen Kindesalter. Kinder lernen Empathie durch Interaktionen mit ihren Eltern und Bezugspersonen, die ihnen helfen, emotionale Signale zu erkennen und darauf zu reagieren.
Einfluss von Erziehung: Die Art und Weise, wie Kinder erzogen werden, hat einen erheblichen Einfluss auf ihre empathischen Fähigkeiten. Eltern, die Empathie vorleben und fördern, können die Entwicklung ihrer Kinder positiv beeinflussen.
Technologische Dimension
In der heutigen digitalisierten Welt hat sich die Art und Weise, wie Empathie erlebt und ausgedrückt wird, verändert:
Soziale Medien: Plattformen wie Facebook, Twitter und Instagram bieten neue Möglichkeiten für empathische Interaktionen, können aber auch zu Missverständnissen und einer Abnahme der persönlichen Verbindung führen.
Virtuelle Realität (VR): Technologische Innovationen wie VR bieten neue Wege, Empathie zu fördern, indem sie es Menschen ermöglichen, die Perspektiven anderer auf immersive Weise zu erleben, also ein Eintauchen in eine Umgebung oder Situation.
Empathie ist also ein vielschichtiges Konzept, das über die psychologische und philosophische Dimension hinausgeht. Sie wird durch biologische, soziale, kulturelle, entwicklungsbedingte und technologische Faktoren beeinflusst. Das Verständnis dieser verschiedenen Dimensionen kann helfen, Empathie in verschiedenen Kontexten zu fördern und ihre Bedeutung für das individuelle und kollektive Leben zu erkennen. Empathie bleibt eine grundlegende menschliche Fähigkeit, die entscheidend für das Verständnis, die Verbindung und die Zusammenarbeit zwischen Menschen ist.
Die Idee, dass Menschen mit besonderen Gaben oder Fähigkeiten sich als gottgleich oder überlegen ansehen, kann in der Tat mit der Wahrnehmung von Empathie als Schwäche verknüpft sein. Hier sind einige Überlegungen, die diese Verbindung näher beleuchten:
Überlegenheitskomplex
Menschen, die sich aufgrund ihrer besonderen Gaben – sei es intellektuelle, kreative oder körperliche Fähigkeiten – als überlegen empfinden, könnten Empathie als eine Art Schwäche abwerten. Sie könnten glauben, dass emotionale Sensibilität sie von ihrer höheren Bestimmung oder ihrem Erfolg ablenkt. In diesem Sinne wird Empathie als hinderlich für das Streben nach Exzellenz oder Erfolg angesehen.
Entkopplung von Emotion und Rationalität
Einige Menschen, die sich in ihrer Leistung oder ihren Fähigkeiten als außergewöhnlich betrachten, könnten dazu neigen, emotionale Aspekte als weniger wichtig oder sogar als nachteilig zu erachten. Sie könnten der Ansicht sein, dass emotionale Bindungen oder Empathie sie daran hindern, rationale Entscheidungen zu treffen oder ihre Ziele zu erreichen. Dies könnte zu der Annahme führen, dass Empathie eine Schwäche darstellt, die in ihrer „göttlichen“ Überlegenheit nicht Platz hat.
Die Illusion der Unverwundbarkeit
Ein Gefühl der Überlegenheit kann auch zu einer Illusion der Unverwundbarkeit führen. Menschen, die sich als „gottgleich“ betrachten, könnten glauben, dass sie nicht die gleichen emotionalen Bedürfnisse oder Schwächen wie andere haben. Dies kann dazu führen, dass sie Empathie nicht nur ablehnen, sondern auch als Zeichen von Schwäche oder Verletzlichkeit verwerfen.
Soziale Isolation
Die Überzeugung, dass man etwas Besonderes oder überlegen ist, kann auch zu sozialer Isolation führen. Menschen, die sich von anderen abheben, könnten Schwierigkeiten haben, echte Verbindungen zu anderen aufzubauen, da sie Empathie als weniger wichtig erachten. Diese Isolation kann sie weiter in ihrer Überzeugung bestärken, dass sie keine „schwachen“ Emotionen benötigen, um erfolgreich zu sein.
Kreativität und Empathie
Es gibt jedoch auch eine interessante Gegenperspektive: Viele kreative und talentierte Menschen erkennen den Wert von Empathie in ihrem Schaffensprozess. Empathie kann ihnen helfen, tiefere und authentischere Verbindungen zu ihrem Publikum aufzubauen und ihre Kunst oder ihre Fähigkeiten auf eine Weise zu präsentieren, die räsoniert. In diesem Sinne könnte Empathie nicht als Schwäche, sondern als eine Quelle von Stärke und Inspiration angesehen werden.
Die Wahrnehmung von Empathie als Schwäche kann also in der Tat mit einem Gefühl der Überlegenheit oder Göttlichkeit zusammenhängen, welches Menschen mit besonderen Gaben empfinden. Diese Haltung kann jedoch sowohl persönliche als auch soziale Konsequenzen haben, die letztlich das Wohlbefinden und die zwischenmenschlichen Beziehungen beeinträchtigen. Es ist wichtig, die Balance zwischen besonderen Fähigkeiten und der Fähigkeit zur Empathie zu erkennen, da beides in einem gesunden und erfüllten Leben von Bedeutung ist. Empathie kann, anstatt als Schwäche angesehen zu werden, als eine Stärke betrachtet werden, die sowohl das persönliche Wachstum als auch die zwischenmenschlichen Beziehungen fördert.
Kap. I Gespräch über Empathie
Elon Musk erklärt „Empathie ist eine Schwäche"
Das Gespräch entwickelt sich am Ende eines Abends in Heiligengrabe, dem Ziel der Männerrüsten für fast 25 Jahren. Meist kommen 20-30 Männer zusammen. Am späten Abend sitzen noch Silvio, Johannes St., Gottfried, Volker, Achim und Johannes S. zusammen. Irgendwie sind sie auf das Thema ‚Empathie‘ gekommen und es kommt zu einer lebhaften Diskussion.
Johannes S.: (beginnt das Gespräch) Also, Männer, ich möchte heute mit euch über das Thema Empathie sprechen. Ich habe oft gehört, dass viele Leute sagen: „Empathie ist eine Schwäche." Was haltet ihr davon?
Silvio: (nickt zustimmend) Das habe ich auch schon oft gehört. In der heutigen Welt scheint es, als ob man stark und unempfindlich sein muss, um erfolgreich zu sein. Empathie wird oft als Zeichen von Verletzlichkeit gesehen.
Volker: Ich sehe das ähnlich. In vielen beruflichen Kontexten wird emotionale Sensibilität als nachteilig angesehen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es besser ist, die eigenen Emotionen und die der anderen auszublenden, um Entscheidungen zu treffen.
Gottfried: Aber ist das wirklich der richtige Weg? Ich denke, dass Empathie eine wichtige Rolle spielt, besonders in der Männerarbeit. Wenn wir nicht empathisch sind, können wir die Bedürfnisse und Gefühle der Menschen um uns herum nicht verstehen.
Achim: Genau! Ich glaube, dass wir als Männer oft gelernt haben, unsere Emotionen zu unterdrücken. Das führt dazu, dass wir Empathie als Schwäche betrachten. Aber in Wirklichkeit ist sie eine Stärke, die uns hilft, tiefere Verbindungen zu anderen aufzubauen.
Johannes St.: Das stimmt, Achim. Ich habe auch festgestellt, dass empathische Menschen oft bessere Beziehungen zu ihren Freunden und Familien haben. Sie können Konflikte besser lösen und ein tieferes Verständnis füreinander entwickeln.
Silvio: Aber was ist mit der Angst, verletzlich zu sein? Ich denke, viele Männer haben Angst, sich zu öffnen und ihre Gefühle zu zeigen, weil sie fürchten, angreifbar zu werden.
Volker: Das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass diese Angst oft aus persönlichen Unsicherheiten resultiert. Wenn wir lernen, dass Empathie keine Schwäche ist, sondern eine Möglichkeit, uns miteinander zu verbinden, können wir diese Ängste überwinden.
Gottfried: Und wir sollten auch bedenken, dass Empathie nicht bedeutet, unsere eigenen Bedürfnisse und Gefühle zu ignorieren. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden – sowohl für uns selbst als auch für die Menschen um uns herum.
Achim: Absolut! Vielleicht sollten wir als Männer mehr darüber sprechen, wie wir Empathie in unserem Leben integrieren können. Es könnte eine positive Veränderung in unseren Beziehungen bewirken.
Johannes S.: Ich finde, das ist ein guter Ansatz. Lass uns darüber nachdenken, wie wir in unserem Alltag empathischer sein können. Vielleicht können wir auch Workshops oder Gespräche anbieten, um anderen Männern zu helfen, Empathie als Stärke zu erkennen.
Silvio: Das klingt gut! Wenn wir das Thema offen diskutieren, können wir vielleicht auch andere dazu ermutigen, ihre Sichtweise auf Empathie zu ändern.
Volker: Ich bin dabei! Lass uns gemeinsam daran arbeiten, Empathie in unserer Gemeinschaft zu fördern. Es ist an der Zeit, diese alte Vorstellung zu hinterfragen.
Gottfried: Genau! Empathie ist keine Schwäche – sie ist eine Möglichkeit, menschlicher miteinander umzugehen und echte Verbindungen zu schaffen. Als geschäftsführender Pfarrer und ‚Chef‘ vieler Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe ich immer wieder gemerkt, wie wichtig mein Einfühlungsvermögen für Konfliktlösungen war und damit auch für das Arbeitsklima in unserer Gemeinde.
Achim: Dich kann ich mir auch als guten ‚Chef‘ vorstellen. Ich freue mich jedenfalls darauf, diesen Dialog fortzusetzen und zu sehen, wie wir als Männer wachsen können, indem wir Empathie in unser Leben integrieren.
Johannes St.: Lasst uns das Thema nicht nur heute hier besprechen, sondern auch in unseren täglichen Interaktionen leben. Empathie ist eine Stärke, und wir sollten stolz darauf sein!
(Die Gruppe nickt zustimmend und beginnt, konkrete Ideen zu sammeln, wie sie Empathie in ihrem Alltag und in der Männerarbeit fördern können.)
Johannes S.: (setzt das Gespräch fort) Unsere Planungen haben mich noch auf einen Gedanken gebracht, den ich noch gern erörtern würde. Was ist mit Menschen die in einem bestimmten Sinne ‚krank‘ sind? Ich denke an Menschen wie Elon Musk. In einer Dokumentation über ihn habe ich über die Wahrnehmung von Empathie bei neurodiversen Menschen gehört, insbesondere denen mit Asperger-Syndrom wie jener Milliardär. Ich denke, es ist entscheidend, wie wir über Empathie in diesem Kontext sprechen.
Silvio: Absolut. Die gesellschaftlichen Missverständnisse über Empathie bei Menschen mit Asperger-Syndrom sind weit verbreitet. Oft wird angenommen, dass sie keine emotionalen Bindungen eingehen können, was einfach nicht wahr ist.
Volker: Das stimmt. Ich habe von vielen Menschen mit Asperger-Syndrom gehört, dass sie sehr empathisch sind, aber Schwierigkeiten haben, dies auszudrücken oder die Emotionen anderer zu erkennen. Das führt zu einem falschen Bild – es ist nicht so, dass sie keine Empathie empfinden, sondern dass sie auf eine andere Weise damit umgehen.
Gottfried: Und das ist es, was wir als Gesellschaft lernen müssen. Empathie ist nicht nur eine Frage der emotionalen Intuition, sondern auch der Fähigkeit, sich in die Perspektiven anderer hineinzuversetzen. Wir müssen die Vielfalt der Empathiefähigkeiten anerkennen und respektieren.
Achim: Genau, und das bringt uns zu den besonderen Fähigkeiten, die viele Menschen mit Asperger-Syndrom haben. Oft sind sie in bestimmten Bereichen außergewöhnlich talentiert. Dies sollte nicht nur als Überlegenheit gesehen werden, sondern auch als eine Möglichkeit, wie sie ihre Empathiefähigkeiten auf ihre eigene Weise ausdrücken können.
Johannes St.: Richtig! Wenn wir die Stärken und Herausforderungen von Menschen mit Asperger-Syndrom erkennen, können wir ein inklusiveres Umfeld schaffen. Es ist wichtig, dass wir nicht in stereotype Vorstellungen verfallen, sondern die individuellen Erfahrungen und Perspektiven wertschätzen.
Silvio: Ich denke, das ist ein guter Punkt. Es geht darum, Empathie nicht nur als eine emotionale Fähigkeit zu betrachten, sondern auch als eine Brücke, die uns hilft, verschiedene Perspektiven zu verstehen. Das kann in sozialen Interaktionen, am Arbeitsplatz und in der gesamten Gesellschaft von enormer Bedeutung sein.
Volker: Und wir sollten auch darüber nachdenken, wie wir diese Empathiefähigkeiten bei neurodiversen Menschen fördern können. Vielleicht könnten wir Workshops oder Schulungen anbieten, um ein besseres Verständnis für Empathie in all ihren Facetten zu schaffen.
Gottfried: Wie sollen wir das diagnostizieren? Indem wir Empathie in der Bildung und in Gemeinschaftsprojekten fördern, tun wir, glaube ich, genug und können dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und ein respektvolleres Miteinander zu schaffen.
Achim: Du hast wohl recht! Zudem gehen nicht alle so offensiv damit um wie Elon Musk. Aber es stimmt natürlich: Sie sind die Experten ihrer eigenen Erfahrungen und können uns wertvolle Einblicke geben, wie wir Empathie besser verstehen und fördern können … aber, wenn sie sich nicht outen …
Johannes S.: Immerhin haben wir gelernt, Menschen mit Asperger-Syndrom und anderen neurodiversen Menschen Empathie nicht abzusprechen. Wir wissen, auch sie können die Gesellschaft bereichern. Empathie ist jedenfalls eine Stärke, die uns alle betrifft, und wir sollten sie feiern und fördern.
Silvio: Ich freue mich darauf, mehr über diese Themen zu lernen und wie wir gemeinsam daran arbeiten können, eine empathischere und inklusivere Gemeinschaft zu schaffen. Das Ziel sollte sein, dass jeder Mensch, unabhängig von neurologischen Unterschieden, in einer Umgebung leben kann, die Verständnis und Mitgefühl fördert.
Volker: Lass uns das Thema weiterhin aktiv angehen und andere dazu ermutigen, sich ebenfalls mit diesen wichtigen Fragen auseinanderzusetzen. Es ist an der Zeit, Empathie als Stärke zu erkennen und zu leben!
Gottfried: Ich bin dabei! Lasst uns unsere Ideen und Gedanken in die Tat umsetzen und einen positiven Einfluss auf unsere Gemeinschaft haben. Gemeinsam können wir einen Unterschied machen.
Johannes S.: Ich würde historisch beginnen …
(Die Gruppe diskutiert weiter, wie sie ihre Ideen umsetzen und das Bewusstsein für Empathie und neurodiverse Perspektiven in ihrem Umfeld fördern können.)
Kap. II Antike Konzepte der ‚Empathie‘
Gespräch über Platos Verständnis von Empathie in „Der Staat“
Johannes S.: (blickt in die Runde) Männer, heute wollen wir uns das Denken antiker Philosophen über Empathie vor Augen halten. Antike Philosophen betrachteten Empathie oft im Kontext von Mitgefühl, Moral und sozialer Verantwortung. Platon betonte die Notwendigkeit des Verständnisses für die Perspektiven anderer als Grundlage für Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Aristoteles sah Empathie als zentral für Freundschaft und ethisches Handeln, da sie es ermöglicht, die Bedürfnisse anderer zu erkennen und zu berücksichtigen. Stoische Philosophen wie Epiktet und Seneca lehrten, dass Empathie eine wichtige Fähigkeit ist, um menschliche Beziehungen zu stärken und das Wohl der Gemeinschaft zu fördern. Insgesamt war Empathie in der Antike eng mit der Idee des guten Lebens und der moralischen Pflicht gegenüber anderen verbunden. Platos Verständnis von Empathie und Gerechtigkeit, wie es in seinem Werk „Der Staat“ dargestellt wird, klingt doch sehr modern, oder? Was denkt ihr, wie Platon Empathie definiert oder beschreibt?
Platons Werk „Der Staat" (auch bekannt als „Politik") untersucht die Natur der politischen Gemeinschaft und die besten Formen der Regierung. Er betrachtet den Menschen als ein „politisches Tier", das nur in Gemeinschaften gedeihen kann. Plato analysiert verschiedene Staatsformen wie Monarchie, Aristokratie und Demokratie und diskutiert deren Vorzüge und Nachteile.
Im Kontext von ‚Empathie', also dem Verständnis und des Mitgefühls für andere, spielt die Vorstellung von Gerechtigkeit eine zentrale Rolle in Aristoteles' Denken. Er betont, dass eine gerechte Gesellschaft auf dem Wohl aller Bürger basieren sollte. Empathie ist entscheidend, um die Bedürfnisse und das Wohlbefinden der Gemeinschaft zu erkennen und zu fördern. Platon argumentiert, dass die Fähigkeit, sich in die Lage anderer zu versetzen, sowohl für die individuelle Tugend als auch für die Stabilität und das Gedeihen des Staates unerlässlich ist.
Man kann also sagen, dass Platon in „Der Staat" eine politische Philosophie entwirft, die auf der Idee basiert, dass Empathie und Gerechtigkeit zentrale Elemente für eine funktionierende und harmonische Gesellschaft sind.
Silvio: (überlegt) Ich glaube, dass Platon ‚Empathie‘ nicht direkt als solchen Begriff verwendet, aber er spricht viel über das Verständnis der Perspektiven anderer und die Notwendigkeit, das Wohl der Gemeinschaft zu fördern. In seiner idealen Gesellschaft sollten die Herrscher, die Philosophenkönige, in der Lage sein, die Bedürfnisse aller zu erkennen und zu berücksichtigen.
Volker: (nickt zustimmend) Genau! Platon sieht Gerechtigkeit als Harmonie, die entsteht, wenn jeder das tut, was für die Gemeinschaft am besten ist. Um das zu erreichen, müssen vor allem die Herrscher empathisch sein und die Gefühle und Bedürfnisse der Bürger verstehen. Das ist eine Form von Empathie, auch wenn er das Wort nicht verwendet.
Gottfried: (hebt die Hand) Und in diesem Zusammenhang ist das „Wohl der Seele“ von zentraler Bedeutung. Platon argumentiert, dass das Wohl des Einzelnen untrennbar mit dem Wohl der Gemeinschaft verbunden ist. Wenn die Herrscher die Seelen der Menschen verstehen, können sie gerecht handeln.
Achim: (interessiert) Das ist ein wichtiger Punkt, Gottfried. Es zeigt, dass Empathie nicht nur eine persönliche Fähigkeit ist, sondern eine moralische Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft. Es geht darum, wie wir miteinander leben und uns gegenseitig unterstützen.
Johannes St.: (schaut nachdenklich) Platon fordert ja eine Art von Bildung, die über das bloße Wissen hinausgeht. Er spricht von der Ausbildung der Seele. Könnte man sagen, dass Empathie eine Art Bildung ist, die wir entwickeln müssen, um das Gute zu erkennen?
Silvio: (nickt) Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Platon glaubt an die Fähigkeit des Menschen, durch Philosophie und Bildung zu wachsen. Empathie könnte also als Teil dieser Entwicklung betrachtet werden – eine Fähigkeit, die wir lernen und kultivieren müssen.
Volker: (begeistert) Und das ist besonders relevant für unsere Arbeit in der Männerarbeit. Wenn wir empathisch sind, können wir nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Gemeinschaft stärken. Wir können einander helfen, die Herausforderungen des Lebens besser zu bewältigen.
Gottfried: (lächelt) Genau! Wenn wir uns in die Lage anderer versetzen, können wir auch besser auf ihre Bedürfnisse eingehen. Das ist ein wichtiger Teil davon, wie wir als Männer in der Kirche und in der Gesellschaft agieren sollten.
Achim: (schaut in die Runde) Vielleicht sollten wir auch darüber nachdenken, wie wir Empathie aktiv in unser tägliches Leben integrieren können. Wie können wir als Gruppe sicherstellen, dass wir diese Werte leben?
Johannes S.: (nickt zustimmend) Das ist eine wichtige Frage, Achim. Wir könnten regelmäßige Gespräche und Reflexionen über unsere Erfahrungen und Herausforderungen einführen, um Empathie zu fördern. Allerdings machen wir das aber auch, wenn wir neue Männerbilder entwerfen.
Silvio: (lächelt) Das tun wir ja auch inzwischen seit drei Jahrzehnten. Denn, wenn wir das tun, können wir nicht nur unser eigenes Verständnis von Empathie vertiefen, sondern auch andere dazu inspirieren, diesen Weg zu gehen. Das Problem ist nur, dass unsere ‚Gender-Mitbewerber‘ an den alten Bildern festhalten, weil sie ihnen nützlich sind.
Volker: (schließt das Gespräch) Lasst uns also die Lehren von Platon als Inspiration nutzen, um Empathie in unserem Leben und in unserer Gemeinschaft zu fördern. Es ist ja eine Stärke, die wir alle brauchen, um eine gerechte und harmonische Gesellschaft zu schaffen. Und das können wie eben nur, wenn wir weiter daran arbeiten, dass man unsere Arbeit würdigt.
Gottfried: (nickt) So denke ich auch. Wir sollten auf eine empathische Zukunft setzen, in der wir einander besser verstehen und unterstützen können!
Gespräch über Aristoteles und Empathie in seinen Ethiken
Johannes S.: (blickt in die Runde) Männer, kommen wir zu Aristoteles und seine Auffassung von Empathie sprechen. In seiner Ethik betont er die Bedeutung von „Philia“, also der Freundschaft und der Bruderliebe. Was denkt ihr darüber?
Silvio: (nickt) Das ist ein spannendes Thema. Aristoteles sieht Freundschaft als eine der höchsten Tugenden. Er argumentiert, dass echte Freundschaft auf einem gegenseitigen Verständnis der Emotionen basiert. Das ist doch im Grunde Empathie, oder?
In der „Nikomachischen Ethik“ entwickelt Aristoteles eine umfassende Ethik, die sich auf das Streben nach dem guten Leben konzentriert. Zentrale Themen sind Tugend, das richtige Handeln und die Rolle der Emotionen im moralischen Leben. Aristoteles betont, dass Glück (Eudaimonia) das höchste Ziel des menschlichen Lebens ist, das durch tugendhaftes Handeln erreicht wird.
Empathie in der Nikomachischen Ethik
Die Rolle der Emotionen: Aristoteles erkennt an, dass Emotionen eine bedeutende Rolle im menschlichen Handeln spielen. Empathie, die Fähigkeit, die Gefühle und Perspektiven anderer zu verstehen, ist eine essentielle Tugend.
Tugend der Gerechtigkeit: Gerechtigkeit gilt als eine der höchsten Tugenden. Empathie ermöglicht es, die Bedürfnisse anderer zu berücksichtigen, was für gerechtes Handeln notwendig ist.
Praktische Weisheit (Phronesis): Praktische Weisheit ist die Fähigkeit, in spezifischen Situationen richtig zu handeln. Empathie unterstützt diese Weisheit, indem sie hilft, soziale Dynamiken und individuelle Umstände zu verstehen.
Freundschaft: Aristoteles betont die Bedeutung von Freundschaft, die auf gegenseitigem Verständnis und Empathie basiert. Echte Freundschaft fördert harmonische und unterstützende Beziehungen.
Moralische Entwicklung: Die Entwicklung von Tugenden geschieht durch Gewöhnung und Praxis. Empathie kann als erlernbare Fähigkeit betrachtet werden, die durch soziale Interaktion gefördert wird.
Aristoteles' Ethik ermutigt dazu, empathisch zu sein, um ein erfülltes und tugendhaftes Leben zu führen.
Volker: (überlegt) Absolut! Aristoteles sagt, dass die Fähigkeit, die Emotionen anderer zu verstehen und nachzuvollziehen, entscheidend für ein harmonisches Leben ist. Wenn wir empathisch sind, können wir nicht nur unsere Beziehungen vertiefen, sondern auch ein erfüllteres Leben führen.
Gottfried: (lächelt) Und das zeigt sich auch in der Art, wie wir als Männer in der Kirche miteinander umgehen sollten. Wenn wir Empathie praktizieren, schaffen wir eine unterstützende Gemeinschaft, in der jeder sich verstanden und akzeptiert fühlt.
Achim: (interessiert) Ich finde es spannend, dass Aristoteles auch zwischen verschiedenen Arten von Freundschaft unterscheidet. Es gibt die Freundschaft, die auf Nutzen basiert, und die, die auf Tugend beruht. Letztere erfordert ein tiefes Verständnis und Mitgefühl für den anderen.
Johannes St.: (nickt zustimmend) Genau! Die Freundschaft, die auf Tugend basiert, ist die tiefste Form der Verbindung. Aristoteles sieht sie als eine Art von Liebe, die Empathie und das Streben nach dem Guten für den anderen beinhaltet. Es geht nicht nur darum, was wir von anderen bekommen, sondern wie wir ihnen helfen können.
Silvio: (denkt nach) Das bringt uns zu einer wichtigen Frage: Wie können wir diese Form der Freundschaft und Empathie in unserem Alltag leben? Wie stellen wir sicher, dass wir nicht nur oberflächliche Beziehungen haben?
Volker: (überlegt) Das geschieht ja, wenn wir bewusst Zeit miteinander verbringen, um uns besser kennenzulernen. Gemeinsame Aktivitäten oder Gespräche über unsere Herausforderungen können helfen, ein tieferes Verständnis füreinander zu entwickeln. Und genau das geschieht in den Männerrüsten, wie hier in Heiligengrabe.
Gottfried: (stimmt zu) Ja, und wir könnten auch in unseren Gruppen mehr Raum für persönliche Geschichten schaffen. Wenn wir unsere Erfahrungen teilen, können wir empathischer miteinander umgehen. Das stärkt die Bindungen und die Gemeinschaft. Das glückt natürlich mit dem einen Thema mehr, mit dem anderen weniger.
Achim: (lächelt) Das stimmt! Ich erinnere mich an das Thema ‚Trauer‘, das war so intensiv, dass ich mit anderen Männern noch Wochen darüber gesprochen. Aristoteles spricht übrigens auch darüber, dass wir durch die Praxis von Tugenden wie Empathie wachsen können. Je mehr wir uns bemühen, empathisch zu sein, desto mehr wird es Teil unseres Charakters.
Johannes S.: (nickt) Und das ist ein Prozess. Wir sollten uns gegenseitig unterstützen, um diese Tugenden zu entwickeln. Es ist wichtig zu erkennen, dass wir alle auf diesem Weg sind und dass wir uns gegenseitig helfen können.
Silvio: (lächelt) Also, lasst uns Aristoteles als Inspiration nutzen, um Empathie in unser Leben zu integrieren. Wir können nicht nur unsere Freundschaften vertiefen, sondern auch eine stärkere Gemeinschaft schaffen.
Volker: (schließt das Gespräch) Einverstanden! Lasst uns die Lehren von Aristoteles in die Tat umsetzen und aktiv daran arbeiten, empathische Männer zu sein, die sich gegenseitig unterstützen und einander verstehen. Aristoteles diskutiert ja in seiner „Nikomachischen Ethik“ die Bedeutung von Freundschaft und Mitgefühl. Er sieht die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, als zentral für das ethische Handeln und das gute Leben an. Warum soll uns das nicht auch gelingen?
Gottfried: Stimmt! Warum soll uns das nicht auch gelingen?
Gespräch über Epiktet und Empathie
Johannes S.: (blickt in die Runde) Kommen wir zu Epiktet und darüber, wie seine stoische Philosophie Empathie beeinflusst. Ich habe seine Texte im Studium oft übersetzt und erinnere mich: Er lehrte, dass wir die Kontrolle über unsere Reaktionen haben. Inch finde, das ist für uns als Männer in der Kirche besonders wichtig. Was denkt ihr darüber?
Silvio: (nickt) Das ist ein interessanter Punkt. Epiktet betont, dass wir nicht von den Handlungen anderer abhängig sein sollten, um unsere Emotionen zu steuern. Wenn wir verstehen, dass jeder Mensch seine eigenen Kämpfe hat, können wir empathischer reagieren.
Volker: (überlegt) Genau! Epiktet spricht von der menschlichen Natur und der Tatsache, dass wir alle Fehler machen. Wenn wir das im Hinterkopf behalten, können wir Mitgefühl entwickeln und uns in die Lage anderer versetzen, anstatt sofort zu urteilen.
Silvio: In seinem Werk ‚Enchiridion‘ legt er dar, dass es wichtig ist, die menschliche Natur zu verstehen und die Perspektiven anderer Menschen zu berücksichtigen. Er betont die Bedeutung der inneren Haltung und der Kontrolle über unsere Reaktionen, was es uns ermöglicht, empathischer zu handeln.
Das ‚Enchiridion', oft auch als ‚Handbuch' übersetzt, ist ein kurzes, aber einflussreiches Werk des stoischen Philosophen Epiktet, das im 1. Jahrhundert n. Chr. verfasst wurde. Es handelt sich um eine Sammlung von Lehren und Ratschlägen, die die stoische Philosophie in praktischer Form darstellen. Das Werk wurde von Epiktets Schüler Arrianus zusammengestellt und dient als Einführung in die stoische Denkweise.
Das ‚Enchiridion' behandelt zentrale Themen der stoischen Ethik, darunter die Unterscheidung zwischen dem, was wir kontrollieren können, und dem, was außerhalb unserer Kontrolle liegt. Epiktet betont, dass wir nur unsere eigenen Gedanken, Meinungen und Reaktionen kontrollieren können, während äußere Ereignisse und die Meinungen anderer Menschen außerhalb unserer Macht liegen. Diese Erkenntnis ist von zentraler Bedeutung für die stoische Lebensweise, die darauf abzielt, innere Ruhe und Gelassenheit zu erlangen.
Das Werk ist in Form von kurzen, prägnanten Abschnitten verfasst, die praktische Ratschläge geben, wie man ein tugendhaftes Leben führen kann. Epiktet ermutigt die Leser, ihre Einstellungen und Reaktionen auf äußere Umstände zu hinterfragen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – das eigene Handeln und die eigene Moral.
Gottfried: (lächelt) Das ist doch eine wertvolle Einsicht. In der Männerarbeit ist es ja auch wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und Verständnis zeigen. Wenn wir die menschliche Natur des anderen anerkennen, können wir eine tiefere Verbindung aufbauen.
Achim: (interessiert) Deswegen haben ja die Männer der Männerarbeit nach dem Krieg die ganze Flüchtlingsseelsorge übernommen. Das geschah in jeder Stadt. Wie anders als ‚von Mann zu Mann‘ hätte man es damals lösen können. Ohne diesen Dienst hätten viele Beziehungen aufgrund der Traumata aus Krieg und Gefangenschaft Zurückgekehrten gar nicht gehalten. Therapeuten für diese Mengen gab es einfach nicht. Heute machen wir uns Sorgen um die Psyche der Kinder während der Corona-Zeit … damals mussten Kinder mit den Kriegsfolgen leben.
Aber von diesen historischen Dingen abgesehen, stellt sich mir eine Frage: Wie können wir konkret diese Kontrolle über unsere Reaktionen üben? Epiktet spricht ja von der inneren Arbeit, die wir leisten müssen, um empathischer zu sein. Das ist ja den Männern damals offenbar gelungen, aber Gespräche, wie das gelingen konnte, habe ich nie gelesen.
Johannes St.: (nickt) Das ist eine gute Frage, Achim. Ich denke, es beginnt mit der Selbstreflexion. Wenn wir unsere eigenen Emotionen und Reaktionen verstehen, können wir besser darauf reagieren, was andere tun. Es erfordert Achtsamkeit und die Bereitschaft, an uns selbst zu arbeiten.
Silvio: (zustimmend) Und vielleicht auch das Üben von Geduld. Wenn jemand uns verletzt oder enttäuscht, ist unser erster Impuls oft defensiv. Wenn wir jedoch an Epiktets Lehre denken, können wir uns fragen, warum die Person so handelt, und versuchen, ihre Perspektive zu verstehen.
Volker: (lächelt) Das ist ein wichtiger Punkt. Empathie bedeutet nicht, dass wir das Verhalten anderer gutheißen, sondern dass wir verstehen, dass jeder Mensch seine eigenen Kämpfe hat. Das hilft uns, unsere Reaktionen zu kontrollieren und auf eine konstruktive Weise zu reagieren.
Gottfried: (überlegt) Und es ist auch eine Einladung, aktiv zuzuhören. Wenn wir wirklich zuhören und versuchen, die Gedanken und Gefühle anderer zu verstehen, können wir empathischer reagieren. Epiktet lehrt uns, dass wir nicht nur auf das Äußere, sondern auch auf das Innere der Menschen achten sollten.
Achim: (nickt) Das ist eine wertvolle Erkenntnis. Wenn wir uns in die Lage anderer versetzen, können wir sie auch besser unterstützen. In der Männerarbeit können wir uns gegenseitig ermutigen und helfen, die Herausforderungen des Lebens zu meistern.
Johannes S.: (lächelt) Lasst uns also Epiktets Lehren als Leitfaden nutzen, um unsere Empathie zu stärken. Wir können an unseren Reaktionen arbeiten und uns bemühen, einander besser zu verstehen. Das wird unsere Gemeinschaft stärken.
Silvio: (zustimmend) Genau! Wenn wir uns auf diese Weise weiterentwickeln, können wir nicht nur bessere Freunde, sondern auch bessere Männer in unserer Kirche und Gesellschaft werden.
Volker: Einverstanden! Lasst uns die Prinzipien von Epiktet in unser tägliches Leben integrieren und aktiv an unserer Empathie arbeiten, um einander zu unterstützen und eine stärkere Gemeinschaft zu schaffen.
Achim: (zustimmend) Wohl gesprochen, Volker!
Gespräch über Seneca und die Kyniker
Johannes S.: (blickt in die Runde) Über Seneca, auch ein Stoiker, würde ich noch gern sprechen und über seine Auffassung von Mitgefühl und Empathie. Er hat in seinen Briefen oft betont, wie wichtig es ist, sich um das Wohlergehen anderer zu kümmern. Was haltet ihr davon?
Die „Briefe an Lucilius“ (Epistulae Morales ad Lucilium) sind eine Sammlung von 124 Briefen des römischen Stoikers Seneca aus dem ersten Jahrhundert n. Chr. Sie richten sich an Lucilius, einen Freund und möglicherweise Schüler Senecas, und behandeln zentrale Themen der stoischen Philosophie.
Hauptinhalte der Briefe:
Ethik und Tugend: Seneca betont, dass Tugend das höchste Gut ist und ermutigt Lucilius, diese Prinzipien im Alltag anzuwenden.
Umgang mit Emotionen: Er bietet Ratschläge, wie man negative Emotionen wie Wut und Angst kontrollieren kann, um inneren Frieden zu erreichen. Vergänglichkeit und Tod: Seneca reflektiert über die Vergänglichkeit des Lebens und ermutigt Lucilius, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, um das Leben besser zu nutzen.
Selbstreflexion: Die Briefe betonen die Bedeutung der Selbstreflexion und der ständigen persönlichen Verbesserung.
Natur und Universum: Seneca spricht über die Verbundenheit des Menschen mit der Natur und ermutigt ein harmonisches Leben mit der Umwelt. Freundschaft: Er hebt die Bedeutung wahrer Freundschaft hervor und diskutiert, wie man gesunde zwischenmenschliche Beziehungen pflegt.
Senecas Briefe bieten praktische Ratschläge für ein erfülltes, tugendhaftes Leben und kombinieren philosophische Reflexion mit persönlichen Erlebnissen.
Silvio: (nickt) Das ist ein wichtiges Thema, Johannes. Seneca spricht von der Bedeutung der Freundschaft und wie sehr sie auf Mitgefühl basiert. Er ermutigt uns, uns um andere zu kümmern und ihre Sorgen ernst zu nehmen. Damit trifft er fast meine Lebensmaxime. Empathie ist für ihn eine zentrale Tugend.
Volker: (überlegt) Richtig! Ich finde es interessant, dass Seneca auch betont, dass wir durch das Mitgefühl mit anderen selbst wachsen. Indem wir uns in die Lage anderer versetzen, lernen wir, die Herausforderungen des Lebens besser zu verstehen. Das ist eine Art von innerer Stärke.
Gottfried: (lächelt) Und das zeigt auch, wie wichtig es ist, in unserer Männerarbeit Mitgefühl zu praktizieren. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen und empathisch sind, stärken wir nicht nur unsere Beziehungen, sondern auch unser gemeinsames Wohl.
Achim: (interessiert) Was ich an Seneca besonders schätze, ist seine Betonung der praktischen Anwendung. Er fordert uns auf, nicht nur über Mitgefühl zu sprechen, sondern es aktiv in unserem Alltag zu leben. Wie können wir das konkret umsetzen?
Johannes St.: (nickt) Das bringt uns zur Frage, wie wir Mitgefühl in unseren Gruppen und im täglichen Leben zeigen können. Vielleicht können wir uns regelmäßig Zeit nehmen, um über unsere Herausforderungen zu sprechen und uns gegenseitig zu unterstützen.
Silvio: