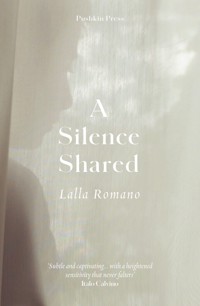Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: marixverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: PERLEN
- Sprache: Deutsch
Lalla Romano erzählt die Geschichte einer kleinen Familie im Piemont in den 1930er und 1940er Jahren. Sie erzählt von der Beziehung zwischen zwei Frauen, die sich in Herkunft, Kultur und Lebensweise sehr voneinander unterscheiden: Maria, eine Bäuerin, und eine Lehrerin, Schriftstellerin und Malerin, in deren Haus Maria als Bedienstete arbeitet. In ihrer nüchternen, genauen, mitunter fast spröden Sprache zeichnet Lalla Romano ein Porträt von Maria. Und dabei entwirft sie das Porträt des Dorfes von Maria mit seinen Menschen, seiner Landschaft und seiner Zeit, in die der Zweite Weltkrieg fällt. Die Bindung zwischen beiden Frauen, ihre Seelenverwandtschaft, tritt zutage, als das Kind der Erzählerin geboren wird. Mit dem Heranwachsen des Kindes wird sie immer offenkundiger. Und so erzählt Lalla Romano in ihrem Roman »Maria«, den sie als »eine wahre Geschichte« bezeichnet, im Grunde von diesem Kind, von Kindern und ihren Müttern. »Maria«, der erste von Lalla Romanos zahlreichen Romanen, erschien 1953 im Turiner Verlag Einaudi und wurde 1954 mit dem Premio Internazionale Veillon ausgezeichnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lalla Romano
MARIA
Aus dem Italienischenvon Claudia Imig
Lalla Romano
geboren 1906 in eine alte piemontesische Familie, studierte Literatur in Turin und Malerei bei Felice Casorati. Ab 1941 veröffentlichte sie Gedichte, Erzählungen und Romane. 1969 wurde sie mit dem Premio Strega ausgezeichnet, 1987 mit dem Premio Grinzane Cavour. 1994 erhielt sie den Premio internazionale Latina für ihr Gesamtwerk. Lalla Romano starb 2001 in Mailand.
Claudia Imig
1970 in Bonn geboren, studierte Romanistik und Musikwissenschaften in Osnabrück, wo sie anschließend freiberuflich als Koordinatorin der Osnabrücker Kulturnacht, als Übersetzerin, Dozentin und Moderatorin tätig war. 2019 verlegte sie ihren Lebensschwerpunkt nach Rom.
»Wo Maria war, herrschteeine spezielle Atmosphäre,fast eine unsichtbare Ordnunginnerhalb der Unordnung der Welt.«
Lalla Romano
Inhalt
Einleitung
Kapitel I.
Kapitel II.
Kapitel III.
Kapitel IV.
Kapitel V.
Kapitel VI.
Kapitel VII.
Kapitel VIII.
Kapitel IX.
Kapitel X.
Kapitel XI.
Kapitel XII.
Kapitel XIII.
Kapitel XIV.
Kapitel XV.
Kapitel XVI.
Kapitel XVII.
Kapitel XVIII.
Kapitel XIX.
Kapitel XX.
Kapitel XXI.
Kapitel XXII.
PERLEN: SECHS GROSSE ITALIENISCHE SCHRIFTSTELLERINNEN
Einleitung
Maria ist eine wahre Geschichte. Ich kannte die Maria aus diesem Buch wirklich; Maria hat viele Jahre in meinem Haus gelebt, ich habe sie oft in ihrem Haus, in ihrem Dorf besucht. Kann man die Geschichte vielleicht deshalb als wahr bezeichnen? Gewiss auch deshalb; aber unter diesem Aspekt handelte es sich nur um eine Frage der Wahrhaftigkeit, nicht der Wahrheit: eine wesentlich komplexere und facettenreichere Vorstellung, welche an die der Poesie grenzt oder gar mit ihr übereinstimmt.
Eine wichtigere und interessantere Frage ist: Was hat mich dazu bewogen, die Geschichte von Maria zu schreiben? Erschien sie mir vielleicht als außergewöhnlich? Ja, so erschien sie mir. Aber um es gleich klarzustellen, soll gesagt sein, dass ich das Außergewöhnliche in dem finde, was klar, einfach und rein ist; was jenen hingegen, die keinen Sinn für diese seltenen Eigenschaften haben, in der Regel belanglos erscheint; mehr noch, sie ziehen sie nicht einmal in Betracht.
Während ich mit Maria zusammenlebte und ohne überhaupt daran zu denken, über sie zu schreiben, empfand ich Folgendes: Wo Maria war, herrschte eine spezielle Atmosphäre, fast eine unsichtbare Ordnung in der Unordnung der Welt.
(Ich schrieb das Buch, als Maria nicht mehr in meinem Haus war, und ich dachte nicht, dass sie zurückkehren würde, was sie jedoch tat: Tatsächlich tauchte Maria nicht nur in meinem Leben, sondern auch in einem anderen Buch wieder auf).
Gesellschaftlich gesehen war unsere Beziehung eine antiquierte und mittlerweile anachronistische, die in den Begriffen Dienstmädchen und Herrschaft oder, weniger grob, Hausangestellte und Hausherrin überdauert.
Der Dichter Eugenio Montale, der auch Kritiker, genauer gesagt ein gründlicher Leser ist, schrieb, das eigentliche Thema des Buches sei nicht das Porträt von Maria, sondern eine Beziehung, die er als fast »mystisch« bezeichnete; was bedeutet, dass über die soziale und sogar über die affektive Beziehung hinaus eine geheimnisvollere Bindung zwischen den beiden Frauen besteht, vielleicht eine gewisse Seelenverwandtschaft, trotz der unterschiedlichen Herkunft, Umgebung und Kultur.
Diese tiefe »Sympathie« zwischen den beiden Protagonistinnen stellt sich im Roman auch als eine umfassendere Begegnung auf geschichtlicher Ebene dar, nämlich zwischen zwei Welten: der bürgerlichen, städtischen, intellektuellen Welt und der bäuerlichen. Im Buch wird die »bürgerliche« Welt durch unvoreingenommene Menschen bescheidener Herkunft verkörpert, denen das Streben nach Macht fremd ist, und die bäuerliche Welt ist arm, würdevoll und religiös: Die Voraussetzungen für ein gegenseitiges Verständnis sind also gegeben.
Der Roman erzählt die Geschichte einer kleinen Familie und erstreckt sich über die 1930er und 1940er Jahre. Da ist ein junges Ehepaar in einer Provinzstadt, und da ist eine Hausbedienstete: Maria; ein Kind wird geboren; sie ziehen in eine große Stadt; da sind die Spiele des Kindes und die ersten Schuljahre; der Krieg, Trennungen. Durch Marias Erzählungen und die Besuche des Paares an ihren Orten entfalten sich viele Geschichten, das heißt viele Existenzen, mit ihren dramatischen oder auch tragischen und ebenso komischen Momenten: die Geschichte von Fredo, die von Margherita und viele mehr. Das für das Genre des Romans typische Gefühl des Vergehens der Zeit ist auch hier zu spüren: Das Kind wächst heran, Maria wird alt. Geschichte setzt Ereignisse in Gang, die Schicksale beeinflussen und Lebensweisen verändern. Das Buch Maria ist auch ein Zeugnis der »bäuerlichen Kultur« (in diesem Fall von Berg- und Grenzlandschaften): eine Kultur, die im Verschwinden begriffen ist.
Was lässt sich über den Stil, die Sprache von Maria sagen? Die Begegnung, die Sympathie, zu der es in der Realität kam, verwirklicht sich auch im Buch, durch den Stil – wie sonst? Sollte der Autor demnach seinen Stil am Vorbild seiner Figur ausrichten? Es geht nicht darum, solch eine absurde und, wie jedes Bemühen, nutzlose, schlimmer noch, schädliche Anstrengung zu unternehmen. Der Schriftsteller trifft eine Wahl, in der Welt oder in seiner Fantasie, was dasselbe ist: Diese Wahl beinhaltet den Stil.
Ich hatte bei Maria eine Lebensweise kennengelernt, die ich bewunderte; nun, meine Bewunderung war weniger eine moralische als vielmehr eine ästhetische, eine literarische: das heißt, für mich war Maria bereits eine Romanfigur, bevor es mir in den Sinn kam, sie zu schreiben, sie mit Worten zu erschaffen. Daher ist nichts in dem Buch unangemessen beziehungsweise nicht im Einklang mit dem gewählten Thema. Marias Welt wird natürlich durch mich betrachtet; aber meine Arbeit wurde geleitet von der Achtung vor dieser Welt, in der nur das Wesentliche zählt, wie in der eigentlichen Sprache der Poesie.
I.
Als wir unser Haus betraten, war Maria schon da.
Wir kamen von der Reise zurück und gingen auf Zehenspitzen, denn es war Mitternacht.
Ich kannte Maria nicht. Ich hatte sie nur kurz gesehen, als sie gekommen war, um sich vorzustellen. Das Kennenlernen von Menschen brachte mich in Verlegenheit; so spähte ich von einem Nebenzimmer aus durch die angelehnte Tür.
Sie saß auf der Stuhlkante, die Füße gekreuzt, die Hände im Schoß gefaltet; sie war mager und zierlich, in Schwarz gekleidet: mit einem runden Spitzenkragen.
Sie hielt den Kopf zur Schulter geneigt, und ihre unbeweglichen blauen Augen mit den hängenden Lidern hatten einen resignierten und etwas traurigen Ausdruck. Ich habe daraus keinen Schluss gezogen, sondern eher gedacht, dass sie eine geeignete Gestalt für ein Gemälde sei.
Am Morgen verließ Pietro früh das Haus: Er musste wieder arbeiten. Als Maria sah, dass ich aufgestanden war, lächelte sie mich an und fragte, ob ich mich gut ausgeruht hätte; als wäre ich ein Gast: Sie jedoch war da, als wäre sie schon immer da gewesen. Sofort legte sich meine Befürchtung, dass Maria Anweisungen von mir erwartete. Sie bewegte sich lautlos durch die Zimmer, war unentwegt beschäftigt und stellte keine Fragen. Ich traute mich immer noch nicht, mit ihr zu reden, und auch sie schien schüchtern zu sein: Wir tauschten lediglich ein Lächeln aus, wenn wir uns begegneten.
Auch das Haus war neu für mich. Durch die Fenster konnte man Baumkronen und Berge sehen. Die Zimmer waren groß, ein wenig leer. Immer noch standen da die Blumenkörbe: Blumen mit langen Stielen und einem intensiven, süßen Duft.
Von außen betrachtet, war es ein großes Gebäude, zur Hälfte bewachsen mit Kletterpflanzen. Man erreichte es von der Auffahrt her durch ein kleines Tor, über einen Kiesweg.
Es war ein stilles Haus und still war auch die Stadt, versunken und fast ein wenig verschlafen, inmitten ihrer Flüsse und bewaldeten Berge.
Dort, wo die Stadt endete, zwischen Weizenfeldern, stand unser Haus. Auf der neu angelegten Straße kam nie jemand vorbei; über die schattige, uralte Allee waren Scharen von Jungen auf Fahrrädern unterwegs oder die Alten aus dem Hospiz, langsam und gebrechlich.
Wenn Pietro nach Hause kam, nahm ich ihn bei der Hand, und obwohl ich sehr wohl wusste, dass er ein junger Mann war, mochte ich es, ihn mir viel älter vorzustellen; und kindlich, mehr noch als liebevoll, setzte ich mich auf seinen Schoß.
Maria sagte »Entschuldigung«, bevor sie eintrat. Oft rührte ich mich nicht. Sie kam schweigend herein, in der Hand einen ovalen, randvollen Teller. Sie stellte ihn auf den Tisch und verschwand mit den Worten »Guten Appetit«.
Die von Maria zubereiteten Speisen waren so harmonisch wie Gemälde.
Wenn sie Karotten, Sardellen und Oliven auf Mayonnaise arrangierte, verstand sie es, die Farbtöne so aufeinander abzustimmen, dass wir bedauerten, die schönen Kompositionen zu zerstören. Aber wir waren immer hungrig.
Wir hatten das Haus im Spätsommer bezogen. Der Herbst setzte nach und nach ein, wie ein langsames Abklingen des Sommers. Zu dieser Zeit gab es im Haus eine Wespeninvasion. Da sie nicht stachen, bewunderten wir sie, so schön, groß und golden, wie sie waren, und ihr Summen klang nicht traurig, wie das der letzten und einsamen Biene, sondern üppig, ja geradezu festlich.
Obwohl sie harmlos waren, hatte Maria große Angst vor Wespen. Sie wirkte in dieser Hinsicht nicht sehr bäuerlich. Man hörte sie schreien: »Die Wespen!« Sie stellte den Teller ab, schützte sich mit dem Arm und rannte davon.
Später lachte sie und schämte sich, ganz rot vor Aufregung, auf eine ländliche Art.
Das Spiel wiederholte sich, und schließlich entdeckte Pietro, dass die unzähligen Wespen aus einem kleinen Loch in der Wand über dem Fenster kamen; er meinte, es müsse ein Maurer her.
In unserer Nähe wohnte einer, in einem kleinen Haus inmitten der Wiesen. Maria ging ihn rufen; der Maurer kam, stellte eine Leiter auf und mauerte die Wespen lebendig ein.
Als auch ich wieder zu arbeiten begann, ergab sich wenig Gelegenheit, mit Maria zu reden. Die Finanzen überprüfte Pietro mit ihr, in einem sehr ordentlichen kleinen Heft.
Maria verlieh allen Dingen, die sie tat, eine gewisse Feierlichkeit, ohne die Aufmerksamkeit darauf zu ziehen, sondern indem sie sie diskret und in aller Stille erledigte. Aber vielleicht wurden sie gerade wegen der von ihr an den Tag gelegten Sorgfalt und Diskretion um ihrer selbst willen wichtig, ohne dass ihr Nutzen eine Rolle gespielt hätte. Wie ein Zeremoniell, bei dem man keine Einzelheit auslassen oder vernachlässigen und vor allem nicht die Reihenfolge und die Dauer der Abläufe verändern durfte.
Maria stand zum Beispiel sehr früh auf und ging zur ersten Messe; sie kam zurück, trank einen Kaffee und ging dann wieder los, um einzukaufen. Die Kirche war weit weg, ebenso wie die Geschäfte; eine halbe Stunde über die Allee und die Abkürzungen über das Land. Ich wagte nicht, ihr vorzuschlagen, beides auf einem Weg zu erledigen. Zudem begriff ich, dass die erste Messe nicht dasselbe war wie eine der späteren.
Sonntags gingen wir bei gutem wie schlechtem Wetter in den Tälern rings um die Stadt spazieren. Wenn wir nass zurückkamen, nahm Maria die besorgte Miene einer Mutter an, aber ohne einen Anflug von Missbilligung. Im Gegenteil, mit einem Beiklang größeren Respekts, als sei ein Unwetter eine Gefahr und ihm entgegenzutreten eine Mutprobe.
Pietro fragte sie, wie sie den Sonntag verbracht habe: So erfuhren wir über die Besuche, die sie von ihrer Familie erhielt.
In der Regel ließen sie uns ein Geschenk in Form von Bauernbrot da.
Den ersten Besuch erhielt sie von ihrer Nichte Giuseppina.
Giuseppina kam mit anderen Mädchen, ihren Freundinnen. Sie wollten nicht in Marias Zimmer sitzen, nicht einmal in der Küche, sondern auf dem Balkon, mit Blick auf den Garten hinter dem Haus. Sie waren sofort in Gelächter ausgebrochen; vielleicht hatten sie sich dorthin geflüchtet, um durchzuatmen und sich zu beruhigen. Anfangs hatte Maria mit ihnen gelacht; dann, als sie nicht aufhören wollten, sagte sie »Genug« und »Kommt essen«, aber sie hatten ihr Essen in einem Koffer dabei und aßen auf dem Steinboden des Balkons sitzend, da sie, wer weiß warum, sogar die Stühle abgelehnt hatten.
Beim Schlucken drohten sie zu ersticken, denn sie konnten sich das Lachen nicht verkneifen. Maria, gekränkt, aß nichts und hätte beinahe geweint.
Im Gehen ergriff Giuseppina schließlich das Wort und sagte auf Piemontesisch zu ihrer Tante: »Entschuldigen Sie uns, magna Marí.«
Giuseppina war in dem Alter, in dem alle Mädchen mal mehr, mal weniger geschmacklos sind; aber das war zu viel, sagte Maria. Nach den Wespen war es das erste Mal, dass wir sie wütend erlebt hatten.
Maria sprach mit großem Ernst über ihre Brüder: ihr Bruder Giacomo, ihr Bruder Giovanni. Mit Freude, einer etwas eifersüchtigen Freude, erwähnte sie ihre Nichten und Neffen.
Unter ihnen war die kleine Maria, Maria Piccola, ihr Liebling. Ich wusste, dass sie lockige Haare hatte und ein wenig wild war. Maria hatte sie einmal zu uns geholt, als wir auf einem zweitägigen Ausflug waren.
Maria Piccola kam zum ersten Mal in die Stadt, zum ersten Mal sah sie ein Stadthaus. Wer weiß, wie Maria Piccola es betrachtet hat. Als Maria sie auf dem Rückweg fragte, was ihr in der Stadt am meisten gefallen habe, antwortete sie: »Dass wir jetzt wieder nach Hause gehen.« Als Maria davon berichtete, war deutlich zu spüren, dass ihr diese Antwort gefiel.
Als Maria Piccola am Morgen in der Stadt eintraf, hatte sie kein Wort gesagt; schon bald hatte sie aufgehört, sich umzusehen; stumm blieb sie neben ihrer Tante. Nicht einmal essen wollte sie. Maria begriff und schickte sie nach draußen, in den Garten.
Als sie vom Balkon aus nach ihr schauen wollte, sah sie sie nicht mehr. Sie lief die Treppe hinunter und verzichtete darauf, nach ihr zu rufen: Das Tor stand offen. Weit weg, am Ende der Allee, wo die Baumstämme zu verschmelzen schienen, entdeckte sie den roten Schal, wie mitgerissen von einer undeutlichen, schwingenden Bewegung. Soldaten waren singend vorbeigezogen und Maria Piccola hatte sich aufgemacht, ihnen zu folgen.
Mit Mühe holte Maria sie ein; sie schimpfte nicht mit ihr.
Nachdem sie sie in die Siedlung, den Villar, zurückgebracht hatte und in der Küche die Geschichte von den Soldaten erzählte, war Maria Piccola abermals verschwunden. Sie hörten sie singen. Sie war auf den Feigenbaum geklettert, der vom Hang aus in den Hof ragte, blieb dort oben versteckt und sang bis zum Einbruch der Nacht. Sie zu rufen war vergebliche Liebesmüh.
II.
Auf die Frage, ob es etwas Neues gäbe, antwortete ich: »Ich weiß nicht«, und tat so, als ob ich es nicht verstanden hätte. So eifersüchtig hütete ich mein Geheimnis. Als meine Kleidung über dem Bauch zu spannen begann, blickten mich selbst unbekannte Frauen mit leuchtenden Augen an und versuchten, mich zum Reden zu bringen; aber ich ließ mich nicht darauf ein und litt darunter, dass das Geheimnis nicht mehr länger das meine war.
Maria ließ nie erkennen, dass sie es wusste. Ich weiß nicht, ob aus Diskretion oder aus Befangenheit. Dafür war ich ihr sehr dankbar.
An einem Sonntag im März luden uns Marias Verwandte in den Villar ein, in das Haus der Familie, die Casa Barcellona.
Der große Ort D., den man mit der Straßenbahn erreichte, lag am Fuß des Berges; die Casa Barcellona gehörte zu einem Ortsteil des Villar, versteckt in einer großen Gebirgsfalte. Man gelangte zum Haus, indem man den Kamm zur Wallfahrtskapelle Santa Maria erklomm und dann dahinter auf einen Pfad bog, der durch Birken- und Buchenwälder führte. Man konnte den Villar nicht sehen, aber von Santa Maria aus erkannte man die Schieferdächer der Casa Barcellona durch die dürren Äste der noch winterlichen Kastanienbäume hindurch.
Damals betrachtete ich alle Dinge, als wären sie fremd, da ich ganz von dem eingenommen war, was ich erwartete; dennoch vermochten es die Wälder, die Steinhäuser, mir zu gefallen, mir vertraut zu erscheinen.
Die Schwägerinnen kamen uns auf dem Weg hinter den Häusern entgegen.
Sie konnten es nicht durch meinen bloßen Anblick bemerkt, sondern Maria musste es verraten haben. Sie schauten mich an, aber auf eine ganz andere Weise als die Frauen aus der Stadt.
Sie hatten beide einen Säugling auf dem Arm und streckten etwas unbeholfen ihre raue, warme Hand aus, ohne ein Wort zu sagen; aber in ihrem langen, fast mitleidigen Lächeln erkannte ich eine feierliche Geste.
In der großen, dunklen Küche erhitzte eine der Schwägerinnen, die ältere, Milch im Kessel, der in einem riesigen, schwarzen Kamin an der Kette hing. Ihr Säugling in den Windeln war winzig und kränklich, ihre Brust kümmerlich und schlaff. Und während sie mich anlächelte, seufzte sie.
Rennend kamen sie herein, dann zögerten sie: herausgeputzte Jungen und Mädchen, die von der Messe zurückkehrten. Die Jungen grüßten, einer nach dem anderen, nahmen ihre Schirmmützen ab und schüttelten mir mit ihren kleinen, festen Fäusten die Hand. Anschließend versteckten sie sich, einer hinter dem anderen. Eines der Mädchen war Maria Piccola, die mich trotzig ansah. Ein großes, blondes Mädchen, das bereits einen mütterlichen Eindruck machte, war Giuseppina, die rot wurde und sich sofort um die Kinder kümmerte. Maria, strahlend, tauchte abwechselnd auf und verschwand wieder.
Am Mittagessen nahmen die beiden Brüder und Schwägerinnen mit ihren Säuglingen teil; von den anderen Kindern war nur Francesco dabei, der älteste Sohn ihres Bruders Giacomo, bereits ein Mann. Giuseppina half Maria beim Servieren.
Die ältere Schwägerin schenkte mir ihr trauriges Lächeln, die jüngere das ihre, heiter, mit Grübchen in den Wangen; ihrem Kind ging es blendend und es streckte bereits die Hände nach dem Essen aus. Die Brüder, ein wenig steif in ihren Gesten, hatten Marias Augen, fest und blau, in denen aber auch, vor allem beim älteren, Giacomo, ein Lachen lag, fast ein wenig boshaft, wie bei Menschen, die Bescheid wissen.
Sie sprachen mit Pietro über die Kriege: Giacomo hatte auch den Krieg in Libyen miterlebt. Sie sagten präzise Dinge, in kurzen Sätzen; Pietro hörte ihnen zu wie jemand, der noch zu lernen hat.
Es regnete plötzlich und wir sahen von der offenen Tür aus, wie sich Hof und Wälder schnell verschleierten. Die Bauern beglückwünschten einander: In den Bergen gibt es nur Wasser vom Himmel. Dann wandten sich die Frauen herzlich, die Brüder mit einer gewissen Ironie an uns und bedankten sich: Sie hatten in unserem Besuch ein versöhnliches Zeichen gesehen.
Bald nahm der Regen ab. Ein Kind lief verstohlen über den Hof. Als es sich beobachtet fühlte, blieb es schlagartig stehen. In diesem Moment ergoss eine Regenrinne ihren Schauer von oben auf sein kleines Köpfchen, auf seinen dünnen Nacken, auf seine spatzenhaften Schienbeine, die sich in dem weiten, steifen Festanzug verloren. Das Kind rührte sich nicht, auch nicht auf die Rufe seiner Mutter hin; schließlich kam ein Mädchen herbeigelaufen, nahm es bei der Hand und rettete es.
Ein Lachen war um den Tisch gegangen. Nur einer lachte nicht: ein grauäugiger Junge mit strengem Blick, aufrecht zwischen den Knien seines Vaters. Er hatte sich dort am Ende des Mahls postiert, wie es ihm zustand; sein Vater, Marias Bruder Giacomo, hatte ihm seine breite, feste Hand auf die Schulter gelegt.
Ich fühlte mich beobachtet von seinen großen, grauen Augen; und Maria erzählte später, dass Guido, wenn die Kinder unseren Besuch »nachspielten«, immer »die Dame« sein wollte, die Madamin.
Der Sommer war trocken. Maria sorgte sich um die Ihren: In der Casa Barcellona würde die Dürre die gesamte Ernte wegfressen.
In den Ferien im August verbrachte ich die Morgenstunden und Nachmittage mit Lesen und Nähen, sehr langsam, die Stiche im Wechsel mit dem Griechisch der unglücklichen Atriden. Drüben las Maria, nachdem sie ihre Arbeit beendet hatte, ihre Kirchenbücher. Vom Tennisplatz hinter dem Haus hörte man in der stillen Luft die Bälle fliegen: tock, tock. In der Dämmerung gingen Maria und ich hinaus, den staubigen Weg entlang. Von den Ulmen fielen die verbrannten, rötlichen Blätter herab.
Ab diesem Zeitpunkt begann ich mir Geschichten über die Casa Barcellona erzählen zu lassen. Sie ähnelten, wenn sie auch etwas heiterer waren, den Geschichten der Atriden und sie schienen mir meinem Zustand angemessen.
Nie sprachen wir über das, was ich erwartete.
Ich begann zu fürchten, dass Maria, sollte es ein Junge werden, nicht mit anfassen würde. Pietro beruhigte mich und sagte, Maria sei eine Bäuerin, sie hatte sicher schon viele Jungen zur Welt kommen sehen.
Wenn ich mit Pietro abends im Dunkeln auf der Terrasse saß und den Grillen zuhörte, dachte ich immer, dass ich einen Jungen haben wollte; ich dachte intensiv daran, während ich die Sternschnuppen beobachtete.
Aber davon sagte ich Pietro kein Wort, weil ich wusste, dass er nicht abergläubisch war.
III.
Unser Kind wurde in einer Septembernacht geboren, als ein riesiger, goldfarbener Mond langsam über den Himmel zog.
Ich lag schon seit einiger Zeit wach, und spürte, dass es so weit war.
Pietro schlief wie ein Kind oder wie ein müder Mensch; als ich ihn rief und schüttelte, regte er sich nicht, dem Schlaf ergeben und schwer. Ich fühlte mich einsam, aber ich hatte keine Angst: Ich war voller Neugierde.
Schließlich stand Pietro auf, bewegte sich wie ein Automat und ging, um die Hebamme zu rufen. Als er zusammen mit ihr zurückkam, war er sehr blass.
Als der Mond untergegangen war und der Himmel sich erhellte, war das Kind geboren.
Maria hatte man nicht gerufen. Auch sie musste ihren Kampf hinter sich haben: Als sie an der Tür des Zimmers erschien, zeigte sie ein erschöpftes Gesicht und geschwollene Augen.
Mit kaum hörbarer Stimme fragte sie, ob sie einkaufen gehen könne. Eine Stunde später erschien sie wieder, sah immer noch mitgenommen aus und fragte, ob sie sauber machen könne.
Die Wiege des Kindes war ein großer Korb auf einem Rollgestell, ohne Baldachin oder Bänder, aus Verachtung für das Adrette. Aber der Korb mit dem Kind darin war ohnehin wunderschön, vielleicht sogar ein wenig feierlich, was der Baldachin sicher verdorben hätte.