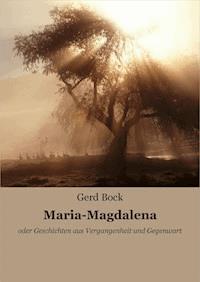
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese "Geschichten …", wie oben postuliert, widme ich mir selbst, bevor der rapid um sich greifende Morbus des Alois Alzheimer auch mir den Geist vernebelt. Ich muß hinzufügen, die Politiker aller Couleur vernebeln seit ewiger Zeit die Hirne eines Großteils der Menschheit erfolgreich, auch ohne die Hilfe des berüchtigten Morbus von Dr. Alois. Es steckt auch ein gerüttelt Maß Autobiographie in meinen Geschichten. Man kann sich nicht alles ausdenken, man wirkt ja sonst so unseriös.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerd Bock
Maria-Magdalena
oder Geschichten aus Vergangenheit und Gegenwart
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1. Vorwort
2. Maria-Magdalena
3. Besuch in Schiebock
4. Dienst … für Deutschland
5. 1. Ehe – 1. Job
6. Vertrieb
7. Reisen
8. König Laurin und sein Rosengarten
9. Und wieder Maria
10. Urlaub und Politik
11. Kater und das wahre Leben
12. Das 2. Arbeitsleben
13. Abgesang
Impressum neobooks
1. Vorwort
Ich will beileibe nicht die Hauptfigur dieser „Geschichten aus Vergangenheit und Gegenwart“ sein, so nenne ich das, was da folgt, mal einfach.
Natürlich ist die eigentliche Hauptfigur, die junge Frau Maria-Magdalena, komplett meinem Hirn entsprungen, wie weiland die jungfräuliche Athene in voller Rüstung mit Helm und Aigis, und auf dem Brustpanzer das Abbild des Gorgonenhaupts, dem Hirn ihres Vaters Zeus entsprang. Das bedeutet natürlich keinesfalls, ich will mich hirnmäßig mit ihm vergleichen.
Trotzdem ist sie natürlich eine visionäre, abstrakte Figur, in und an der ich meine eigenen Gedanken, Vorstellungen und Wünsche reflektiere. Besonders solche, bei denen ich das Gefühl habe, nicht allein klar zu kommen und den Rat eines anderen Menschen suche.
Und ich rede auch mit ihr, einfach so, mitten im Text, ohne vorher Ort und Zeit zu fixieren. Wer will mich daran hindern. Meistens antwortet sie mir sogar.
Das Schlimmste ist ja, sich selbst für unfehlbar zu halten. Das tun leider sehr viele Menschen, nicht nur Päpste.
Päpste machen das ziemlich erfolglos schon seit dem Ersten Vatikanischen Konzil 1870 unter Pius IX. Das ist der Papst mit dem längsten Pontifikat seit es Päpste gibt - 32 Jahre.
Man hält es einfach nicht für möglich, daß im Jahre 1870 noch solcher Irrsinn festgeschrieben werden durfte, wo doch damals schon seit 31 Jahren die D-Züge auf der ersten deutschen Fernstrecke von Leipzig nach Dresden und zurück fuhren.
Ein Schatten davon hat damals auch auf Bismarck abgefärbt, wie man weiß und darüber hinaus später noch auf viele andere. Das hält bis heute an. Vielleicht sollte das Konzil von 1870 auch auf diese Personen erweitert werden.
Mir scheint die heutige, marktwirtschaftlich geforderte und geförderte, völlig überzogene Sucht zur Selbstdarstellung, Karrierebesessenheit, Rücksichtslosigkeit und Egoismus, ein Schritt in Richtung der vermeintlichen Unfehlbarkeit jedes Einzelnen zu sein. Es kann einfach nicht jeder für sich unfehlbar sein, das führt unweigerlich ins Aus. Die tägliche Realität ist ein Beweis dafür, wie überhaupt die Praxis der einzige Wahrheitsbeweis jeder Hypothese ist.
Was ich in diesen „Geschichten aus Vergangenheit und Gegenwart“ will ist, mir einiges von der Seele zu reden. Wahrheit vermischt mit Dichtung, Wunsch mit Realität, Gesagtes mit Unausgesprochenem. Anders geht es so wie so nicht.
Daß ich ein Kind der DDR bin, ist leicht nachzuvollziehen. Zwar in Adolfs 1000-jährigem Reich geboren, jedoch im Kindesalter schon begriffen, wie kurz doch 1000 Jahre sein können.
Dann 40 Jahre Sozialismus dieser oder jener Schattierung, wobei nicht überall Schatten war. Hat mir jedenfalls nicht geschadet. Habe fast die halbe Welt in der Sonne gesehen.
Die darauffolgenden 24 Jahre Marktwirtschaft haben mir schon arg zu denken gegeben. Umdenken natürlich, und schlußendlich bin ich zu der bitteren Erkenntnis gekommen, daß es doch eine Schmutzgesellschaft auf hohem Niveau ist und die persönliche Freiheit darin nur soweit reicht, wie das persönliche Geld und die Fähigkeit, dieses zu vermehren. Damit hatten die meisten gelernten DDR-Bürger immer schon Schwierigkeiten.
Bedeutet nicht, daß ich mich in den Sozialismus zurücksehne, aber ein bißchen Nostalgie darf schon sein.
Denn es sollte nicht die Befürchtung von Stefan Heym Wirklichkeit werden, daß die DDR in den Geschichtsbüchern der Zukunft nur noch als Fußnote erscheint.
Erstaunlicherweise ist in beiden Gesellschaftsordnungen eine Kategorie absolut gleich, nämlich der gravierende Unterschied zwischen Worten und Taten der Regierenden aller Ebenen. Diese lügen und jene haben gelogen und das auf Teufel komm raus, ja. Und alle vorhergehenden auch, über Jahrtausende.
Vielleicht ist das Lügen ein Bestandteil menschlicher Intelligenz. Und das Volk, der große Lümmel glaubte und glaubt den Lügen damals wie heute.
Daraus resultiert u. a. auch eine meiner Lebenserkenntnisse: Gegen Dummheit kämpften Götter schon vergebens!
Wissen fasziniert mich, schon immer. Las ich doch neulich, 123 von 13000 sächsischen Abiturienten haben dieses Jahr ihr Abi mit summa cum laude gemacht.
Falls mich jemand klont und ich im neuen Leben wieder Kinder habe, so werde ich alles daransetzen, ihnen etwas Vernünftiges beizubringen, natürlich, wenn sie das wollen. Wollen muß schon dabei sein. Es gibt im Normalfall nur selten Lernunfähigkeit, dafür aber erschreckend häufig Lernunwilligkeit.
Diese „Geschichten …“, wie oben postuliert, widme ich mir selbst, bevor der rapid um sich greifende Morbus des Alois Alzheimer auch mir den Geist vernebelt.
Ich muß hinzufügen, die Politiker aller Couleur vernebeln seit ewiger Zeit die Hirne eines Großteils der Menschheit erfolgreich, auch ohne die Hilfe des berüchtigten Morbus von Dr. Alois.
Es steckt auch ein gerüttelt Maß Autobiographie in meinem Buch. Man kann sich nicht alles ausdenken, man wirkt ja sonst so unseriös.
2. Maria-Magdalena
Die Warteschlange zum Counter bei der DB, jetzt wieder Schalter, nach der Sprachreform von Bahnchef Grube, rückte langsam vorwärts.
Vor mir eine junge Frau, vielleicht 30, oder ein paar Jahre mehr. Im engen Kostüm, keine Pumps, Schuhe mit halbhohen Absatz. Also seriös, verheiratet, möglicherweise aus bürgerlichen Verhältnissen und im Job bei einer Bank, oder Uni, oder Chefsekretärin, oder so ähnlich.
Sie rutschte über irgend etwas, kippte nach hinten ab, oder es war ihr schwindelig geworden. Nein, nicht bei so einer jungen Frau. Das Haar übrigens lang und braun. Es flog mir ins Gesicht, duftete gut.
Ich hielt sie um den Bauch fest, sie flog nicht, aber ihr rechter Fuß stand so komisch. Hinterher sah ich, sie war auf einem Spuckfladen ausgerutscht – Bahnhofshalle! Ich dachte nichts und sagte nichts.
Sie kam nur schwer auf beide Füße. Der rechte schmerzte offenbar sehr. Ich ließ sie los. Sie wollte einen Schritt in der Schlange nach vorn gehen, denn die war gerückt. Aber schon hatte sie wieder meinen rechten Unterarm im Griff – es geht nicht.
Links stand eine Bank in der Halle, dorthin. Den Schuh ließ sie liegen, ich nahm ihn mit zur Bank. Blaß und weit aufgerissene Augen, sie waren braun. Sie ließ meinen Arm nicht los. Schmerzen – ja.
Ich kniete mich vor sie hin. Den Fuß bitte mal hoch. Gar nicht so einfach im engen Kostüm. Rock hoch und Beine übereinander, hörte ich mich sagen. Sie tat es widerspruchslos.
Der Knöchel war schon ganz schön dick, bald würde er blau werden. An Laufen nicht zu denken. Nach Hause, nein, da ist niemand. Wieso, haben Sie keinen Mann zu Hause? Ja, doch schon, aber im Moment habe ich nur Sie.
Ich dachte so bei mir … Du meinst, jetzt habe ich nur Dich … und plötzlich sagte ich das auch so zu ihr.
Ja, Dich. Mit schmerzverzerrtem Gesicht. Zum Arzt? Ja. Gut, mein Oggi steht auf dem Parkplatz vorm Bahnhof.
Der Versuch, selbst zu laufen, ging voll in die Hosen. Ich faßte sie, als sie stand, rechts um die Hüften, den linken Arm unter die Kniekehlen – los ging’s. Das Bündel an den OCTAVIA gelehnt, Türe auf, rein, mit Schrei und Entschuldigung.
Nach 2 h beim Arzt mit dickem Elastikverband wieder zum Auto. Heim zu Dir - nein. Warum nicht - ist zu weit. Also zu mir. Ja, aber? Kein Problem, sage ich. Ich hab’ das alles durch.
Hatte ich doch neulich im Mai erst, meine Exfrau und unseren gemeinsamen Sohn zu meinem und meiner Frau Geburtstag eingeladen. Meine große Tochter und meine liebe Schwiegertochter haben sich darüber ein wenig aufgeregt. Meine Frau auch. War mir egal.
Die Ex und ich sind seit 50 Jahren geschieden und haben keine Probleme mehr miteinander, auch keinen Sex.
Sie saß im Auto neben mir wie ein Häufchen Unglück. Halt mal an, wenn es geht, ja. Ich dachte, sie hat wohl tolle Schmerzen. Sie sagte aber, warum tust Du das alles für mich. Du kennst mich doch überhaupt nicht. Ich kann doch auch ein Luder sein oder eine Nutte und HIV- positiv.
Bist Du nicht und ich tue doch nur für Dich, was jeder andere auch tun würde. Du hast einen Job an der TU, sagte ich unvermittelt. Stimmt, sagte sie und bin promoviert.
Sie sah mich an, es hätte einen Stein erweichen können. Aber nicht glücklich?
Doch schon, nur mit einem Kind will es nicht klappen. Und ich möchte doch so gerne eins.
Ich dachte so bei mir mit Friedrich von Schiller: … der Frau kann geholfen werden!
Aber das wäre wohl nicht fair, in dieser Situation.
Ich dachte auch an den hübschen Witz von der jungen Frau mit tollen Zahnschmerzen und dem Spruch des Zahnarztes … das müssen Sie schon selbst entscheiden, da muß ich nämlich den Stuhl umstellen.
Na gut. Plötzlich lehnte ihr Kopf an meiner Schulter, wir standen, und sie heulte Rotz und grüne Pflaumen (mecklenburgisch-vorpommerscher Spruch meiner Frau).
Wie das alles weitergehen soll, war mir im Moment verdammt unklar. Ein hübsches junges Weib, das Herz auf den Lippen, Tränen, ein schmerzender Knöchel, nicht laufen können, getragen werden müssen, ein Kerl und ein Auto und warmes Wetter. Was Besseres ist kaum denkbar. Jetzt hatte ich den Schwarzen Peter. Nein, eigentlich nicht. Mit 76 hast du keine Chance mehr.
Wollte ich da raus – eigentlich nicht. Nur jetzt keine Gedanken machen, oder Ressentiments haben, nein, nein und nochmals nein. Verfluchter Wunsch!
Also flugs nach Hause in unser Häuschen und auf die Couch mit der promovierten Lady. Meine Frau würde wohl mitspielen, es war ja doch ein Notfall, aber irgendwann würden schon Fragen kommen.
Kann mich, abgesehen vom Geburtstagsknatsch wegen meiner Ex, noch gut an die Geschichte mit der „Gräfin“ aus Böhmen erinnern, exakt an Frau Merinna Coraldi de Larric, so ums Jahr 1999 herum und an den Anruf deren adliger Tochter bei uns zuhause, da war die Gräfin schon ein paar Jahre tot, sie rauchte ja jahrzehntelang täglich ca. 40 Zigaretten. Kein schöner Suizid. Wir haben sie, die Gräfin, im Oktober 2000 mal in ihrem Schloßhotel im Böhmischen Mittelgebirge zwischen Aussig und Leitmeritz besucht, sind aber vorzeitig wieder abgehauen, obwohl wir das Hochzeitszimmer hatten. Sie war halt doch zu direkt in ihrer Art!
Von der Couch bei uns zu Hause hat sie, sie heißt übrigens Maria, genauer Maria-Magdalena und nach dem Neuen Testament Maria von Magdala (nicht das bei Jena, nein, das Magdala am See Genezareth in Galiläa), ihren Mann angerufen. Der kam nach ein paar Stunden, ganz freundlicher Kerl. Was machst Du nur für Sachen, Maria. Zu mir, vielen Dank auch für Ihren Einsatz.
Verdammt, dachte ich, der Kerl taugt ja was. Na, eben Pech gehabt.
3. Besuch in Schiebock
3 Wochen später ruft sie an: Ich lade Dich und Deine Frau mal zum Essen ein, wir wohnen in der Lausitz. Der Fuß ist wieder heil.
Meine Gute hatte wohl keinen rechten Hunger aufs Essen und so fuhr ich allein.
Benannt hatte Marie einen hübschen Gasthof „Erbgericht“ in der Nähe von „Schiebock“. Jeder weiß, wo und was das ist, das Tor zur Lausitz. In der Lausitz heißen 11 von 10 Kneipen Erbgericht. Gemeint ist natürlich das Amtsgebäude des Dorfrichters früherer Zeiten, dessen Funktion erblich war.
Sah ich doch neulich im TV eine Sendung über Karl Stülpner, den Robin Hood des Erzgebirges, da war viel von der lieblichen Tochter des Dorfrichters, der Geliebten Karls die Rede. Ein hochgelehrter Professor, kein Sachse, sprach über die Armut der Erzgebirgler im 18. und 19. Jahrhundert, stimmt ja auch, und über die Frondienste, die die leibeigenen Bauern früher verrichten mußten.
Der Mann weiß offenbar bis heute nicht, daß es im Wettinischen Sachsen nie, zu keiner Zeit, Leibeigene gegeben hat und ist trotzdem Professor geworden. Unwissenheit ist keine Schande, Halbwissen schon. Mancher schafft’s eben trotzdem.
Maria wollte den etwas modernisierten Namen Marie nicht akzeptieren. Ich heiße Maria, Maria–Magdalena. Ich ergänzte: Maria von Magdala – nein, nicht von Magdala. Gut.
Wo ist Dein lieber Mann? Leider keine Zeit. Was jobbt er eigentlich? Er ist Arzt, Hausarztpraxis, das heißt, er hat selten oder nie Zeit. Auch keine Zeit zum Kindermachen? Sei nicht so frech.
Als nächstes war zu klären, wo ich heute Abend mein müdes Haupt zur Ruhe betten kann, oder ich darf wegen der Rückfahrt keinen Schluck Bier trinken, oder nur einen ganz kleinen.
Sie sagte leichthin, wir werden eine Lösung finden.
Was für eine Lösung meinte sie? Welche Art Doktorin bist Du eigentlich? Technische, biologische, mathematische oder was für eine Doctora. Ah, die weibliche Form von Doctor. Hast Du Ahnung von Latein?
Ja, sagte ich, und nein dachte ich. Es war vor 60 Jahren auf der OLO in Saalfeld, habe fast alles vergessen. Wer übt schon sein Leben lang Latein.
Habe als junger Kerl auch über 11 Jahre Russisch „gelernt“, aber halt ohne innere Bereitschaft. Hätte mir vielleicht doch bei meinen dienstlichen Jobs im Ausland weitergeholfen, könnte mich heute noch in den Hintern beißen.
Sie: Das wäre Dir weder früher noch heute gelungen. Stimmt sogar. Das Frauen doch immer Recht behalten müssen, ich.
Sie: Ja, Frauen sehen eben alles um sich herum ziemlich realistisch.
Ich wollte noch fragen – im Gegensatz zu Männern, etwa. Habe es aber in eine andere Frage umgeleitet: Warum fährst Du mit der Bahn nach Schiebock, mit dem Auto geht’s doch viel bequemer. Ja schon, wenn die Waldschlößchenbrücke mal fertig sein wird und ich und viele andere nicht einen Kilometer zum Parkplatz laufen müßten, dann ja. Und das geht nun schon einige Jahre so. Alles wegen der Spitzmaulnashörner – will sagen der Hufeisennasenfledermäuse. Die Brücke hatte schon vor 3 Jahren fertig sein können. Stimmt natürlich.
Wie schön wird das Elbtal doch sein, mit dieser wunderbaren Brücke, diesem eleganten technischen Wunderwerk, auch und gerade ohne Weltkulturerbetitel. Ein doofes Wort, übrigens.
Gegen das Blaue Wunder hat bisher, d. h. seit fast 120 Jahren auch noch keine UNESCO Einspruch eingelegt. Irgendwelche „Körnerfresser“ hatte wohl Wut auf die Waldschlößchenbrücke. Manche haben sich in einer alten Rotbuche oben am Waldschlößchen angekettet. Andere haben eimerweise Kies in die Getriebekästen von Baggern geschüttet – alles Hirnrißlinge, die man 3 Jahre in die Braunkohle schicken sollte, damit sie zu denken beginnen.
Früher war der Slogan im Schwange:
Hier macht jeder was er will und keiner was er soll und alle machen mit!
Heutzutage ist dieser Spruch potenziert zu Gange. Das reimt sich sogar.
Sie saß mir gegenüber in der Kneipe, das Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden, eigentlich unmodern, umwerfend hübsch anzusehen. Hab’ wahrscheinlich die Augen verdreht, vor Wonne. Ist was, ist Dir übel?
Völlige Fehleinschätzung – ich möchte Dich küssen, so wohl ist mir. Sie, abwarten und Tee trinken.
Unser ehemaliger Fuhrparkleiter, Erich Mühlberg war sein Name, sagte immer in kniffligen Situationen: Weiterfahren und beobachten. Friede seiner Asche.
Wir fahren weiter und werden nicht nur beobachten, nein, auch im rechten Moment zufassen – hoffentlich. Dazu gehören immer Zwei.
Ich wußte noch nicht, welche Art Doktorin sie ist. Glatt das Thema verfehlt. Abgelenkt durch ihre Schönheit und ihr Geschick, das Gespräch in die ihr genehmen Bahnen zu lenken.
So fragte ich denn mit Elsa von Brabants Worten aus Lohengrin: … wess’ Art und Stamm bist du?
Im Wagnerjahr ist es schon erlaubt, solche Fragen zu stellen.
Es kam prompt mit Lohengrin zurück: … Nie sollst du mich befragen, noch Wissens Sorge tragen, wess’ Art und Stamm ich bin …
Eigentlich wolltest Du doch wissen, was ich doktoriere, ja, ich bin Laborchemikerin in der Uniklinik – na prima, sagte ich.
Dann sprach sie über ihre Arbeit, sprich ihren Job: Sehr interessant, manchmal auch traurig, wenn Analysen doch sicher auf Krebs deuten, prima Kollegen und -Innen. Kein Mobbing, keinen Knatsch, nur manchmal. Nun wußte ich alles.
Was Art und Stamm anbelangten, sagte sie mir erst viel später.
Es gab noch so viel zu erzählen. Erzählen zählt bei mir altem Kerl zu den sehr wichtigen Praktiken des Kontaktmachens, auch Kommunikation genannt, was eigentlich korrekt übersetzt ´sich vergemeinsamen´ heißt.
Ja, Datensammlung nach Art des Hauses NSA in Gottes eigenem Land. Nur 18 Geheimdienste haben die dort. Vielleicht für jede Geheimniskategorie einen. Erich Mielke hätte von denen viel lernen können, sehr schade, nun ist alles zu spät. Ich weiche ab – wie so oft.
Alter Kerl, das ist das Stichwort. Ich bin nur knappe 40 Jahre älter als diese junge Frau. Könnte gut meine Enkeltochter sein. Eine von denen wird im November 33. Fast bedeutungslos, möchte man meinen. Im Gegenteil, kreuzgefährliche Situation, wenn man bedenkt, was alles nicht mehr, oder nicht mehr so richtig, oder überhaupt nicht mehr geht. Ich muß mich davor hüten, mich durch unbedachten Quatsch lächerlich zu machen, das heißt mit anderen Worten, ihre Jugend und diesen Altersunterschied immer und über alle meine Träume und Wünsche hinweg respektieren. Auch wenn’s schwerfällt.
Bock, reiß’ dich am Riemen! Soll heißen, alter Bock.
Mir fiel eben wieder das noch ungelöste Problem ein, Bier - wo den Kopf hinlegen - oder nach Hause fahren. Es wird eine Lösung gefunden werden müssen, oder auch nicht. Das alles klingt sehr sophistisch, ja spitzfindig.
Wir hatten einen hübschen Kneipennachmittag mit freundlichen Gesprächen, gutem Essen, sie Kalbsbraten mit böhmischen Knödeln und Bier, ich Roulade mit Rotkraut … und Bier.
Später fuhr ich doch mit dem Auto nach Hause – besser so. Aber das Essen hat geschmeckt. Bestes Zeichen dafür, Essen ist doch die Sexualität des Alters – makabre Erkenntnis, aber so wahr, wie nur irgend etwas wahr sein kann. Gutes Essen hatte und hat für mich schon immer einen hohen Stellenwert, seit ich Magazinverwalter für Verpflegung bei der NVA war und das ist schon sehr, sehr lange her.
4. Dienst … für Deutschland
Hatten damals, 1956, die Regierungs-Fliegerstaffel ins Regiment bekommen. Das war nicht weit von Berlin-Schönefeld gelegen in einem ehemaligen, früher wie heute stark getarnten Raketentreibstoffwerk für die V1 und die V2 des Barons Wernher von Braun aus dem Warthegau, also in der Nähe von Posen. Hohe Kiefern wuchsen auf den meterdicken Betonflachdächern der Gebäude.
Der damals jüngste Professor des Deutschen Reichs ist ja nun seit 1977 auch in höheren Gefilden zu Hause, hat aber zu Lebzeiten doch die gesamte US- Raumfahrt auf Vordermann gebracht und nicht nur die dickste Saturn 5 für die Mondlandung entwickelt, nein auch den Abstand zur UdSSR-Raumfahrt nach Möglichkeit verkleinert. Hat irgendwann auch mal seine Cousine geheiratet und mit ihr hübsche blonde Kinder gemacht.
Die Fliegerstaffel hatte einen eigenen Koch und einen viel höheren Verpflegungssatz und ich mußte (gern) für diesen Koch mit einkaufen. Zygiel hieß er, ein Name polnischen Ursprungs und Feldwebel war er.
Man kann sich leicht vorstellen, bald hatte auch ich inoffiziell den höheren Verpflegungssatz, gehörte ich doch nun quasi gleichsam zum Verpflegungsbodenpersonal der Regierungs-Staffel.
Wie war es nur dazu gekommen, ich meine, ich in Wernher von Brauns ehemaliger Fabrik? Das muß irgendwie mit der NVA zusammen hängen:
Am 24. Juli 1956 sind 22 Stück frisch gebackene Abiturienten aus der ganzen Republik im damals ersten und einzigen Nachrichtenregiment in der brandenburgischen Sand- und Kiefernwüste nahe Königswusterhausen angekommen (worden).
Kam doch die Nationale Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik in Form eines Oberleutnants des Wehrkreiskommandos Saalfeld zu uns beiden Abiturienten, Bock und R.K. in die Freie Schulgemeinde Wickersdorf, wo wir beide gerade einen bezahlten Ferienjob als Nachtwächter für das Ferienlager ausführten und hat uns am 24.7.1956 höchstselbst ins Nachrichtenregiment des Ministeriums für Nationale Verteidigung, nach Niederlehme / Brandenburg gebracht, wo wir denn die beiden schönsten Jahre unseres bisherigen Lebens verbringen durften.
In memoriam: 13 Jahre vorher, am gleichen Tage, war mein Vater in Rußland gefallen. „Für Führer, Volk und Vaterland“, schrieb man damals Millionen von Kriegerwitwen, auch meiner Mutter. Ich habe den Brief heute noch.
Und neulich stand doch in der SZ, der oberste Landesrichter des Freistaates Sachsen hat einen Prozeß gegen den Neonazi Steffen Hupka niedergeschlagen, mit der Begründung, dessen Parole „Ruhm und Ehre der Waffen SS“ stehe nicht im Widerspruch zum Strafgesetz. Der Mann muß doch die Übersicht verloren haben!
Wehret den Anfängen zu sagen, ist vielleicht schon viel zu spät. In der Weimarer Republik hat es genauso angefangen, wie es in der Berliner Republik angefangen hat. Es scheint, kaum jemand hat etwas aus der Geschichte gelernt.
Dieser bedeutungsvolle Tag war wohl das Ende meiner Kindheit und Jugend, obwohl ich noch keine 18 war und meine Mutter ihre Einwilligung zu meinem „Waffengang“ geben mußte. Jetzt begann der Ernst des Lebens.
Raus aus der behüteten Kindheit und Schulzeit, rein in das blödeste System der Verknechtung, das sich die Menschheit jemals ausgedacht hat: Armee!
Doch halt, an meine Armeezeit habe ich fast nur noch angenehme Erinnerungen. So schlimm war es wirklich nicht. Damals schon gar nicht. Die NVA war ja noch so jung, erst 4 Monate alt und noch eine Spielarmee, wie z. B. heute wieder die Bundeswehr, wo fast jeder Soldat und Uffz. abends nachhause, oder doch zumindest zur Freundin gehen kann.
Episode zwischendurch:
Unser Nachrichtenregiment Niederlehme lag ja nur ca. 150 m von der damaligen Stadtgrenze Berlin entfernt, Flußmitte der Dahme, gegenüber Berlin-Wildau. Später hatten dann R. K. und ich ein Faltboot für 30,- Mark gekauft und sind darin in Badehosen über die Stadtgrenze gepaddelt, den Grenzern freundlich winkend und die zurück. Ei, wie lustig ging es damals noch im Kalten Krieg zu. Alles war zwar äußerst kurios, aber man konnte noch damit leben und darüber lachen. 10 Jahre später ging das schon nicht mehr und es war blutig geworden.
Na gut, Episode, Ausbildungskompanie, so im September 1956, Entlassungskandidaten mit in der Kompanie. Aaaach, wenn wir nur auch schon in dieser Position wären!
Alter Hase hatte sich abends junge Kirsche mit auf Bude genommen, Doppelzimmer einfach belegt, in der Kaserne natürlich.
Früh das Wecken und rechtzeitige Ausbüchsen des Mädels verpennt und der OVD (Offizier vom Dienst) stand plötzlich vor den beiden:
Was geht hier vor? Gesülze von Meldung, Bestrafung, das nahm kein Ende.
Der EK (Entlassungskandidat) ganz locker: „Genosse Oberleutnant, wenn Sie ein Faß aufmachen wollen, bitte gern. Aber nach verbüßtem Knast bin ich, haste nicht gesehen, im Westen (Berlins) und dann haben Sie die Brille auf, ha, ha.“
Dem Knaben ist reineweg gar nichts passiert. Er wurde kurz danach in Ehren entlassen.
8 Wochen Ausbildungskompanie, dann Funkkompanie, dann ein Befehl zur Uffz-Schule zu gehen, Befehl verweigert, 5 Tage in strengen Knast gegangen. War aber halb so schlimm, hatte gute Kumpels im Med-Punkt, die mich als fiebernd deklariert haben – erinnere mich genau an Sanitätssoldat Conrad Hund (Name leicht modifiziert), etwas später dann Ordentlicher Professor für deutsche Geschichte und Institutsdirektor an der Humboldt Uni Berlin, Spezialgebiet Zweites Deutsches Kaiserreich von 1871 bis 1918. Im Jahre 2002 emeritiert. Aus dem Jungen ist etwas geworden.
Danach durch das wohlwollende Verständnis eines Offiziers der Regimentsleitung (Oberleutnant Gr., Leiter für Versorgung) für den Studienwunsch eines Abiturienten ins Verpflegungsmagazin des Regiments delegiert worden und nach 4 Monaten dort zum „Chef“ avanciert. Bekam als Freiwilliger sogar ein Gehalt von 420,- DDR-Mark auf die Hand, ohne Abzug von Lohnsteuer und Krankenversicherung. Das war damals ein Schweinegeld. Ein 3-Pfund-Brot kostete 92 Pfennig. Mein erstes Ingenieurgehalt war 565,- Mark brutto!
Mußte zwar körperlich ziemlich hart arbeiten, brauchte aber, außer Schießübungen und Sommerlager keinen weiteren soldatischen Dienst zu tun und konnte alle 4 Wochen in Urlaub nach Saalfeld fahren, mit einem Reisetag Gutschrift. Damals fuhren die D-Züge noch mit der legendären Schnellzug-Dampflock BR 01, 2300 PS und Triebraddurchmesser 2 m, Tempo streckenweise 130 km/h. Aber halt auch nur mit einem Wirkungsgrad von 8% an der Schiene. 92% der kostbaren Steinkohle aus Ölsnitz gingen durch den Schornstein.
Das war eine Zäsur in meinem Leben, nicht nur im Soldatenleben. Vielleicht ist damals schon meine Lust am Kaufen und Verkaufen geweckt worden. Jahre später konnte man diese Lust dann mit dem Begriff Vertriebsingenieur umschreiben. Und das waren auch mein Job und mein Lebensinhalt für einige Jahrzehnte.
Und ich bin recht zufrieden damit gewesen. Nur meine Ehe und die Erziehung meiner Kinder haben darunter gelitten – nicht noch einmal dieses Spiel. Ich sagte es schon.
Wir hatten im Wirtschaftszug anfangs als persönliche Waffen das „Deutsche Sturmgewehr 44“ (d.h. MPi 44) von Adolf Hitler, später die sowjetische MPi 42 mit Trommelmagazin von Josef Stalin. Die MPi 44 war wohl doch zu schade für uns und vor allem zu hochkarätig. Sie durchschlug mit ihrer verkürzten Karabinermunition auf 150 m Schußentfernung noch 20 cm Fichtenholz – wir haben es ausprobiert.
Übrigens, außer der todbringenden Wirkung beider, ein technischer Unterschied wie Tag und Nacht. Die Stalin’sche zog beim Schießen, wegen des Masseschlosses, immer so fürchterlich nach oben. Treffen war Glückssache, aber schnell schoß sie schon. Die 44 Patronen waren flink rausgeballert. Die vielgepriesene „Kalaschnikow“ von Nikita Chruschtschow, dem kleinen Schuhschläger, kam erst 1960 zur NVA, da war ich schon Student.
5. 1. Ehe – 1. Job
Student, wie stolz das klingt. War auch stolz, nur die Weiber, oder besser gesagt, ein Weib und alles was damit im Zusammenhang stand, hat im Juni 1961 für meine selbst beantragte Exmatrikulation den Grundstein gelegt. Natürlich trifft nicht das Mädchen die Schuld, sondern mich allein, das ist klar wie Kloßbrühe, nur wahrhaben wollt’ ich´s damals nicht.
Was weiß man schon vom Leben, wenn man mit 21 heiratet, man weiß nicht mal wo man steht!
Ehe- und Familienpflichten, Kind in Auftrag gegeben, Geldbeschaffung stand im Vordergrund, Studium fand nur noch manchmal statt. Aussteigen war schon programmiert.
Im Januar 1961 kam Sohnemann zur Welt. Alles war neu und gar nicht mehr studentisch.
Heute gehört das, glaub’ ich, wohl zur Normalität, daß Studentinnen Kinder bekommen und das geht kurioserweise gut, auch das Studium führt am Ende zum Erfolg. Die Jungen sind halt viel wendiger als wir Alten, Konservativen.
Episode zwischendurch:
Am 12. August 1961, ein Sonnabend, kamen Heidi, auch schon geschwängert und R. K. zu Besuch nach Dresden, in unsere Einliegerwohnung für 32,- DDR-M auf dem Obergraben. Wir sprachen über Gott und die Welt und wie jämmerlich die DDR doch irgendwann zugrunde gehen wird. Es dauerte allerdings noch schlappe 28 Jahre.
Seit Januar 1961 hatten ca. 66.000 Bürger die Republik gen Westen verlassen – ausbluten war angesagt.
Wir, wenn wir schon diesem Trend der Zeit folgen wollen, dann müssen wir es bald tun, sagte der ehemalige Student Bock. Es liegt was in der Luft, so schien es mir.
Daß es nicht mal 12 Stunden dauern sollte, bis die Luft in Berlin stacheldrahthaltig und später auch bleihaltig wurde, lag außerhalb meiner Erkenntnisfähigkeit.
Am 14. August 1961, früh um 6 Uhr 45 ging ich dann in meinen neuen Job. Job sagte man damals natürlich nicht so eklig englisch, „auf Arbeit“ in den VEB Funkwerk Dresden, früher Radio Mende, und damit nahm das wahre Leben, mein erstes Leben, seinen Anfang.
Im nachhinein möchte ich sagen, es war ein schönes Leben, mein erstes, ein erfülltes. Vor allem wegen meines Traumjobs, der am 1. Februar 1966 begann. Später mehr dazu.
Auch das Zweite war schön, war anders, war kapitalistisch, hatten wir doch viel mehr Geld und viel mehr Probleme, als im ersten – nun dauert dieses auch schon wieder 24 Jahre, das 2. Leben.
Wann und wo begann es eigentlich. Ich glaube am 18. Oktober 1989 an der Goldenen Pforte des Dresdner Rathauses unter dem Fenster von OB Wolfgang Berghofer, als ich mit den Massen schrie „Wir sind das Volk!“ Wie dumm waren wir eigentlich damals.
Wir sind nie das Volk gewesen und werden es auch niemals sein, egal wie sich das gerade amtierende gesellschaftliche System auch nennen mag. Das ist eine der schmerzlichen Erkenntnisse meines zweiten Lebens.
6. Vertrieb
Na, nun ist wohl doch der richtige Zeitpunkt gekommen, etwas zu meinem ersten Leben zu sagen. Es geht los:
Am 1. Februar 1966 war meine "Tätigkeit mit einem Brett vor dem Kopf", sprich Konstrukteur mit Zeichenmaschine, beendet. Schon im März 1965 hatte mich Manfred W., seines Zeichens Vertriebsleiter im VEB Funkwerk Dresden, das erste Mal zu einer Messe nach Leipzig berufen. Für mich war es ein Riesenerlebnis, außerdem das 800-jährige Jubiläum der MM (Michaelis Messe). Und am 1. Messetag um 8 Uhr mussten wir die Eingänge der Halle 15 freischaufeln. Damals dauerte die MM noch ganze 10 Tage.
Am letzten Messetag nach 18 Uhr zogen wir dann durch die größte Halle des alten Messegeländes mit 2 Galerien und sangen im Gänsemarsch das Schleiferlied ab, „Wir sind die Schleifer, die Schleifer, die Schleifer von Paris. Und was wir schleifen das schleifen wir sicher und präzis …“, was aber verboten war, zu singen. Na ja, es gab auch Spaß im Sozialismus. Heute heißt das selbstverständlich Fun.
Bitter kalt im März 1965 aber das Flair einer Messe war für mich völlig neu, unbekannt, aufregend und sollte meine ganze berufliche Zukunft bis zum Ausscheiden aus dem ersten und dem zweiten Arbeitsleben beeinflussen. Manch einer hat eben zwei Leben.
Ab März 1966 liefen die Vorbereitungen für den Umzug von der Weinbergstraße 92 in die Freiberger Straße 8 auf Hochtouren. Chr. war inzwischen im Krankenhaus Neustadt angekommen mit seiner „Einschußstelle“ über der Nasenwurzel.
Am 9. April sind wir dann tatsächlich umgezogen. In eine, für damalige DDR-Verhältnisse geradezu luxuriöse Wohnung, für sage und schreibe 92,- Mark Warmmiete. Glaubt uns heute keiner mehr. Na gut, ich bekam knapp 600,- Mark brutto als Ingenieur und Karin noch weniger.
War nun "Offert-Ingenieur" im Absatz, besser im Export, konnte mich in Ruhe auf meine Auslandseinsätze vorbereiten, war seit 1965 dabei, eine postgraduale Qualifizierung als Außenhandelsökonom in Leipzig zu machen, habe sie im August 1969 beendet, wechselte fachlich von der Funktechnik zur Kabelfehlerortungstechnik und harrte der Dinge, die da kommen sollten.
Und sie kamen bald und in unübersehbaren Massen.
7. Reisen
Die erste (1967) im Funkwerk und die letzte (1994) meiner Dienstreisen bei der Hagenuk GmbH, heute sagt man ja wohl Geschäftsreise, das klingt viel gestochener, waren für mich markant. Der Fa. Hagenuk Kiel gehörte ich ja gemäß Konzernbeschluß der Preussag, damals gab es sie noch, ab meinem Eintrittsdatum ins Funkwerk Dresden, dem 14.08.1961 an, einen Tag nach der Berliner Mauer. Wenn das damals der Stasi-Beauftragte des Betriebes gewusst hätte, wäre ich sofort in der Bautzner Straße aufgenommen worden, mit freier Kost und Logis, natürlich.
Im April 2009 habe ich ihn anlässlich eines Brigadetreffens Absatz MKD im „Stammhaus Feldschlößchen“ wieder getroffen, Werner E., jetzt 81 Jahre alt und ganz ruhig geworden. Seine Frau Rita war damals bei uns im Absatz, eine einfache, aber fleißige Frau aus Leipzig.
„Deinen Namen hab’ ich vergessen“, sagte er, „aber daß Du einen lila Trabi hattest, das weiß ich noch genau.“
In den Mittachtzigern haben wir uns manchmal bald in die Fresse gehauen, so engärschig hat er sich angestellt. Dabei war er nicht doof. Bergbau-Ing. in der Leipziger Braunkohle, irgendwann mal zur Stasi umgekippt, erzählte uns seine Rita damals.
Im Juni 1967, schon läuteten verhalten die ersten Glöcklein des Prager Frühlings, sah man G. Bock mit einigen Meßgeräten im Gepäck zur Post- und Fernmeldeverwaltung nach Prag fahren. Natürlich mit der Eisenbahn. Wahnsinnig aufgeregt, werden mich die Leute überhaupt verstehen können - nie in den nächsten 28 Jahren hatte ich in dieser Richtung Probleme - wo werde ich wohnen, schlafen, essen und was wird sein. Von der Goldenen Stadt habe ich erst viel später etwas gesehen, keine Zeit, keine Zeit. Alles lief glatt. Wie konnte es anders sein. Immer war jemand da, der sich kümmerte. Einer vom TKB (Technisch-kommerzielles Büro), einer von den Kunden. Nie hatte ich das Gefühl, völlig auf mich selbst gestellt zu sein. So stellte sich eben die neue Realität für einen frischgebackenen Reisekader dar.
Die beeindruckendste aller Reisen war meine letzte bei Hagenuk, die 2. nach China. Fast 4 Wochen im September/Oktober 1994. Was soll ich weiter dazu sagen. Schon beim ersten Telefonat mit der "Heimat" erfuhr ich, daß ich spätestens 1995 zu gehen hatte - altes Eisen wirft man auf den Schrott - und so kostete ich "das letzte Mal" so richtig aus.
Heute noch bekomme ich hin und wieder Post von den Singapore Airlines. Mußte ich doch aus Kostengründen und auf Weisung von Herrn Dr. R., Direktor für Meßtechnik, Hagenuk GmbH Kiel, einen „Billigflieger“ nehmen. Nie habe ich vorher und nachher einen besseren Service kennengelernt, nicht mal bei der stolzen Lufthansa.
Meine 2. Heimat in diesen Jahren meines ersten Berufslebens ist Jugoslawien geworden. Das hatte ganz konkrete Ursachen: Mit der „Bunten Kuh“ Barkas B1000 (FOF 101) und mit dem Fiat 75 NC (FOF 111) bin ich mehr als 50.000 km durch die SFRJ selbst gefahren oder im Fiat gefahren worden (Wo. Schü. und Eb. Gl.).
In MonteNegro, wo ich wohl am häufigsten war, habe ich das gute Saufen, in Serbien das gute Essen, in Kroatien die wunderschöne blaue Adria und in Slowenien die Kultur und Technik kennengelernt. In Bosnien die Gold- und Silberbasare, aber da war ich recht selten.
In Mazedonien die Gastfreundschaft und in Bora Maksimovi? aus Belgrad einen wahren Freund, obwohl er 12 Jahre älter war, als ich und schon im April 1989 mit 63 Jahren an Krebs starb. Einen Tag vor seinem Tod habe ich noch privat mit ihm telefoniert, verbotenerweise natürlich.





























