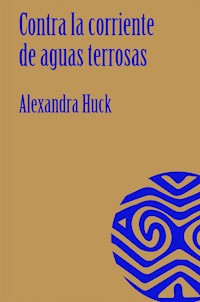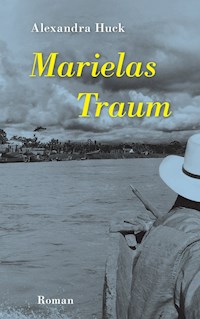
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Eher fließt das Wasser flussaufwärts, als dass ein Vertriebener sein Land zurückbekommt - oder dass ein General für seine Verbrechen ins Gefängnis geht“, sagt der alte Eugenio, Marielas Vater. Marielas Traum spielt überwiegend in Kolumbien und ist über weite Strecken wie ein Polit-Thriller erzählt. Eine spannungsvolle Geschichte über Menschen, die nicht nur für ihr Stück Land kämpfen, sondern auch für Gerechtigkeit. Mariela und die Menschen in ihrem Dorf stehen einer erdrückenden Übermacht gegenüber. Doch sie sind entschlossen, den Kampf um ihr Land aufzunehmen. Mariela wächst an den Ufern des Chitandó auf, wo ihre Eltern im kolumbianischen Dschungel ein Stück Land urbar gemacht haben. Immer weiter dringen indes Paramilitärs in die Region vor. Sie haben auch Marielas Vettern Jhon und Alexis im Visier. Brutal vertreiben die bewaffneten Männer die Menschen aus Marielas Dorf. Und Oberst Montenegro und sein Verbündeter Héctor setzen alles daran, dass die Dorfbewohner niemals an den Chitandó zurückkehren. Doch Mariela und die Ihren sind nicht allein. Der erfahrene Anwalt Felipe hilft ihnen, ihr Recht auf das Land am Chitandó einzuklagen. Felipe will die Verantwortlichen für Mord und Vertreibung vor Gericht bringen - und fordert damit mächtige Interessen heraus. Wie gefährlich das ist, lernt schnell auch die junge Deutsche Beata. Sie war eigentlich nur für ein Praktikum bei Felipe und seinen Kollegen nach Kolumbien gekommen. Aber die Menschen vom Chitandó wachsen Beata ans Herz, und ihr wird klar, dass die Plantagen, die auf dem geraubten L and angelegt werden, auch für den europäischen Markt produzieren werden. Der Roman erzählt nicht nur die Geschichte von Marielas persönlichem Kampf für Gerechtigkeit sondern auch davon, wie Menschen inmitten des bewaffneten Konfliktes in Kolumbien die Hoffnung aufrecht erhalten. Nicht nur Mariela, sondern viele Kleinbäuer_innen weltweit sind von „Landgrabbing“ betroffen und in ihrer Existenz bedroht. (weitere Informationen auf www.alexandrahuck.de) Der Roman ist von realen Ereignissen in Kolumbien (und der Welt) inspiriert und könnte so ähnlich wirklich passiert sein. Alle Personen sowie manche Orte sind jedoch rein fiktiv; sollten den-noch Ähnlichkeiten mit realen Personen bestehen, so wäre dies Zufall.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 704
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Roman:
„Eher fließt das Wasser flussaufwärts, als dass ein Vertriebener sein Land zurückbekommt - oder dass ein General für seine Verbrechen ins Gefängnis geht“, sagt der alte Eugenio, Marielas Vater.
Marielas Traum spielt überwiegend in Kolumbien und ist über weite Strecken wie ein Polit-Thriller erzählt. Eine spannungsvolle Geschichte über Menschen, die nicht nur für ihr Stück Land kämpfen, sondern auch für Gerechtigkeit.
Der Roman ist von realen Ereignissen in Kolumbien (und der Welt) inspiriert und könnte so ähnlich wirklich passiert sein. Alle Personen sowie manche Orte sind jedoch rein fiktiv; sollten dennoch Ähnlichkeiten mit realen Personen bestehen, so wäre dies Zufall.
Die Autorin:
Alexandra Huck wurde 1969 in Baden-Württemberg geboren und hat Politikwissenschaft, Romanistik und Volkswirtschaftslehre studiert. In Kolumbien war sie 1999 zum ersten Mal und ist seither vielfach dorthin gereist, u.a. zu Recherchen für diesen Roman. Sie lebt und arbeitet seit Jahren in Berlin und hat in dieser Zeit verschiedentlich Sachtexte zu Kolumbien verfasst. Mit Marielas Traum legt sie ihren ersten Roman vor.
Weitere Informationen unter: www.alexandrahuck.de
Für die Gemeinden von CAVIDA im Flussbecken des Cacarica (Chocó, Kolumbien), die mich viel über das Leben im Chocó und noch mehr über die Hoffnung gelehrt haben.
Mit einem herzlichen Dank an alle, die mich unterstützt und damit diesen Roman möglich gemacht haben, ganz besonders Christiane, Tine, Andreas, John und Roland.
»Kaufen Sie Land. Es wird keines mehr gemacht.«
Mark Twain
»Hoffung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.«
Václav Havel
Ein Glossar und einige Hinweise zur Aussprache der spanischen Namen finden sich am Ende des Buches.
Mariela sah ihrer Mutter aufmerksam zu, wie sie die Habseligkeiten im schwachen Schein der nackten Glühbirne zusammenpackte. Mariela war aufgeregt, doch sie drückte ihre kleine Schwester Anna an sich, die Mama immer wieder zwischen den Beinen herumlaufen wollte und beim Packen störte.
Mama faltete die Kleidchen von Anna und Mariela sorgfältig in die große Tasche zu ihren eigenen Kleidern. Sie legte für die beiden Mädchen das grün-geblümte und das blaue Kleid zur Seite.
„Für die Fahrt morgen“, sagte sie und sah dabei kurz zu den beiden hinüber, die zusammen auf einem grob aus Holz gezimmerten Stuhl saßen. Mamas schwarze Haut glänzte matt im Schein der Glühbirne.
„Ist es weit, wo wir morgen hinfahren?“, fragte Mariela.
„Ja, wir fahren den ganzen Tag in einem Boot.“
Mariela erklärte der kleinen Schwester genauer, worum es ging.
„Siehst du Anna, es ist eine ganz weite Reise. Wir fahren morgens ganz früh los.“ Anna sah sie mit großen Augen an.
„Die Fahrt dauert so lange, dass wir nicht vor dem Abendessen zurückkommen“, versuchte Mariela, die Länge der Reise zu erklären.
„Nein Mariela, was redest du? Ich habe es dir doch schon gesagt: wir kommen nicht zurück, wir bleiben dort. Papa hat uns dort schon eine Hütte gebaut. Wir werden am Chitandó wohnen.“
„Chi – taa – nndó“, beförderte Anna jede der Silben mit einem konzentrierten Kopfnicken in den Raum und drehte dabei mit den Händchen in den krausen Zöpfen.
Aus dem schiefen Holzschränkchen, dessen Tür von zwei rostigen Nägeln zusammengehalten wurde, nahm die Mutter mit energischen Bewegungen die restliche Kleidung heraus und legte sie in die Tasche. Marielas Blick streifte weiter zum verblichenen Blumenmuster des Lakens auf dem Bett der Eltern. Die Mutter wusch es regelmäßig mit ihren großen schwarzen Händen am Fluss mit der Bürste und einem großen Stück blauer Seife. Vor dem Bett der Eltern hatte sich am Boden eines der Holzbretter nach unten gebogen. In die Lücke zum nächsten Brett kullerten oft Marielas Glasmurmeln, wenn sie sie nicht schnell genug auffing. Seit Jhon Jairo weg war, half ihr niemand mehr, die Murmeln dort wieder herauszufischen. Die Murmel, die gestern dort hineingefallen war, war verloren. Sie würden morgen Abend nicht zurückkommen. Das konnte sich Mariela nicht vorstellen. Ihr ganzes Leben hatte sie hier verbracht, hatte sich im erdigen Geruch der Hütte nachts neben Anna ins Bett gekuschelt und den frischen Duft der Laken nach Seife eingesogen.
Papa war in den letzten Monaten meist weg gewesen, dort am Chi - tan - dó, von dem er erzählte, wenn er selten für ein paar Tage zu Besuch kam. Papas Bruder, Onkel Pacho, der Vater von Jhon Jairo, hatte ihnen von dem fruchtbaren Land dort vorgeschwärmt. Dann hatten sich die Eltern nachts, wenn Anna und Mariela schon im Bett lagen, beraten. Sie sprachen von Nachbarn, die aufgebrochen waren, um dort im Dschungel ein Stück Land zu bewirtschaften. Eines Tages war Papa hingefahren, um sich alles anzusehen. Morgen würden sie alle dort sein. Mariela versuchte sich das auszumalen. Doch sie kannte nur El Carmen und ihre direkte Nachbarschaft in der Hafenstadt. Im Traum hatte sie ein großes Zimmer gesehen, von dem aus eine Tür ins Freie führte. Direkt vor der Tür standen Bäume und dichtes Blattwerk, die ins Zimmer hineinragten. Papa hatte erzählt, dass die Pflanzen am Chitandó so üppig wuchsen, dass es schwer war, sie zurückzudrängen.
„Du träumst schon mit offenen Augen. Ihr beide müsst jetzt schlafen gehen. Morgen stehen wir früh auf“, befahl die Mutter streng.
„Ist es weit von dort bis zur Schule?“, wollte Mariela wissen.
„Ja“, seufzte die Mutter. „Eine ganze Tagesreise.“
Mariela zögerte.
„Wie soll ich dann im Januar zur Schule gehen?“
„Du gehst zur Schule. Aber noch nicht im Januar. Erst muss dort eine Schule gebaut werden. Du wirst noch früh genug anfangen!“, lächelte die Mutter ihr zu.
Mariela war enttäuscht. Sie hatte sich so sehr auf die Schule gefreut! Zusammen mit ihrer Freundin Pepita hatte sie sich ausgemalt, wie sie dort den ganzen Tag mit bunten Stiften malen und schreiben üben und sich bunte Bilder in Büchern ansehen würden.
Vorn am Eingang war das Knarren der Holztür zu hören. Papa kam ins Zimmer. Er trug einen vollen Sack.
„Dein Essen steht drüben auf dem Tisch“, begrüßte die Mutter ihn. „Ich bin gleich fertig. Dann schlafen wir ein paar Stunden. Alles andere packe ich in der Früh zusammen.“
Der Vater sah Mariela und Anna an.
„Und diese beiden Damen hier? Warum sind die nicht schon längst im Bett?“
Hinter seiner strengen, müden Miene wollte ein Lächeln hervordrängen.
„Wir helfen Mama!“, rief Mariela.
„So, so“, lachte Papa jetzt. Dann nahm er Mariela unter den einen und Anna unter den anderen Arm. Beide kicherten und strampelten. Nebenan ließ er sie auf ihr Bett fallen und zog ihnen die Schuhe aus. Mariela und Anna schlüpften aus ihren Kleidern, dann legten sie sich zusammen unter das Laken.
„Wie heißt das Dorf, wo wir hinziehen?“, wollte Mariela vor dem Einschlafen wissen.
„Es gibt noch keinen Namen, es gibt auch noch kein Dorf. Jetzt schlaft aber schnell!“
Als Papa die Tür zuzog, wurde es ganz dunkel. Nebenan hörte Mariela die Stimme der Mutter. Anna schlief schon ganz tief. Mariela wollte über das nachdenken, was Papa gesagt hatte. Bevor sie dazu kam, war sie schon eingeschlafen.
Mama weckte sie in der Nacht. Es war dunkel in der Hütte. Mama gab ihnen die Kleidchen und stellte ihnen die nagelneuen, schwarz glänzenden Gummistiefel hin.
„Zieht euch an! Mariela, hilf deiner Schwester! Wir müssen bald los.“
Mama schien in Eile zu sein. Sie klapperte in der Küche mit den Töpfen und Tellern, die sie in einen der braunen Säcke steckte. Die Matratze der Eltern stand schon aufgerollt und fest verschnürt neben der Eingangstür.
Schlaftrunken schlüpfe Mariela in ihr Kleid und half Anna, die sie immer wieder wachrütteln musste. Papa kam zur Tür herein. Er nahm die Matratze auf seine Schulter verschwand damit. Mariela erkannte im schwachen Licht, dass die Hütte fast ganz leer geräumt war. Braune Säcke und die schwarze Tasche standen an der Wand. Als Papa wiederkam, nahmen Mama und er die Tasche und die Säcke. Alle zusammen gingen sie los zum Hafen. Mariela musste Anna an der Hand nehmen. Mama stöhnte und musste ihre Last immer wieder absetzen. Mariela zog mühsam die müde Anna hinter sich her. Es war dunkel und still. Die Straßen waren menschenleer. Mariela fröstelte in ihrem Kleidchen. Sie war müde, aber sehr aufgeregt.
Am Gestank nach fauligem Wasser konnten sie den Hafen erahnen, lange bevor sie ihn erreichten. Papa führte sie an den dunklen Umrissen großer Kähne vorbei, deren Aufbauten hoch aufragten. Vor einem kleineren Kahn blieb er stehen und pfiff leise. Der weiß lackierte Bootsrand schimmerte in der Dunkelheit. Hinter der weißen Kante tauchte das dunkle Gesicht eines ernst blickenden Mannes auf. Papa begrüßte ihn und reichte ihm das Gepäck, das Stück für Stück im Kahn verschwand. Papa gab Mama die Hand. Sie setzte einen Fuß auf das Boot, das sich schwankend vor ihr zurückzog. Sie stolperte zurück auf die Hafenmauer. Sie stemmte sich erneut nach oben und verschwand ebenfalls hinter dem weiß gestrichenen Rand im Inneren des Bootes. Papa hob Mariela hoch, und sie landete in den Armen des ernsten Mannes, der sie neben Mama absetzte. Das Boot wankte. Mariela fiel um. Dann standen Anna und Papa neben ihr im großen weiten Bauch des Kahns.
„Es ist soweit, jetzt lernt ihr bald euer neues Zuhause kennen“, sagte Papa stolz.
„Hoffentlich ist es so schön, wie du versprochen hast. Wenn nicht ...“, lächelte Mama und hob ihre Hand drohend.
Papa wirkte ernst und feierlich.
„Es ist gutes Land. Die Mücken werden euch zusetzen, aber wir können schon bald unseren eigenen Reis ernten. Ich habe ein großes Feld angelegt. Du hast es nicht weit bis zum Fluss, um die Wäsche zu waschen. Wir brauchen niemanden um Beschäftigung oder Lohn anzubetteln. Von unserer Hände Arbeit können wir dort gut leben.“
Mariela konnte im Bauch des Kahns die dunklen Umrisse von Gepäckstücken, von Taschen, Säcken und kleinen Möbelstücken erkennen. Irgendwo gackerte ein Huhn. Es kamen noch andere Passagiere. Sie ließen sich auf den vielen Säcken und Kisten nieder. Ganz vorne im Boot schimmerten die Gesichter von zwei hellhäutigen Frauen im ersten Licht der Dämmerung. Die schwarze Haut von Marielas Eltern hingegen verschmolz noch immer fast ganz mit der Dunkelheit.
Einer der Männer ging nach hinten und zog ein paar mal schnell an einer Schnur. Motorenlärm durchbrach die nächtliche Stille. Eine Leine flog vorne von der Hafenmauer herüber. Ein Junge sprang der Leine hinterher ins Boot. Langsam bewegte sich der Kahn vorwärts. Die Eltern setzten sich auf ihre zusammengerollte Matratze. Mama zog Anna zu sich und Mariela setzte sich auf Papas Schoß.
„Kommen keine anderen Kinder mit?“, fragte Mariela ihn.
„Nein, aber Alexis und Jhon Jairo sind schon am Chitandó. Und weiter unten am Fluss, da wohnt eine Familie mit zwei Jungs und einem ganz kleinen Mädchen.“
„Alexis und Jhon Jairo“, seufzte Mariela zufrieden und erinnerte sich an die beiden Vettern. Jhon Jairo hatte sie durch die Luft gewirbelt, es hatte in ihrem Bauch gekribbelt und sie hatte vor Vergnügen geschrien. Sie lehnte sich an die Brust des Vaters und schloss die Augen.
Das Brummen des Bootsmotors begleitete Mariela durch ihre Träume. Als sie wieder aufwachte, war es schon hell geworden, aber die Sonne verbarg sich noch hinter Wolken. Mariela richtete sich auf und sah über den Bootsrand. Rechts und links zog das üppige Grün von Arracacho- und Bijaoblättern vorbei, die mannshoch aus dem Wasser ragten. Dahinter rückten die bläulichen Umrisse von Bergen näher und verloren sich wieder im Dunst. Mariela wollte nichts verpassen. Leicht wankend schob sich das Boot gegen die Strömung des breiten braunen Flusses von einer Biegung zur nächsten. Doch kaum hatte Mariela sich ein wenig umgesehen, wurde ihr Kopf schwer. Sie sank zurück auf die schwarze Stofftasche, in die Mama gestern Abend die Kleider gepackt hatte. Ihre Augen fielen wieder zu.
Erst als die Sonne durch die Wolken stieß und auf ihrer Haut brannte, wachte Mariela auf. Mama wickelte ihr ein weißes Tuch um den Kopf, um sie vor der Sonne zu schützen. Anna lag schlafend unter einem gelben Handtuch neben Mama.
Mama reichte Mariela einen kleinen Blechtopf mit Reis. Sie aß gierig ein paar Löffel.
Dann stellte sie sich so auf die Matratze, dass sie über den Bootsrand sehen konnte. Am Ufer zog noch immer behäbig das dichte Grün vorbei, doch jetzt fuhr der Kahn in einem Bogen in einen schmaleren Fluss hinein. Papa stellte sich neben sie.
„Das ist schon der Chitandó. Aber es wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir ankommen“, sagte er.
Die Bugwelle des Bootes lief über das blau schimmernde Wasser hinüber zu den Bijaoblättern, die hellgrün in der Sonne leuchteten und sich schwankend vor Mariela zu verbeugen schienen, wenn die Welle sie erreichte. So weit Mariela blicken konnte, sah sie rechts und links nur dieses dichte Grün aus dem Wasser ragen. Große weiße Vögel flogen aufgeschreckt hoch. Mariela blieb so stehen, bis sie zwischen den anderen Pflanzen erste Bäume sehen konnte, die ebenfalls im Wasser zu stehen schienen. Papa zeigte ihr Affen, die in den Ästen hingen. Mariela betrachtete sie staunend. Lange fuhren sie so, bevor ein schmaler Streifen Ufer den Fluss an den Seiten begrenzte. Unter Bäumen wuchs jetzt grünes Dickicht auf dunkelbrauner Erde. Der Fluss wurde immer schmaler. Mariela hätte fast zum Ufer hinüber springen können.
Anna wachte auf und stellte sich neben sie. Mama kam dazu. Alle beobachteten gespannt die vorbeiziehende Landschaft. Manchmal schien es, als könnte der Kahn nicht mehr weiter durch die immer engeren Flusswindungen kommen, doch der Bootsführer lenkte ihn geschickt.
„Dort steigen wir aus“, sagte Papa endlich. Er zeigte auf einen kleinen Hügel, der vor ihnen lag. „Heute kommen wir nicht mehr weiter. Hier gibt es einen Unterschlupf mit einem Dach aus Palmblättern, wo wir die Nacht verbringen können. Onkel Pacho wird uns morgen mit einem kleineren Boot abholen. Heute erreicht ihn die Nachricht von unserer Ankunft nicht mehr.“
***
„Los, aufstehen!“
Anna stieß Mariela in die Seite. Mariela öffnete die Augen, hob den Kopf und lauschte. Sie schaute durch den feinen Stoff des Moskitonetzes ins Halbdunkel. Durch die Bretterwand hörte sie, wie Mama einen Deckel auf einen Blechtopf setzte.
„Nein, noch nicht! Draußen sind noch so viele Mücken.“ Mariela kratzte sich an den Beinen, die von roten Stichen übersät waren.
„Ich stehe auf“, sagte Anna trotzig.
„Nein, das darfst du nicht. Wenn du das Moskitonetz hochhebst, dann kommen die Mücken alle zu mir hier herein!“
„Ich muss aber pinkeln.“
„Jetzt nicht. Später gehen die Mücken weg.“
„Die gehen nicht weg. Gestern waren sie den ganzen Tag da. Und ich muss jetzt sofort.“
Anna fing leise an zu weinen. Mariela wurde weich.
„Ist gut, dann gehst du eben. Aber du musst ganz vorsichtig hinausschlüpfen, hörst du?“
Ungelenk zog Anna das Moskitonetz hoch. Der Saum verfing sich in ihren schwarzen Zöpfen. Mariela griff danach und stopfte ihn hastig zurück unter die Matratze. Anna trippelte im Halbdunkel davon und rief nach Mama. Mariela legte sich wieder hin und kratzte an ihrem Bein. Die Stiche brannten. Sie wollte weinen. Vielleicht konnte sie einfach den ganzen Tag hier unter dem Moskitonetz bleiben. Dann würde sie nicht immer weiter gestochen werden. Papa hatte versprochen, dass die Mücken weniger würden, wenn er die Blätter und das Gras rund um ihre Hütte mit der Machete ganz kurz schnitt. Doch erst musste er das Unkraut zwischen den Bananenstauden säubern, das war wichtiger, hatte er ihr erklärt. Jetzt, wo sie wach lag, musste Mariela ganz dringend pinkeln, doch sie wollte versuchen, so lange wie möglich unter dem Moskitonetz zu bleiben. Sie hörte, wie Mama mit Anna zurückkam.
„Mariela, steh auf! Ich koche euch Schokolade.“
Sie blieb stumm. Draußen zirpten die Grillen, ein Vogel stieß einen hellen, eigentümlichen Ruf aus. Sie lauschte. Ganz in der Ferne konnte Mariela Stimmen hören, die allmählich näher kamen. Ein Mann und die hellere Stimme eines Jungen. Sie verstand. Sie riss das Moskitonetz zur Seite und stolperte hastig ins Freie. Draußen war es sehr hell, sie musste blinzeln, bevor sie etwas sehen konnte. Dann sah sie die drei Gestalten auf dem Pfad, der zum Haus führte.
„Jhooooon, Alexis!“, rief sie, stürzte die Holztreppen hinunter und rannte ihren Vettern auf dem Pfad entgegen, ohne auf die Mutter zu hören, die hinter ihr herrief. Atemlos fiel sie Jhon in die Arme. Er hob sie überschwänglich hoch.
„Du bist ganz verrückt“, schalt Onkel Pacho. „Du rennst barfuß herum, als würde es hier keine Schlangen geben. Wo sind deine Gummistiefel?“, fragte er und sah Mariela ernst an.
Sie drehte sich auf Jhon Jairos Arm um und versteckte sich hinter ihm. Sie sah in das Gesicht von Alexis.
„Sie hat sich eben gefreut“, lachte dieser.
„Freude hin oder her, ihr könnt hier nicht einfach so herumrennen. Jeden Moment kann eine Mapaná auf dem Weg liegen. Wenn sie dich mit ihren Giftzähnen erwischt ...!“, schnaubte der Onkel wütend.
Jhon Jairo trug Mariela den Weg zur Hütte zurück. Sie traten unter das Blätterdach in die ebenerdig gebaute Küche mit den halbhohen Bretterwänden. Anna sprang auf Alexis zu, der sie an den Händen fasste und im Kreis wirbelte.
„Wenn du noch einmal ohne Schuhe aus dem Haus rennst, dann schlage ich dich, hörst du?“, schimpfte Mama Mariela aus, die sich an Jhons Hals klammerte.
„Guten Morgen, Pacho! Ihr seid schon früh unterwegs“, begrüßte die Mutter dann den Onkel.
„Wir waren im Morgengrauen in der Lagune angeln.“
Der Onkel hob einen leuchtend grünen Bijao-Stengel hoch, an dem von oben bis unten Fische aufgereiht hingen.
„Ich dachte, ihr könnt ein paar gebrauchen.“
„Ganz bestimmt!“, freute sich Mama. „Ihr habt einen guten Fang gemacht.“
„An Fisch mangelt es hier nicht – man muss sich nur die Mühe machen, ihn zu fangen. Anders als in der Stadt, wo alles Geld kostet. Wo ist Eugenio?“, fragte er.
Mama deutete mit dem Kopf in Richtung Hügel.
„Er säubert das Feld mit den Kochbananen.“
„Ob ihr für uns ein paar Kochbananen übrig habt? Unser neues Feld trägt noch nicht.“
„Ja, natürlich, wir haben genug. Wir können keine Kochbananen mehr sehen. Es wird Zeit, dass der Reis zur Ernte reif wird. Und heute essen wir Fisch!“
Mama lachte und schnalzte mit der Zunge.
„Dort liegen welche, nimm so viel du brauchst“, deutete sie auf die grünen Bananen, die in einer Ecke lagen.
Sie reichte dem Onkel und den beiden Vettern je einen Becher heißen, dampfenden Kaffee. Dann nahm sie aus einem rußverschmierten Topf ein paar Stücke grauer, gekochter Bananen und gab Mariela und Anna je ein Schüsselchen davon. Mariela stach mit ihrem Löffel lustlos an den mehligen Stücken herum.
„Und, haben die Cousinchen denn schon schwimmen gelernt?“, fragte Jhon Jairo.
Marielas Herz schlug höher.
„Nein! Können wir das jetzt üben?“, rief sie.
„Ja!“, stimmte Anna begeistert ein. „Wir gehen jetzt zum Fluss!“
„Ihr esst erst auf“, befahl die Mutter. „Ist das nicht gefährlich?“, fragte sie den Onkel.
„Gefährlich ist es hier nur, nicht schwimmen zu können. Wer am Fluss lebt, der muss schwimmen können.“
Er ermahnte seine Söhne: „Ihr bleibt dort in der Einbuchtung. Draußen in der Strömung ist es zu gefährlich. Habt ihr gehört?“
Jhon und Alexis nickten.
Nachdem Mariela und Anna aufgegessen hatten, gingen sie los. Die beiden hatten sich seit Tagen nach Abwechslung gesehnt. Mama war ängstlich und ließ sie kaum ein paar Meter vor die Hütte gehen. Zu viert gingen sie den schmalen Pfad Richtung Fluss, hindurch zwischen Gras und großen Blättern, die nicht nur Mariela, sondern auch die Vettern weit überragten. Am liebsten wäre Mariela sofort das steile Ufer hinunter gerannt und hätte sich ins Wasser gestürzt, doch Jhon hielt ihre Hand ganz fest. In weitem Bogen war der Fluss einem mächtigen Baum ausgewichen, der seine Wurzeln bis tief zum Ufer hinunterstreckte. Jhon vergewisserte sich, dass unterhalb des Baumes keine starke Strömung war. Dann zog er Mariela vorsichtig zu sich ins Wasser und zeigte ihr, wie sie mit den Füssen strampeln sollte, während er ihre Hände hielt. Sie kniff den Mund zusammen, stützte sich fest auf die Hände ihres Vetters und strampelte so fest wie sie konnte. Das Wasser spritzte hoch auf. Ihre Beine wurden schnell schwer. Sie schluckte Wasser und hustete. Ihre Brust wollte platzen. Mariela bekam Angst. Jhon hob sie aus dem Wasser und klopfte ihr auf den Rücken. Langsam bekam sie wieder Luft. Sie keuchte erschöpft.
„Nicht schlecht“, sagte Jhon. „Ruh dich aus, jetzt übt Anna.“
Anna drückte sich am Ufer ängstlich an Alexis.
„Später“, piepste sie.
Jhon stellte Mariela am Ufer ab und hob dann Anna hoch.
„Nein“, kreischte sie.
Die beiden Jungen lachten.
Jhon ließ nur Annas Beine ins Wasser sinken. Als sie merkte, dass ihr Kopf in Sicherheit bleiben würde, fing sie an ihre Beine so zu bewegen, wie der Vetter es ihr erklärte. Als sie müde wurde, war Mariela wieder dran. Sie war jetzt schon geschickter und achtete darauf, kein Wasser mehr zu schlucken. Sie übten weiter, bis beide Mädchen völlig erschöpft waren. Mariela traute sich schon, ein paar Zentimeter alleine bis zu Jhon zu paddeln.
„Ihr müsst morgen wiederkommen, dann üben wir weiter!“, forderte Mariela, als sie auf dem Pfad zurück zur Hütte gingen.
„Das geht nicht, morgen müssen wir mit auf die Felder“, antwortete Alexis. „Aber wir kommen bestimmt bald wieder.“
Mariela gab sich mit der Antwort nur ungern zufrieden. Stolz berichteten die Mädchen abends Papa von ihren ersten Schwimmversuchen.
Die Vettern kamen danach häufiger zu Besuch. Bald kannten sie den Weg und kamen ohne den Onkel. Beide trugen schon eine kleine Machete am Gürtel, so wie die Männer. Mariela fragte die Eltern täglich, wann die Vettern das nächste Mal kämen. Schnell lernte sie, sich alleine über Wasser zu halten, und sogar Anna verlor ihre Scheu.
***
„Beeil dich Anna. Wir kommen zu spät“, drängelte Mariela.
Warum war ihre Schwester bloß immer noch nicht fertig? Mariela stand ungeduldig vor dem Haus. Sie band noch einmal die vielen dünnen Zöpfchen, die Anna ihr morgens geduldig geflochten hatte, mit einem Haargummi zusammen und zog ihre grüne Sporthose hoch. Anna kam zur Tür heraus. Gemächlich stieg sie in ihre schwarzen Gummistiefel und sprang die drei Holzstufen von der Veranda herunter.
„Na endlich!“, stöhnte Mariela, schwang sich ihren Beutel über die Schulter und ging los.
„Ich komme mit“, kam Tito aus der Küche gestürzt und heftete sich an ihre Fersen.
„Du bleibst hier, Brüderchen!“, drehte sich Anna zu Tito um. „Du kommst mit Mama nach. Wir können dich nicht mitnehmen, wir spielen Fußball.“
„Ich will zusehen“, quengelte der Kleine.
„Dann hilf Mama mit deinen Geschwistern, damit ihr fertig werdet, na los!“, Anna schubste ihn zurück zum Haus.
Mariela winkte ihrem Vater zu, der Holz hackte und zu ihnen herübersah.
„Viel Glück“, rief er ihnen nach.
Dann gingen sie endlich los. Mariela ging schnell voran. Der Pfad führte am Fluss entlang und lag im Schatten der hohen Bäume. Es war seit Jahren der Schulweg der Schwestern. Tagelang hatte es nicht geregnet, so dass sie nur selten durch Morast waten mussten. Doch an den sumpfigen Stellen reichte der Schlamm bis an den oberen Rand ihrer Stiefel.
„Was rennst du so? Wen möchtest du so dringend sehen?“, neckte Anna ihre Schwester.
„Wir kommen zu spät zum Spiel. Komm schon.“
„Die fangen nicht ohne uns an. Es ist wegen Manuel, nicht wahr? Oder wegen Ángel? Seid ihr verabredet?“
Mariela blieb abrupt stehen und drehte sich zu Anna um.
„Wenn du irgendjemandem etwas erzählst oder auch nur andeutest, dann sage ich dem ganzen Dorf und den Eltern, dass Edwin dein Freund ist, hörst du?“
„Das stimmt doch gar nicht“, empörte sich Anna.
„Das musst du erst einmal beweisen“, grinste Mariela. „Und wenn du dann ständig mit ihm tanzt, dann wird dir keiner glauben.“
Anna blieb mit offenem Mund stehen.
„Na komm schon. Du erzählst nichts und ich sage nichts. Papa verdrischt mich, wenn er glaubt, dass ich einen Freund habe, bevor ich mit der Schule fertig bin“, sagte Mariela.
„Ist Manuel dein Freund? Nun sag schon! Ich verrate nichts!“
„Wir werden sehen“, antwortete Mariela mit einem geheimnisvollen Lächeln.
Sie drehte sich um und fiel in einen schnellen Schritt. Bald erreichten sie die letzte Flussbiegung und balancierten über einen umgefallenen Baum, um ans andere Ufer zu kommen. Aus dem Schatten der Bäume traten sie in die brennende Sonne. Hoch spannte sich der wolkenlos blaue Himmel über dem Fußballfeld, dahinter lagen verstreut die braunen Holzhütten von Quebrada Azúl. Ein paar Mädchen kickten sich auf dem Feld schon den Ball zu. Mariela und Anna winkten ihnen im Vorbeigehen zu und gingen hinüber zu Alexis’ Haus.
Carmen saß in Sportkleidung auf der Veranda und stillte ihren Sohn. Daneben lehnte Ángel lässig im Schatten an der Hütte.
„Schau mal, wer auf dich wartet“, kicherte Anna halblaut.
„Ssst“, zischte Mariela zurück. Sie begrüßte Carmen und nickte Ángel verlegen zu.
„Na, so schüchtern“, frotzelte dieser mit einem herausfordernden Lächeln. „Das passt nicht zu der Stürmerin von Quebrada Azúl.“
„Bei unserem Spiel wird es jedenfalls mehr zu sehen geben als bei euch. Langweilig, was du als Linksaußen gegen Dos Bocas geboten hast. Null zu Zwei habt ihr verloren ...“, stichelte Mariela.
Sie zog spöttisch die Augenbrauen hoch und sah erst zu Ángel, dann zu Anna.
„Immerhin erinnerst du dich, dass ich links außen gespielt habe, freut mich“, grinste Ángel noch selbstsicherer.
„Weil der Ball ständig links ins Aus ging!“, entgegnete Mariela.
„Wenn du deine Angriffslust in Tore umsetzt, dann haben die Mädels aus Dos Bocas heute ein schweres Spiel“, lachte Alexis, der aus der Hütte getreten war. „Na, wie geht es meinen Cousinchen? Wo sind Onkel Eugenio und Tante Ligia?“
„Sie müssten bald da sein“, antwortete Anna.
Mariela wurde heiß, als sie Ángels Blick weiter auf sich spürte.
„Wir müssen los“, sagte Carmen und reichte Alexis den Kleinen. Sie knöpfte ihr Hemd zu und ging mit Mariela und Anna zum Fußballfeld.
Das Spiel begann kurz danach, obwohl die Sonne noch sehr hoch stand. Die Frauen und Mädchen aus Quebrada Azúl waren gut aufeinander eingespielt. Anna spielte Mariela die Bälle zu, und diese stürmte entschlossen los, an allen vorbei und schoss zwei Tore. Sie gewannen Drei zu Eins gegen Dos Bocas. Danach spielten die Männer. Mariela stellte sich am Spielfeldrand mit Carmen und Anna unter einen Baum. Kurz vor dem Anpfiff baute sich Ángel dicht vor Mariela auf.
„Heute schieße ich ein Tor für dich, und dann tanzt du die ganze Nacht nur mit mir!“, lachte er ihr zu und war schon wieder weg. Mariela verfolgte das Spiel gespannt. Sie klatschten und feuerten Alexis und Jhon Jairo mit ihren Rufen an. Insgeheim beobachtete Mariela jedoch genauso intensiv die Mannschaft aus Dos Bocas, vor allem einen Spieler, der sich meist weit hinten hielt. Hätte Anna sie nicht in die Seite gestoßen, dann hätte sie versehentlich losgejubelt, als er plötzlich mit dem Ball nach vorn stürmte und das erste Tor schoss.
„Uih, Manuel, erst ganz ruhig und dann – bumm!“, begrüßte sie ihn nach dem Spiel.
Er strahlte sie verlegen an.
„Bleibt ihr heute Abend zum Tanzen?“
„Na klar. Es ist Weihnachten, wir wollen feiern, dafür sind wir hergekommen. Und du?“
„Ich bleibe bis morgen hier bei meiner Tante. Wir sehen uns nachher“, rief er und rannte davon.
Mariela ging mit Anna zu Onkel Pacho und Tante Ernestina. Ihre Eltern waren mit den drei jüngeren Geschwistern schon dort. Aus einem riesigen Topf schöpften Ernestina und Mutter heißen Eintopf mit Maniok und Huhn. Während sie den Sancocho aßen, tauschten die Familien Neuigkeiten aus. Marielas Vater war kürzlich in El Carmen gewesen und hatte dreißig Bohlen Holz verkauft. Er hatte alte Freunde getroffen, mit denen er und der Onkel früher in den Bananenplantagen gearbeitet hatten.
„Rodolfo wohnt jetzt in El Carmen. Sein Bruder arbeitet immer noch bei Apartadó in den Bananenplantagen. Er sagt, dass die Gewalt dort schlimm wütet. Es kommen immer mehr Paramilitärs. Sie drohen und haben schon mindestens acht Gewerkschafter umgebracht. Die Paramilitärs behaupten, die Ermordeten seien Guerilleros gewesen. Die Paras seien gekommen, um die Region von diesem Übel zu säubern. Die Leute haben große Angst, selbst Rodolfo, der mit all diesen Angelegenheiten nichts zu tun hat. Der Lohn ist schlecht. Als die jüngste Tochter von Rodolfos Bruder krank war, musste er alles Geld für Medizin ausgegeben und sich auch noch bei seinen Freunden verschulden.“
„In der Stadt richtest du ohne Geld nichts aus“, nickte Onkel Pacho. „Das haben wir selbst lange genug erfahren. Hier hilft dir dein Nachbar aus. Ein paar Kochbananen hat immer jemand übrig. Ich bin froh, dass ich mich damals entschieden habe, hierher zu kommen, auch wenn die erste Zeit ziemlich hart war. Wie viel hast du für das Holz bekommen?“
„Jetzt vor Weihnachten, weil sie wissen, dass alle das Geld brauchen, drücken sie den Preis. Immerhin hat es für neue Kleider gereicht. Für Ligia habe ich ein paar Küken gekauft. Damit kann sie ihre Hühnerschar vergrößern, und dann essen wir jeden Tag Sancocho mit Huhn, nicht nur zu Weihnachten“, lachte der Vater und biss genüsslich in ein Hühnerbein.
„Kleider und Hühnchen! Und eine Schnapsflasche war etwa keine dabei?“, schnaubte die Mutter.
„Aber Ligia, es ist Weihnachten, und wir wollen ein wenig feiern“, zwinkerte Onkel Pacho ihr zu.
„Mach dir keine Sorgen, Ligia“, wandte Tante Ernestina ein. „Wir bleiben nicht durstig, dafür habe ich gesorgt.“
Ihr verschmitztes Lächeln steckte Marielas Mutter an.
„Es ist nicht richtig, wie die Händler jedes Jahr vor Weihnachten die Preise drücken“, warf Jhon Jairo ein. „Wir bräuchten so etwas wie eine Gewerkschaft, um das Holz zu einem guten Preis zu verkaufen“.
„Hinter den Händlern steht die Holzfirma, die hat alles in der Hand. Da sind wir machtlos“, antwortete der Vater mit einen hilflosen Achselzucken.
„Geschieht ihnen gerade recht, dass die Guerilla ihnen das Sägewerk angezündet hat“, freute sich Alexis.
„Was nützt das schon? Wenn die Holzfirma nicht wäre, dann könnten wir gar kein Holz verkaufen und hätten jetzt gar kein Geld und keine neuen Kleider.
„Aber wenn die Holzfirma nicht alles in die eigene Tasche stecken, sondern uns einen höheren Preis bezahlen würde, dann hätten wir mehr Geld!“, beharrte Jhon Jairo. „Schließlich machen wir die ganze Knochenarbeit. Wir fällen den Baum, sägen die Bohlen und bringen das Holz den weiten Weg bis nach El Carmen. Es ist unser Holz und unsere Arbeit. Doch wenn wir die Kosten für den Transport abziehen, dann bleibt viel zu wenig übrig.“
Mariela wurde unruhig. Vom Versammlungsraum in der Dorfmitte wehte die Musik herüber. Eilig sammelte sie die leeren Teller ein. Anna und Mariela verzogen sich mit einer Kerze in das Zimmer der Kinder, um ihre neuen Kleider anzuziehen. Als Mariela ihr strahlend weißes Kleid überzog, verflogen ihre Gedanken an die ernsten Gespräche. Eng schmiegte sich der weiche Stoff an ihren Körper. Kichernd ging sie abwechselnd mit Anna ein paar Schritte mit wiegenden Hüften vor dem Bett hin und her. Wenn sie doch nur schon zum Tanz hinüber gehen könnten! Mühsam bremsten die beiden ihre Ungeduld und setzten sich wieder zu den anderen.
„Einen tiefen Seufzer höre ich“, sagte Jhon Jairo leise, als sie sich neben ihm auf einen Hocker plumpsen ließ. „Wem gilt er? Einem kräftigen schwarzen Burschen mit geschickten Fußballerbeinen?“
Mariela merkte, wie die Eltern herüberlauschten.
„Es ist Weihnachten, und ich möchte gerne tanzen, das ist alles!“
Marielas Ungeduld wuchs, je länger die sehnsüchtigen Klänge der Vallenatomusik von der Dorfmitte herüberwehten. Endlich durften sie gemeinsam mit den Vettern losziehen.
„Kommt nicht so spät zurück, wir wollen auch noch tanzen“, rief ihnen Onkel Pacho nach, der mit ihren Eltern und den Kleinsten zurückblieb und dem Vater gerade die Schnapsflasche reichte.
Viele Nachbarn waren für das Weihnachtsfest, die Fußballspiele und den Tanz aus den umliegenden Dörfern herbeigekommen, und sogar aus El Carmen waren viele Besucher da. Als Mariela und Anna mit ihren Vettern in der Mitte des Dorfes ankamen, lehnten junge Männer in kleinen Gruppen an dem Holzgeländer, das die Tanzfläche einfasste. Sehnsüchtig schielten sie zu den Mädchen hinüber, trauten sich jedoch noch nicht, sie aufzufordern. Hoch über der Tanzfläche spannte sich das aus Palmblättern geflochtene Dach. Mariela stand mit Anna bei ihren Schulfreundinnen. Sie besahen gegenseitig ihre neuen Kleider. Mariela drehte sich für die anderen in ihrem engen Kleid, das die Rundungen ihres leicht fülligen Körpers betonte. Das leuchtende Weiß unterstrich den schwarzen Glanz ihrer Haut.
„Wir werden uns die Beine in den Bauch stehen, bevor sich die Jungs trauen, jemanden aufzufordern“, sagte Carolina so laut, dass die Jungs, die nur ein paar Meter weiter standen, es hören mussten. Die lachten nur. Marco reichte Ángel eine Schnapsflasche und der nahm einen großen Schluck.
„Komm“, zog Alexis Carmen auf die Tanzfläche, als eine Merengue erklang, und Jhon folgte ihm mit Erika. Ángel löste sich als erster aus der Gruppe der Jungen und steuerte auf Mariela zu. Er zog sie auf die Tanzfläche. Weitere Paare folgten. Mariela nahm es den Atem, als sie Ángels Körper so dicht an dem ihren spürte.
„Nur mit mir sollst du tanzen!“, flüsterte er ihr ins Ohr.
„Das hättest du gerne.“
Marielas Körper folgte Ángels sanftem Druck in eine Drehung. Am Ende des Musikstückes strömten die Paare von der Tanzfläche, und die Männer suchten sich neue Tanzpartnerinnen. Doch Ángel hielt Mariela fest und drückte sie noch enger an sich, als ein Vallenato erklang. Fast ohne sich von der Stelle zu bewegen, wiegten sich die Paare im Halbdunkel zum Rhythmus der Musik. Ángels Hüfte presste sich dicht an die Marielas. Ihr war heiß. Als die Musik endete, löste sie sich ungern von Ángel, doch Jhon Jairo zog sie fort.
„Wenigstens einmal musst du schon mit mir tanzen, bevor du dich den ganzen Abend an Ángel hängst“, lächelte er sie an.
Ángel schaute ihr nach. Mariela schmiegte sich zufrieden an ihren Cousin. Verschwommen nahm sie im Halbdunkel Annas versunkenen Gesichtsausdruck wahr, die Schläfe an Schläfe mit Edwin tanzte.
Mariela wiegte sich danach mit schnell wechselnden Tanzpartnern eng umschlungen im Rhythmus. Dann ging sie hinaus, um sich in der leichten Brise abzukühlen. Manuel stand bei den Jungs aus Dos Bocas. Er hatte sich den ganzen Abend noch nicht von dem Holzgeländer gelöst, an dem er lehnte. Ungeduldig wartete sie darauf, dass er sie aufforderte. Mit einer Freundin wollte sie zu den Jungs hinüberschlendern, doch als die gefühlsseligen Akkordeonklänge des nächsten Vallenato ertönten, schob Ángel sie erneut auf die Tanzfläche. Er drückte sie eng an sich und wollte sie nicht mehr weglassen. Die Musik und die Berührung Ángels waren heiß und prickelnd auf ihrer Haut. Doch am Ende des Liedes löste sie sich mit einem Lächeln von Ángel. Draußen ging sie schnurstracks auf Manuel zu.
„So, jetzt kannst du den Tanz bekommen, den ich dir versprochen habe“, sagte sie fordernd.
Strahlend führte Manuel sie zur Tanzfläche. Sie lehnte ihren Kopf an den seinen und fühlte durch die Kleidung seine harten Muskeln sowie die sanfte Ruhe, die von ihm ausging. Mariela fühlte sich im Rhythmus der Musik mit ihm vereint. Ángel näherte sich am Ende des Stücks, doch Manuel zog sie dichter an sich.
Mariela suchte nach einer Möglichkeit, irgendwo mit Manuel allein zu sein, doch sie fühlte die neugierigen Augen des Dorfes ständig auf sich. Schnapsflaschen machten die Runde. Die Menschen wurden fröhlicher und weniger wachsam. Spät nachts stahlen sich Mariela und Manuel davon und drängten sich dicht an die Holzbretter eines halbfertigen, leerstehenden Hauses. Aus der Dunkelheit des Waldes drang der helle Ruf eines Vogels herüber, Leuchtkäfer tanzten ihnen hell entgegen.
„Warum hast du mich nicht zum Tanzen aufgefordert?“, schmollte Mariela.
„Jetzt sind wir hier“, sagte Manuel und küsste sie vorsichtig.
„Die Eltern dürfen nichts merken. Ich muss erst die Schule fertig machen“, sagte Mariela. „Vielleicht werde ich dann Lehrerin.“
Manuel sah sie amüsiert an.
„Eine Lehrerin hier aus dem Dorf!“, lachte er. Dann wurde er ernst. „Das ist gut. Eine von uns Bauern als Lehrerin! Dann kannst du unsere Kinder unterrichten.“
„Unsere Kinder?“, fragte Mariela. Sie wollte antworten, doch Manuel legte fest seine Hand in ihren Nacken und küsste sie.
***
Der Schmerz kam wieder in einer heftigen Welle, und Mariela biss auf das Tuch, das Mama ihr hinhielt, um nicht laut zu schreien. Die Wehen wurden immer stärker und wollten sie zerreißen. Tante Ernestina, die schon vielen Kindern auf die Welt geholfen hatte, blickte sorgenvoll. Sie flüsterte mit Mama. „Liegt nicht richtig“, schnappte Mariela auf. Dann drehte Tante Ernestina Mariela auf die Seite.
Ein dunkler Schatten hatte sich in den letzten Stunden in Mariela ausgebreitet, während die Wehen stärker wurden, ohne dass das Kind herauskam. Als Tante Ernestina mit Mutter in der Ecke flüsterte, breitete sich der dunkle Schatten im ganzen Raum aus. Sie wünschte es wäre ein Arzt da und Schwestern mit weißen Häubchen würden ihr den Schweiß von der Stirn tupfen, so wie sie es einmal in einem Film gesehen hatte. Doch hier waren nur der Schmerz und die sorgenvollen Gesichter von Tante Ernestina und Mama. Und da war Annas Hand.
„Schaffe ich es?“, stieß Mariela hervor, bevor der Schmerz ihr wieder den Atem nahm.
„Wir schaffen es“, antwortete die Tante ruhig. „Du musst durchhalten.“
Mariela drehte den Kopf und sah in Annas erschrockenes Gesicht. Mariela klammerte sich fest an Annas Hand, als könnte der Tod sie nicht mitnehmen, wenn sie sich nur stark genug an ihr festhielt. Sie schrie laut in die nächste Welle des Schmerzes hinein, bis sie keine Kraft mehr hatte.
„Nicht aufgeben“, forderte die Tante sie auf. Doch Mariela wollte nur noch liegen und warten, dass alles aufhörte.
Anna drückte ihre Hand noch fester.
„Los Mariela, du musst das schaffen“, stieß sie hervor.
Mariela nahm alle Kraft zusammen und tat, was die Tante ihr sagte. Alles war Schmerz und Erschöpfung. Wenn sie aufgeben wollte, hörte sie Annas drängende Stimme an ihrem Ohr. Nach einer Ewigkeit hielt Tante Ernestina einen winzig-zarten, blutverschmierten Körper in ihren Händen. Sie hatte es geschafft.
Der Schatten holte Mariela in den nächsten Wochen oft ein. Doch es blieb kaum Zeit, sich damit aufzuhalten. Die kleine Anita, deren hellbraune Haut täglich dunkler wurde, streckte unbeholfen ihre kleinen Hände nach ihr aus und musste gestillt und gewaschen werden. Manuel sehnte sich danach, dass sie mit Anita zu ihm nach Dos Bocas kam. Doch vorerst war sie zu schwach, um sich und ihr Kind ohne Annas Hilfe zu versorgen.
Manuel hatte sie begleitet, als sie den Eltern erzählte, dass sie schwanger war. Beide hatten Angst vor diesem Gespräch. Als Papa sie anbrüllte, blieb Manuel ruhig.
„Ich habe zwei Hektar Land gerodet, um Mais zu säen. Mein Vater und meine Brüder werden mir helfen, ein Haus für uns zu bauen. Ich werde für Mariela sorgen. Früher oder später hätten wir sowieso Kinder bekommen. Mariela ist fast achtzehn“, antwortete Manuel ganz ruhig.
„Früher oder später!“, brüllte der Vater weiter. „Und die Schule? Warum konntest du nicht so lange warten?“
Er sah Mariela verächtlich an. Sie hielt seinen Blick nicht aus.
„Eugenio“, sagte die Mutter. „Jetzt beruhige dich. Hör Manuel zu. Du kannst froh sein, dass er hier sitzt und seine Verantwortung übernimmt. Konnte ich denn die Schule fertig machen, bevor du mich geschwängert hast? Ich war fünfzehn und hatte gerade die dritte Klasse geschafft.“
Mariela wollte hinzufügen, dass fast alle Mädchen, die mit ihr die Schule besucht hatten, schon lange Kinder hatten. Doch keine davon war je wieder in der Schule aufgetaucht. Sie schwieg.
Ihr Vater fühlte sich in die Enge getrieben.
„Die Zeiten ändern sich“, brummte er. „Deshalb will ich, dass meine Kinder die Schule abschließen. Dafür habe ich dieses Land mit der Machete bearbeitet. Wie oft bin ich mit Pacho nach El Carmen gefahren, bis sie uns endlich die Schule bewilligt haben? Hast du nicht gesagt, dein Traum ist, Lehrerin zu werden?“, herrschte er Mariela an. „Eine von uns, hier aus dem Dorf, als Lehrerin. Und jetzt? Wovon wollt ihr leben?“
„Das hat Manuel schon gesagt, Papa. Er hat ein Feld vorbereitet. Wir säen, erst Mais und im April Reis. Dafür brauche ich kein Abitur, genauso wenig wie du. Ich mache die Schule später fertig.“
„Natürlich, vieles geht ohne Abitur. Aber ich habe gesehen, wie die Händler die Leute betrügen, wenn sie nichts von Zahlen verstehen, und wie die Ämter uns weggeschickt haben, weil wir nichts wussten und uns nicht wehren können.“
„Du hast ja recht. Ich mache die Schule fertig. Ich nehme das Kind mit in den Unterricht“, hielt Mariela entgegen.
Mama schüttelte den Kopf.
„So einfach ist das nicht, Mariela. Kochen, die Wäsche, die Felder und dann das kleine Kind dazu.“
„Ich helfe dir“, warf Anna ein.
„Ich kümmere mich um das Haus und die Felder“, erklärte Manuel. „Mariela geht während der Schwangerschaft weiter in die Schule. Wenn das Kind ein bisschen größer ist, dann kümmert sich meine Mutter darum.“
„Ihr werdet euch wundern, wie es ist, auf eigenen Beinen stehen zu müssen“, antwortete der Vater mürrisch. „Doch es ist nun, wie es ist.“
Mariela wurde ärgerlich. Warum trauten die Eltern ihnen so wenig zu?
„Habe ich nicht die ganze Zeit schon Wäsche gewaschen, gekocht und auf die Geschwister aufgepasst? Oder hat Manuel noch nie mit seinem Vater auf den Feldern gearbeitet?“
„Ist ja gut. Mir ist Manuel willkommen in der Familie“, sagte Mama versöhnlich.
„Also dann“, knurrte der Vater und reichte Manuel die Hand.
Nur langsam erholte sich Mariela nach der Geburt. Sie half Anna beim Waschen am Fluss oder der Mutter beim Kochen. Nach drei Monaten war sie stark genug, um zu Manuel in das kleine Haus nach Dos Bocas überzusiedeln. Mama gab ihr zwei von ihren alten, zerbeulten Töpfen mit. Manuel schulterte ihre Sachen und trug Anita. Mariela selbst trug nur eine kleine Tasche. Anna begleitete sie. Sie setzte sich einen kleinen Sack Reis auf den Kopf. Bis zum Fluss hinunter rannte Tito ihnen nach. Mariela winkte ihm zum Abschied von der anderen Seite des Flusses. Seine Anhänglichkeit machte ihr den Abschied noch schwerer. Ein Fußweg von zwei Stunden würde sie künftig von der Familie trennen. Sie freute sich darauf, endlich mit Manuel zusammen zu leben, doch Dos Bocas war ihr fremd. Das Haus ihrer Eltern und Quebrada Azúl, das war das Land, auf dem sie aufgewachsen war.
Der Marsch durch den dichten Dschungel war beschwerlich. Oft versanken Marielas Stiefel im Morast. Sie war bald erschöpft. Wenn sie stehenblieben um auszuruhen, fielen die Mücken unerbittlich über sie her. Als sie ankamen, ließ Mariela sich kraftlos auf eine Holzbank fallen. Sie lehnte sich mit dem Rücken an die Bretterwand ihres neuen Zuhauses. Während sie Anita stillte, sah sie sich um. Das Haus war am Rande des Dorfes gebaut. Auf Pfählen erhob sich der Bretterboden, der Platz für zwei Zimmer und eine Küche bot. Es standen schon die Pfosten, die das Dach trugen und die Zimmer abtrennten, doch nur ein Zimmer war bisher von Bretterwänden umschlossen.
Manuel schloss das kleine Vorhängeschloss an der Tür des Zimmers auf und brachte ihre Sachen hinein. An der äußersten Ecke, gegenüber von dem künftigen, zweiten Zimmer, war auf dünnen Pfosten mit Brettern eine viereckige Fläche gebaut.
„Den Herd musst du selbst machen. Ihr Frauen wisst am besten, wie er sein soll“, sagte Manuel, der ihrem Blick gefolgt war. „Der Lehm liegt schon bereit“, zeigte er auf einen Haufen neben dem Haus.
„Ich kann das machen“, bot sich Anna an. „Und du ruhst noch etwas aus.“
Manuel ging los, um Feuerholz zu holen. Mariela legte Anita ins Zimmer unter das Moskitonetz. Dann half sie Anna, mit Lehm den Herd zu formen. Anna arbeitete ernst und konzentriert.
„Du brauchst nicht so traurig zu schauen. Du kannst mich hier immer besuchen“, wollte Mariela sie aufmuntern.
Anna versuchte zu lächeln.
Mariela war in den letzten Wochen so sehr mit Anita beschäftigt gewesen, dass sie nicht wusste, was in ihrer Schwester vorging.
„Was ist mit dir und Edwin?“, fragte sie.
Anna grub ihre Finger tief in den Lehm.
„Nichts“, antwortete sie und schien im Lehm verschwinden zu wollen. „Ich habe ihm gesagt, dass wir nicht zusammen passen. Jetzt schleicht er um Maira herum. Ich glaube ja, dass sie schon schwanger ist.“
„Von ihm? Wann hast du ihn weggeschickt? Bist du schwanger?“
Anna lachte steif.
„Ich bin ganz sicher nicht schwanger. Maira ist so komisch und spielt nicht mehr Fußball. Es hat sie schnell erwischt.“
„Und warum hast du Edwin weggeschickt?“
Anna fing leise an zu weinen.
„Er war so fordernd. Als ich Manuel gesehen habe, wie er sich um dich gesorgt hat und Vater ganz ruhig von dem Maisfeld erzählt hat ... So etwas würde Edwin niemals machen, er denkt nur an sich“, schluchzte sie. „Aber dass er sich sofort an Maira rangemacht hat!“
„Das zeigt, dass du recht gehabt hast!“
Mariela hatte ihrer Schwester nie gesagt, dass sie Edwin nicht mochte. Annas Entschluss überraschte und erleichterte sie.
„Dieser Luis, der kürzlich hier nach Dos Bocas gezogen ist, der hat nichts mit deinem Entschluss zu tun?“
Anna hörte auf zu weinen.
„Ich kenne ihn kaum“, raunte sie und wandte ihren Blick ab.
„Sei ehrlich!“, drängte Mariela.
„Ach, was weiß ich!“, seufzte Anna. Ihr Gesicht heiterte sich auf.
„Also ja. Warum trauerst du Edwin dann hinterher?“
„Findest du das richtig, dass er sich sofort an Maira heranmacht? Als wäre ich austauschbar!“
„Du interessierst dich doch selbst für jemand anderen.“
„Ja schon ...“, Anna ruderte mit der Hand in der Luft und suchte nach einer Erklärung.
Mariela grinste. Anna wurde angesteckt, während ihr noch Tränen in den Augen standen.
„Ich verstehe. Du kannst mich hier oft besuchen. Vielleicht ergibt sich die eine oder andere Begegnung mit Luis ...“
Anna wischte die letzten Tränen weg, als sie Manuel zurückkommen sah. Manuel spürte ihre vertraute Stimmung. Er sagte nichts und ging neben die Hütte, um dort Holz zu hacken. Danach setzte er sich zu ihnen. Sie wickelten die mitgebrachten Tamales auf und aßen die würzige Masse aus Reis und Hühnerfleisch direkt aus den großen grünen Blättern.
Mariela fragte Anna über den neuen Lehrer aus. Seit Monaten war sie nicht mehr nach Quebrada Azúl gegangen. Mariela wurde wehmütig, weil sie nicht mehr mit ihren Freunden in der Schule war. Doch wenn sie die hilflose kleine Anita an ihrer Brust spürte, dann vergaß sie das schnell.
Rechtzeitig vor der Dämmerung machte Anna sich auf den Rückweg. Mariela nahm Anita auf den Arm und ging mit Manuel zu seinen Eltern. Auf dem Weg durch das Dorf grüßte Manuel die Nachbarn, die auf der Veranda vor ihrer Hütte saßen. Mariela kannte nur ein paar wenige aus der Schule. Sie bekam Heimweh nach Quebrada Azúl.
Don Jesús saß auf einem selbstgezimmerten Stuhl auf der Veranda und zog genüsslich an einer Zigarette. In seinen Schläfen glänzte ein leichtes Grau, er war hager, aber muskulös. Er begrüßte Mariela herzlich. Von ihm hatte Manuel seine ruhige Art geerbt. Don Jesús strich Anita vorsichtig über den Kopf und strahlte die Kleine an. Manuels jüngere Schwestern rissen sich darum, Anita zu halten. Doña Blanca fragte Mariela nach der Geburt.
„Ihr kommt erst einmal hierher für die Mahlzeiten. Hier ist immer ein Teller Reis für euch übrig“, bot sie an.
Mariela war froh über das Angebot und die herzliche Aufnahme.
„Und wie gefällt dir euer Haus?“, fragte Don Jesús.
„Wunderbar“, freute sich Mariela. „Wir haben vorhin mit Anna schon den Herd gebaut.“
„Es wird noch viel Arbeit sein“, nickte Don Jesús, „bis ihr alles fertig habt. Und die Felder wollen versorgt sein, sonst fehlt es nachher am Reis. Ihr seid tüchtig. Mit Gottes Hilfe werdet ihr bald auf eigenen Beinen stehen. Wenn es Schwierigkeiten gibt, dann findet ihr hier eine offene Tür. Die letzten drei Häuser, die du dort siehst“, zeigte er zum Dorfausgang, „gehören meinen zwei Söhnen und meiner Tochter. Alle Häuser haben wir gemeinsam gebaut. Alle haben ihre eigenen Felder und Ernten“, fügte er stolz hinzu.
„Deine Mutter ist so zurückhaltend“, bemerkte Mariela abends, als sie mit Manuel in ihrem neuen Zuhause unter das Moskitonetz kroch.
„Mach dir keine Sorgen. Es wird eine Weile dauern, bis ihr vertrauter werdet. Bei den Frauen meiner Brüder war es anfangs genauso. Mittlerweile schimpft sie meine Brüder aus, wenn sie findet, dass die ihre Frauen nicht gut behandeln“, lachte Manuel. „Du müsstest sie sehen, wenn sie Leo, der zwei Köpfe größer ist als sie, ausschimpft wie einen kleinen Jungen.“
Mariela grinste.
„Ich hoffe, das wird bei dir nicht nötig sein.“
„Das hoffe ich auch.“
Die Wochen vergingen. Mariela lebte sich ein. Durch die gemeinsamen Mahlzeiten entwickelte sich bald Vertrautheit zu den Schwiegereltern. Um die Wäsche zu waschen, war Mariela viel am Fluss. Dort wuschen neben ihr die Frauen aus Dos Bocas, die sie langsam kennenlernte. Dennoch vermisste sie Anna, ihre engste Vertraute. Sie war froh, dass sie häufig zu Besuch nach Dos Bocas kam – nicht nur um Mariela zu sehen. Ihr Interesse für Luis nahm mit jedem Besuch zu.
Vom Erlös ihrer ersten eigenen Maisernte kauften Manuel und Mariela Kaffee, Zucker, Öl, Seife, ein paar Teller und Tassen und etwas Benzin. Manuel lieh sich eine Motorsäge. Sein Bruder half ihm Bretter zu sägen, mit denen er das zweite Zimmer fertig bauen konnte. Mit der nächsten Ernte würden sie sich Wellblech kaufen. Bis dahin musste das Dach aus Palmblättern halten. Manuel zeigte Mariela die besten Stellen zum Angeln. Sie ging gerne mit Anita an den Fluss. Dort war es ruhig, und im Schatten der Bäume konnten sie der Hitze entkommen. Mariela machte morgens in aller Frühe Feuer, kochte, drosch mit Manuel zusammen den Reis, kümmerte sich um Anita und hielt das Haus sauber, während Manuel auf den Feldern arbeitete. Hin und wieder spielten die jungen Frauen in Dos Bocas Fußball. Als Anita etwas größer war, schloss Mariela sich ihnen an, während Anitas Cousinen die Kleine umsorgten. Anita wuchs und war gesund. Ihr Reis versprach eine gute Ernte. Mariela war stolz auf das, was sie sich zusammen erarbeiteten. Allmählich gab sie es auf, beim Schein der Kerze in ihrem Schulbuch zu lesen. Dennoch bewahrte sie das Buch weiter sorgfältig auf, wie eine Kostbarkeit.
*****
Beata stellte ihr Fahrrad am Metallgeländer der Brücke ab und schloss es dort sicher an. Der Kanal glitzerte in der Sonne. Sie ging die wenigen Meter über die Brücke und ließ ihren Blick über die Tische gleiten, die tief unten am Wasser unter großen Trauerweiden standen. Das Klappern der Kaffeetassen und das Gewirr der Stimmen klangen fröhlich, ungeachtet des Autolärms, der sich vom Kottbusser Damm her darüber legte. Sie suchte alle Tische ab, doch Sebastian war nirgends zu sehen. Dann spürte Beata zwei große, starke Hände fest um ihrer Taille fassen. Sie holte tief Luft und drehte sich energisch um. Sie sah in Sebastians lachende blaue Augen.
„Bitte nicht hauen!“, hob er abwehrend die Hände.
Ihre Wut verpuffte, sie boxte ihrem Bruder gegen die Brust.
„Na, ein bisschen Haue verdienst du dafür schon“, grinste sie.
„Ach nein, ich habe es schon schwer genug.“
Schnell war der traurige Blick zurückgekehrt, der sich in den letzten Monaten in seinem Gesicht festgesetzt hatte. Sie suchten sich einen Tisch in der warmen Sonne und bestellten Kaffee und Obstkuchen.
„Du hast es also geschafft und gehörst jetzt zum erlauchten Kreis arbeitsloser Akademiker. Herzlichen Glückwunsch, Frau Diplom-Sozialpädagogin!“
„Ich habe die letzten Wochen wie verrückt für die Prüfungen gelernt. Ich möchte mich jetzt darüber freuen und nicht daran denken, dass ich arbeitslos bin. Wenigstens für ein paar Tage.“
Sie nahm ihm seine Bemerkung nicht übel, doch die Erschöpfung der letzten Wochen saß ihr in den Knochen. Dann erzählte Beata von den Prüfungen, von ihrer Aufregung und von ihrer Freude über die unerwartet guten Noten.
„Und du? Wie geht es dir?“, fragte sie.
Sebastian versuchte zu lächeln.
„Oh, ganz ausgezeichnet. Die Auseinandersetzungen mit Birgit über die Kinder sind weiter energiegeladen und ergebnislos. Ich richte mich in der kalten, leeren Singlewohnung ein und versuche die Ruhe zu genießen.“
Er wirkte gefasst, doch der Schmerz war unüberhörbar.
„Habt ihr viel gestritten?“
„Ich wünschte, wir würden uns mal so richtig anschreien. Vielleicht wäre es dann leichter. Aber wir schießen ganz kühl unsere Giftpfeile aufeinander ab.“
„Und wie habt ihr euch mit den Kindern geeinigt?“
„Ich sehe sie jedes zweite Wochenende. Unter der Woche arbeite ich abends zu oft spät. Ich hole sie dreimal die Woche morgens ab und bringe sie in den Kinderladen. Aber sie fehlen mir, wenn ich abends in die leere Wohnung komme! Obwohl sie dann meistens schon geschlafen haben.“
Beata wünschte, sie könnte seinen Schmerz lindern.
„Na wenigstens läuft es mit der Arbeit gut“, fuhr er fort. „Ich kann in letzter Zeit viele Beiträge bei den Radiosendern unterbringen und meist zu den Themen, die mich interessieren. Nun erzähl du. Was sind deine Pläne? Hältst du noch an dieser Kolumbienidee fest?“
„Diese Kolumbienidee“, äffte sie ihn nach. „Die scheint dir nicht sonderlich zu gefallen. Und dabei hatte ich gehofft, dass du mir hilfst, die Eltern zu beruhigen. Schließlich hast du selbst nicht immer nur brav bei Mama auf dem Sofa gehockt.“
„Schon gut. Es ist richtig, wenn du in die große weite Welt hinausziehst und deine Erfahrungen machst. Ich komme nur nicht aus meiner Rolle als großer Bruder heraus.“
„Ich habe mir keine Sorgen gemacht, als du mit dem Bulli durch Afrika gereist bist. Ich war stolz auf dich und war mir sicher, dass du alle Lebenslagen meisterst. Ist dir eigentlich klar, wie oft mir Mutter etwas vorgejammert hat, wenn du wochenlang nicht geschrieben hast?“
„Das kann ich mir vorstellen“, verdrehte er die Augen. „Ich mache mir andere Sorgen.“
Sie sah ihn fragend an.
„Es geht nicht darum, dass ich denke, dass du überfallen oder entführt wirst. Wenngleich das für Kolumbien kein abwegiger Gedanke ist. Es ist mehr die Verletzung der Seele. Wir haben damals in Afrika gesehen, was Armut, Gewalt und Krieg mit Menschen machen. Ich war jung. Das viele Unrecht und Leid hat mich verzweifeln lassen. Wenn ich nicht meine besten Freunde bei mir gehabt hätte – ich weiß nicht, was dann aus mir geworden wäre. Ich hatte noch lange daran zu knabbern. Hinter der Fassade des sonnengebräunten Gesichts, das für alle so erholt aussah, waren viele Wunden. Und du wirst alleine fahren, oder?“
Es war das erste Mal, dass Sebastian Beata so von diesen Erfahrungen erzählte. Sie hatte gespürt, dass er sehr ernst war, als er aus Afrika zurückkehrte. Doch er wollte nie darüber sprechen.
„Man braucht nicht einen Bombenangriff erleben oder einen Mord sehen. Manchmal reicht es einfach, ein unterernährtes kleines Kind zu sehen und zu wissen, dass du ihm nicht helfen kannst. Und selbst wenn, dann wären da noch hunderte andere, und du könntest nie allen helfen.“ Er atmete tief. „Du bist so jung, so offen und so berührbar und du willst die ganze Welt retten, am besten alleine. Du wirst in Kolumbien merken, dass du das nicht kannst, und ich habe Angst davor, was das mit dir macht.“
Beata rührte nachdenklich im verbliebenen Milchschaum ihres Cappuccinos. Obwohl sie von Sebastians Offenheit gerührt war, regte sich Widerstand in ihr.
„Deine kleine Schwester ist inzwischen schon ziemlich groß. Ich habe mich darüber informiert, auf was ich mich da einlasse. Mir ist klar, dass ich nicht die Welt retten kann.“
„Es geht nicht darum, dass ich dir nichts zutraue. Aber ich wusste damals hier“, schlug er sich mit den Fingerknöcheln gegen den Kopf, „ganz genau, dass ich die Welt nicht retten kann, aber hier“, legte er die Faust aufs Herz, „hat es trotzdem verdammt weh getan.“
Er lehnte sich zurück.
„Ich will dich nicht abhalten. Ich weiß, dass du dafür sowieso viel zu stur bist. Ich möchte aber, dass du auf dich aufpasst und regelmäßig schreibst.“
„Na gut, großer Bruder, versprochen!“, grinste sie ihn an.
„Das will ich hoffen. Sonst sage ich Mutter, dass du etwas unglaublich Gefährliches vorhast. Dann bindet sie dich mit einem Strick in Walldorf an“, hänselte er sie. „Wann soll es denn losgehen und wann beichtest du es den Eltern?“
Sie hatte ihrer WG schon angekündigt, in zwei Monaten auszuziehen. Sie hoffte, bis dahin alle nötigen Dokumente für das Visum zu beschaffen. Mit leuchtenden Augen erzählte sie von der Arbeit der kolumbianischen Anwaltsorganisation in einem der Armenviertel von Bogotá, wo sie ihr Praktikum machen wollte. Als die Sonne verschwunden war, wurde es schnell kühl und sie trennten sich. Sebastian sah Beata nach, als sie mit beschwingtem Schritt zu ihrem Fahrrad ging. Er wünschte, sie würde die Kolumbienidee verwerfen.
*****
Pater Orlando sprach über den Segen, den die neue Schule für die Kinder von Dos Bocas bringen würde. Mariela gefiel es, wie er das neue Schulgebäude segnete, doch hörte sie nicht auf seine Worte. Die feierliche Atmosphäre war ihr genug. Manuelito war auf seinem Pult eingeschlafen, und sein Kopf hing schlaff zur Seite. Anita starrte gebannt auf den Pater und baumelte aufgeregt mit den Beinen. Anna saß ein paar Stühle weiter. Sie lauschte andächtig dem Pater und stillte gleichzeitig Miguel.
Die nagelneuen Pulte standen in vier Reihen. Die Männer aus dem Dorf hatten sie nach dem Vorbild der Schule in El Carmen gezimmert. Eine Bank, seitlich von zwei Brettern getragen, die auf halber Höhe durch Streben mit den Füßen des schmalen Tisches verbunden war. Auf einem schmaleren Brett unter dem Tisch konnte ein Heft abgelegt werden, und rechts an der Seite des Tisches stand ein Nagel hervor, um eine Schultasche daran zu hängen. Manuel hatte besonderen Wert auf dieses Detail gelegt, damit die Pulte denen in El Carmen in Nichts nachstanden. Natürlich war in El Carmen das Holz lackiert, so dass es glänzte, und die Beine und der runde Haken für die Tasche waren aus matt glänzendem, grauem Metall. Doch das schmälerte Marielas Stolz auf die neue Schule nicht. Alles war noch rechtzeitig fertig geworden. Dieses Jahr musste Anita nicht länger auf ihre Einschulung warten. Gestern war die Lehrerin im Boot der Pfarrei mit dem Pater zusammen angekommen.
Lange hatte Mariela sich damit gequält, dass ihre Tochter keine Schule im Dorf haben würde. Sie konnte sich nicht vorstellen, die Kleine allein den weiten Weg nach Quebrada Azúl gehen zu lassen. Sie erinnerte sich daran, wie ungeduldig sie selbst damals auf die Schule gewartet hatte. Erst als sie acht Jahre alt war, war es dann endlich so weit gewesen: Die erste Schule in der Region wurde in Quebrada Azúl eröffnet und ein Lehrer traf im Dorf ein.
Manuel unterstützte sie, als sie sich für die Schule einsetzte, doch es war nicht seine Art, sich in diese Dinge einzumischen. So war sie es, die gemeinsam mit Männern vom Gemeinderat nach El Carmen gefahren und bei vielen Ämtern vorgesprochen hatte, damit endlich eine eigene Schule für Dos Bocas bewilligt wurde. Immer wenn sie kamen, versprach ihnen der Bürgermeister Holz für das Gebäude, Nägel, Schulbänke und zwei Lehrer. Nichts davon kam jemals an. Es hatte nichts genutzt, dass Pater Orlando sie mehrfach zu den Ämtern begleitete. Als Mariela dann gehört hatte, dass jemand aus dem Ministerium El Carmen besuchen würde, da wusste sie, dass das eine einmalige Chance war. Die Vorstellung, persönlich mit einem Ministeriumsbeamten zu sprechen, machte sie nervös. Doch sie bedrängte die Sprecher des Gemeinderates. Zusammen mit Don Jesús fuhr sie nach El Carmen. Vor dem Bürgermeisteramt warteten sie auf den Beamten. Als ein verschwitzter Mann mit hellbraunem Haar in Jeans, weißem Hemd und mit von der Hitze gerötetem Gesicht heraustrat, nahm sie ihren Mut zusammen und ging auf ihn zu, um ihr Anliegen vorzutragen. Der Mann aus Bogotá schnitt Mariela ungeduldig das Wort ab. Einen schriftlichen Antrag brauche er, sonst könne er sich damit nicht befassen. Sie solle doch bitte verstehen, dass er nicht die Landkarte auswendig lernen könne von einer Region wie dem Chocó, die überwiegend aus Sümpfen und Tümpeln bestehe und wo niemand wisse, wo alle diese kleinen Dörfer lägen, die ohnehin auf keiner Karte eingezeichnet waren. Unwirsch wollte er sich an ihr vorbei drängen. Sie stellte sich ihm in den Weg. Don Jesús merkte, dass sie noch nicht aufgab und baute sich neben ihr auf, so dass der Beamte nicht durchkam. Der wischte sich aufs Neue den Schweiß von der Stirn.
„Wo finde ich Sie heute Abend? Ich bringe Ihnen den Antrag dorthin“, sagte sie.
„Den Antrag und einen Zensus. Ohne Zensus können wir leider gar nichts machen, gute Frau.“
Mariela spürte die Verlogenheit in seinem gespielten Bedauern.
„Die Liste haben wir schon dreimal beim Bürgermeister vorgelegt. Reicht das nicht?“, fragte Don Jesús zaghaft.
„Vom Bürgermeister haben wir nichts bekommen. Wir brauchen die Liste im Ministerium, nicht beim Bürgermeister.“
„Dann sagen Sie uns, wo Sie heute Abend sind, und wir bringen Ihnen den Zensus und das Schreiben“, forderte Mariela.
Es fiel ihr schwer, freundlich zu bleiben.
Der Beamte zog die Augenbrauen hoch.
„Dort drüben“, murmelte er und nickte mit dem Kopf in Richtung Hotel Katío. „Jetzt lasst mich durch, ich muss weiter.“
Er bahnte sich seinen Weg an ihnen vorbei.
Don Jesús schüttelte den Kopf.
„Arroganter Kerl. Hast du das dicke Goldkettchen gesehen?“
Die Zeit drängte, wenn sie bis zum Abend alles fertig haben wollten. Morgen war der Beamte vielleicht schon weg.
„Lass uns in die Pfarrei gehen“, sagte Mariela. „Dort bekommen wir Papier und Stift und können uns hinsetzen, um zu schreiben.“