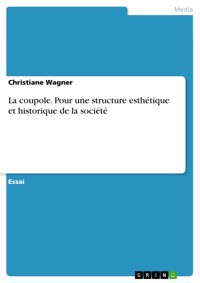6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AMELIE
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Wenn man als Frau um die dreißig und solo ist, stehen meist zwei Dinge ganz oben auf der Wunschliste: endlich den Traummann zu finden und beruflich Erfolg zu haben. Zumindest eines dieser Ziele sollte in naher Zukunft erreicht werden, um keine Panik aufkommen zu lassen. Paulas Leben scheint jedoch überhaupt nicht auf Kurs zu sein. Gerade ist sie schmerzhaft Single geworden, sie lebt immer noch im Haus ihrer Eltern und zweifelt daran, ob ihr Psychologiestudium die richtige Entscheidung gewesen ist. Als sie sich Hals über Kopf in den attraktiven Marek verliebt, weiß sie nicht, was ihr blüht: Er ist Reinkarnationstherapeut und eröffnet ihr, dass ihre Eltern im früheren Leben Marilyn Monroe und Sigmund Freud gewesen seien. Alles Quatsch, denkt Paula. Lieber konzentriert sie sich auf das Verliebtsein und die Hochzeit ihrer jüngeren Schwester Marlene – eine gute Gelegenheit, um ihrer Familie den neuen Freund vorzustellen. Und wenn ihr Traummann ernsthaft daran glaubt, dass sie die Tochter zweier Legenden des 20. Jahrhunderts ist, warum sollte sie sich gegen diese Idee sträuben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 262
Ähnliche
Christiane Wagner
Marilyn sei Dank
Roman
Für meine Familie
1.
Der falsche Prinz
Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, eine Tür zu schließen, wenn man wütend ist. Bei der ersten achtet man darauf, dass der Tür nichts passiert, denn schließlich kann sie nichts für die eskalierte Situation. Bei der zweiten steht die Tür im Mittelpunkt des Zornesausbruchs. Man verwendet all seine Kraft, um sie mit dem größtmöglichen Knall ins Schloss zu werfen. Nichts kann den Wutschrei einer Frau so sehr unterstreichen wie der laute Knall einer Tür, die vor Schreck nachbebt.
Die dritte Möglichkeit braucht Fingerspitzengefühl. Sie sollte ihn so lange reizen, bis er die Verfolgung aufnimmt. Die Tür wird dann so zugeschlagen, dass sie ihn wie eine Ohrfeige trifft.
Dass sich Oliver jedoch gleich die Nase brechen würde, hatte ich nicht gewollt. So stark war ich auch gar nicht, obwohl meine Waffe aus stabiler Eiche war. Der Schrei meines Freundes war so laut, dass er den Knall der Tür übertönte. Als ich sie wieder öffnete, lag Oliver zusammengekrümmt am Boden. Ein Blutstrom schoss aus seiner Nase, als wollte er nie mehr enden. Und das auf dem beigefarbenen Vorwerk-Teppich, der in seinem perfekt gestylten Wohnzimmer lag. Ich dachte kurz und sehr beruhigt an meine Haftpflichtversicherung, die ich schon seit Jahren bezahlte, die aber noch nie zum Einsatz gekommen war. Das Blut würde Oliver auch die Möglichkeit geben, noch einmal über diese Nicht-Farbe und seine »Ich will hier keine Kinder«-Ansichten nachzudenken. Jetzt lag er wie ein Dreijähriger hilflos am Boden und ich sah mich schon mit seinem Porsche ins Krankenhaus fahren.
Zehn Minuten später stand ich in der Hausgarage, die für die teuren Autos der Stellplatzeigentümer beheizt wurde. Man will bei diesen Preisen ja nicht frieren, dachte ich mir. Auch nicht als Auto, dabei hätte Kälte Olivers Nase jetzt gutgetan. Oliver stützte sich so sehr auf meine Schulter, dass ich mich nur in gebückter Haltung und sehr mühsam an der parkenden Autoreihe entlangschleppen konnte. Ich fühlte mich wie der Glöckner von Notre-Dame. Den Mann, der die Frau auf Händen trägt, habe ich in meinem Leben schon immer vermisst. Unser Weg führte vorbei an einer Autogruppe, die sich aus 30 Prozent Mercedes, 50 Prozent BMW, 20 Prozent Kleinwagen diverser weiblicher Ehepartner und anderen Luxusautos zusammensetzte. Darunter Olivers Porsche, schwarz wie ein Leichenwagen, in dem aber nicht einmal im Kofferraum ein Toter hätte verstaut werden können. Mörder sollten keinen Porsche fahren.
Ich hasste dieses Auto. Es war laut, auffällig und schenkte seinem Besitzer für einen Haufen Geld die Illusion, ein Charismatiker zu sein. Während unserer fast zehnmonatigen Beziehung hatte ich mich bisher standhaft geweigert, diese Potenzschleuder zu fahren. Oliver hatte das Auto natürlich nur wegen des Designs und diesem unglaublich glücksbringenden Fahrgefühl gekauft. Abgesehen davon war es eine fahrende Wertanlage, wenn man das gute Stück nicht frühzeitig an die Wand setzte. Männerträume, die kostenintensiver als jede Freundin sind. Vielleicht lernt er an einer Tankstelle seine neue Freundin kennen, dachte ich mir spöttisch und sah schon ein Paris-Hilton-Imitat das Auto bewundern.
Ich öffnete mit dem Funkschlüssel den Wagen, der sofort angeberisch blinkte. Oliver wurde mir langsam zu schwer. Nachdem ich meinen noch immer über Schmerzen klagenden Freund auf dem ergonomischen Ledersitz versorgt hatte, wurde mir schlagartig klar, dass ich gerade meinen Exfreund anschnallte. Es war der Moment kurz vor dem Einklicken des Gurtes in die Halterung. Meine Augen trafen für einen kurzen Moment die seinen. Trotz seines vorwurfsvollen und gequälten Blickes spürte ich, dass ich ihn nie würde ehrlich bemitleiden können. Es war aus, ohne dass ich es in Worte packen musste. Das wussten wir beide. Trotzdem konnte Oliver nicht fahren und erwartete diesen letzten Dienst von mir. Ich hatte gerade andere Probleme und drückte nervös auf den Knöpfen des Armaturenbretts herum, um die Auspuffklappe zu schließen. Bei dem verdammten Auto war fast immer die Auspuffklappe geöffnet, um das Fahrzeug laut und satt brummen zu lassen. Und ich wollte nicht satt brummen, sondern möglichst unauffällig das Krankenhaus erreichen.
»Wo kann ich dieses blöde Ding leiser stellen?«, fragte ich ungehalten. Oliver drückte genervt einen Schalter und würdigte mich keines Blickes.
Ich hätte ihn einfach in ein Taxi setzen sollen. Aber das schlechte Gewissen ließ mich auch einen Porsche fahren.
»Los geht’s!«, kommentierte ich mit einem Hauch zerstörerischer Lust in der Stimme.
Oliver rutschte nervös auf seinem Ledersitz herum. »Der fährt sich wie ein normales Auto, lass die Kupplung bitte langsam kommen.«
»Danke für den Tipp«, antwortete ich ihm gleichgültig, »aber ich hatte nicht vor, mit 180 aus der Parklücke zu schießen.«
»Fang nicht schon wieder an, Paula, es reicht jetzt.« Oliver hatte im wahrsten Sinne des Wortes die Nase voll von mir. Der Wagen heulte auf wie ein wiehernder Hengst im Stimmbruch, als ich mich vorsichtig aus der Parkbucht bewegte. Ich hatte das Gefühl, der Wagen wäre um Tonnen schwerer als jedes andere Auto, aber dafür unberechenbar wendig für eine im Ausparken ungeübte Frau. Ich schlug langsam das Lenkrad ein und schaute nach hinten. Mein rechter Fuß drückte dabei etwas zu stark auf das Gaspedal und in einer schnellen Halbdrehung fuhr ich haarscharf an einem silberfarbenen Mercedes vorbei. Oliver stieß einen lauten Seufzer aus.
»Hast du noch Schmerzen?«
Die Schnauze des Porsches zeigte Richtung Ausfahrt. Oliver lehnte sich angestrengt nach vorne, drückte den Senderknopf des Garagentüröffners und befahl mir ungehalten, endlich in den zweiten Gang zu schalten. Das Blut tropfte aus seiner Nase direkt auf den Schaltkopf der lederbespannten Gangschaltung. Ich hatte Mühe, sie anzufassen. Langsam fühlte ich mich wie die Lady Macbeth der Beziehungskiste. Ich hatte sein Blut an meinen Händen und gehörte zum Kreis der Verdächtigen.
Zum Glück waren wenige Autos unterwegs. Es war Mitt-woch-abend, kurz vor sieben. Die Rushhour war schon vorbei, das Krankenhaus glücklicherweise leicht zu finden. In Gedanken überlegte ich schon, mit welchem Bus ich von der Klinik zurückfahren könnte. Mittlerweile fuhr ich fast routiniert im dritten Gang und fühlte mich wie die Fahrerin eines luxuriösen Express-Taxis. Oliver saß leidend und endlich schweigend neben mir, allerdings immer noch umgeben von einer Aura des Vorwurfs.
Fünfzehn Minuten später tauchte das Heidelberger Krankenhaus in Sichtweite auf. Noch ein paar Minuten, dann würden sich endlich unsere Wege trennen.
»Irgendwie stinkt es hier so verschmort«, sagte ich. Während ich versuchte, die Spur zu halten, suchten meine Finger nervös den richtigen Knopf, um das Fenster zu öffnen.
»Sag mal, stehst du etwa mit dem Fuß auf der Kupplung?«
Mit einem kurzen Blick sah ich Oliver von der Seite an und bemerkte, wie er nach Luft rang. Aus seiner Sicht waren Frauen tödlich für einen Porsche. Sie blieben aus Angst immer etwas auf der Kupplung stehen. Gift!
»Dafür darf dein Porsche jetzt auf einem Frauenparkplatz stehen, sonst hättest du mit deiner Nase meilenweit laufen müssen!« Ich parkte sehr schwungvoll ein. Den restlichen Abend würden die Ärzte der Notaufnahme mit meinem Ex und seiner kaputten Nase verbringen. Mein Gott, war ich froh, dass ich die Röntgenbilder nicht sehen müsste. Dann würde ich nämlich das tun müssen, was ich nicht konnte – ihn bemitleiden.
»Ich ruf schnell Claudia an, gib mir doch einfach die Schlüssel und geh nach Hause. Ich schaff das schon allein.«
»Klar, allein mit Claudia. Wie gut, dass deine Ex, entschul-dige, Ex-Ex, fast um die Ecke wohnt.« Mein Blick fiel kurz auf Oliver, der mich mit bedrohlicher Miene ansah. »Ich bin schon weg«, sagte ich schnell. »Ich glaube, da drüben ist die Bushaltestelle.«
»Spar dir deinen Sarkasmus. Sie ist meine beste Freundin. Und wie wäre es mit dem Zauberwort zum Abschluss?« Olivers Stimme hörte sich leicht verschnupft an und ich hatte Mühe, ihn deshalb überhaupt ernst zu nehmen.
»Also gut. Entschuldige … aber es hat mich einfach aufgeregt, dass du mich gestern auf der Party vor deinen Freunden bloßstellen musstest. Leider hatte ich keine Zeit, mich umzuziehen. Ich habe auch nicht einen Gedanken daran verschwendet, das kleine Schwarze anzuziehen und unbequeme Stöckelschuhe zu tragen, nur um mich uniformiert zu diesen Small-Talk-Tanten zu stellen …«
»Paula, kannst du …«
»Und dass mir die Tomatensuppe auf den Schoß gekippt ist, war mir selbst peinlich genug. Da brauche ich nicht noch eine tolle Bemerkung wie: ›Deshalb trägt Paula heute Abend die alten Jeans.‹ Danke für diese Pointe. Ich habe jetzt noch das Lachen deiner Freunde im Ohr.«
»Paula, bitte öffne endlich diesen verdammten Gurt, ich muss zur Notaufnahme. Falls du es nicht bemerkt hast, meine Nase tut höllisch weh und deine Tomatenhose war in null Komma nix ausgewaschen.«
Meine innere Stimme versuchte, mir schon seit einigen Minuten zu sagen, dass dieser Moment der ungeeignetste war, um eine Diskussion über Trennungsgründe zu entfachen. Aber es war die letzte Gelegenheit. Ich befreite Oliver von seinem Gurt, lief eilig um sein Auto herum und öffnete ihm die Tür wie ein gut ausgebildeter Chauffeur.
»Paula, Kleines, wir hatten zwar auch gute Zeiten, aber es ist wirklich besser, wenn sich unsere Wege jetzt trennen.«
Ich schaute ihn fassungslos an. Auf dieses verbale Trinkgeld hätte ich verzichten können.
»Schade, ich hätte gerne gesehen, wie deine Nase so wird. Aber gut. Bei den Frauen wird sie bestimmt gut ankommen. Vielleicht erzählst du allen, du hättest dich vor ein heranbrausendes Auto geschmissen, um ein Kind zu retten.«
»Paula …« Jetzt schien Oliver wirklich wütend zu werden.
»Bin schon weg. Grüß Claudia von mir.« Ich wendete mich von ihm ab und machte mich auf den Weg zur Bushaltestelle. Mit dem ersten Schritt dorthin vollzog ich die Trennung. Dieser erste Schritt tat gut. Beim zweiten fragte ich mich, warum ich nicht schon früher darauf gekommen war, und beim dritten konnte ich endlich wieder frei durchatmen.
Manchmal wählt das Schicksal harte Wege, um Partnern zu zeigen, dass sie nicht füreinander bestimmt sind. Mir war schon länger klar, dass Oliver nicht der Mann war, mit dem ich alt werden wollte. Dabei war der Anfang so wunderschön gewesen. Ich hatte ihn bei einer Vernissage in der Heidelberger Altstadt kennengelernt. Die naive Malerei hatte uns einander näher gebracht, obwohl dieser Stil noch heute weder meinem monochrom angelegten Geschmack, noch Olivers Vorliebe für alte Meister entspricht.
Wir hatten gemeinsam vor einem Bild mit dem Titel »Sonntagsidyll mit Hunden« gelacht und einander sofort ins Herz geschlossen. Die Bilddarstellung war klischeehaft wie der Titel, die Hunde überfressene Möpse, die an den Leinen ihrer schon älteren Besitzerinnen liefen. Wahrscheinlich wurden sie gerade zum nächsten Kuchenessen geschleppt. Sonntage sind Kuchengroßkampftage. Vor und hinter den älteren Damen mit den dicken Möpsen schoben glückliche Mütter stolz altmodische Kinderwagenmodelle vor sich her. Der Anblick dieses Motivs löste bei mir allerdings Würgereiz aus und ich war froh, dass ich dieses unangenehme Gefühl mit Oliver weglachen konnte. Ich war sofort geblendet von seinem Aussehen. Groß, schlank, aber nicht dürr, alles ansehnlich in einem geschmackvollen Anzug verpackt, der ihn nicht verkleidet aussehen ließ. Bei unseren folgenden Treffen machte ich dann den ersten großen Fehler. Ich sprach fast die ganze Zeit über mein Psychologiestudium und entfächerte stolz wie ein Pfau Theorien, die er nicht kennen konnte. Dabei erwähnte ich immer wieder geknickt meine anstehende Seminararbeit, die nicht so richtig ins Laufen kam. Bei jedem Treffen wurden meine Monologe länger, ich verschlang mit Heißhunger asiatische Curry-Enten und genoss mediterrane Gourmetküche. An diesen Abenden ließ ich mich gerne von Oliver bewundern, aber auch bemitleiden und verständnisvoll anlächeln. Natürlich durfte er ohne meine Gegenwehr das Essen zahlen. Endlich jemand, der sich um mich kümmerte!
Ich war von dieser väterlichen Art zunächst begeistert. Was hätte mir Besseres passieren können als ein attraktiver Zuhörer, der mich kostenfrei in die nächtliche Restaurantwelt entführte? Ich glaubte tatsächlich, dass mich dieser Mann verstand. Dass er mich durch sein verständnisvolles Zuhören und großzügiges Einladen nur ködern wollte, durchschaute ich natürlich nicht.
Doch nach diesem vielversprechenden romantischen Auftakt begann Oliver, mir zunehmend das Gefühl zu geben, ich wäre für ihn nicht gut genug. Dieser Zustand tauchte wie eine Fata Morgana am Horizont auf, an deren Ortseinfahrt deutlich zu lesen war: »Du gehörst nicht zu ihm, kehre um!« Aber ich war längst mit Vollgas an diesem Hinweisschild vorbeigerauscht.
Von da an begann ich, mich immer mehr wie ein überflüssiges Accessoire seines Lebens zu fühlen. Leider passte ich weder zu seinem Porsche, noch zu seiner gestylten Wohnung. Oliver wünschte sich eine Frau, die von einem Dolce & Gabanna-Plakat direkt in sein Leben springt. Schlank, lächelnd, sexy – ein weibliches Statussymbol.
Natürlich versuchte ich zunächst, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Oliver wurde regelmäßig aufs gesellschaftliche Parkett gebeten. Natürlich gerne mit Begleitung. Also kaufte ich mir extra für einen Empfang ein schwarzes, ultrakurzes Minikleid und schwarze Pumps, in denen ich fast senkrecht stand. Die gefährlichen Spitzen dieser Schuhe wären der Türöffner zu jedem Sado-Maso-Club gewesen. Dazu fand ich eine goldene, große Lacktasche im Ausverkauf, die an einer Metallkette hing. Schwarze Netzstrumpfhosen rundeten das Bild ab. Zum Glück war der Empfang am Abend, so musste ich nicht noch irgendeine Fälschung aus der letzten Gucci-Brillen-Kollektion kaufen. Über mein Kleid warf ich einen schwarzen Wollponcho, damit mich Oliver wie eine Statue enthüllen konnte. Dank einer Dior-Promotionstour wurde ich im Kaufhaus vor den Augen zahlreicher Schaulustiger geschminkt. Ich zahlte gerne 15 Euro für eine verheißungsvolle Wimpernverlängerung, die mir den Augenaufschlag eines Straußenweibchens verlieh. Meine Nägel ließ ich mir am Nachbarstand verlängern. Mein feminines Power-Tuning war perfekt.
Ich fühlte mich wie ein Star auf dem Weg in den Mode-Olymp. Der Blick in den Spiegel zeigte mir eine andere Frau, vielleicht die, in die sich Oliver wieder hoffnungslos verlieben würde. Der Weg zum Empfang sollte zu meinem Triumphzug werden.
Ich fuhr mit der Straßenbahn bis zur Villa, in die wir eingeladen waren. Mutig stöckelte ich über eine Hauptverkehrsstraße und interpretierte jedes Hupen als Anerkennung meiner Verwandlung. Dann kam mein großer Moment. Aufgeregt betrat ich das festlich erleuchtete Haus, meine Augen fanden sofort Olivers Blick, ich lächelte ihn an mit meinen mit rotem Lipgloss übergossenen Lippen. Langsam ging ich über den Marmorfußboden auf ihn zu. Meine Absätze hallten selbstbewusst und mein laszives Lächeln hätte sogar aus dem Papst einen Don Juan gemacht.
Endlich stand ich vor Oliver, bereit, alle Komplimente wie einen riesigen Strauß Rosen entgegenzunehmen, und konnte es kaum erwarten, dass er mein hinreißendes Kleid sah. Während ich schwungvoll meinen Wollponcho abnahm, fühlte ich mich wie bei einem gelungenen Auftritt in der Campari-Werbung. Oliver schaute mich mit großen Augen und mit offenem Mund an. »Paula, Schatz«, sagte er zögerlich, »hast du die Einladung genau gelesen?«
Ich schaute Oliver fragend an. Nur Ort und Uhrzeit der Einladung hatte ich mir gemerkt.
Oliver hatte mich dann mit leicht erregter Stimme aufgeklärt.
»Das hab ich mir gedacht. Kleines, das ist ein besinnlicher Abend, zu dem die Barmherzigen Schwestern eingeladen haben. Wir sind hier, um meine Mutter zu vertreten. Sie ist Ehrenmitglied und macht sich für Waisenkinder in Rumänien stark.«
Meine Laune fiel schlagartig in den Keller. Ich hatte mit einem mehrgängigen Abendessen gerechnet, Wein und Kerzenschein, ein wenig Small Talk, bei dem ich brav an den richtigen Stellen gelacht hätte, aber nicht mit einem Spendenabend und Schwestern, die halbstündlich christliche Lieder sangen. Im nächsten Moment stand schon eine kleine, dicke Nonne vor mir, die mich nachsichtig anlächelte und mir eine Spendenbüchse unter die Nase hielt. Geld kennt keine gesellschaftliche Ausgrenzung. Vielleicht hatten sie auch noch ein Projekt für Prostituierte. »Moment, Schwester«, sagte ich und suchte aufgeregt nach meinem Geldbeutel, den die Tiefe meiner neuen Lacktasche gierig verschlungen hatte. Ich scheiterte bei dem Versuch, meine Münzen in den Schlitz zu werfen – meine Nägel waren einfach zu lang. Am liebsten wäre ich davongerannt.
Dieser Abend war das erste große Missverständnis zwischen uns. Oliver dachte, dass ich ihn mit dieser Verkleidung, wie er es nannte, ärgern wollte. Also landete mein Körper wieder in den gewohnten Jeans, die sich sofort wie eine zweite Haut anfühlten. Alles blieb beim Alten und mir wurde klar, dass ich mich nicht verkleiden konnte, um unsere Beziehung zu retten.
Mit Olivers erfolgreichen Segelfreunden wurde ich auch nicht warm. Die teuren Friseure der Freundinnen dieser Männer kannte ich nur aus Erzählungen. Ich hatte kein Interesse, über »Must-haves« zu reden und darüber, wie ideal Berlin zum Einkaufen geworden war. Heidelberg war ja nur Provinz. Ich hatte keine Lust mehr auf das ewige Gequatsche, welches Wellness-Hotel gerade angesagt war. Der reinste -Erholungs-Jetset. Und natürlich alles vom Freund spendiert, weil man selbst nur einen Termin zur monatlichen Nagelmodellage finanzieren konnte.
Auch mit Oliver war die Kommunikation nicht gerade im Fluss. Meine wachsende Aggression ihm gegenüber war bald nicht mehr zu übersehen. Ich sah in ihm immer mehr ein verwöhntes Weichei aus reicher Familie. Er streifte die Welt nur mit seiner Porsche-Mentalität. Oliver konnte, während er im Fernsehen Nachrichten über Terroranschläge und Kriege verfolgte, unbeeindruckt seinen Segelurlaub in Südfrankreich planen. Ein Karrierist, dessen Laufbahn schon mit seinen 36 Jahren unaufhaltsam Richtung Bankvorstand ging.
Ich konnte nie verstehen, warum er es so weit gebracht hatte. Aber sein Wissen war wohl in seiner beruflichen Eingleisigkeit exzellent. Und dann das Auto. Es war mir immer peinlich, wenn er mich mit dem Porsche zur Universität fuhr. Zum Glück befand sich das Seminargebäude der Psychologen in der Fußgängerzone. Ich ließ mich immer um die Ecke absetzen, um nicht dem Spott meiner Mitstudenten zum Opfer zu fallen. Ich erkannte natürlich, dass es hintergründig der Ausdruck von Geld und Macht war, den ich ablehnte. Schließlich befand ich mich im 14. Semester meines Psychologiestudiums. Kurz vor dem Diplom.
Jetzt, wo ich die Überflussbeziehung los war, konnte ich mich endlich meinem nächsten Problem widmen: das falsche Studium gewählt zu haben und es erst mit 28 Jahren zu bemerken. Eigentlich zweifelte ich schon seit fünf Semestern. Dieselbe Situation wie mit meinem Ex: Ich merkte es schon seit längerer Zeit und fand die Notbremse nicht, um mein Leben wieder in Richtung glückliche Zukunft zu lenken. Die letzten beiden Klausuren hatte ich auch nicht bestanden, obwohl forensische Psychologie zu meinen Leidenschaften zählt. Und vom Thema meiner Diplomarbeit – »Kreativität und psychische Erkrankung« – war ich auch nicht mehr überzeugt. Die schlechte Beurteilung meiner letzten Seminararbeit ließ mich noch mehr daran zweifeln, ob ich wirklich eine wissenschaftliche Karriere vor mir hatte. Therapeutin wollte ich bereits seit meinem erfolgreichen Grundstudium nicht mehr werden. Wozu auch? Ich konnte in all den gängigen therapeutischen Ansätzen keinen Sinn erkennen. Ich fühlte mich schon seit Langem wie eine Theologiestudentin, die nicht mehr an Gott glaubte.
Zum Glück hatte das Studentenbüro um 17 Uhr geschlossen, das bewahrte mich vor einer Kurzschlusshandlung. Sonst hätte ich heute Abend wieder bei null anfangen müssen. Als Single, mit einem abgebrochenen Studium, ohne Berufsaussicht.
Ich setzte mich auf eine einsame Wartebank an der Bushaltestelle gegenüber dem Krankenhaus, in dem Oliver gerade geröntgt wurde. Garantiert hatte er Claudia schon angerufen. Sie hatte sich bei seinem Anruf und seinen nasalen Erläuterungen bestimmt vorbildlich erschrocken und war geradewegs zu ihm geeilt. Auf ihrer Haut sein Lieblingsparfum. Wie dumm, dass dieser Lockstoff heute sinnlos war. Erschöpft schloss ich die Augen und wünschte mir, sechs Jahre jünger zu sein. Ich würde mich in jeden anderen Mann verlieben, nur nicht in Oliver. Und ich würde alles studieren – aber bestimmt nicht mehr Psychologie. Meine Seele schrie nach etwas, was Hand und Fuß hatte, vielleicht Humanmedizin. Kinderärztin könnte ich dann werden oder mich voll und ganz auf Ohren oder Augen spezialisieren! Ich könnte mein ganzes Leben lang in fremde Augen schauen. Das wäre wie eine Reise zu den exotischsten Orten der Welt.
Endlich kam mein Bus um die Ecke gebogen. Ich stieg ein und nahm auf der hintersten Bank Platz. Noch fünf Haltestellen, dann war ich zu Hause. Mit Ende zwanzig lebte ich noch immer bei meinen Eltern. Natürlich ohne Pausenbrot von Mama und Gutenachtgeschichten, sondern in einer Art familiärer Wohngemeinschaft. Das brachte Vorteile, denn zur Uni brauchte ich nur zwanzig Minuten zu Fuß, und ich musste mir nie Gedanken darüber machen, wann ich meine Eltern einmal wieder besuchen sollte. Das Haus war groß genug für uns alle und der Garten ideal für eine Grillparty mit Freunden und Kommilitonen. Leider war ich nie in Feierlaune, und so würde ich den bunten Studentenhaufen, eine Mischung aus Turnschuhträgern und modischen It-Girls, nie im Garten meiner Eltern stehen sehen.
In modischen Angelegenheiten gab ich mich ganz den Empfehlungen und dem Kleiderschrank meiner Mutter hin. Praktischerweise hatten wir seit Jahren die gleiche Kleidergröße. Erst in der letzten Zeit war der Kleidertausch mit ihr schwieriger geworden. Vor ein paar Jahren hatte sich meine Mutter entschlossen, in den allgemeinen Sog der Selbstverwirklichung zu springen. Ganz klassisch. Die Hausfrau und glückliche Mutter zweier Kinder, die sich kurz vor fünfzig fragt, ob das alles gewesen sein soll. Vielen Frauen wird in diesem Alter ja plötzlich klar, dass sie sich bald von ihren Kindern verabschieden müssen und in ein tiefes Loch fallen. Wenn man bald fünfzig wird, merkt man plötzlich, wie schnell die Uhr tickt. Bevor die Demut vor dem Leben im eigenen Bewusstsein Platz nehmen kann, werden Lebenslügen studiert, wird verpassten Chancen hinterhergeheult und natürlich der Partner kritisiert. Man befindet sich mitten in der eigenen Projektionsschlacht, macht eine kleine Lebensrechnung und denkt zum ersten Mal über ein Testament nach. Oder man versucht, sich endlich selbst zu finden, weil man glaubt, bisher in einer Scheinwelt gelebt zu haben.
Diesem Prozess der Häutung fällt meist der Kleiderschrank zum Opfer.
Die schwarzen Pullis, Mäntel und Hosen trifft es zuerst. Man will ins Leben und nicht zu einer Beerdigung. Über diesen Entschluss hatte ich mich noch gefreut, denn ich liebe schwarze Kleider. Ich hatte alles Aussortierte in meinen Kleiderschrank geräumt. Aber das, was dann in den mütterlichen Schrank einzuziehen begann, machte mich etwas ratlos.
Meine Mutter wollte ihre bisher verleugnete spirituelle Ader ausleben. Sie hatte sich für einen Kurs im Aura-Sehen entschieden, um weniger von ihren Mitmenschen ausgenutzt zu werden, für makrobiotisches Kochen, um ihr Leben zu verlängern, und für eine Yoga-Ausbildung, um endlich den Körper zu haben, den sie schon immer wollte. Die Farbe Schwarz wurde in diesen Kreisen als energetisches Loch angesehen, das eine Lösung karmischer Verstrickungen verhindert. Also hatte sich meine Mutter mit regenbogenfarbenen Schals eingedeckt und einen Stapel Seidenröcke gekauft, um ihre Weiblichkeit stärker zum Ausdruck zu bringen. Sie hatte sich ein halbes Dutzend flache Schuhe mit Latexsohlen angeschafft, um die Verbindung zur Erde nicht zu unterbrechen. Alles sollte aus natürlichen Rohstoffen sein. Strickoberteile und leichte Baumwolltops in Türkis und Rosa hatten das neue Bild abgerundet. Diese Farben passten am besten zu ihren blonden Haaren. Und sie hatte alle Schuhe, die eine gesunde Absatzhöhe von 2,5 Zentimetern überschritten, einem Altschuhcontainer des Roten Kreuzes vermacht. Sogar Chanel- und Dior-Parfums hatten das Bad verlassen müssen. Mit ihnen waren auch alle chemischen Anti-Falten-Produkte und alles, was zu viele Konservierungsstoffe, Erdöl oder andere schädliche Zusatzstoffe enthielt, gegangen.
Am Morgen nach dieser radikalen Räumung hatte ich verzweifelt mein Erdbeerduschgel gesucht und nur noch eine übel riechende Hanfseife gefunden. Ich hatte mich nach der Dusche abgetrocknet, ohne den leicht süßlichen, fruchtigen Geruch auf meiner Haut genießen zu können.
Mir war dieser radikale Wandel zu viel. Ich wünschte mir meine alte Mutter wieder. Die neue entwickelte sich zu einer Gesundheitsfundamentalistin. Und sie wollte nie wieder Mutter oder Mama genannt werden. Sie wollte endlich Marianne sein.
Der Bus brachte mich fast bis zum Haus meiner Eltern. Ich fühlte mich mittlerweile müde und leer. Zwar war ich froh über die Trennung von Porsche und Oliver, aber ich spürte auch, dass sich mein Herz nach Erholung sehnte. Als ich das Gartentor öffnete, wünschte ich mir, dass ich jetzt endlich meinem Traummann begegnen würde. Irgendwo da draußen lief er sicher herum, schaltete vielleicht in diesem Moment den Fernseher ein oder verliebte sich in die Falsche. Dann konnte ich nur noch hoffen, dass er es bald begriff und nicht erst in fünf Jahren. Mittlerweile müsste ich alle männlichen Einwohner Heidelbergs in meinem Alter mindestens einmal gesehen haben.
Ich war noch nie für einen Mann die Nummer eins gewesen. Auch nicht für Oliver. Kein Mann hatte jemals aus ganzem Herzen »Ich liebe dich« zu mir gesagt. Alle meine Freundinnen konnten auf diese Gefühlstrophäe zurückblicken, und wenn sie nur ein Lebkuchenherz vom Jahrmarkt war, auf dem mit zuckersüßer Schrift die Liebesbotschaft stand. Aber diese Herzen wurden zu schnell hart oder wurden zu unerträglichen Staubfängern.
Ich war nicht an Süßkram interessiert, sondern an Liebe.
2.
Viele Welten unter einem Dach
»Paula, was machst du denn hier? Du wolltest doch ein paar Tage bei Olli bleiben.« Lene, meine zwei Jahre jüngere Schwester, stand vor mir und strahlte. Sie musste gerade von ihrem zukünftigen Ehemann Sebastian gekommen sein. Die beiden richteten momentan ihre gemeinsame Wohnung ein, in die sie aber erst nach der Hochzeit einziehen wollten. Die Trauung war für kommenden Sonntag geplant. Ein Ereignis, dem auch ich schon entgegenfieberte. Ich liebe Hochzeiten.
Lene sah heute schon zum Heiraten aus – strahlend schön. Sie hatte die blonden, lockigen Haare unserer Mutter, ihren sinnlichen Mund und blaue Augen, die jeden Gletscher zum Schmelzen bringen würden. Manchmal war ich neidisch auf Lene. Sie war immer so positiv, unbeschwert, das Glückskind der Familie. Meine Schwester hatte beide Traumziele des Lebens mit Leichtigkeit erreicht: Sie hatte die Liebe ihres Lebens gefunden und war drauf und dran, eine beachtliche Karriere hinzulegen. Alles, was sie anfasste, gelang. Sie hatte ihren Abschluss in Jura schon mit 24 in der Tasche gehabt, sich auf Eherecht spezialisiert und ihren Mann Sebastian vor -Gericht kennengelernt. Sie hatte seinen Scheidungsfall vertreten – erfolgreich.
»Hi Lene«, druckste ich herum, »mit Oliver ist Schluss, aber frag mich ein anderes Mal danach oder vergiss es einfach.« Ich hatte jetzt wirklich keine Lust, darüber zu reden. »Was macht eure Hochzeitsplanung?«
»Ach, das läuft. Der Koch wird sogar extra für Mama makrobiotisch kochen. Alle Zutaten kommen aus der Region, nur Pfeffer und ein paar Gewürze hatten eine längere Anreise. Ich finde es ohnehin übertrieben.«
Erleichtert atmete ich auf. Hochzeitsvorbereitungen und Mamas Essgewohnheiten – solche unverfänglichen Themen waren genau das, was ich gerade brauchte. »Früher mussten es Designerkleider sein und heute süßer Klebreis und Gemüse mit Saisongarantie«, meinte ich. »Sag mal, Lene, ist heute diese makrobiotische Kochgruppe im Haus? Es riecht so nach … Hirse.«
Lene rümpfte angewidert die Nase. »Na klar, hörst du nicht das alberne Gelächter? Pass auf, wenn die mich fragen, was ich beruflich mache, dann gibt es bestimmt ein Ehepaar, das den Weg zu mir findet. Ihre Ehen kochen die auch nicht glücklich. Lass uns reingehen.«
Lene und ich hatten das Treppenhaus schon als Jugendliche gehasst. Sobald man das Haus betrat und zur Treppe gehen wollte, die zu unseren im oberen Stockwerk gelegenen Zimmern führte, konnte man von der Küche und vom Wohnzimmer gesehen werden. Wir waren nie unentdeckt geblieben, wenn wir zu spät von einer Feier kamen. Auch die makrobiotische Kochgruppe verstummte, als wir die Haustür schlossen. Unsere Absätze waren auf dem Marmorfußboden nicht zu überhören.
»Lenchen, Paulinchen! Wie schön, meine Töchter, kommt zu uns!« Die Stimme meiner Mutter überschlug sich fast vor übertriebener Freude. Wenn ihre neuen Freunde im Haus waren, hörte sie sich immer etwas inszeniert und fremd an. Sie stand in der Küche mit vier anderen, etwas aufgedrehten Gleichaltrigen.
Renate war geschieden und stellte wie meine Mutter ihr Leben auf den Kopf, die Ansteckungsgefahr lag in der Luft. Gerhard und Susa spielten ein so gut gelauntes, harmonisches Ehepaar, dass Lene wohl schon beim ersten Zusammentreffen mit den beiden Kundschaft gerochen hatte. Jedenfalls hatte ich die freudige »Gerichtsmiene« meiner Schwester so gedeutet. Dann gab es noch Friedericke, die den Guru Bhagwan persönlich gekannt hatte und heute Lehrerin war. Sie unterrichtete Deutsch und Mathematik für die Oberstufe und schien die Normalste in der Gruppe zu sein. Im Vorübergehen hatte ich in ihrer geöffneten Handtasche einen Schokoriegel gesehen und die Ecke einer Zigarettenschachtel, die unter dem weißen Seidenschal hervorlugte. Kleine Sünden sind der Zucker des Lebens.
Auf dem Küchenherd standen wie immer zwei Druckkochtöpfe für das wichtigste Grundelement makrobiotischer Ernährung: Vollkorngetreide. Seit sich meine Mutter für diese Ernährungsweise entschieden hatte, war die Küche von allen schädlichen Lebensmitteln befreit worden. Konserven, Tiefkühlkost, Zucker, Ketchup, Schokolade und alle künstlich produzierten Nahrungsmittel, sogar frische Tomaten, bekamen keine Aufenthaltserlaubnis mehr. Auch Kartoffeln wurden in die Verbannung geschickt. Da meine Mutter ein ethisches Problem damit hatte, Nahrungsmittel wegzuwerfen, übergab sie alles Ungeeignete der seelischen Mülldeponie – die Kirche nahm es dankbar für ihre Armenspeisung.
Die Kaffeemaschine in der Ecke überlebte nur der Familie zuliebe – sie war der Atommeiler eines Makrobiotikers. -Ansonsten wurde die Küche von jeglichem Zellengift gereinigt. Yin und Yang sollten endlich in der Seele und im Körper meiner Mutter ins Gleichgewicht kommen.
Für Harmonie in der Familie sorgte diese Lebens- und Ernäh-rungsumstellung jedoch nicht. Mein Vater ging immer öfter in der Klinik essen. Er war Psychologe in der Psychiatrischen Klinik in Wiesloch, wo die Welt für ihn noch in Ordnung schien. In der Kantine gab es Fleisch mit Soße, Nudeln in Butter geschwenkt und Schokoladenpudding zum Dessert. Und – wenn er noch Hunger hatte – für Herrn Doktor gab es immer einen Nachschlag.
Ich war glücklich, dass Lenes bevorstehende Hochzeit die Familie wieder zusammenführte. Vielleicht würde sie auch etwas Entspannung in die Hysterie meiner Mutter bringen. Spätestens bei der Trauung in der Kirche würde sich Marian-ne einmal so richtig die Augen wund heulen können, wie es jede gute Mutter tut.
»Marianne, reich mir doch bitte die Algen für den Reis rüber. Ich glaube, wir wollten auch langsam den Saitan dazugeben. Hast du den naturbelassenen?« Renate stampfte Reis in einem Topf. Dabei verwendete sie meinen alten Baseballschläger und sah etwas unbeholfen aus.
Wenn wir unsere Mutter ansahen, waren wir nicht sicher, ob wir wirklich ihre Kinder waren. Sie duftete nach süßem Patchouliöl und in ihren bunten Kleidern sah sie aus wie ein vom Himmel gefallener Regenbogen. Sie ließ gerade ihre Haare wieder lang wachsen, um ihren mädchenhaften Elfentyp zu unterstreichen. Diesen Floh hatte ihr ein neuer Freund aus dem Yogakurs ins Ohr gesetzt und meine Mutter stürzte sich auf dieses Kompliment wie eine heißhungrige Löwin.
In manchen Augenblicken sah ich meine Schwester schon im Scheidungsfall unserer Eltern vor Gericht ziehen. Nein, Lene würde einen Kollegen bitten, den Fall zu übernehmen. Immerhin stand ihr Ruf auf dem Spiel.
Immer mehr fühlte ich mich einsam bei dem Gedanken, dass Lene bald das elterliche Haus verlassen würde. Dann wäre ich die einzige Tochter, die unter den Entgleisungen unserer Mutter zu leiden hätte. Lenes Zimmer war schon als Meditations- und Yogaraum verplant. Marianne hatte vor, regelmäßig Kurse zu geben, und wollte sowohl Aura-Sehen als auch die Entwicklung der eigenen Hellsichtigkeit unterrichten. Ich empfand den aktuellen Wissensstand meiner Mutter als zu wenig ausreichend, um als selbsternannte Lehrerin sinnsuchende Schüler ins Haus zu bitten. Sie interpretierte immer wieder erfolglos an mir und meiner Schwester herum. Bei Lene erkannte sie den hellsichtigen Kanal des Sehens. Sie versuchte, ihr immer wieder zu erklären, dass sie ihr drittes Auge öffnen solle, um Antworten in schwierigen Situationen zu erhalten. Das Orakel von Heidelberg!
»Klar«, hatte Lene entnervt geantwortet, als unsere Mutter ihr diesen Tipp gegeben hatte, »wenn mir vor Gericht einmal die Argumente ausgehen sollten, dann bitte ich um einen kurzen Moment Ruhe, weil ich mein drittes Auge erst aufwecken muss, um einen Rat im Scheidungsfall Brehm gegen Brehm zu erbitten. Auf jeden Fall könnte ich dann bald bei Papa in der Klinik den Höhepunkt meiner Karriere erleben.«
Meine Qualitäten hatte sie im hellsichtigen Hören vermutet, da ich ab und zu mit der Tür ins Haus fiel und etwas laut in meiner Art war. Sie hatte mir den Tipp gegeben, auf innere Stimmen zu hören und mich auf die seitlichen Schläfenlappen zu konzentrieren, wenn ich mit einem Problem nicht weiterwusste.
Meine innere Stimme klang ängstlich, wenn ich über diese Entwicklung innerhalb meiner Familie nachdachte. Vor meinem inneren Auge sah ich schon meine Mutter mit einem dürren, übertrieben ökologisch denkenden Mann im Garten eine Schwitzhütte bauen und verliebt Dinkelkekse knabbern.