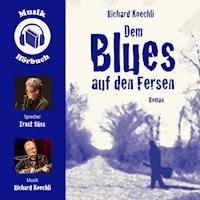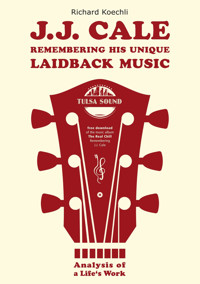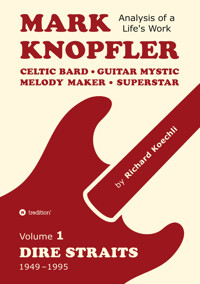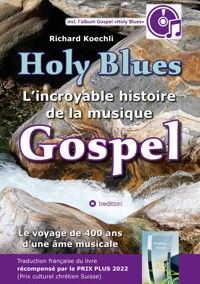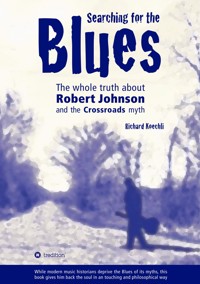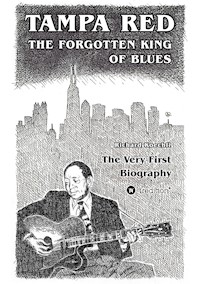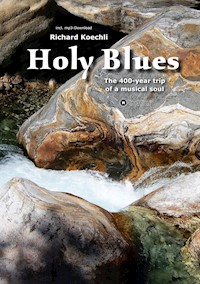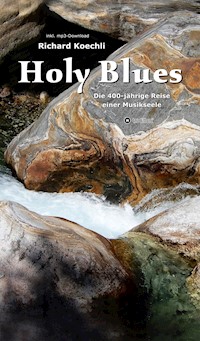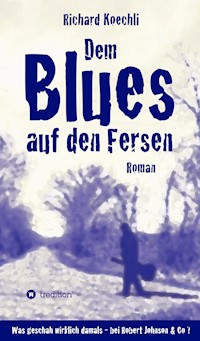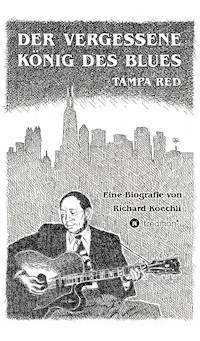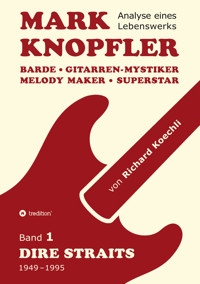
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das umfassendste Buch über Mark Knopfler und die Dire Straits. Sensibler Geschichtenerzähler, Meister der subtilen Virtuosität, entspannter Superstar – Knopflers Karriere bricht fast alle Rekorde. Der renommierte Schweizer Musiker und Fachbuchautor Richard Koechli taucht tief ein ins Universum des britischen Songwriters und Sängers mit dem unverkennbaren Gitarrensound, um sein Lebenswerk mit akribischer Detailverliebtheit zu würdigen. Leidenschaftlich, kompetent, kritisch, respektvoll und in leichtfüssiger Sprache untersucht er Mark Knopflers Werdegang, seine Kunst und Philosophie, den Einfluss seiner Vorgänger und Wegbegleiter, den musikhistorischen Kontext der 1960er-, 70er-, 80er- und 90er-Jahre. Allein schon die Story der Dire Straits verschlingt mehr als 500 Buchseiten; ein zweiter Band über Mark Knopflers anschliessende Solo-Karriere wird später erscheinen. Ein inspirierendes, multimediales Lese-Abenteuer – für Knopfler-Fans genauso wie für Gitarren-Freaks und audiophile Liebhaberinnen & Liebhaber der Musikgeschichte. Deutsche Original-Ausgabe (eine englische Übersetzung ist kürzlich erschienen, eine französische folgt demnächst).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 778
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
BARDE • GITARREN-MYSTIKER MELODY MAKER • SUPERSTAR
Band 1
DIRE STRAITS
1949 – 1995
von Richard Koechli
Impressum
© 2025 Richard Koechli
Webseite des Autors: www.richardkoechli.ch
Lektorat: Donald Meyer
Schriftsatz & Layout: Richard Koechli
Der Autor stammt aus der Schweiz, es gelten deshalb die entsprechenden orthografischen Sonderregelungen des CH-Dudens
Coverdesign: Richard Koechli
Teile der grafischen Elemente lizenziert unter: shutterstock.com 2473379703 / 2444015075 (Burbuzin / THP Creative)
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
ISBN Softcover: 978-3-384-49304-0
ISBN Hardcover: 978-3-384-49305-7
ISBN E-Book: 978-3-384-49306-4
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Richard Koechli, Seehalde 22, 6243 Egolzwil, Switzerland. Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Ein Merci an alle, die mir dabei halfen, dieses Buch zu schreiben! Executive Producers: Walter Köchli (mein Vater), Hape Schuwey (mein Manager), Otti Wiederkehr, Fausto Medici. Sponsoren: Peter Jordi, Franz Wolfisberg, Emmanuel B. de Haller, Peter Emch, Philippe Schneeberger. Ich bedanke mich zudem: Bei allen Journalist: innen, Medien, Fans und Sammlern, die es mir ermöglichten, mich über Mark Knopfler und seine Musik zu informieren (die entsprechenden Quellen habe ich im Buch jeweils möglichst präzise erwähnt). Bei Mark Knopfler für sein Lebenswerk, bei seinen Weggefährten für den Support. Bei allen, die mir täglich Inspiration und Lebensfreude bescheren, insbesondere bei meiner Frau Evelyne Rosier, meinen Eltern Walter & Marlise Köchli, meiner Band Blue Roots Company. Und natürlich beim dreieinigen Gott und allen guten Geistern.
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Musik als Spiegel
Ein Start ins Leben
Lonnie Donegan und Chris Barber
Hank Marvin
Bert Weedon
Mark Knopflers erste Gitarre
Die 1960er – Marks erste Jahre als Gitarrist
Die allererste Aufnahme
The Kingston Trio
Mark entdeckt den Fingerpicking-Gral
Mark wird erwachsen
Stephen «Steve» Phillips
Mark zieht nach London
Was passierte kurz vor dem Senkrechtstart?
J.J. Cale (John Weldon Cale)
Dire Straits – Blitzstart aus Zufall?
Die berühmten ersten Demo-Aufnahmen
Charlie Gillett
Der aufsteigende Stern «Dire Straits»
Das phänomenale Debütalbum
Die Geschichte der Sultans of Swing
«Water Of Love» – die grosse innere Dürre
Die Rakete, die nicht sofort abhob
Eine Live-Band, eine Album-Band
«Live At The BBC» – geballte Bühnenladung
Auf nach Amerika
Plötzlich gilt der Prophet auch im eigenen Land
Wenn Konzertlokale aus allen Nähten platzen …
«Communiqué» – der Fluch des zweiten Albums?
Der Ritterschlag: «Slow Train Coming» (Bob Dylan)
«Making Movies» – der Wendepunkt
David Knopfler verlässt die Band – Geschichte eines Bruderzwists
Das beste Dire Straits-Album?
Roy Bittan – der Glückstreffer
Tunnel Of Love
«Love Over Gold» – mit einem Bein im Psychedelic Rock
Und wieder neue Musiker in der Band
Pick Withers verlässt die Band
«Local Hero» – Rückkehr ins Land der Feen und Druiden
«Infidels» – Mark Knopfler produziert Bob Dylan
«Alchemy» – ein Live-Album als Vermächtnis
«Cal» – Mark wird zum Celtic Music Ambassador
Paul Brady und Liam O’Flynn
Keine Ruhepause – Mark Knopfler in fremden Diensten
«Brothers In Arms» – Ikarus fliegt der Sonne entgegen
Das vorläufige Ende der Dire Straits
«On Every Street» – ein letztes Aufbäumen
Schlusswort
Mark Knopfler - Barde, Gitarren-Mystiker, Melody Maker, Superstar (Band 1, Dire Straits)
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Schlusswort
Mark Knopfler - Barde, Gitarren-Mystiker, Melody Maker, Superstar (Band 1, Dire Straits)
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
Die 28 besten Laidback-Songs & Instrumentals aus der 35-jährigen Karriere des Swiss Blues Award-Gewinners Richard Koechli. Ein Tribut an die beiden grossen Meister des Laidback-Universums: J.J. Cale und Mark Knopfler …
01 Don't Go To Strangers (J.J. Cale), 2020
02 Lucerne Is A Blues Town (R. Koechli), 2014
03 Silence (R. Koechli), 2008
04 Mister Marketing Man (R. Koechli), 2008
05 Sensitive Kind (J.J. Cale), 2020
06 Blessed Be The Name (Trad.), 2022
07 Six String Spell (R. Koechli), 2016
08 Lord I Just Can't Keep From Crying (B.W. Johnson), 2022
09 Feel Like Going Home (Charlie Rich), 2022
10 I Got Life (R. Koechli), 2018
11 Le Jardin De Tes Sens (R. Koechli), 2018
12 Samhain (R. Koechli), 2002
13 Blue Collar Worker (R. Koechli), 2018
14 Laid-Back Sur Hamac (R. Koechli), 2008
15 Easy Road (R. Koechli), 2011
16 Carry On (J.J. Cale), 2020
17 My Slide Is Crying (R. Koechli), 2008
18 Pedro (R. Koechli, E. Rosier), 2018
19 The Unsung King Tampa Red (R. Koechli), 2018
20 Goalies Intro (R. Koechli), 2013
21 Love Endures Everything (R. Koechli), 2023
22 Local Hero (Mark Knopfler), 1997
23 Lily Of The West (Trad.), 2005
24 Der Barde Taliesin (R. Koechli), 2002
25 Irish Man (R. Koechli), 2018
26 Holy Blues (R. Koechli), 2022
27 Down In The Valley To Pray (Trad.), 2022
28 S' Grossmuetti Zöglet (R. Koechli), 1997
Bonus: Sultans Of Swing (Dire Straits), 1991 (live)
Kostenloser Download des mp3-Albums inkl. Bonus-Song:
www.richardkoechli.ch/images/laidback.pdf
Vorwort
Was macht einen Menschen aus? Was formt ihn? Wie kommen Bilderbuchkarrieren zustande? Allein die Tatsache, dass es darauf tausend Antworten gibt, macht das Leben spannend. Auch wenn aus eigener Sicht vielleicht einige dieser Erklärungen in die Kategorie «Unsinn!» fallen («baloney again» würde Mark Knopfler womöglich sagen …), scheint es mir am besten zu sein, die ganze weltweite Palette an Antworten auf die Frage, was Knopfler als Songschreiber und Musiker genau ausmacht, einfach mal ungeordnet auf den Tisch zu legen – im Idealfall ohne sie zu bewerten. Mark Knopfler hat ein Millionenpublikum, ein überaus treues zudem. Jeder einzelne dieser Menschen hat eine eigene Lebensgeschichte, in welcher irgendwann der MK-Groschen fiel, weil ein Song oder ein Gitarrenton des britischen Erfolgsmusikers das Herz öffnete und für immer berührte.
Er sei der beste Gitarrist aller Zeiten, hören wir zuweilen. Er sei das grösste Genie der Musikgeschichte. Oder, in irgendeinem Forum (anlässlich der Frage, ob Knopfler gläubig sei) die Antwort eines Fans: «Mark Knopfler ist grösser als Gott und Jesus zusammen.»
Solche Phrasen müssen nicht erschrecken; sie zeigen im Grunde einfach nur, wie unglaublich stark Musik berühren kann. Dass so was geradezu religiöse Ausmasse annehmen kann, kennen wir aus unzähligen Fällen. Was glauben Sie, wie das beispielsweise im Lager der hartgesottenen Bob Dylan-Fans zu und hergeht? Jüngerschaft! Es wird nicht diskutiert, wie gut Dylan und seine Stimme in einem bestimmten Song wirklich ist – Dylan-Songs sind per se eine Offenbarung, Punkt.
Das kann ich problemlos respektieren. Dennoch, ich möchte diskutieren! Ich möchte so tief und nuanciert wie möglich versuchen, Musik und ihre Berührungskraft zu verstehen. Ich möchte das Phänomen Mark Knopfler entschlüsseln. Ich möchte sein musikalisches Lebenswerk analysieren, musikhistorisch einordnen – aber definitiv nicht, um es zu entzaubern. Im Gegenteil! Diese Art der Beschäftigung hilft mir, Musik noch besser zu verstehen, sie noch intensiver zu erleben, sie zu zelebrieren!
Das hilft mir jeweils auch als Musiker. In meinen zahlreichen Büchern über grosse oder vergessene Musiklegenden habe ich als Gitarrist, Sänger und Songwriter mehr gelernt als in tausend Übungsstunden. Warum berührt ein ganz bestimmter Ton an einer ganz bestimmten Stelle eines Songs? Wie muss er klingen, damit er berührt? Natürlich sind das oft auch bloss spieltechnische, musiktheoretische Fragen; um solche Fragen, so interessant sie sind, soll es in diesem Buch allerdings nicht in erster Linie gehen. Auch Gitarren-Freaks werden zwar auf ihre Rechnung kommen, doch ich schreibe hier kein Gitarren-Fachbuch; Lehrbücher dieser Art habe ich bereits genug verfasst. Es geht um noch grössere Fragen: Wie entsteht Inspiration, woher kommt sie und wie wunderbar verwoben ist Musikgeschichte.
Ich freue mich, wenn Sie mich begleiten auf dieser Reise in Mark Knopflers Lebenswerk. Keine Biografie soll das werden, eine autorisierte schon gar nicht, obwohl ich auch immer wieder Ereignisse aus Marks Biografie (es gibt da kaum Geheimnisse) in den musikalischen Kontext stelle. Im Zentrum steht auf meiner Reise jedoch immer die Musik – und die hat in Mark Knopflers Falle mehr als genug Substanz. Enthüllungen, Skandale oder billige Promi-Geschichten interessieren mich nicht; bei Mark gibt es diesbezüglich ohnehin kaum was zu holen. Blinde Verehrung allerdings ist ebenso wenig mein Credo; ich kann diese Verehrung zwar verstehen und teilweise nachempfinden, doch seinem Lebenswerk möchte ich aus der Perspektive eines neugierigen, leidenschaftlichen Musikers sowie jener eines kritischen Musikjournalisten auf die Schliche kommen. Ich hoffe, der Mix dieser beiden Ebenen wird Mark Knopfler gerecht.
Künstler: innen werden geformt von ihrem eigenen Leben, vom Umfeld und von allem, was vor ihrer Zeit passierte. Kein Mensch dieser Welt erfindet Musik neu; alles ist verwoben, verknüpft und mit der Vergangenheit verbunden. Deshalb wühle ich hier stellenweise auch ziemlich tief in der allgemeinen Musikgeschichte; ich betrachte Mark Knopfler nicht isoliert, mich interessieren ebenso seine Weggefährten und die musikhistorischen Umstände, die ihn prägten.
Hanspeter «Düsi» Kuenzler, der wunderbare in London lebende, freiberufliche Schweizer Journalist führte mehrere längere Interviews bei und mit Mark Knopfler. Düsi schenkt uns diese exklusiven Interviews für das Buch hier, einfach so – grossartig! Ich werde an passenden Stellen daraus und aus unzähligen anderen Medienberichten zitieren. Bei einem dieser Interviews von Hanspeter Kuenzler, 2018 in den legendären British Grove Studios, beendete Mark Knopfler das längere und dennoch höchst kurzweilige Gespräch mit einer alles sagenden Antwort auf Düsis Frage «Was ist mit den Platten anderer Leute? Bringen sie dich auf neue Ideen?»
Mark Knopfler: «Oh, yes. I think so. I absolutely think so. It’s a good thing, too. I mean, that’s what they’re for. That’s what it’s all for. You drop a stone into a well, and ripples come out, and then they come back, you know. And also, it makes other people do things. You’re making other people – other people are creating off what you’ve done. It’s wonderful.»
Es ist wundervoll! Schauen und hören wir uns gemeinsam all die Wellen an; jene, die Knopfler erreichten, und jene, mit welchen Knopfler wiederum andere erreichte. Wir werden uns dabei selbstverständlich tonnenweise Audio-Beispiele anhören und Videos ansehen, auf die ich jeweils verweise, nur so kann Musik unsere Seele vollständig erreichen. Es gibt kaum eine Ton- oder Film-Aufnahme, die inzwischen nicht im Internet zu finden ist. Im Buch jeweils entsprechende QR-Codes abzubilden, wäre natürlich eine verführerisch-moderne Idee – ich habe in früheren Publikationen jedoch schlechte Erfahrungen damit gemacht, weil Internet-Adressen zuweilen ändern können und somit QR-Codes plötzlich nicht mehr funktionieren. Deshalb habe ich hier grundsätzlich jeweils die Titel (in Kursivschrift) aufgeführt, unter welchen Sie die Beiträge im Internet jederzeit problemlos finden (sofern sie nicht gelöscht wurden).
Da es in meinem Buch um Musik und nur um Musik geht, habe ich zudem grundsätzlich auf die Abbildung von Fotos verzichtet. Es ist letztlich eine Konzeptfrage; ein Bild-Band hat selbstverständlich seinen Reiz, doch die Bildsprache steht in Konkurrenz zur Musik- und Textsprache. Mark Knopfler ist kein Foto-Modell, er ist Musiker und Songwriter; wir alle wissen, wie er damals aussah und wie er heute aussieht. Es spielt für mich keine Rolle, und es würde das Buch unnötig teurer sowie rechtlich komplizierter machen.
Okay, let’s go! Ich freue mich wie ein Kind auf unseren gemeinsamen Trip, liebe Leserinnen und Leser. Ich wollte ursprünglich ein einziges Buch über Mark Knopflers gesamte Karriere schreiben – wie Sie sehen, füllt dieses Lebenswerk nun problemlos zwei umfangreiche Bücher …
Herzlich:
Richard Koechli
Musik als Spiegel
Wie soeben im Vorwort gesagt: Künstlerinnen und Künstler werden geformt von ihrem eigenen Leben, vom Umfeld und von allem, was vor ihrer Zeit passierte.
Was hat Mark Knopfler zu dem gemacht, was aus ihm wurde? Diese Fragen stellen wir uns nicht aus einer Lust des Schnüffelns heraus; wir sind keine Voyeure. Es geht um Musik! Die Privatsphäre eines Künstlers verdient Unantastbarkeit. Mark Knopfler gehört ohnehin zu jener Sorte Starts, die es ausgesprochen schätzen, wenn man sie ungestört im Pub ein Bier trinken lässt oder bei einem zufälligen Aufeinandertreffen auf der Strasse nicht gleich «Oh my God»-schreiend auf die Knie fällt. Die Haltung, möglichst unerkannt bleiben zu wollen, hat wohl auch einen Zusammenhang mit Knopflers Arbeitsweise als Songschreiber. In ihm steckt bekanntlich der Journalist (den er ja vor seiner Musikkarriere eine gewisse Zeit lang tatsächlich war); am liebsten hört Mark diskret und respektvoll den Gesprächen anderer Menschen zu – um so den Stoff für seine wunderbaren Songs über die Gefühle, Sorgen, Nöte und Erlebnisse der ‘kleinen’ Menschen zu erhalten. Es ist die Perspektive des neutralen Beobachters.
So neutral wie eben möglich, zumindest aber nicht wertend. Subjektivität spielt immer mit, wenn wir in die Haut anderer Menschen schlüpfen, sie interpretieren oder gar zu erklären versuchen. Wenn Mark Knopfler aus fremden Geschichten Songs macht, fragt er danach nicht die Leute, «ist es recht so, erkennt ihr euch im Spiegel, darf ich die Story so veröffentlichen?» Er tut es einfach, schickt die Songs auf Reisen. Das mache ich jetzt in gewisser Weise genauso. Meine Sicht auf den Musiker und Songschreiber Mark Knopfler ist subjektiv gefärbt, und ich schicke diese subjektive Sicht auf die Reise, ohne ihn erst «ist es recht so?» zu fragen. Das ist der Unterschied zu einer autorisierten Biografie. Ich führe mit Mark Knopfler keine Gespräche, mein Englisch wäre dazu sowieso nicht gut genug, und im schlimmsten Falle könnte es sogar den ‘Song’ zerstören, den ich über ihn hier schreiben möchte. Ich beobachte Mark und sein Lebenswerk in einer Weise, wie er selber jeweils die Leute beobachtet für seine Songs.
Wenn mich neben seiner Musik auch gewisse Hintergründe interessieren, dann deshalb, weil ich es spannend und inspirierend finde darüber zu rätseln, wie das Werk eines Künstlers mit dem Leben und all den zurückgelegten Wegen verstrickt ist. Wie sich alles gegenseitig beeinflusst. Musik ist mehr als ein blosses Handwerk; Musik ist ein Spiegel, eine Art Tagebuch des Lebens. Dazu passt auch meine philosophische Annahme, dass wir uns längst nicht nur durch Üben und Streben weiterentwickeln. Alles, was du im Leben denkst und tust (wie du es tust), wirkt sich auf geheimnisvolle Weise auch auf deine Arbeit aus – das war als Musiker immer mein Credo. Deshalb ja auch die an sich banale Tatsache, dass viele Künstler: innen im Alter besser, reifer und ausdrucksstärker werden, obwohl sie meist im Vergleich zu früheren Tagen weniger hart daran arbeiten.
Irgendein roter Faden kann bei einem solchen Unterfangen natürlich nicht schaden. Wenn «Zeit» auch nicht die einzige Ebene ist – der beste und brauchbarste Faden ist noch immer, chronologisch vorzugehen. Der Blick zurück ist im Alter ohnehin Volkssport, und dieser Blick tut ja auch wirklich gut; die meisten Träume und Prägungen stammen aus der Zeit unserer Kindheit und Jugend. Sich mit ihnen rückwirkend zu verbinden, ist wie Religion in ihrer wirklichen Bedeutung: Lateinisch «religare» (verbinden, anbinden, abstammen); Rückverbindung mit den Ursprüngen also. Unsere Existenz schreit danach.
Okay, here we go. Ein kurzer Blick in Mark Knopflers Kindheit und Jugend …
Ein Start ins Leben
In der Timeline auf Mark Knopflers Webseite stand früher der schlichte Satz zum Anpfiff unserer Partie (inzwischen ist die Timeline nicht mehr auf Marks Seite):
1949: Mark is born in Glasgow, to an English mother and Hungarian émigré father
Well, überaus viel Information steckt nicht in dieser Formulierung. Gut möglich, dass Mark Knopfler das genaue Geburtsdatum für nicht sehr wichtig hält und vielleicht auch der Astrologie keine grosse Bedeutung zuspricht. Kann ich verstehen; Astrologie ist bekanntlich keine Wissenschaft, sondern Esoterik und Lust am Orakeln. Doch warum nicht einfach mal so und aus Spass Mark Knopflers Geburtsdatum deuten lassen? Er erblickte das Licht der Welt am 12. August 1949. Ein Löwe also. Ohne den Aszendenten (das Tierkreiszeichen minutengenau im Moment der Geburt) zu kennen, lassen wir das am besten mal kurz von einem Profi deuten; die Autorin, Journalistin, Astrologin und Tarotkartenleserin Danijela Pilic beschreibt den Löwen auf www.glamour.de wie folgt:
Das Sternzeichen Löwe (23. Juli – 22. August) ist eine Diva, die Wärme und Kreativität ausstrahlt, eine grosse Persönlichkeit, wie gemacht für die Bühne. Der Löwe will auffallen, kann dabei durchaus eitel sein. Weitere Charaktereigenschaften: Der Löwe ist stark, selbstbewusst, grosszügig und loyal: Er liebt seine Freunde und freut sich über ihre Erfolge. Der Löwe will gewinnen und geht nicht gut damit um, wenn sein Ego verletzt wird. Er liebt Drama, Luxus und Reisen.
Verblüffend, diese Deutung. Wärme, Kreativität, grosse Persönlichkeit, wie gemacht für die Bühne, selbstbewusst, grosszügig, loyal, Gewinner-Typ. Es scheint vieles auf Mark Knopfler zuzutreffen, zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus. Erstaunlich, gebe ich gerne zu.
Eine Erklärung für seine Musik und seinen Erfolg kann so was allerdings nie und nimmer sein. Bei allem Respekt vor den Sternen; da war bei Millionen von kleinen und grossen Ereignissen, die in Mark Knopflers Leben hineinwirkten, der freie Wille im Spiel – der von Mark Knopfler und der von all jenen Menschen oder Wesen (wie Städte, Landschaften usw.), die Mark und seine Musik prägten.
Unser Planet ist ein Tummelplatz für Vibes. Abertausende von Stimmungen, Schwingungen und Gefühlen – in jedem Moment und an jedem Ort der Welt herrscht eine distinktive emotionale Atmosphäre, von welcher wir uns nie vollkommen abgrenzen können. In der Kindheit dringen diese Vibes besonders leicht in die Menschenseele ein, um sie zu formen, auch wenn wir das kaum bewusst wahrnehmen und meist erst viel später erkennen können.
Um das Phänomen Mark Knopfler auch nur annähernd verstehen zu können, ist die Frage unumgänglich: Was waren das für Vibes, die ihn formten? Was passierte in Marks Leben? Wo wuchs er auf? Wer waren seine Eltern? Was waren das für Menschen, die ihn prägten und inspirierten? Was geschah vor ihm in der Musikgeschichte? Ich bin durchaus der Meinung, dass jedes Leben von Neuem beginnt, dass wir nicht einfach nur ein Glied in einer vorprogrammierten Kette sind – dennoch sind wir eben auch dieses Glied, sind wir in unseren Genen und im Geiste mit unseren Vorfahren und der Geschichte verbunden.
Natürlich, man kann sich leicht verlieren in endlosen Details. Ich streife diese Fragen hier nur skizzenhaft, das reicht und ist spannend genug.
Sein Vater Erwin Knopfler (1909-1993) stammte aus Miskolc (Ungarn). Er war Architekt und Schachspieler; ein erfolgreicher Schachspieler übrigens, 1953 erreichte er bei den schottischen Meisterschaften den zweiten Platz. Ein spannender Mix! Als Architekt den Formen, der Ästhetik und der Sinnhaftigkeit von Gebäuden verpflichtet, als Schachspieler dem scharfen und vorausschauenden Denken. Wenn das in Mark Knopflers Charakter hineinwirkte, wovon ich überzeugt bin, sind das Eigenschaften, die beim Erschaffen seines Lebenswerkes sicherlich mithalfen. Die Ästhetik und Formen-Verliebtheit seiner Musik sowie die Sinnhaftigkeit, das alles ist unüberhörbar. Auch die Schlauheit und das sichere Gespür des Vorausschauenden, mit welcher Mark seine Karriere bis heute höchst erfolgreich verwaltet (in allen Nebenbereichen, bis zur eigenen Modereihe und dem eigenen Whiskey), für mich keine Frage – da hatten und haben auch die Gene seines Vaters die Hände mit im Spiel.
Womöglich auch die Fähigkeit zur Resilienz. Ein Modewort, es bedeutet psychische Widerstandsfähigkeit; die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und sie als Gelegenheit für persönlichen Wachstum zu nutzen. Zu Erwin Knopflers Zeiten kursierte noch nicht dieser Fachbegriff, doch die Fähigkeit gehörte selbstverständlich zum Tugend-Arsenal. Als politischer Gefangener in den 1930er-Jahren spielte Erwin Knopfler Schach, mit Papierschnipseln. Auf der Flucht vor den Nazis verliess er Ungarn 1939 und liess sich in Glasgow, Schottland, nieder. Erwin Knopfler war dort eine Zeit lang Mitglied in einer kommunistischen Partei und heiratete eine einheimische Lehrerin. Mark Knopfler beschrieb später seinen Vater als einen marxistischen Agnostiker.
Interessant, auch Geistiges lässt sich gewissermassen weitervererben – bei Mark ist sich die Fangemeinde zwar nicht sicher, wo genau seine geistige Heimat liegt, weil er darüber in der Öffentlichkeit nie eindeutig spricht, doch es wird tatsächlich vermutet, er sei Agnostiker. Jemand also, der die Existenz Gottes für möglich hält, es aber für unnötig hält, sich darüber zu streiten.
Streiten tun sich einige Fans zuweilen dennoch – bei der Frage, woran Mark Knopfler wohl glauben möge. Nicht selten versuchen sie dabei, ihr Idol ins eigene Boot zu locken. Jüdisch Gläubige hätten ihn am liebsten in ihren Reihen (Marks Vater war jüdischer Herkunft), andere beten für ihn, er möge Jesus Christus begegnen, und gewisse Atheisten versuchen, ihn auf ihre Seite zu zerren (www.celebatheists.com/ wiki/Mark_Knopfler). So ist das nun mal, alle möchten ihn gerne für sich gewinnen – das verspotte ich keineswegs, ich betrachte es als ein Zeichen dafür, wie sehr die Leute Mark Knopfler und seine Musik lieben. Mark selber hingegen schweigt bei solchen Themen. Es gibt zwar Songs von ihm mit ein paar kurzen Anspielungen auf christliche Werte und Formulierungen, doch höchstwahrscheinlich bezieht er diese nicht auf sich, sondern auf die in den erzählten Storys vorkommenden Protagonisten. Zum Beispiel im Song «Baloney Again» (vom Album «Sailing To Philadelphia» aus dem Jahre 2000), wo er über afroamerikanische Gospel-Musiker singt, die auf ihrer Tournee durch die USA schlecht und rassistisch behandelt werden.
Noch am ehesten konkret drückte sich Knopfler aus, als er am 10. November 1991 von David White (Radio 4MMM FM in Brisbane, Australien) interviewt wurde. Bei der Frage, ob er ans Schicksal glauben würde, antwortete er im typischen Agnostiker-Jargon – und irgendwie auch im Stile eines Mystikers, als er mehrmals betonte, dass wir nicht auf alle Fragen eine Antwort haben müssten, und dass es vieles verderben würde, wenn wir genau Bescheid wüssten. Die berühmte Weisheit des Nichtwissens also, und die kann im günstigen Falle tatsächlich ein möglicher Weg zur Demut sein.
Nun, wir waren beim Vererben von Eigenschaften. Natürlich wirken Länder, Orte und damit auch betreffende Musiktraditionen in die Menschenseele hinein. Und vielleicht lässt sich so was zumindest abgeschwächt oder indirekt später auch weitervererben. Ungarn, die Heimat seines Vaters, hat eine wunderbare Musikkultur; durchaus denkbar, dass davon in Mark Knopflers Universum eine Prise hängenblieb. Ungarische Volksmusik, wie sie auch von Roma gespielt wurde, galt seit dem 19. Jahrhundert weithin als «Zigeunermusik» (Zigeuner ist die heute umstrittene Bezeichnung für Roma, Sinti und Fahrende). Ein reisender, umherziehender Musiker wurde Mark Knopfler jedenfalls sehr wohl; der Spirit auf grossen und langen Welttourneen gleicht tatsächlich irgendwie dem eines fahrenden Musikers. Auch wenn «Zigeuner» natürlich nicht in grossen Hallen spielen, in Fünfsterne-Hotels logieren und im First Class Flugzeug reisen.
Doch ich denke darüber hinaus sogar an eine mögliche musikalische, melodische Parallele. Es gibt nämlich eine bestimmte Skala, welche «Zigeuner-Moll-Tonleiter» (auf Englisch «gipsy scale») oder auch «ungarische Tonleiter» genannt wird. Sie ist eine Variante der Molltonleiter und entspricht dem «Harmonischen Moll» mit zusätzlich erhöhter vierter Tonstufe. Musikersprache, braucht Sie nicht zu beeindrucken. Diese «ungarische Tonleiter» jedenfalls erzeugt in Melodien – ähnlich wie Harmonisch Moll – einen leicht orientalischen Anklang. Harmonisch Moll wird in westlicher Musik oft verwendet, Zigeunermoll vergleichsweise eher selten. Aber eben doch auch stellenweise; zum Beispiel dann, wenn ein Stück in Harmonisch Moll gespielt wird – von einem Blues-affinen Musiker, der scharf auf Blue Notes ist. Eine dieser legendären Blue Notes deckt sich zufällig nämlich genau mit jener erhöhten vierten Stufe der ungarischen Tonleiter. Bingo!
Ja und? Hat Knopfler das mal gespielt in einem Song? Selbstverständlich, von Anfang an! Es gibt unzählige Songs von ihm in Moll, die meisten sind in Harmonisch Moll, was auf der fünften Stufe einen Dur-Akkord bedeutet. In «Sultans Of Swing» zum Beispiel; der ist in D-Moll Harmonisch, auf der fünften Akkord-Stufe spielt Knopfler einen A-Dur (nicht einen A-Moll) Akkord, und beim Solieren (nicht nur im Haupt-Solo, auch bei zahlreichen Einwürfen während den Gesangspausen) bewegt er sich an den entsprechenden Stellen naturgemäss im Bereich der Harmonischen Moll-Tonleiter. Yeah, und beim Improvisieren rutschen bei ihm eben laufend diese triefend heissen Blue Notes hinein – genau dadurch landet er im Zigeuner-Moll aus Ungarn.
Na gut, das ist jetzt einigermassen spekulativ; bei diesen Blue Notes bezieht er sich womöglich einfach nur auf die Blues-Tradition. Doch es bleibt immerhin die Vorstellung, und die finde ich aufregend, dass bei dieser Knopfler-Affinität zur erhöhten vierten Tonstufe auf geheimnisvolle Weise vielleicht eben doch auch Vaters Herkunft aus Ungarn eine Rolle gespielt haben könnte …
Wir haben bisher nur über Marks Vater geredet. Typisch! Und seine Mutter? Die vererbte ihm höchstwahrscheinlich nicht weniger. Bei mir zum Beispiel kommt die Musikalität sogar deutlich mehr von meiner lieben Mutter (Marlise Köchli-Rapp); sie sang während meiner Kindheit mit Leidenschaft und viel Gefühl, und sie hatte diese melodische Fähigkeit, dabei jeweils intuitiv und problemlos bei jedem Lied eine zweite Stimme zur Original-Melodie hinzu zu finden. Das zeugt für ein sehr gutes Musikgehör (kein absolutes, sondern ein relatives) – genau davon kann ich heute zehren. Merci, Mama!
Doch irgendwie scheint es in unserer Gesellschaft noch immer so zu sein, dass über Väter tendenziell mehr erzählt wird als über Mütter. Auch bei der Recherche über Mark Knopflers Eltern fällt mir auf, dass in den Medien und im Kreise der Fans etwas mehr über Erwin Knopfler gesprochen wird als über Louisa Mary Laidler-Knopfler (1926-2018), Marks Mutter. Im Internet zirkuliert ein Foto von ihr aus Marks Kindheit – eine Frau mit herzlicher Ausstrahlung. Erwin Knopfler heiratete die junge Engländerin 1944 in Newcastle, wo 1947 ihr erstes Kind geboren wurde (Marks ältere Schwester Ruth, die 2020 mit 73 Jahren verstarb). Später zog die Familie in die Gegend von Glasgow, wo 1949 Mark und 1952 David geboren wurden; wir werden darüber gleich reden.
Ein paar wenige Informationen sind durchaus zu finden über Mutter Louisa Mary. Sie machte an der renommierten Universität Durham ihren Bachelor-Abschluss und wurde Lehrerin. Auf einer Webseite über die Schachgeschichte Schottlands ist zudem zu erfahren, dass Erwin Knopflers Ehefrau sich eine gewisse Zeit lang als Amateur-Schauspielerin engagierte. Eine sehr intelligente, kultivierte Frau also. Und musikalisch war sie auch; Louisa Mary spielte Klavier, und sie sang. Bei Knopflers zuhause war somit zweifelsfrei ein inspirierender, musikalischer Spirit spürbar – ein Glücksfall für Mark und seinen Bruder David. Vielleicht ist es ein Stück weit Klischee, dennoch bin ich überzeugt, dass in jungen Jahren der Geist, welcher in der Familie weht, entscheidend dazu beiträgt, bestimmte Fähigkeiten eines Kindes zu fördern. Ganz ohne Drill, einfach nur durch gute Vibes. Gerade in der Musik, die ja selber Verkörperung und Gestaltung von Schwingungen (Klangwellen) ist, können Vibes besonders schnell und nachhaltig wirken. Womöglich sogar bereits vor der Geburt, während der Schwangerschaft.
Nun, in der Timeline auf Knopflers Webseite hiess es, dass innerhalb der Familie die erste richtige Musikinspiration die eines gewissen Onkels Kingsley war, den Mark mit ungefähr 11 Jahren Boogie-Woogie-Piano und Bluesharp spielen hörte. Das stimmt sicherlich; es war die erste bewusste Inspiration. Doch unbewusst passierte höchstwahrscheinlich bereits vorher Entscheidendes. In einigen Interviews erzählte Mark später, dass bei Knopflers zuhause, als er ein kleines Kind war, offenbar (einen Plattenspieler hatten sie nicht) regelmässig gewisse BBC-Musiksendungen liefen, unter anderem die legendäre Kindersendung «Listen with Mother» mit viel Musik. Und noch wichtiger – dass seine Mutter oft mitsang, wenn im Radio beispielsweise Musical-Stücke liefen.
Die singende Mutter also. Da wird es mir warm ums Herz. Marks überaus feines Gespür für Melodien wurde später legendär. Wenn ich mir selber ein einziges kleines Talent zuschreiben darf, dann ebenso im Bereich des intuitiven Umgangs mit Melodien. Für mich keine Frage: Das verdanken wir unter anderem unseren Müttern! Den singenden Müttern. Nichts kann mehr berühren als eine Stimme.
Nun, ausstrahlen und in Menschenseelen hineinwirken können wie gesagt auch Landschaften, pulsierende Städte usw. Natürlich sind solche Einflüsse nicht konkret fassbar, nicht messbar, dennoch – auch die Frage «was hat der Ort aus mir gemacht?» ist berechtigt. Wiederum vor allem in jungen Jahren, wo der Mensch am durchlässigsten ist.
Die ersten sieben Jahre in Marks Leben wohnten die Knopflers in der Gegend von Glasgow. Glasgow, die berühmte Hafenstadt! Die grösste Stadt Schottlands, im Grunde eine Millionenstadt, wenn wir die Agglomeration hinzurechnen. War da in Glasgow womöglich irgendein Puls, der in Mark Knopflers Leben hineinwirkte?
Die Frage erübrigt sich. Glasgow war und ist eine Musikstadt – und was für eine! Raffinierte Marketing-Rhetorik eines Touristenbüros? Ich glaube, es steckt mehr dahinter, es trifft im Kern die Wahrheit. Glasgow ist eine lebendige Stadt mit höchst attraktiver Musikszene; «Glasgows musisches Herz pumpt den Rhythmus bis in die letzte Lebensader der Stadt », schreibt irgendein Werbetexter. In der Tat, internationale Acts geben sich dort auf grossen Bühnen die Klinke in die Hand, während sich Newcomer in den Pubs und Clubs inszenieren. Von Klassik bis Rock, von Punk bis Pipes, von Country bis Celtic – rund 130 Konzerte auf über 100 Bühnen finden jede Woche statt in Schottlands grösster Stadt, und das seit Jahrzehnten. Wow! Mit gutem Grund darf sich Glasgow seit dem Jahr 2008 deshalb mit der Auszeichnung «UNESCO City of Music» schmücken.
Und es ist mehr als bloss Quantität. «People make Glasgow»; die Menschen sind das, was Glasgow ausmacht. Wieder so ein Slogan, doch keine Frage – er spiegelt die Multikulturalität, den Kulturreichtum und den besonderen Charme dieses Ortes. Die «Scouser» (Einwohner Glasgows) gelten als die freundlichsten Menschen Schottlands. Glasgow wird regelmässig sogar zu einer der freundlichsten Städte der Welt gewählt. Da ist viel Wahres dran. Und dass diese Freundlichkeit ihren Anker während sieben Jahren auch in der Seele Mark Knopflers setzen konnte, bezweifelt heute kaum jemand. Er strahlt diese Freundlichkeit aus; alle, die ihm begegnet sind, scheinen es zu bestätigen.
Okay, das mag alles Zufall sein; Mark wäre vielleicht auch anderswo derselbe geworden. Allerdings, wenn ich mir die Liste der Musikstars ansehe, die in Glasgow geboren wurden, ist das schon beeindruckend – und inspiriert mich zur Aussage: Der Spirit von Glasgow hat das Zeug dazu, gute Früchte hervorzubringen.
Bitteschön, hier ein paar Namen zur Auswahl, geordnet nach Geburtsjahren:
1931 Lonnie Donegan, die Skiffle-Legende
1945 Al Stewart, eine meiner Lieblingsstimmen
1946 Donovan, das britische Pendant zu Bob Dylan
1948 Dick Gaughan, der hochkarätige Folksänger und Gitarrist
1949 Mark Knopfler
1950 John Paul Young, der Mann hinter dem Welthit «Love Is in the Air»
1952 David Knopfler, Marks Bruder
1953 Malcolm Young, der AC/DC-Rhythmusgitarrist
1955 Angus Young, der AC/DC-Leadgitarrist
1956 Maggie Reilly, die traumhafte Stimme in Mike Oldfields «Moonlight Shadow»
1959 Craig Armstrong, Komponist und Arrangeur für U2, Björk, Tina Turner, Madonna
1959 Jim Kerr, Mitbegründer der Simple Minds
1959 Eddi Reader, Sängerin bei Eurythmics, The Waterboys, Fairground Attraction
1959 Charlie Burchill, noch ein Mitbegründer der Simple Minds
1961 Jimmy Somerville, die legendäre Falsett-Stimme hinter Bronski Beat, The Communards
1964 Justin Currie, bekannt mit der Band Del Amitri
1987 Amy MacDonald, die Stimme vom Welthit «This Is the Life»
Viel und gute Früchte, nicht wahr? Dass Schottland in Mark Knopflers Musik Spuren hinterlassen hat, ist offensichtlich – in einigen seiner Songs (und in gewissen Filmsoundtracks) vermittelt er regelrecht den Eindruck, Ambassador der keltischen Musik zu sein. Für die keltische Tradition ein ausgesprochener Glücksfall. Ich würde sagen, dass Mark Knopfler dieser Kultur das zurückgibt, was er von ihr geschenkt erhielt: dieses ganz bestimmte Gefühl für zerbrechliche und tief ins Herz treffende Melodien. In der keltischen Musik sind diese Melodien zuhause, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden.
Nun, schauen wir, was in Mark Knopflers Timeline als Nächstes kommt; zwei Ereignisse im Abstand eines Jahres:
1955: At six, he hears Lonnie Donegan, and the music bug bites him hard.
1956: Mark and family move to his mother’s home town, Newcastle-upon-Tyne.
Im Grunde überschneidet sich beides. 1955 hörte Mark Knopfler zum ersten Mal den grossen Skiffle-Star Lonnie Donegan (1931-2002); das war noch in Glasgow. Und ein Jahr später, als Mark sieben Jahre alt wurde und zur Schule musste, zog die Familie weg aus Glasgow – in die Heimatstadt von Mutter Louisa Mary, nach Blyth. Blyth ist eine Kleinstadt im englischen Northumberland, an der Küste von Nordostengland, südlich des Flusses Blyth, etwa 21 Kilometer nordöstlich von Newcastle upon Tyne. Der Umzug war nicht gleich um die Ecke, von Glasgow nach Blyth sind es rund 200 Kilometer und rund drei Autostunden. Ein ziemlicher Wechsel auch in der Mentalität; keine Grossstadt mehr, klimatisch zwar ähnlich kalt und ungemütlich wie Glasgow, aber romantisch klein und verträumt, herrschte in Newcastle der typische Geordieland-Spirit. «Geordies» werden die dort lebenden Menschen genannt, und ebenso ihr ziemlich verrückter Akzent – wer von uns Nicht-Briten glaubt, gut Englisch zu verstehen, kann dort ziemlich auf die Welt kommen. «The most sexiest accent in the UK», behauptet die Zeitung The Telegraph; sehr eigenwillig klingt dieser Akzent. Penibel genau genommen dürfen sich zwar nur in Newcastle geborene Menschen echte Geordies nennen, doch Mark Knopfler bezeichnete sich später mehrmals als einer von ihnen – und Geordies (Geordie Boys) schafften es in mehrere seiner Songs («Why Aye Man», «Sailing to Philadelphia» oder «Fare Thee Well Northumberland»).
Die beiden Ereignisse in der Timeline (1955 und 1956) überschneiden sich; ich meine damit, dass Mark seinen soeben entdeckte Helden aus Glasgow (Lonnie Donegan) in der Schatzkammer seines Herzens mitnahm nach Northumberland. Donegans Einfluss wurde in der Tat nachhaltig und langfristig. Mark Knopfler schenkte ihm im Song «Donegan’s Gone» (2004 auf dem Album «Shangrila») ein würdiges Denkmal, und wann immer er mit Kennern unter den Journalisten über Musik sprach, fiel der Name Donegan.
Hanspeter «Düsi» Kuenzler, der in London lebende Schweizer Journalist, von dem ich erzählte, ist so ein Kenner. Als die beiden bei einem Interview 2005 über die damalige Jugendzeit und den Einfluss der Folk-Musik diskutierten, fiel neben Bob Dylan (den Knopfler 1964 mit 15 Jahren entdeckte) sehr schnell auch der Name Lonnie Donegan. Donegan erreichte Knopfler zuallererst; vor Hank Marvin, vor Bob Dylan, vor B.B. King, vor Chet Atkins, vor J.J. Cale und allen andern Inspirationsspritzen. Vielleicht ist jetzt hier genau der richtige Moment, um Knopfler zuzuhören, wie er in diesem exklusiven Interview von Donegan erzählt, wie er über ihn schwärmt. Danke, Düsi, dass ich das auf Deutsch übersetzen darf (obwohl es original in Englisch noch mehr Spass macht):
Mark Knopfler: «Wer mit 7 Jahren mit Skiffle-Musik anfängt, wie ich es tat, bekommt eine wirklich demokratische Sichtweise, eine britische Sichtweise. Lonnie Donegan war zwar Schotte (er wurde in Glasgow geboren), dennoch war er ein ‘Cockney’ (Spottname für die Bürger von London, Donegan lebte und wirkte die meiste Zeit in der Gegend von London). Man bekommt eine englische Sichtweise auf amerikanische Musik, die schwarz und weiss und allumfassend ist. Skiffle war ein grossartiger Einstieg für viele Musiker hier in diesem Land. Auch für Leute wie Joe Brown zum Beispiel (Brown war einer der englischen Rock’n’Roll Stars der ersten Stunde, und einer der ersten Sessionmusiker, welcher US-Grössen wie Gene Vincent, Eddie Cochran oder Johnny Cash in Europa begleitete).»
Knopfler weiter: «Als ich klein war, wusste ich nichts über Leadbelly oder Josh White, über Big Bill Broonzy oder über Ewan MacColl. Ich kannte Pete Seeger nicht, keinen von diesen Typen. Ich kannte nur Lonnie Donegan, der «The Battle of New Orleans» sang – und ich wusste, dass mir das gefiel! Es war mir egal, ob es schwarz oder weiss oder fröhlich oder traurig war, wir mochten es einfach.»
Kuenzler etwas später im Interview: «Um noch einmal auf den Song Lonnie Donegan’s Gone und die ganze Skiffle-Musik zurückzukommen; Martin Carthy (ein britischer Folkmusiker, der unter anderem Simon and Garfunkel zum Welthit ‹Scarborough Fair› inspirierte) beschrieb sie mir einmal als die erste Punk-Sache, weil jeder sie machen konnte und jeder Zugang dazu hatte.»
Knopfler: «Genau, richtig! Und die ganze Sache war sowieso ein Unfall. Denn Chris Barber (1930-2021, legendärer britischer Posaunist, Kontrabassist und Bandleader) hatte eine Jazzband, die er in dem Jahr gründete, in dem ich geboren wurde, und er hatte nicht genug Material fürs erste Album. Es waren alles junge Musiker in der Band, Lonnie Donegan war der Banjospieler, und Lonnie schlug vor, etwas Skiffle zu machen. Viele Leute wussten nicht, was der Begriff bedeutete. Auch heute noch gibt es verschiedene Theorien über Skiffle. Ich verstehe darunter eine Art von Musik, die bei den so genannten Skiffle-Partys in den USA gespielt wurde, bei denen man Eintritt verlangte, um die Miete bezahlen zu können. Wie in diesen ‘Shebeens’ (Bezeichnung für illegal betriebene Kneipen in Irland und Schottland, wo früher ohne die nötige Lizenz Alkohol verkauft wurde).»
Knopfler weiter: «Lonnie hatte Zugang zu einigen dieser Library of Congress-Aufnahmen (US-Nationalbibliothek, wo die legendären frühen Blues- und Folk-Fieldrecordings von Alan und John Lomax archiviert sind). All diese Sachen auf Barbers erster Platte wurden sehr schnell aufgenommen. Das ist tatsächlich Chris Barber, der bei ‘Rock Island Line’ (ein alter Eisenbahnsong, der in der Version von Lonnie Donegan 1956 zum Welthit wurde) den Bass spielt. Sie fingen an, einen Skiffle-Teil in ihr Konzertprogramm aufzunehmen. Viele der Jazzer waren ziemlich versnobt, was Skiffle anging. Aber Chris war das nie. Ich erinnere mich, als wir vor ein paar Jahren im Ronnie Scott’s (berühmter Jazz Club in London) ein Hillbilly-Stück spielten, war es wunderbar, Chris an der Posaune dabei zu haben; wir bildeten eine kleine Gruppe mit ein paar Saxofonen und Chris, und wir spielten Sachen wie ‘Feel Like Going Home’, das war einfach toll. Chris bewegt sich sehr geschmeidig zwischen Hillbilly-Musik, Blues und traditionellem Jazz.»
Von diesem Konzert im Ronnie Scott’s gibt es auf Youtube übrigens einen Ausschnitt zu sehen; mit Lonnie Donegan (aber leider keine Szene mit Chris Barber), zu finden unter Mark Knopfler and Lonnie Donegan perform at Ronnie Scotts 1998.
Lonnie Donegan und Chris Barber
Ich könnte stundenlang zuhören, wenn Knopfler über Skiffle redet, über Lonnie Donegan und über Chris Barber. Barber sah ich live, am 11. April 2013 in Zürich, beim Internationalen Dixie & Blues Festival im Albisgütli. Ein guter Freund von mir, Albi Matter, organisierte dieses Festival; ich produzierte das Programmheft, schrieb den Programmtext über Barber – und natürlich wollte ich die britische Jazzlegende dann auch auf der Bühne sehen. Er war umwerfend, mit damals 83 Jahren. Und Albi Matter erzählt heute noch davon, wie Barber nach dem Konzert bescheiden in die Restaurantküche trottete, um dort sehr konzentriert die Geldscheine seiner Konzertgage zu zählen. Ein Gentleman und Geschäftsmann der alten Schule.
Lonnie Donegan würde allein tausend Buchseiten füllen; er war für die Geschichte der Pop- und Rockmusik (vor allem in Europa) etwa so wichtig wie die Beatles, Elvis oder die alten Blueser. Wir müssen uns bewusst sein, dass es ohne Lonnie Donegan keine Beatles, keine Rolling Stones, keine Led Zeppelin, keine Queen oder keine Bee Gees geben würde. Und eben auch keine Dire Straits! Lonnie Donegan war der erste grosse Rock’n’Roll-Star in England; er löste im Grunde diese ganze wunderbare Welle aus auf unserem Kontinent – und zwar genau mit Songs wie «Rock Island Line» und «The Battle of New Orleans», die Knopfler erwähnte.
Vor allem mit «Rock Island Line», einem alten Folksong. Die Musikforscher Alan und John Lomax entdeckten dieses Lied 1934 während ihrer Besuche in Staatsgefängnissen in den US-Südstaaten. Blues-Legende Huddie William Ledbetter (genannt «Leadbelly», 1888-1949) nahm es erstmals auf, am 22. Juni 1937 in Washington D.C., für eben jene Library of Congress.
Yeah, und 20 Jahre später «fingen tausende von Kids in England an Gitarre zu spielen, nur weil sie diese Version von Lonnie Donegan hörten», wie Knopfler später erklärte. Donegan machte aus dem Song einen Welthit; er spielte ihn (in einer deutlich schnelleren Version als Leadbelly) erstmals 1953 während eines Konzertes in der Londoner Royal Festival Hall. Und im Juli 1954 kam er dann eben auf Chris Barbers Debüt-LP «New Orleans Joy» (zusammen mit «John Henry», einem zweiten Skiffle-Song). Im November 1955 veröffentlichte Decca Records beide Songs («Rock Island Line» auf der A-Seite) als Lonnie Donegans erste Single – sie stürmte in England die Charts, ebenso in den USA. Johnny Cash nahm den Titel 1957 auf, für seine LP «Johnny Cash With His Hot And Blue Guitar»). Das Wichtigste aber: Donegans Hit löste unter den britischen Teenagern die Skiffle-Welle aus, als der Song im Januar 1956 über das BBC Light Programm ausgestrahlt wurde.
Das alles sind nicht bloss Anekdoten der Musikgeschichte – es ist eine Schlüsselstelle! Allein schon ein kleines Detail beweist diese Tatsache: «Rock Island Line» gehörte von nun an auch zum Standardrepertoire einer englischen Amateur-Band namens Quarrymen; einer jungen Formation, 1956 gegründet von einem gewissen John Lennon, mit dabei seine beiden Schulfreunde Paul McCartney und George Harrison. Klingel’s? Die Beatles-Vorläuferband! Nicht mehr und nicht weniger …
Es gibt keinen Zweifel daran: Ohne Lonnie Donegan keine Beatles – und nichts von all dem, was später passierte. Das meine ich damit, wenn ich sage: Kein Mensch dieser Welt erfindet Musik neu; alles ist verwoben, verknüpft und mit der Vergangenheit verbunden. Donegan war eine Schlüsselstelle (obwohl auch er wiederum aus der Vergangenheit schöpfte). Ebenso Chris Barber, der Donegan die Chance gab, die Lawine überhaupt erst ins Rollen zu bringen.
Und weil diese Lawine damals eben auch den siebenjährigen Mark Knopfler mitriss – habe ich nun die wunderbare Gelegenheit, dieses Buch hier zu schreiben …
Ach ja, fast hätte ich es vergessen: Musik ist für die Ohren. Hören Sie sich Lonnie Donegans Version des Songs an, vielleicht auch noch die von Leadbelly; problemlos zu finden im Internet. Es gibt auch eine alte Filmaufnahme eines Live-Auftritts von 1961, auf Youtube unter Lonnie Donegan - RockIsland Line (Live) 15/6/1961; beeindruckend, wie Lonnie gemächlich beginnt und dann gegen Schluss völlig verrückt loslegt.
Noch was, eine kleine Anekdote diesmal: Donegan erhielt damals 50 Pfund für die Aufnahmesession mit Barber, aber keine Tantiemen für «Rock Island Line». Auch Barber nicht. Richtig gutes Geld verdiente mit dem Welthit nur die Plattenfirma. The same old story …
Wo waren wir in Mark Knopflers Biografie? Ach so ja, die Familie Knopfler zog 1956, als Mark sieben Jahre alt war, von Schottlands grösster Stadt Glasgow nach England, in die verträumte Kleinstadt Blyth in der Gegend von Newcastle upon Tyne. In Marks Musikherz hatte sich bereits Skiffle-König Donegan eingenistet; in Newcastle folgte nun schon bald die nächste überaus nachhaltige Inspirationsspritze. Und Newcastle würde später sogar mächtig stolz sein auf Mark; ziemlich viel später natürlich – dass der renommierte Fussballverein Newcastle United FC Knopflers Filmsoundtrack «Local Hero» (den Titelsong «Going Home») zur offiziellen Vereinshymne wählen würde, konnte der Siebenjährige damals nicht wissen.
Mark hatte in Schottland zwei Jahre lang die Bearsden Primary School in Schottland besucht; in Newcastle besuchten Mark und sein Bruder David nun die Gosforth Grammar School. Die einfachsten Schüler waren Mark und David vermutlich nicht, vor allem nicht für den Musiklehrer; durch Donegan hatten sie den wilden Skiffle-Sound für sich entdeckt, und durch ihren Onkel Kingsley auch das Boogie-Woogie Piano. Gegen Ende der 1950er-Jahre waren beide, Mark und David, mehr oder weniger hoffnungslos bereits vom Rock’n’Roll-Fieber befallen. In ihrer vielbeachteten Dire Straits-Biografie von 1991 schrieb die in London lebende deutsche Autorin und Musikhistorikerin Petra Zeitz, die beiden Brüder hätten das schulische Klavier damals «mit solcher Wucht bearbeitet», dass dem Musiklehrer, einem älteren Klassikliebhaber, «die Haare zu Berge standen». Eine filmreife Szene, und irgendwie auch ein Klischee. Es war wohl einfach der Normalfall damals: Eine Szene, welche sich in der westlichen Welt tausendfach täglich abspielte, weil eine neue Generation die Musikwelt auf den Kopf stellte. Und bei den beiden Knopfler-Boys kam noch hinzu, dass sie auch die damals übliche Art des Erlernens eines Musikinstrumentes auf den Kopf stellten. Beide weigerten sich nämlich, nach Noten zu spielen; weil sie eben einfach auditive (und nicht visuelle) Lerntypen sind – so wie das erstaunlich viele Menschen sind.
Nur schon ein Jahrzehnt später, als ich 1970 als Achtjähriger in der Schweiz begann, Gitarre zu spielen, stiess ich mit demselben Fimmel (ich wollte nichts wissen von Noten, mein Gehör war viel schneller als der Verstand) bei meiner Gitarrenlehrerin, einer älteren Dame, auf erstaunlich viel Verständnis. Ein blosser Glücksfall? Für mich jedenfalls war es Gold wert, und ich werde Frau Murer nie vergessen. Heute ist das meist sowieso selbstverständlich; gute Musiklehrer: innen unternehmen alles, um die Kinder individuell zu fördern und dort abzuholen, wo ihre spezifischen Fähigkeiten liegen. Dieser Mentalitätswechsel erfolgte sozusagen auf natürliche Weise, weil ein beträchtlicher Teil der heutigen Musiklehrer: innen selber auch auditiv veranlagt sind und früher so lernten.
Nun, zur Zeit von Mark und David Knopfler war es noch ein gehöriges Stück schwieriger – doch die beiden waren offenbar cool und dickköpfig genug, sich durchzusetzen. Zum guten Glück!
Aber eben, das Wichtigste sind die Inspirationsspritzen, die ganz grossen Schlüsselerlebnisse – für ein Musiker-Leben können sie entscheidend sein. Bei Mark passierte es im Sommer 1960, mit elf Jahren. Und es passierte sozusagen vor der Haustüre; in Newcastle, wo ein dort ansässiger 19-jähriger Gitarrist drauf und dran war, mit einem eigenen Sound und einem ganz bestimmten Instrumentalstück die Welt zu erobern.
Hank Marvin
Der legendäre Hank Marvin bringt mich nun wiederum in Verlegenheit, aus zwei Gründen. Einerseits, weil der Mann derart wichtig war (und glücklicherweise noch immer ist) im Puzzle der Musikgeschichte, dass er problemlos ein separates Buch füllen würde. Da wir nun hier aber den Fokus auf Mark Knopfler richten, kann ich Hanks Story leider nur kurz streifen.
Und andererseits, weil die Geschichte Hank Marvins unter anderem eben auch meine eigene berührte. Genau jenes berühmte Gitarrenstück «Apache» nämlich war per Zufall die erste Single, die ich besass, und die erste Gitarrenmelodie, die ich erlernte. Nicht 1960 allerdings, sondern elf Jahre später, als ich 1971 nach dem ersten Jahr Gitarrenunterricht mir für das Schulabschluss-Konzert diesen Challenge aufbrummte. Irgendwie habe ich es als Neunjähriger hingekriegt, den Shadows-Hit auswendig zu lernen, natürlich ohne die geringste musiktheoretische Ahnung, was ich da genau spielen würde. «Apache» war mein allererstes Erfolgserlebnis, zu einem Zeitpunkt, wo ich von all den andern Helden (den Rock’n’Rollern und Bluesern, den Beatles, den Rolling Stones, von Dylan, Clapton, Knopfler, J.J. Cale, Ry Cooder und vielen anderen) noch nicht die geringste Ahnung hatte. Natürlich ist meine Jugend hier nicht unser Thema; meine persönliche Geschichte mit Hank Marvin ist ohnehin nicht sehr spektakulär, weil Marvins Funken seinerzeit natürlich zigtausend Musiker: innen meiner Generation traf.
Eine glückliche Fügung ist es dennoch, dass Hank Marvin damals unzählige berühmte und weniger berühmte Gitarristinnen und Gitarristen entscheidend zu prägen vermochte. Glücklich auch deshalb, weil so was heute womöglich nicht mal mehr stattfinden könnte; die Entstehungsgeschichte von Hank Marvins «Apache», der gesamte kulturelle Hintergrund, das alles ist Ausdruck einer oberflächlichen, romantisierenden Vorstellung vom Indianer-Leben. Ein Klischee, ein Mythos. So was würde inzwischen ohne Zweifel ins Visier der «Woke»-Polizei geraten; ein Stück wie «Apache» würde heute garantiert kein Welthit mehr werden können.
Der englische Songwriter und Komponist Jerry Lordan (1934 – 1995) schrieb die Melodie in den späten 1950er-Jahren, und Lordan wurde zu diesem Stück Musik inspiriert, nachdem er 1954 den amerikanischen Western «Apache» gesehen hatte; er wollte «etwas Edles und Dramatisches» komponieren, um damit den Mut und die Wildheit des indianischen Apachen-Kriegers Massai (gespielt von Burt Lancaster) auszudrücken. Wir wissen, was mit solchen Klischees im aktuellen Zeitgeist passiert; sie kommen auf die schwarze Liste – Bücher aus jener Zeit werden umgeschrieben, Filme aus dem Fernsehprogramm gestrichen. Der Begriff «Indianer» ist aus heutiger Sicht zurecht ein No-Go; korrekt sollte es heissen «Angehöriger indigener Stämme», «Native Americans». Zensur dieser Art geschieht an sich mit guten Absichten, es ist notwendig, Geschichte aufzuarbeiten, Sprache weiterzuentwickeln. Wenn ideologischer Übereifer jedoch bewirkt, dass Kunst und Kultur auf der Strecke bleiben, ist es fragwürdig. Jedes Kunstwerk dieser Welt verkörpert letztlich immer nur ein Klischee, eine naturgemäss beschränkte Perspektive. Keine Künstlerin und kein Künstler dieser Welt kann etwas vollkommen objektiv und «ganz» darstellen, jedes Kunstwerk bleibt eine subjektive, begrenzte Sicht. Und vor allem eine Sicht, die später mit Sicherheit sich verändern und weiterentwickeln wird. Wenn wir neuerdings damit rechnen müssen, dass aktuelle Kunst von der nächsten Generation zensuriert, umgeschrieben oder verboten wird – erstickt das jede Leidenschaft dafür, im Kontext unserer augenblicklichen Empfindungen und Sichtweisen überhaupt noch Werke zu erschaffen.
Nun, ich will damit nur sagen: Wir sind froh und dankbar, dass Hank Marvin damals frei und ganz nach seinem Gusto arbeiten konnte, dass er mit seiner romantisierenden Apache-Interpretation ganze Heerscharen von künftigen Guitar Heroes auf den Weg schickte, unter anderem eben auch Mark Knopfler.
Hank Marvin war zu einem gewissen Zeitpunkt vor allem in England eine musikhistorische Schlüsselstelle – und gleichzeitig zeigt seine Biografie schonungslos auf, woher das ganze Zeug in Wirklichkeit kommt. Marvin wurde als Brian Robson Rankin 1941 in der Stanhope Street 138 in Newcastle upon Tyne, England geboren; in derselben Gegend, in welcher Mark Knopfler später aufwuchs. Zur Gitarre fand Hank erst mit 16 Jahren (vorher spielte er Banjo und Klavier), als er 1957 Buddy Holly hörte, den soeben aufgehenden Stern am Rock’n’Roll-Himmel. Marvin beschaffte sich augenblicklich eine Gitarre, liess sie nicht mehr los und versuchte, vom Spiel der damaligen Guitar Heroes so viel wie möglich aufzuschnappen; neben Buddy Holly vor allem von Scotty Moore mit Elvis, Cliff Gallup mit Gene Vincent, Chuck Berry, James Burton mit Ricky Nelson – Hank war verrückt nach diesem Art Gitarrensound. Es gab zudem eine Single namens «The Fool» von Sanford Clark (erschienen im Juni 1956) mit einem Gitarrenriff, welches Hank nicht mehr losliess (er verwendete das beinahe selbe Riff schon bald später, um zusammen mit Jet Harris den Song «She’s Gone» zu schreiben).
Dieses Riff war genau genommen ein Blues-Lick, eine Gitarrenphrase, wie sie in der Blues-Geschichte seit den 1930er-Jahren so ähnlich an jeder Strassenecke gespielt wurde (etwas überspitzt formuliert). Das meinte ich vorhin mit dem Ausdruck «woher das ganze Zeug in Wirklichkeit kommt»; «the Blues had a baby and they named it Rock’n’Roll», wie Muddy Waters so schön sagte. Der Blues wiederum war natürlich auch «nur» ein Baby, ohne die Gospel-Musik würde es ihn nicht geben (wie ich im Buch «Holy Blues» detailliert aufzeige). Geschichte ist eine Verkettung; ich bin überaus dankbar für diese Kette von Ereignissen, die letztlich eben auch Gitarristen wie Hank Marvin und Mark Knopfler hervorbrachte.
Hank Marvin zog schon ein Jahr später (1958) nach London, um dort sein Glück zu versuchen. Er und sein Schulfreund Bruce Welch trafen Johnny Foster, Cliff Richards Manager, und beide spielten sehr bald in Richards Band The Drifters. Der Rest ist Geschichte; 1959 kaufte Cliff Richard in den USA für seinen neuen Gitarristen Hank Marvin eine fiesta red Fender Stratocaster – diese rote Strat gilt heute als die erste Fender Stratocaster, die auf europäischem Boden landete. Cliff Richards Band änderte bald darauf ihren Namen und hiess von nun an The Shadows; diese Shadows spielten künftig sowohl mit Cliff Richards als auch solo, und vor allem solo ging 1960 plötzlich die Post ab – mit eben diesem instrumentalen Welthit «Apache», dem vier weitere Nummer-1-Hits folgten (darunter «Wonderful Land», das acht Wochen lang die UK-Charts anführte, länger als jeder Beatles-Hit).
Hank Marvin gilt heute als erster (oder zumindest als einer der allerersten) britischen Gitarrenhelden. Er wurde legendär durch sein gefühlvolles, melodiöses Spiel sowie durch die Verwendung des Volumen-Pedals. Sein Sound und seine Phrasierung, die an den menschlichen Gesang erinnert, sind einzigartig und beeinflussten neben Mark Knopfler unzählige britische Rockgrössen wie George Harrison, Eric Clapton, David Gilmour, Brian May, Peter Frampton, Steve Howe, Roy Wood, Tony Iommi, Pete Townshend, Jeff Beck und Jimmy Page. Sein Einfluss ging selbstverständlich über Europa hinaus; zu seinen Fans der ersten Stunde zählen zum Beispiel auch der australische Gitarrenvirtuose Tommy Emmanuel oder die US-amerikanische Folkrock-Legende Neil Young (der ihm auf dem Album «Harvest Moon» den Song «From Hank to Hendrix» widmete).
Noch heute ist Hank Marvin in bester Form, sprüht mit über 80 Jahren vor Spielfreude und machte neulich auf überzeugende Weise auch bei Mark Knopflers Charity-Version von «Going Home» («Local Hero») mit, zusammen mit 60 legendären Musikerinnen und Musikern (wir werden darüber in Band 2 reden). Knopfler verdankt der damaligen Hank Marvin-Initialzündung von 1960 viel und bat seinen ehemaligen Lehrer bereits zu Dire Straits-Zeiten mehrmals als Gast auf die Bühne.
Übrigens, wie lief das denn damals eigentlich genau mit diesem berühmten «Apache»-Hit; Hank Marvin schrieb das Stück bekanntlich nicht selber, und er war auch nicht der Erste, der es aufnahm. Warum traf der Schuss bei ihm ins Schwarze?
Ursprünglich wurde der Song Anfang 1960, vor den Shadows also, von einem gewissen Bert Weedon aufgenommen; einem britischen Gitarristen, von dem wir gleich sprechen werden. Diese Aufnahme blieb aufgrund von Promotions- und Label-Problemen jedoch während Monaten in der Schublade liegen. Der Komponist des Stücks (Jerry Lordan) liebte Weedons Version ohnehin nicht besonders; er spielte deshalb den Shadows auf ihrer Cliff Richard-Tournee den Song auf seiner Ukulele vor. Die Shadows waren Feuer und Flamme für Lordans markante Melodie, nahmen die Nummer unverzüglich im Juni 1960 auf und veröffentlichten sie einen Monat später. Etwa zur gleichen Zeit kam dann doch auch Weedons Version heraus, und obwohl sie vereinzelt durchaus gute Kritiken erhielt und es immerhin auf Platz 24 der britischen Charts schaffte, machte Hank Marvins Version in kommerzieller Hinsicht haushoch das Rennen – sie wurde zu einem regelrechten Welthit.
Dieser Weedon jedoch, der war keineswegs ein Nobody oder gar ein stümperhafter Gitarrist, weit gefehlt! Bert Weedon (1920 – 2012) war schon eher so was wie ein richtungsweisender Vater für Hank Marvin – und für eine ganze Menge weltberühmter britischer Gitarristen, unter anderem eben auch für Mark Knopfler.
Bert Weedon
Ich gebe gerne zu, dass ich diesen Mann nicht kannte, bevor ich für dieses Buch hier recherchierte. Es ist irgendwie typisch; wir alle werden medial seit vielen Jahrzehnten mit Infos über die grossen Stars der Musikgeschichte gefüttert, doch entscheidende kleine Details in dieser Geschichte werden nicht selten ignoriert. Aus Angst, dass sie gefährlich werden könnten für den Mythos der grossen Genies, welche unsere Popmusik oder bestimmte andere Genres angeblich erfunden haben? Seien wir ehrlich; wir können es uns schwer vorstellen, dass legendäre Musiker und Gitarrengötter wie Eric Clapton, Brian May, Paul McCartney, George Harrison, John Lennon, Pete Townshend, Keith Richards, Sting, Hank Marvin, Robert Smitz, Mike Oldfield, Jimmy Page und eben auch Mark Knopfler – dass derart begnadete Musiker damals in ihrer Kindheit mit Hilfe eines Gitarrenlehrbuches ihre ersten und entscheidenden Gehversuche machten, in einer (pardon) stinknormalen Weise, so wie Millionen von andern Gitarre lernenden Kindern. Die Fantasie, dass unsere Gitarrenhelden auf geheimnisvolle Weise und ohne fremde Hilfe den Zauber ihrer Kunst entweder als göttliches Geschenk in die Wiege kriegten oder auf höchst eigenwillige Weise selber erlernten – diese Vorstellung ist irgendwie viel aufregender, und kommerziell wohl auch besser verwertbar.