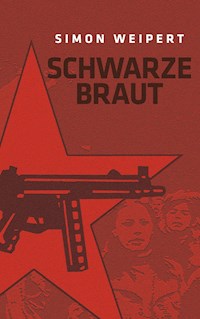Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Erzählungen über die Suche nach einer Heimat im wörtlichen wie im übertragenen Sinn: In Mashava macht sich eine junge Afrikanerin auf den Weg nach Europa, einer ebenso ungewissen wie gefahrvollen Zukunft entgegen. Die Villa am Stadtrand erzählt, beginnend mit den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts, zwei Episoden aus der tragischen und am Ende doch hoffnungsvollen Geschichte einer jüdischen Familie. Die Fremde beschreibt einen Abschnitt aus dem kurzen Leben der 19-jährigen Elisa, die weit reist und doch immer eine Fremde bleibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Mashava
Die Villa am Stadtrand
Die Fremde
Mashava
Wie der ferne Widerschein einer verlorenen Welt erhoben sich die Ruinen der Stadt aus der Savanne des südlichen Afrika. Langsam bewegte sich die Reisegruppe im Licht der untergehenden Sonne auf die ringförmige Mauer zu, die die Gegenwart von der Vergangenheit trennte. Als sie kurz darauf die schmale Pforte durchquerten, die den Weg ins Innere eröffnete, warfen die Stadtmauer und der Turm neben ihr bereits lange Schatten, während die Spitze des Turmes die rötlichen Sonnenstrahlen aufsog wie ein Elixir des Lebens. Der runde, aus eher kleinen, rechteckigen Steinen gemauerte Turm war unten breiter und verjüngte sich zu seiner erleuchteten Krone hin wie der Stamm eines Baumes, der langsam dem Himmel zustrebte. Rebecca fragte sich, was sich einst im Inneren verborgen haben mochte, und erinnerte sich vage daran, in der Vergangenheit einen ähnlichen Turm gesehen zu haben, auch wenn sie nicht mehr wusste, wann und wo es gewesen war. Für einige Zeit ließ sie ihre Augen über die Fundamente der Häuser im Inneren der Stadtmauer schweifen, doch kehrte ihr Blick immer wieder zu dem Turm zurück und zu den unbestimmten, fernen Erinnerungen, die mit ihm verbunden waren, bis die Gruppe schließlich die Große Einfriedung verließ und sich auf den Weg zu einer Ansammlung von Gebäuden begab, die an der Spitze eines Hügels deutlich zu erkennen waren. Nach einem halbstündigen, beschwerlichen Aufstieg in der noch immer feucht-heißen Abendluft erreichten sie schließlich den Gipfel des Berges und nahmen die Bauten in Augenschein, von denen einige wirkten, als seien sie den umgebenden Felsen entsprossen. Um in das Innere der Ansiedlung zu gelangen, mussten die Reisenden mehrere enge, niedrige Gänge durchqueren, die in der beginnenden Dämmerung bereits in tiefer Finsternis lagen und in Rebecca ein leichtes Gefühl der Beklemmung weckten, bevor sie schließlich die höchste Stelle erreichten, von der aus sich ein weiter Ausblick über die Ruinen und das sie umgebende Buschland bot. Nachdem der Reiseleiter ihnen einige Erläuterungen zur Geschichte und zu den Bauten von Groß-Zimbabwe gegeben hatte, kehrte die Gruppe mit Rebecca, Christian, Judith und Désirée schließlich ins Tal zurück, wo der Bus auf sie wartete. Für sie alle war die zu Ende gehende zweiwöchige Urlaubsreise durch Südafrika und Zimbabwe eine Belohnung für ein Jahr harter Arbeit gewesen. Rebecca hatte in den letzten Monaten als Pianistin mehrere Konzerte gegeben, die für sie immer mit großer Anspannung verbunden waren. Ihr Freund Christian hatte neben seiner Tätigkeit an der Universität seine Promotion abgeschlossen und erste Vorarbeiten für eine spätere Habilitation in Angriff genommen. Judith, die ihrer Schwester Rebecca mit ihren lockigen dunkelbraunen Haaren und ihren ausdrucksvollen, leicht melancholischen Augen nicht nur äußerlich sehr ähnlich war, arbeitete seit fast zwei Jahren als Assistenzärztin am Frankfurter Universitätsklinikum, während Désirée, die Rebecca vor einigen Jahren zufällig an der Musikhochschule kennengelernt hatte, in Darmstadt im zweiten Semester Maschinenbau studierte und nebenher in ihrem ursprünglichen Beruf als Gebäudereinigerin arbeitete. Mit dem Geld, das sie auf diese Weise verdiente, finanzierte sie nicht nur teilweise ihren Lebensunterhalt, sondern auch den Ratenkauf eines Klaviers, mit dem sie sich mit Rebeccas Hilfe den lange gehegten Traum erfüllte, ein Musikinstrument zu erlernen. Désirée war ein wenig größer als Rebecca und Judith und wirkte durch jahrelange körperliche Arbeit kräftig und sportlich, doch zeigten sich in ihrem Gesicht trotz ihrer 32 Jahre bereits einige Falten, und ihr Haar war an manchen Stellen leicht ergraut, auch wenn diese Spuren schmerzlicher Erlebnisse in der Vergangenheit aufgrund ihrer schwarzen Hautfarbe nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen waren.
Am nächsten Tag, dem letzten ihrer Reise durch Südafrika und Zimbabwe, unternahmen die Touristen mit dem Reiseleiter einen Ausflug zum Mutirikwi-Stausee, der etwas mehr als eine Stunde Fahrzeit von ihrer Unterkunft in der Nähe von Groß-Zimbabwe entfernt war. Désirée hingegen hatte beschlossen, eigene Wege zu gehen und ihre nahe gelegene ehemalige Heimatstadt Mashava zu besuchen.
»Euch erwartet ein schöner Tag«, sagte sie am Morgen zu Rebecca, Christian und Judith. »Es ist eine reizvolle Gegend, und mit ein wenig Glück sieht man sogar einige Nashörner.«
»Ich glaube auch, dass wir an der Landschaft Gefallen finden werden. Seen haben mich schon immer angezogen«, antwortete Rebecca und fragte: »Wann fährt dein Bus nach Mashava?«
»In gut einer Stunde. Wenn ihr abends zurückkehrt, bin ich wieder da. Es wird für mich faszinierend sein, zu sehen, wie sich die Stadt in den vergangenen 17 Jahren entwickelt hat.«
»Du warst seit deiner Auswanderung nie mehr dort …«, sagte Judith.
»Nein«, erwiderte Désirée. »Mittlerweile leben nur noch einige entfernte Verwandte in Mashava. Vielleicht werde ich trotzdem einige Leute treffen, die sich noch an mich erinnern.«
In diesem Augenblick hielt der Bus des Veranstalters vor dem Hotel, und der Reiseleiter bat die Gruppe einzusteigen. Nachdem sie sich von Désirée verabschiedet hatten, bestiegen Rebecca, Christian und Judith den Bus und ließen während der Fahrt die weite, trockene, bisweilen trostlose Savanne auf sich wirken, bis sie den Stausee erreichten, der ihnen wie eine unwirkliche Idylle in der abweisenden Steppe erschien. Die drei unternahmen mit dem Reiseleiter eine kurze Wanderung und verbrachten anschließend den Nachmittag am See. In der beginnenden Abenddämmerung blickte Rebecca in die Ferne, auf die vulkanartigen Berge am Horizont und die einige Kilometer entfernte Staumauer, die von aufsteigendem Dunst halb verdeckt war. Während der feine Nebel sich langsam vom Ende des Sees her ausbreitete, erschien in Rebeccas Phantasie wieder der Turm in der Einfriedung von Groß-Zimbabwe und mit ihm jene vage Erinnerung, die am Tag zuvor kurz ihr Bewusstsein gestreift hatte. Wenig später kehrten Rebecca, Christian und Judith mit den anderen ins Hotel zurück, wo Désirée in der Lobby schon auf sie wartete. Nachdem alle vier geduscht hatten, trafen sie sich im Hotelrestaurant und erzählten einander während des Abendessens von ihren Erlebnissen.
»Es ist wirklich eine schöne Landschaft«, sagte Christian nach einer Weile und fügte hinzu: »Ich habe in der Tat am anderen Seeufer einige Nashörner gesehen, die aber sofort wieder das Weite gesucht haben.«
»Ja, trotz ihrer Größe sind sie oft eher scheu«, antwortete Désirée mit einem Lächeln, bevor Christian sie fragte, wie ihre kurze Reise in ihre ehemalige Heimat verlaufen sei.
»In etwa so, wie ich es erwartet hatte. Mashava sieht noch fast genauso aus wie vor fast 20 Jahren, aber es sind mir nur wenige Menschen begegnet, die ich kannte. Die meisten meiner Verwandten leben mittlerweile anderswo, und auch viele ehemalige Bekannte sind weggezogen oder ausgewandert. Immerhin habe ich eine Schulfreundin getroffen, die mir erzählt hat, dass sich eine Cousine, zu der ich allerdings nie Kontakt hatte, ebenfalls auf die Reise nach Europa gemacht hat. Wer weiß? Vielleicht werde ich eines Tages erfahren, was aus ihr geworden ist, auch wenn wir uns nicht kennen.«
»Was hat euch eigentlich damals im Einzelnen zur Auswanderung bewogen?«, fragte Christian.
»Zunächst einmal die wirtschaftliche Lage. Wie viele andere Städte in Zimbabwe hatte auch Mashava mit einer zunehmenden ökonomischen Misere zu kämpfen. Das Asbestwerk und eine Goldmine mussten schließen, und auch meine Eltern als Besitzer eines kleinen Supermarkts bekamen die Folgen zu spüren, denn viele Leute haben damals die Stadt verlassen oder hatten wesentlich weniger Geld zur Verfügung. Manchmal fürchteten meine Eltern schon um unsere Existenz … Außerdem spielte auch die politische Situation eine Rolle, die Diktatur, der Personenkult um den Präsidenten und die zunehmende Gewalt. Auch ich und unsere Familie haben einige Erfahrungen damit gemacht … Es fing an mit einem Klassenausflug nach Groß-Zimbabwe, den wir gut ein Jahr vor unserer Emigration nach Europa unternahmen. Wir erfuhren dabei wenig über die Geschichte dieses Ortes. Stattdessen pries der Lehrer unablässig unseren Präsidenten, der angeblich von den Herrschern von Groß-Zimbabwe abstammte. Ich war genervt und habe einer Mitschülerin zugeflüstert: ›Der Präsident ist auch nur ein Mensch wie wir alle.‹ Leider hat die Klassenkameradin sofort laut wiederholt, was ich gesagt hatte. Daraufhin hat der Lehrer mir zwei schmerzhafte Ohrfeigen verpasst, so dass ich für einige Augenblicke ohnmächtig wurde. Danach wurden meine Eltern vorgeladen, und ihnen wurde klargemacht, dass auch sie die Folgen meiner Verfehlungen zu spüren bekämen, wenn ich in der Schule noch einmal auffiele. In den folgenden Wochen und Monaten haben wir dann bemerkt, dass immer wieder mit Stöcken bewaffnete Jugendliche und junge Männer aus der Partei des Präsidenten drohend vor unserem Supermarkt herumlungerten, was sich natürlich auch negativ auf das Geschäft ausgewirkt hat. Glücklicherweise waren mir meine Eltern nicht böse, sondern hatten Verständnis für meine Neigung zur Rebellion, zumal sie meine Ansichten über das Regime des Präsidenten teilten. Auf jeden Fall wurden unter anderem durch diesen Zwischenfall unsere Auswanderungspläne konkreter. Immerhin hatten wir das große Glück, zu den Wohlhabenden zu gehören, die über größere Ersparnisse verfügten, so dass wir den Flug nach Europa selbst finanzieren konnten, ohne auf die Hilfe von Menschenhändlern angewiesen zu sein. Meine Eltern hatten den Plan, in Deutschland später einen Supermarkt zu betreiben, wie sie es in Mashava getan hatten. Freilich war damit ein erhebliches Risiko verbunden, weil klar war, dass unser kleines Vermögen dafür nicht ausreichen würde. Da aber die Geschäfte in Mashava zunehmend schlechter liefen und auch immer öfter die Banden der Partei und gewöhnliche Kriminelle die Gegend um unseren Markt unsicher machten, haben wir uns schließlich auf die Reise ins Ungewisse begeben. Nach unserer Ankunft in Deutschland haben meine Eltern zunächst längere Zeit als Angestellte in einem Supermarkt gearbeitet, während ich Deutsch lernte und zur Schule ging. Freilich musste ich mich vorerst mit dem Hauptschulabschluss begnügen, weil ich so schnell wie möglich Geld verdienen und zu unserem Familieneinkommen beitragen wollte. Deshalb habe ich zunächst eine Ausbildung zur Gebäudereinigerin gemacht und mehrere Jahre in diesem Beruf gearbeitet, obwohl ich eigentlich von einem Ingenieurstudium geträumt habe. Mit der Zeit hat sich dann allerdings die politische Lage in Europa so zugespitzt, wie ich es nie erwartet hätte, und auch dieses Mal hat mir meine rebellische Ader einige Probleme eingebrockt«, sagte Désirée und senkte den Kopf, bevor sie nach einem Augenblick fortfuhr: »Trotzdem habe ich es nie bereut.«
»Du warst mutiger, als es viele Europäer je gewesen wären«, erwiderte Rebecca.
»Ich weiß nicht … Unter meinen Leidensgenossinnen waren damals auch viele Europäerinnen … Auf jeden Fall habe ich hinterher beschlossen, das Abitur zu machen und Maschinenbau zu studieren, nachdem meine Eltern inzwischen ihren eigenen Supermarkt aufgebaut hatten und in der Lage waren, mich finanziell ein wenig zu unterstützen.«
»Es ist erstaunlich, dass du es geschafft hast, neben deiner Arbeit die Vorkenntnisse in Mathematik und den Naturwissenschaften zu erwerben, die man für ein Ingenieurstudium braucht«, sagte Judith.
Désirée errötete unmerklich und antwortete: »Ich habe oft die halbe Nacht daran gearbeitet. Außerdem hatte ich schon immer ein besonderes Verhältnis zu Zahlen … Sie lügen nicht, im Unterschied zu vielen Menschen, die glauben, im alleinigen Besitz der Wahrheit zu sein.«
»Das stimmt«, entgegnete Christian, und alle vier lachten. Wenig später gingen Rebecca, Christian, Judith und Désirée früh zu Bett, weil ihre lange Heimreise nach Frankfurt schon im Morgengrauen des nächsten Tages beginnen würde.
Nachdem sie um sechs Uhr aufgebrochen waren, fuhren die Mitglieder der Reisegruppe zunächst mit ihrem Bus nach Harare und flogen von dort nach Johannesburg, wo sie um neun Uhr abends ihren Flug nach Europa antraten. In der Nacht, während Christian, Judith und Désirée schliefen, öffnete Rebecca die Blende ihres Fensters und blickte im Licht des Halbmonds auf das dunkle Land tief unter ihr, das nur manchmal unter hellgrauen Wolken oder leichtem Dunst verschwand. Der einsame Kontinent weckte in ihr Erinnerungen an die Ruinen von Groß-Zimbabwe, den geheimnisvollen Turm in der Großen Einfriedung und an den Mutirikwi-Stausee, über dessen Oberfläche sich in der Abenddämmerung aufsteigende Nebelschwaden ausbreiteten. Während sie einschlief, verschmolzen all diese Eindrücke mit früheren Erlebnissen zu einer fernen Traumwelt, deren Bilder noch längere Zeit in Rebeccas Phantasie lebendig blieben, nachdem sie wieder aufgewacht war, während das Flugzeug die Sahara überquerte. Schließlich jedoch ließ sie der Anblick der endlosen Dünen und Sandflächen, die manchmal von dunklen Gebirgszügen durchbrochen wurden, noch einmal in einen Traum eintauchen, in dem sie als nächtliche Wanderin eine Landschaft durchquerte, deren Weite und Einsamkeit sie schon in ihrer Jugend als ebenso faszinierend wie bedrohlich empfunden hatte, erfüllt von fremdartigen Wesen und einer Nähe zur Unendlichkeit des Alls, die vielleicht nirgends so unmittelbar zu spüren war wie an diesem Ort.
Als sie etwas mehr als eine Stunde später erwachte, wurde bereits das Frühstück serviert. Bald darauf überflogen sie im Morgenlicht die Gipfel der Schweizer Alpen und näherten sich ihrer Heimatstadt, die sie kurz vor acht Uhr erreichten.
Nach der Landung verabschiedeten sich die vier am Flughafen voneinander. Rebecca umarmte Désirée und ihre Schwester, mit der sie fast jeden Tag telefonierte, bevor sie und Christian ins Westend fuhren, wo sie seit Jahren gemeinsam lebten. Auch Judith kehrte in ihre Dachgeschosswohnung in Frankfurt-Rödelheim zurück und verbrachte den Tag mit Einkäufen und Besorgungen, bevor sie am Abend todmüde einschlief, während in der Oktobernacht die Dunkelheit anbrach. Als sie während der frühen Morgenstunden kurz aufwachte, erinnerten sie nur der ferne Schein der Straßenlampen und das unablässige Rauschen des Verkehrs daran, dass viele Menschen in der Stadt nie zur Ruhe kamen.
Zu dieser Zeit, es mochte gegen vier Uhr morgens sein, taumelte eine junge Frau durch die Straßen des Bahnhofsviertels. Sie wirkte wie betrunken und am Ende ihrer Kräfte, doch nahmen die Drogensüchtigen, Obdachlosen, Prostituierten, Zuhälter und die noch immer zahlreichen, nach Abenteuer und Vergnügen gierenden Nachtschwärmer keine Notiz von ihr oder empfanden sie allenfalls als lästiges Hindernis, während sie eine letzte Rettung suchte, die nicht weit entfernt war und doch unerreichbar schien. Etwa zwei Stunden später, in der sich ankündigenden Morgendämmerung, brach sie in der Notaufnahme der chirurgischen Universitätsklinik bewusstlos zusammen. Die Ärztin, die ihr zu Hilfe eilte, diagnostizierte einen Kreislaufzusammenbruch und einen schockähnlichen Zustand, möglicherweise als Folge von Nierenversagen und Mangelernährung. Außerdem fiel ihr bei der genauen Untersuchung ihrer Haut auf, dass ihr Körper von Striemen und Blutergüssen übersät war, die sie unter anderem wegen der dunklen Hautfarbe der Patientin nicht auf den ersten Blick bemerkt hatte. Nachdem sie ihren Kreislauf mit Infusionen stabilisiert hatte, setzte sie sich mit den Kollegen des Zentrums für Innere Medizin in Verbindung, wohin die noch immer Bewusstlose bald verlegt wurde. Während des Vormittags bestätigten Bluttests und Ultraschalluntersuchungen, dass die junge Frau nur knapp überlebt hatte und dass ihre Nieren und andere wichtige Organe aufgrund von Misshandlungen und Mangelerscheinungen schwer geschädigt waren.
Nachdem Judith um 16 Uhr ihren Dienst im Zentrum für Innere Medizin angetreten hatte, berichtete ihr eine Kollegin kurz über die Patienten auf ihrer Station und insbesondere über die junge Frau mit schwarzer Hautfarbe, die erst jetzt langsam aus ihrer Ohnmacht erwachte. Als Judith kurz darauf ihr Krankenzimmer betrat, war sie jedoch noch sehr schwach und kaum in der Lage, mit ihr zu sprechen. Da niemand wusste, wer sie war, fragte Judith sie, wie sie heiße, worauf sie mit einem leisen Flüstern antwortete, das Judith nicht verstehen konnte. Erst am nächsten Tag war sie fähig, in unförmigen Buchstaben ihren Namen auf ein Blatt Papier zu schreiben: Ayleen Mbeke. Judith konnte noch in Erfahrung bringen, dass sie aus Zimbabwe stammte, doch war die junge Afrikanerin zu benommen, um weitere Fragen zu beantworten. Freilich erinnerte sich Judith sofort an Désirée und ihre Cousine, die vor einiger Zeit nach Europa aufgebrochen war. Inzwischen hatte sich gezeigt, dass die Patientin neben den bereits bekannten Verletzungen und den Folgen von Mangelernährung auch haarfeine Frakturen an ihrem rechten Unterarm erlitten hatte, die schmerzhaft, aber nicht auf den ersten Blick erkennbar waren. Da der Gedanke an ein Verbrechen nahelag, hatten die Ärzte bereits erwogen, die Polizei zu informieren, waren aber zu dem Schluss gekommen, dass sie im Augenblick für eine Vernehmung noch zu sehr geschwächt sei, zumal sie stundenweise immer wieder das Bewusstsein verlor. Nachdem Judith Ayleens Namen in Erfahrung gebracht und herausgefunden hatte, woher sie kam, erzählte sie ihren Kollegen von ihrer Reise nach Afrika, von Désirée und ihrer Cousine und schlug vor, Désirée zu bitten, mit Ayleen zu sprechen. Nachdem der Chefarzt und ihre Kollegen zugestimmt hatten, berichtete sie Rebecca am nächsten Tag, was vorgefallen war, und rief anschließend Désirée an, die sich freute, so bald wieder von ihr zu hören, und ihr versprach, sich um Ayleen zu kümmern.
Bevor Judith zwei Tage später nachmittags ins Klinikum fuhr, schlug sie die Zeitung auf, in der eine Meldung auf einer der letzten Seiten ihre Aufmerksamkeit weckte. In dem kurzen Artikel war die Rede von der Leiche einer jungen Afrikanerin, die am Tag zuvor in einem einsamen Waldgebiet im Nordspessart gefunden worden war. Die Obduktion habe ergeben, dass die Ermordete bereits seit einigen Tagen in dem idyllischen Tal in der Nähe der Gemeinde Neuengronau gelegen habe, bevor ein Jäger sie durch Zufall entdeckt habe. Judith fühlte sich an Ayleen erinnert, hielt es jedoch für unwahrscheinlich, dass es einen Zusammenhang zwischen ihr und dem Fall der unbekannten Toten gab, deren Namen noch niemand kannte.
Um sechs Uhr abends kam Désirée, wie zuvor angekündigt, auf die Station im Zentrum für Innere Medizin, nachdem Judith Ayleen am Tag zuvor von einer Freundin erzählt hatte, die aus Zimbabwe stamme und ihre Sprache spreche. Daraufhin hatte Ayleen Judith gefragt, ob sie diese Bekannte kennenlernen könne, zumal sie kein Deutsch beherrsche und nur eingeschränkt in der Lage sei, sich auf Englisch auszudrücken.
Als Judith und Désirée Ayleens Zimmer betraten, hatte Ayleen gerade zu Abend gegessen.
Judith stellte Ayleen Désirée vor und verabschiedete sich kurz darauf, weil sie zu einer anderen Patientin gerufen wurde.
»Dein Name ist Désirée …«, sagte Ayleen.
»Ja … Woher genau kommst du?«, fragte Désirée.
»Aus Mashava.«
»Ich auch. Vielleicht sind wir uns in der Vergangenheit schon einmal begegnet, ohne es zu wissen. Ich bin allerdings schon vor 17 Jahren nach Deutschland ausgewandert.«
»Da war ich gerade einmal neun Jahre alt. Ich bin erst vor ein paar Wochen, Anfang September, hierhergekommen.«
Désirée nickte und fuhr fort: »Ich war übrigens vor einer Woche in Mashava.«
»Wolltest du Verwandte besuchen?«
»Mittlerweile leben leider nur noch wenige entfernte Familienmitglieder dort, die ich kaum kenne. Es war eine Urlaubsreise, aber ich wollte natürlich auch meine alte Heimat endlich einmal wiedersehen … Freilich habe ich dann doch eine ehemalige Schulfreundin getroffen, die mir erzählt hat, dass sich eine meiner Cousinen vor einiger Zeit nach Deutschland aufgemacht hat.«
»Wie ist dein Familienname?«
»Mbeke.«
In diesem Augenblick huschte ein Lächeln über Ayleens Gesicht, und sie antwortete:
»Meiner auch, und ich glaube, die Cousine bin ich.«
»Mein Gott, wer hätte geglaubt, dass wir uns mehr als zehntausend Kilometer von Mashava entfernt hier in Frankfurt unter solchen Umständen kennenlernen würden?«
»Es ist ein fast undenkbarer Zufall …«
»Das stimmt. Aber vielleicht sind gerade solche außergewöhnlichen Wendungen des Schicksals mehr als reiner Zufall.«
»Ja, wer weiß?«, erwiderte Ayleen mit einem melancholischen Gesichtsausdruck und fuhr nach einem Augenblick fort: »Du lebst schon seit 17 Jahren in Deutschland … Mich würde interessieren, warum du nach Europa gekommen bist und was du hier erlebt hast.«
Daraufhin berichtete Désirée Ayleen ausführlich von der Vorgeschichte ihrer Auswanderung, von ihrem Flug nach Frankfurt, der sie innerhalb weniger Stunden in eine fremde Welt versetzt hatte, und von ihren Erfahrungen in der neuen Heimat.
»Ich sehe, auch deine ersten Jahre hier waren nicht immer einfach«, sagte Ayleen, als Désirée ihre Erzählung beendet hatte.
»Ja«, entgegnete Désirée. »Aber ich fürchte, dass es dir viel schlimmer ergangen ist … Ich, meine Freundin Judith und die Ärzte hier würden gerne wissen, was dir zugestoßen ist und wie du hierher ins Krankenhaus gekommen bist.«
»Ich bin beinahe froh, dass du mir diese Frage stellst, auch wenn es mir schwerfällt, sie zu beantworten …« Nachdem Ayleen einen Schluck Wasser getrunken hatte, fuhr sie nach einer kurzen Pause fort: »Ich war gerade 26 Jahre alt geworden, als ich mich allein auf die Reise gemacht habe. Meine Eltern waren beide über 50, und eine Auswanderung kam für sie nicht mehr in Frage. Mein Vater hatte in einem Goldbergwerk gearbeitet, das vor einigen Jahren schließen musste, und war arbeitslos. Danach hielten meine Eltern und ich uns mit Gelegenheitsarbeiten auf Bauernhöfen mehr schlecht als recht über Wasser, und wir wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Da fand ich eines Tages im Internet ein Angebot, in dem von einem attraktiven, gut bezahlten Job in Europa die Rede war. Außerdem hieß es, dass sogar die Reisekosten übernommen würden und dass nach unserer Ankunft für die Unterbringung gesorgt sei. Besondere Fähigkeiten oder eine Ausbildung seien nicht notwendig, und für die Verständigung reichten einfache englische Sprachkenntnisse. Ich hatte eigentlich von Anfang an ein ungutes Gefühl, aber trotzdem habe ich mich langsam mit dem Gedanken angefreundet, auf dieses Angebot einzugehen. Ich hoffte, dass ich in Europa eine Perspektive und die Aussicht auf ein besseres Leben finden würde und dass ich auch meine Eltern ein wenig würde unterstützen können. Da ich ihr einziges Kind war, fiel es ihnen nicht leicht, mich gehen zu lassen, aber schließlich haben sie doch schweren Herzens zugestimmt. Daraufhin habe ich mich mit dem Anbieter in Verbindung gesetzt und schließlich einen Vertrag abgeschlossen, in dem es hieß, dass die Kosten der Reise vorgestreckt würden und dass ich in Deutschland eine Beschäftigung sowie eine angemessene Unterkunft erhalten würde. Zwar machten mich manche Formulierungen im Vertragstext misstrauisch, aber ich glaubte, angesichts unserer miserablen Lage keine Wahl mehr zu haben, und hörte nicht auf meine Intuition, die mich davor warnte, diesen Schritt zu tun. Nachdem ich die Vereinbarung unterschrieben hatte, bekam ich die Mitteilung, dass ich mich zur Abreise an einem Treffpunkt in Harare einfinden sollte.
Als Anfang August der gefürchtete Tag gekommen war, habe ich mich tief niedergeschlagen und fast verzweifelt von meinen Eltern und meinen Freundinnen verabschiedet, obwohl ich versucht habe, nach außen hin Hoffnung und Optimismus zu verbreiten, auch um mir selbst Mut zuzusprechen. Dann bin ich gegen Mittag mit dem Bus nach Harare gefahren, wo ich in einem schäbigen, dreckigen Hotel eine letzte, schlaflose Nacht in der Heimat verbracht habe, bevor ich am nächsten Morgen zur Sammelstelle ging. Dort warteten bereits drei junge Frauen, zu denen kurz darauf noch zwei weitere stießen, so dass wir insgesamt zu sechst waren. Nach etwa einer halben Stunde kam ein junger Mann, der uns zu einem in der Nähe abgestellten Kleintransporter führte und uns anschließend zum Flughafen brachte. Dort bestiegen wir am Abend ein heruntergekommen wirkendes Flugzeug einer obskuren Billigfluggesellschaft, deren Namen ich noch nie gehört hatte. Während des Starts sah ich, dass Flammen aus einem der Triebwerke schlugen, und hatte den Eindruck, dass das Flugzeug nur langsam an Höhe gewann. Meine Nachbarin und ich sahen uns an, und wir hielten uns an den Händen, weil wir beide um unser Leben fürchteten. Schließlich jedoch erlosch das Feuer, und wir flogen die ganze Nacht hindurch, bevor wir im Morgengrauen in Lagos landeten. Wir hatten angenommen, dass wir dort in ein Flugzeug nach Europa umsteigen würden, und waren zutiefst entsetzt, als wir nach der Landung erfuhren, dass wir von Lagos aus unsere Reise auf dem Land- und Seeweg fortsetzen würden. Ein Beauftragter der Organisation, mit der ich den Vertrag geschlossen hatte, brachte uns anschließend in eine große Sammelunterkunft, wo mehrere hundert junge Männer und Frauen untergebracht waren, die alle auf dem Weg nach Europa waren. Am nächsten Morgen wurden wir dann einer größeren Gruppe zugeteilt und machten uns in einem Bus auf den langen Weg nach Norden. Nachts schliefen wir in billigen Unterkünften, die manchmal vor Ungeziefer wimmelten, und in Zelten, in denen wir uns nicht sehr sicher fühlten, weil wir Angst vor Überfällen hatten. Nach mehreren Tagen schließlich wichen die anfangs dichten Wälder langsam, aber sicher der Wüste, und wir wussten, dass wir die Sahara erreicht hatten. Da die Sandpisten für die Busse zunehmend unpassierbar wurden, stiegen wir in geländegängige Fahrzeuge um, in denen wir zusammengequetscht wie Sardinen in sengender Sonne weiter nach Nordwesten fuhren, während wir wegen des oft beinahe ungenießbaren Essens stetig an Gewicht verloren. Nachdem wir mehrere Tage unterwegs gewesen waren, wurde unser Fahrzeug immer langsamer und blieb schließlich stehen, während die anderen Jeeps des Konvois vorausgefahren waren. Der Fahrer erklärte uns, dass wir irgendwie unseren Weg zum Endpunkt der Etappe finden müssten, wo wir dann ein anderes Fahrzeug besteigen würden. Unsere Gruppe bestand aus sechs Männern und sechs Frauen, die jetzt alle eine lange Wanderung antreten mussten, deren Ziel wir vielleicht nie erreichen würden. Glücklicherweise war ich noch immer mit den fünf Frauen