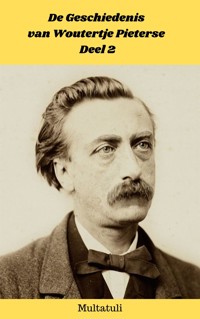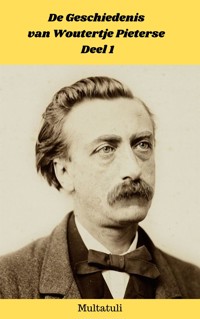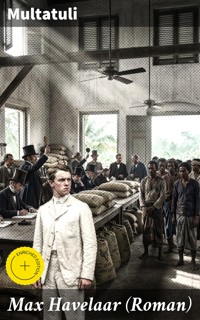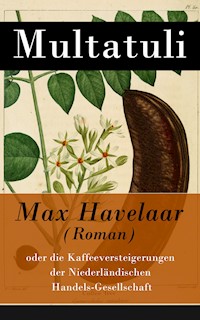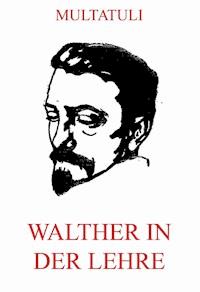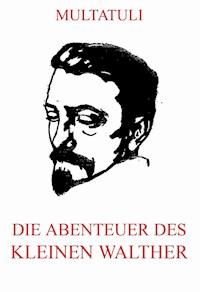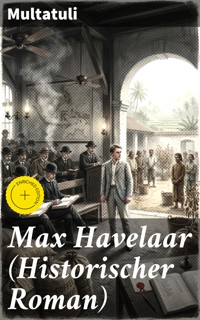
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der historische Roman 'Max Havelaar', verfasst von dem renommierten niederländischen Schriftsteller Multatuli, hinterfragt die kolonialen Praktiken des 19. Jahrhunderts in Indonesien. Mit einem eindringlichen literarischen Stil, der geschickte Narrativelemente mit scharfer sozialer Kritik verbindet, schildert der Roman die desolate Lage der indonesischen Bevölkerung unter niederländischer Herrschaft. Multatuli nutzt eine Vielzahl von Erzähltechniken, um eine vielschichtige Geschichte zu entfalten, die sowohl persönliche Schicksale als auch umfassende gesellschaftliche Missstände beleuchtet, und hebt somit die Notwendigkeit von sozialem und politischem Wandel hervor. Multatuli, ein Pseudonym für Eduard Douwes Dekker, war selbst ein Verfechter sozialer Gerechtigkeit und kämpfte gegen die Ungerechtigkeiten, die er in seinen eigenen Erfahrungen als Kolonialbeamter in Java erlebte. Sein persönliches Engagement und seine Empathie für die unterdrückten Menschen prägten seine literarische Stimme und motivierten ihn, auf die Missstände der Kolonialzeit aufmerksam zu machen. Sein Werk gilt heute als ikonisch und hat entscheidend zur Debatte über Kolonialismus beigetragen. 'Max Havelaar' ist ein unerlässliches Buch für alle, die ein tieferes Verständnis für die Geschichte des Kolonialismus und dessen Auswirkungen auf die heutigen gesellschaftlichen Strukturen erlangen möchten. Durch seine eindringlichen Charaktere und die emotionale Tiefe bietet der Roman nicht nur historische Einsichten, sondern regt auch zu kritischen Reflexionen über soziale Gerechtigkeit an. Ein Muss für Literatur- und Geschichtsinteressierte! In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Max Havelaar (Historischer Roman)
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Zwischen dem aufbegehrenden Gewissen eines Einzelnen und der schwerfälligen Maschinerie eines kolonialen Apparats spannt sich in Max Havelaar eine Auseinandersetzung auf, in der wirtschaftliche Interessen, gesellschaftliche Masken und die Frage, wer sprechen darf, unablässig aneinandergeraten, während die alltägliche Ware Kaffee zur Chiffre wird für ein weit verzweigtes System aus Gewinn, Gewalt und Verschweigen, das sich in Dokumenten, Protokollen und Geschichten rechtfertigt, zugleich aber durch die Stimme eines Beobachters herausgefordert wird, der darauf besteht, dass Worte nicht nur ordnen und verdecken, sondern auch sichtbar machen, anklagen und Verantwortung einfordern können, und dass Literatur im Spannungsfeld von Recht und Gerechtigkeit zu einem Ort wird, an dem Gewissensfragen nicht länger vertagt werden können.
Multatulis Roman Max Havelaar erschien 1860 in den Niederlanden und gilt als Schlüsseltext der niederländischen Literatur sowie als kompromisslose Kolonialkritik. Unter dem Pseudonym Multatuli veröffentlichte der Autor Eduard Douwes Dekker ein Werk, das erzählerische Formen mischt: Roman, Satire, politische Anklage und Selbstreflexion. Schauplätze sind vor allem Java in den damaligen Niederländisch-Indien und, spiegelbildlich, das Amsterdam des Kaffeehandels. Die Entstehung ist im Kontext der Mitte des 19. Jahrhunderts verankert, als Verwaltung, Handel und Mission eine gemeinsame Ordnung behaupteten, deren moralische Kosten das Buch mit literarischen Mitteln offenlegt, ohne sich in bloßer Dokumentation zu erschöpfen.
Die Ausgangssituation ist scheinbar harmlos: Ein Amsterdamer Kaffeekaufmann stilisiert seine Geschäftswelt und legt Maßstäbe der Nützlichkeit an Texte an; ein weiterer Erzähler greift ein und ordnet, kommentiert, verschiebt. In diese Rahmen tritt die Figur eines niederländischen Kolonialbeamten auf Java, der mit alltäglichen Missständen konfrontiert wird und versucht, Gehör zu finden. Mehr muss man nicht wissen: Der Roman entfaltet seine Spannung weniger durch Überraschungen der Handlung als durch die Frage, ob Sprache in einem von Hierarchien und Akten gefesselten System wirksam werden kann, und wie eine Erzählung Verantwortung übernimmt, ohne sich in Pose zu retten.
Stilistisch ist Max Havelaar polyphon und beweglich. Der Ton reicht von trocken-geschäftsmäßiger Prosa über beißende Ironie bis zu eindringlicher moralischer Dringlichkeit; Berichte wechseln mit szenischen Auszügen, Reflexionen und rhetorischen Appellen. Die Stimmen widersprechen einander, überbieten sich, hebeln sich aus und ergänzen sich doch, sodass Leserinnen und Leser ständig zwischen Vertrauensmomenten und Skepsis navigieren. Diese Vielstimmigkeit schafft ein Leseerlebnis, das gleichermaßen unterhält, herausfordert und irritiert: Humor entlarvt, Pathos zieht Grenzen, und dokumentarische Genauigkeit wird bewusst neben literarische Zuspitzung gestellt, um zu zeigen, wie sehr die Realität der Kolonien durch Sprachregime und ökonomische Kalküle geformt wird.
Zentrale Themen sind die Gewalt der kolonialen Ordnung, die Verflechtung von Bürokratie und Geschäft, die Frage der Verantwortung des Einzelnen und das Verhältnis von Gesetz und Gerechtigkeit. Der Roman untersucht, wie administrative Routinen Unrecht normalisieren, wie ökonomische Begriffe moralische Kategorien überblenden und wie das Schweigen der Betroffenen durch Stellvertretung und Übersetzung gefährdet ist. Ebenso wichtig ist die Selbstprüfung des Erzählens: Wer darf wessen Leid erzählen, und mit welchen Risiken? Daraus erwächst eine Ethik der Aufmerksamkeit, die nicht sentimentale Entrüstung sucht, sondern nachhaltige Wahrnehmung für Strukturen, in denen Beteiligte profitieren, indem sie wegsehen.
Für heutige Leserinnen und Leser bleibt das Buch relevant, weil es Mechanismen beleuchtet, die auch gegenwärtige Debatten prägen: globale Lieferketten, unter ihnen der Kaffeehandel; die Macht unternehmerischer Erzählungen, die Verantwortung glätten; und Formen des Whistleblowings, die an institutionellen Grenzen abprallen. Max Havelaar schärft das Gespür dafür, wie Narrative Legitimation erzeugen und wie Gegenerzählungen diese brechen können. In einer Zeit, die koloniale Erbschaften neu verhandelt, bietet der Roman keine fertigen Rezepte, sondern zeigt, wie mühsam moralische Einsichten gegen Gewohnheit, Karriereinteressen und publizistische Bequemlichkeit durchgesetzt werden müssen. Zugleich sensibilisiert er für die feinen Übergänge zwischen wohlmeinender Rhetorik und praktischer Verantwortung im Alltag von Konsum und Politik.
Wer den Roman liest, sollte mit wechselnden Perspektiven, Brüchen im Ton und bewussten Irritationen rechnen, die Konzentration und Bereitschaft zum Mitdenken verlangen. Gerade weil Max Havelaar keine einfache Katharsis bietet, wirkt er als intellektuelle und emotionale Herausforderung, die die eigene Komfortzone verschiebt. Als literarisches Dokument seiner Zeit, das zugleich an die Gegenwart rührt, lädt es dazu ein, die Rollen von Zuschauerin, Mitwisser und Handelndem neu zu betrachten und die Verknüpfung von Ästhetik und Ethik ernst zu nehmen. So erweist sich die historische Erzählung als anhaltende Prüfung unseres Urteilsvermögens und unserer Bereitschaft, aus Geschichten Konsequenzen zu ziehen.
Synopsis
Max Havelaar, 1860 unter dem Pseudonym Multatuli veröffentlicht, ist ein niederländischer Roman, der die Praktiken des Kolonialismus in Niederländisch-Indien anklagt und zugleich literarisch experimentiert. Multatuli ist der Schriftstellername des ehemaligen Kolonialbeamten Eduard Douwes Dekker, dessen Erfahrungen den Stoff motivieren. Das Werk verbindet Satire, Verwaltungsbericht, Erzählung und politische Rede zu einer vielstimmigen Komposition. Handlung und Reflexion wechseln einander ab, sodass der Leser von Amsterdam nach Java und wieder zurück geführt wird. Im Zentrum stehen Machtmissbrauch, wirtschaftliche Ausbeutung und die Frage nach persönlicher Verantwortung im Angesicht eines Systems, das Profit über Recht und Menschenwürde stellt.
Zunächst führt ein Amsterdamer Kaffeekaufmann die Feder: Batavus Droogstoppel, stolz auf Ordnung, Buchführung und Geschäftssinn, präsidiert über die Kaffeemärkte und glaubt an die Unfehlbarkeit der Zahlen. Sein enger Blick auf Nutzen und Moral schafft einen satirischen Einstieg, der die Distanz zwischen Handelsmetropole und Kolonie markiert. Droogstoppel erhält ein Konvolut von Aufzeichnungen eines verarmten Bekannten, das er verwerten will, ohne dessen Gehalt zu verstehen. Um daraus ein lesbares Buch zu formen, beauftragt er den jungen Deutschen Stern. Mit dieser redaktionellen Geste ist der Rahmen gesetzt: Fremde Stimmen dringen in Droogstoppels nüchterne Welt und beginnen sie zu irritieren.
Sterns Bearbeitung öffnet den Blick auf Java und auf die Figur des Max Havelaar, eines idealistischen Kolonialbeamten, der als Assistent-Resident eine abgelegene Regentschaft übernimmt. Der Ton kippt vom Kaufmanns-Spott zur engagierten Erzählung über Verwaltungspraxis, lokale Hierarchien und die Abhängigkeit der Bevölkerung. Aus Briefen, Berichten und Szenen entsteht ein Bild ständiger Spannungen zwischen Vorschrift und Gewissen. Havelaar will die Verantwortung seines Amtes ernst nehmen, stößt jedoch auf Routinen der Bequemlichkeit und der Furcht vor Skandalen. Die Wechsel der Erzähler markieren dabei immer auch Perspektivwechsel, die verdeutlichen, wie Wahrnehmung und Deutung am kolonialen Alltag ringen.
Im Dienstbezirk, den Havelaar übernimmt, lastet die Bevölkerung unter Abgaben, Fronarbeit und willkürlicher Gewalt lokaler Machthaber, deren Privilegien durch koloniale Amtsträger gedeckt werden. Havelaar prüft Klagen, sucht Zeugen und drängt auf Abhilfe. Unterstützt von einzelnen Kollegen, aber ausgebremst durch Furcht vor politischen Verwicklungen, verlangt er eine Untersuchung, die die Verantwortung der höheren Verwaltung berührt. Damit rührt er an das Gefüge von Abhängigkeiten zwischen europäischer Behörde und einheimischer Elite. Der Konflikt schärft sich, als Meldungen über Misshandlungen auflaufen und ausgerechnet Formvorschriften, Zuständigkeitsfragen und Rücksichten auf die Kaffeeerlöse als Gründe dienen, um Entscheidungen zu verzögern und Verantwortung zu verschieben.
Parallel dazu meldet sich immer wieder Droogstoppel zu Wort, der die aufwühlenden Berichte mit Geschäftsmoral relativiert und die Logik des Handels preist. Seine Einwürfe verknüpfen die koloniale Realität mit den Kaffeeauktionen in den Niederlanden und mit der Nederlandsche Handel-Maatschappij, die als Drehscheibe der Profite fungiert. Der Roman zeigt, wie administrative Routine, wirtschaftlicher Druck und Selbstrechtfertigung zusammenwirken. Havelaars Eingaben und Appelle werden Teil eines Aktenkreislaufs, in dem Zuständigkeiten wandern. Das Spannungsverhältnis zwischen Pflichtethos und Opportunismus tritt schärfer hervor, während die Idee materiellen Nutzens immer wieder als Argument dient, um moralische Einwände an den Rand zu drängen.
Zwischengeschaltet sind erzählerische Episoden, die das Leid der Bevölkerung anschaulich machen, am eindrücklichsten die Geschichte von Saidjah und Adinda. In solchen Passagen tritt die Verwaltungssprache zurück, und der Blick richtet sich auf Bauernfamilien, deren Besitz, Würde und Sicherheit unter den Zwängen der Abgabensysteme zerbrechen. Diese Kontraste schärfen die moralische Frage, ob Recht bestehen kann, wenn es nur auf dem Papier gilt. Zugleich zeigen sie, wie Literatur Mitgefühl erzeugt und abstrakte Begriffe mit Leben füllt. Die polyphone Anlage verbindet Dokumentarisches mit poetischen Mitteln, ohne den Grundkonflikt zwischen kolonialer Ordnung und menschlicher Würde zu verdecken.
Auf dem Höhepunkt rückt der Text vom satirischen Rahmen ab und wird zur direkten, an Öffentlichkeit und Staatsmacht gerichteten Anklage. Ohne die konkreten Folgen für Havelaar im Detail auszuführen, kulminiert die Komposition in einem Appell an politische Verantwortung über wirtschaftliches Kalkül hinaus. Die nachhaltige Wirkung des Buches lag in der breiten Debatte, die es in den Niederlanden über das koloniale System auslöste, und in seinem Rang als Meilenstein der Literatur über Macht und Moral. Es bleibt ein Werk, das mit literarischen Mitteln fragt, wie Gerechtigkeit aussehen kann, wenn sie gegen eingespielte Interessen antritt.
Historischer Kontext
Max Havelaar entstand in der Mitte des 19. Jahrhunderts im Kontext der niederländischen Herrschaft über die Insel Java in Niederländisch-Indien. Ort und Zeit sind geprägt von der kolonialen Verwaltungsstruktur mit Generalgouverneur in Batavia, Residenten und Assistenzresidenten sowie der Einbindung lokaler Adelseliten (Regenten, priyayi). Zentral war das seit 1830 eingeführte Cultuurstelsel, das Abgaben und Zwangsanbau für die Exportwirtschaft festschrieb. Die Nederlandsche Handel-Maatschappij organisierte den Absatz, vor allem über die Amsterdamer Kaffeeversteigerungen. In den Niederlanden schufen die Verfassung von 1848 und eine wachsende Presseöffentlichkeit neue Voraussetzungen für parlamentarische Kontrolle und öffentliche Debatten über Kolonialpolitik.
Die unmittelbare Vorgeschichte des Systems lag in der Java-Krise nach dem Java-Krieg (1825–1830), der Staatshaushalt und Verwaltung belastete. General Johannes van den Bosch führte 1830 das Cultuurstelsel ein, das Dorfgemeinschaften verpflichtete, einen Teil ihres Bodens mit exportfähigen Kulturpflanzen wie Kaffee, Zucker oder Indigo zu bestellen oder gleichwertige Arbeitsleistungen zu erbringen. Europäische und einheimische Beamte überwachten Quoten, Transport und Ablieferung, während Erträge über die Kolonialkasse und die Nederlandsche Handel-Maatschappij nach Europa gelenkt wurden. Das System verbesserte die niederländischen Staatsfinanzen, erzeugte jedoch starke Zwänge und Abhängigkeiten auf Dorfebene, die in amtlichen Berichten und zeitgenössischen Debatten dokumentiert wurden.
Die koloniale Ordnung stützte sich auf ein abgestuftes Verwaltungsgefüge. Niederländische Residenten und Assistenzresidenten kooperierten mit einheimischen Regenten und Bezirksbeamten, die als priyayi traditionelle Autorität besaßen. Corvée-Dienste (heerendiensten), Abgaben und gerichtliche Zuständigkeiten banden die Bevölkerung eng an Staat und Dorfeliten. Das Regeeringsreglement von 1854 kodifizierte Kompetenzen, Rechtswege und Verantwortlichkeiten in Niederländisch-Indien und stärkte formale Rechenschaftspflichten gegenüber Den Haag. Zugleich blieb die Kontrolle über ländliche Räume begrenzt und stark von lokalen Vermittlern abhängig. Diese strukturellen Bedingungen und Machtasymmetrien bilden den Hintergrund, vor dem der Roman seine Konflikte, Verwaltungspraktiken und die wirtschaftliche Logik des kolonialen Extraktionsregimes sichtbar macht.
Eduard Douwes Dekker, der unter dem Pseudonym Multatuli veröffentlichte, war seit den späten 1830er Jahren Kolonialbeamter in Niederländisch-Indien. 1856 wurde er zum Assistenzresidenten im westjavanischen Lebak ernannt. Dort erhob er dienstlich Vorwürfe gegen Missstände unter dem örtlichen Regenten; nachdem seine Eingaben ohne die erhoffte Wirkung blieben, trat er zurück. Aus diesen Erfahrungen formte er 1859 sein Buch, das 1860 in Amsterdam als „Max Havelaar, of de koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij“ erschien. Jacob van Lennep begleitete die Erstveröffentlichung redaktionell. Die autobiografische Perspektive und die Benennung realer Institutionen geben dem Text dokumentarisches Gewicht.
Der Roman kombiniert Satire, Behördenprosa und erzählerische Rahmung, um unterschiedliche Blickwinkel auf die Kolonie zu bündeln. Die Figur des Amsterdamer Kaufmanns Droogstoppel spiegelt die Perspektive des Metropolenhandels und dessen Gleichgültigkeit gegenüber den Produktionsverhältnissen. Einschübe wie die Geschichte von Saïdjah und Adinda dienen als literarische Verdichtung ländlicher Erfahrungen unter Abgabedruck und Dienstpflichten, ohne statistische Darstellung zu ersetzen. Das Nebeneinander von Bürokratiesprache, moralischer Anklage und handelstäglichen Routinen bildet die koloniale Wirklichkeit als System, dessen wirtschaftliche Effizienz von lokalen Hierarchien, Zwangsleistungen und europäischen Absatzmechanismen abhängt. Wiederkehrende Verweise auf die Amsterdamer Kaffeeversteigerungen der Nederlandsche Handel-Maatschappij verknüpfen Dorfprozesse mit Kapital- und Kommunikationsflüssen der Metropole. So entsteht eine literarische Fallstudie über Verwaltung, Handel und Verantwortung.
Nach Erscheinen 1860 löste das Buch in den Niederlanden lebhafte Diskussionen aus. Zeitungen und Zeitschriften stritten über Verantwortlichkeiten im kolonialen Apparat; einzelne Beamte widersprachen den Vorwürfen, andere forderten Untersuchungen. Im Parlament gewannen koloniale Detailfragen an Sichtbarkeit; zugleich mehrten sich amtliche Berichterstattungen über Produktion, Abgaben und Arbeitsleistungen. In den 1860er Jahren begann der schrittweise Abbau des Cultuurstelsels; 1870 markierten das Agrargesetz (Agrarische Wet) und neue Investitionsregeln eine Zäsur hin zu privater Plantagenwirtschaft. Regionale Zwangsanbau-Regime, insbesondere im javanischen Kaffeeanbau, bestanden teils länger fort, was die Spannweite zwischen Reformrhetorik und kolonialer Praxis deutlich machte.
Das Werk steht in einer Epoche, in der liberale Reformen in den Niederlanden – etwa die Verfassung Thorbeckes 1848 – Parlamentarismus und Presse stärkten. Zugleich wuchsen europaweit Debatten über Arbeit, Recht und Verantwortlichkeit in Imperien. Für die Niederlande spielte die Einbindung globaler Warenketten eine Schlüsselrolle: Kaffee, Zucker und Indigo aus Java wurden über die Nederlandsche Handel-Maatschappij und öffentliche Auktionen in Amsterdam verwertet. Seit 1851 lagen dem Parlament regelmäßig Kolonialberichte vor, die Produktion und Verwaltung statistisch erfassten. 1863 wurde in Suriname und den Antillen die Sklaverei abgeschafft, was Diskussionen über Formen unfreier Arbeit im Imperium zusätzlich schärfte.
Max Havelaar fungierte als literarischer Kommentar zur politischen Ökonomie des niederländischen Kolonialismus. Das Buch verband konkrete Verwaltungsvorgänge, Handelsstrukturen und moralische Argumente so, dass Missstände für eine Metropolenöffentlichkeit nachvollziehbar wurden. Es wurde in den 1860er Jahren ins Deutsche und Englische übersetzt und blieb im 20. Jahrhundert ein Referenztext kolonialkritischer Debatten. Sein Nachhall trug zur Formierung reformorientierter Strömungen bei, die um 1901 in der sogenannten Ethischen Politik der Niederlande programmatisch wurden, ohne dass sich eine einfache Kausalkette behaupten lässt. So steht das Werk exemplarisch für die Verknüpfung von Literatur, Öffentlichkeit und kolonialer Reformdiskussion.
Max Havelaar (Historischer Roman)
Erstes Kapitel.
Inhaltsverzeichnis
Wir lernen Herrn Batavus Droogstoppel kennen, sowie seine Ansichten über Poesie im allgemeinen und Romanschreiben im besonderen.
Ich bin Makler in Kaffee, und wohne auf der Lauriergracht Nummer 37[1][1q]. Es ist eigentlich nicht mein Fall, Romane zu schreiben oder dergleichen, und es hat auch ziemlich lange gedauert, bis ich mich entschloß, ein paar Ries Papier extra zu bestellen und das Werk anzufangen, das ihr, liebe Leser, soeben zur Hand genommen habt, und das ihr lesen müßt, ob ihr Makler in Kaffee seid, oder ob ihr irgend etwas anderes seid. Nicht allein, daß ich niemals etwas geschrieben habe, was nach einem Roman aussah – nein, ich bin sogar nicht einmal ein Freund davon, solches Zeug zu lesen, denn ich bin ein Geschäftsmann. Seit Jahren frage ich mich, wozu so etwas gut sein kann, und ich stehe verwundert über die Unverschämtheit, mit der die Dichter und Romanerzähler euch allerlei weißmachen dürfen, was niemals geschehen ist, und was überhaupt niemals vorkommen kann. Wenn ich in meinem Fach – ich bin Makler in Kaffee und wohne auf der Lauriergracht Nummer 37 – einem Prinzipal – ein Prinzipal ist jemand, der Kaffee verkauft – eine Deklaration machte, in der nur ein kleiner Teil der Unwahrheiten vorkäme, die in Gedichten und Romanen die Hauptsache sind, er würde zur Stunde sicher Büsselinck & Waterman nehmen. Das sind auch Makler in Kaffee, doch ihre Adresse braucht ihr nicht zu wissen. Ich passe deshalb wohl auf, daß ich keine Romane schreibe oder andere falsche Angaben mache.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, daß Menschen, die sich mit so etwas einlassen, meistenteils schlecht wegkommen. Ich bin dreiundvierzig Jahre alt, seit zwanzig Jahren besuche ich die Börse, und ich kann daher wohl vortreten, wenn man jemand ruft, der Erfahrung hat. Ich habe schon etwas von Häusern fallen sehen! Und meistens, wenn ich der Sache nachging, kam es mir vor, daß der Grund in der verkehrten Richtung lag, die die meisten in ihrer Jugend empfingen.
Ich sage: Wahrheit und gesunder Menschenverstand, und dabei bleib ich. Für die heilige Schrift mache ich natürlich eine Ausnahme. Der Unsinn beginnt schon mit van Alphen, und gleich bei der ersten Zeile über die "lieben Kleinen". Was Teufel kann den alten Herrn veranlassen, sich für einen Anbeter meiner Schwester Trude auszugeben, die schlimme Augen hatte? Oder meines Bruders Gerrit, der immer die Finger in der Nase hatte? – und doch sagte er: "daß er die Verschen sang, durch Lieb' dazu gedrungen." Ich dachte mir oft als Kind: "Mann, ich möchte dich gern einmal treffen, und wenn du mir dann die Marmeln abschlägst, um die ich dich bitten will, oder meinen Namen in Zuckergebäck – ich heiße Batavus – dann halte ich dich für einen Lügner." Aber ich habe van Alphen niemals gesehen. Er war, glaube ich, schon tot, als er uns erzählte, daß mein Vater mein bester Freund wäre, – ich hielt Paulchen Winser mehr dafür, der in unserer Nähe wohnte, in der Batavierstraat; – und daß mein kleiner Hund so dankbar wäre, – wir hielten keine Hunde, weil sie so unreinlich sind.
Alles Schwindel. So geht nun die Erziehung weiter. Das neue Schwesterchen ist von der Gemüsefrau gekommen in einem großen Kohlkopf. Alle Holländer sind tapfer und edelmütig. Die Römer konnten froh sein, daß die Bataver sie leben ließen. Der Bey von Tunis bekam Bauchkneifen, als er das Flattern der niederländischen Flagge hörte. Der Herzog von Alba war ein Untier. Die Ebbe, ich glaube 1672, dauerte etwas länger als sonst, bloß um Niederland zu beschirmen. Lügen. Niederland ist Niederland geblieben, weil unsere Vorfahren sich um ihre Geschäfte kümmerten, und weil sie den rechten Glauben hatten; das ist die Sache.
Und dann kommen wieder andere Lügen. Ein Mädchen ist ein Engel. Nun, wer das zuerst entdeckte, hat niemals Schwestern gehabt. Liebe ist eine Seligkeit; man flüchtet mit dem einen oder anderen Gegenstand bis ans Ende der Welt. Die Welt hat keine Enden, und die Liebe ist auch Dummheit. Kein Mensch kann sagen, daß ich mit meiner Frau nicht gut lebe – sie ist eine Tochter von Last & Co., Makler in Kaffee – kein Mensch kann etwas über unsere Ehe sagen; ich bin Mitglied von Artis, und sie hat ein Umschlagetuch für zweiundneunzig Gulden, aber von so einer verdrehten Liebe, die durchaus am Ende der Welt wohnen will, ist zwischen uns nie die Rede gewesen. Nach unserer Hochzeit haben wir einen Ausflug nach dem Haag gemacht – sie hat da Flanell gekauft – ich trage noch Unterjacken davon – und weiter hat uns die Liebe nicht in der Welt herumgejagt. Also alles Unsinn und Schwindel.
Und sollte meine Ehe nun weniger glücklich sein als die der Menschen, die sich vor Liebe die Schwindsucht an den Hals holten oder die Haare aus dem Kopfe? Oder denkt ihr, daß mein Haus weniger gut geregelt ist, als es wäre, wenn ich vor siebzehn Jahren meinem Mädchen in Versen gesagt hätte, daß ich sie heiraten wollte? Unsinn. Ich hätte es ebenso gut gekonnt wie jeder andere, denn Versemachen ist ein Handwerk, das sicher leichter ist als Elfenbeindrechseln. Wie wären sonst die Pfefferkuchen mit Versen so billig? Und frage einer nach dem Preise eines Satzes Billardbälle!
Gegen Verse an sich habe ich nichts. Will einer die Worte in Reihe und Glied setzen, meinetwegen; aber er soll nichts sagen, was nicht die Wahrheit ist. " Die Luft geht rauh, vier Uhr ist's genau" – das laß ich gelten, wenn es wirklich rauh und vier Uhr genau ist. Aber wenn es nun dreiviertel drei ist, dann kann ich, der seine Worte nicht in Reih und Glied setzt, sagen: "Die Luft geht rauh, und es ist dreiviertel drei." Der Versemacher dagegen ist durch die Rauheit der ersten Zeile an eine volle Stunde gebunden; es muß genau vier, fünf, zwei, ein Uhr sein, oder die Luft darf nicht rauh sein. Da macht er sich nun ans Pfuschen: entweder muß das Wetter geändert werden oder die Zeit. Eins von beiden ist dann gelogen.
Und nicht bloß die Verse verführen die Jugend zur Unwahrheit. Gele einmal ins Theater und höre zu, was da für Lügen an den Mann gebracht werden. Der Held des Stücks wird aus dem Wasser geholt von einem, der gerade im Begriff steht, Bankerott zu machen. Darauf giebt er ihm sein halbes Vermögen; das kann nicht wahr sein. Wie unlängst auf der Prinzengracht mein Hut ins Wasser flog, hab ich dem Mann, der ihn mir wiederbrachte, ein Dübbeltje gegeben, und er war zufrieden. Ich weiß wohl, daß ich ihm etwas mehr hätte geben müssen, wenn er mich selber herausgeholt hätte, aber mein halbes Vermögen ganz gewiß nicht; – denn das ist klar, daß man auf die Weise bloß zweimal ins Wasser fallen dürfte, um bettelarm zu sein. Was aber das Schlimmste bei solchen Theaterstücken ist: das Publikum gewöhnt sich so an die Unwahrheiten, daß es sie schön findet und Beifall klatscht. Ich hätte wohl Lust, einmal so ein ganzes Parterre ins Wasser zu werfen, um zu sehen, ob der Beifall ernst gemeint war. Ich, der ich die Wahrheit liebe, warne hiermit jedermann, daß ich für das Auffischen meiner Person keinen so hohen Finderlohn bezahlen will. Wer nicht mit weniger zufrieden ist, lasse mich liegen. Höchstens Sonntags würde ich etwas mehr bewilligen, weil ich dann meine goldene Uhrkette trage und einen besseren Rock.
Ja, das Theater verdirbt viele, mehr noch als die Romane. Es ist so anschaulich. Mit ein bißchen Flittergold und einer Umrahmung von ausgeschlagenem Papier macht sich das alles so verführerisch. Für Kinder und Leute, die nicht im Geschäft sind, meine ich. Selbst wenn sie Armut darstellen will, ist die Vorstellung immer lügenhaft. Ein Mädchen, deren Vater bankerott machte, arbeitet, um die Familie zu ernähren; gut. Da sitzt sie nun, zu nähen, zu stricken oder zu sticken. Aber nun zähle einmal einer die Stiche, die sie während der ganzen Handlung macht. Sie schwatzt, sie seufzt, sie läuft ans Fenster, aber arbeiten thut sie nicht. Die Familie, die von der Arbeit leben kann, braucht wenig. So ein Mädchen ist natürlich die Heldin. Sie hat einige Verführer die Treppe hinuntergeworfen; sie ruft fortwährend: "O meine Mutter! o meine Mutter!" und stellt also die Tugend vor. Was ist das für eine Tugend, die zu einem Paar wollener Strümpfe ein Jahr braucht? Giebt das nicht falsche Ideen von Tugend und "Arbeit um das liebe Leben"? Alles Unsinn und Schwindel.
Dann kommt ihr erster Verehrer, der früher Schreiber war am Kopierbuch – jetzt aber steinreich – mit einem Male zurück, und der heiratet sie. Auch wieder Schwindel. Wer Geld hat, heiratet kein Mädchen aus einem bankerotten Hause. Und wenn ihr meint, daß das auf dem Theater hingehen könnte, als Ausnahme, so bleibt doch mein Tadel bestehen, daß man den Sinn für die Wahrheit beim Volke verdirbt, welches die Ausnahme für die Regel nimmt, und daß man die öffentliche Sittlichkeit untergräbt, wenn man das Volk gewöhnt, auf der Bühne etwas zu applaudieren, was im Leben durch jeden verständigen Makler oder Kaufmann für eine lächerliche Verrücktheit gehalten wird. Als ich mich verheiratete, waren wir auf dem Kontor von meinem Schwiegervater – Last & Co. – dreizehn, und es ging etwas vor.
Und noch mehr Lügen auf dem Theater! Wenn der Held mit seinem steifen Kömödienschritt abgeht, um das Vaterland zu retten, wie kommt es, daß dann die doppelte Hinterthür sich immer von selber öffnet?
Und dann – woher weiß eine Person, die in Versen redet, was die andere antworten hat, um ihr den Reim bequem zu machen? Wenn der Feldherr zu der Prinzessin sagt: "Prinzeß, es ist zu spät, verschlossen sind die Thüren!" wie kann er da vorher wissen, daß sie sagen will: "Wohlan denn, unverzagt! laßt uns die Schwerter rühren!" Wenn sie nun einmal, da die Thür zu ist, antwortet, sie werde dann warten, bis wieder aufgemacht wird, oder sie würde ein ander Mal wiederkommen, wo bleibt da Maß und Reim? Ist es also nicht purer Unsinn, wenn der Feldherr die Prinzessin fragend ansieht, um zu wissen, was sie nach Thoresschluß thun will? Noch eins: wenn sie nun gerade Lust hätte, zu Bette zu gehen, anstatt irgend etwas zu rühren? Alles Unsinn!
Und dann die belohnte Tugend? O, o! – ich bin seit siebzehn Jahren Makler n Kaffee – Lauriergracht Nummer 37, – und ich habe also etwas erlebt – das aber kränkt mich immer fürchterlich, wenn ich die gute liebe Wahrheit so verdrehen sehe. Belohnte Tugend – ist das nicht, um aus der Tugend einen Handelsartikel zu machen? Es ist nicht so in der Welt, – und es ist gut, daß es nicht so ist, denn wo bliebe das Verdienst, wenn die Tugend belohnt würde! Wozu also immer die infamen Lügen vorgeschoben?
Da ist zum Beispiel Lukas, der Packknecht, der schon bei dem Vater von Last & Co. gearbeitet hat, – die Firma war damals Last & Meyer, aber die Meyers sind heraus – das war doch wohl ein tugendhafter Mann. Keine Kaffeebohne ging da verloren, er ging gewissenhaft zur Kirche, und trinken that er auch nicht; als mein Schwiegervater zu Driebergen war, bewahrte er das Haus und die Kasse und alles. Einmal hatte er an der Bank siebzehn Gulden zu viel erhalten, und er brachte sie zurück. Er ist nun alt und gichtig und kann nicht mehr dienen. Nun hat er nichts; denn es ist viel Umsatz bei uns, und wir brauchen junge Leute. Nun also, ich halte diesen Lukas für sehr tugendhaft, und wird er nun belohnt? Kommt da ein Prinz, der ihm Diamanten schenkt, oder eine Fee, die ihm Butterbrote schmiert? Wahrhaftig nicht, er ist arm, er bleibt arm, und das muß auch so sein. Ich kann ihm nicht helfen – denn wir brauchen junge Leute, weil viel Umsatz bei uns ist – aber könnte ich auch, wo bleibt da sein Verdienst, wenn er nun auf seine alten Tage ein sorgenloses Leben führen könnte? Dann sollten wohl alle Packknechte tugendhaft werden, und jeder einzelne, – was doch der Zweck nicht sein kann, weil dann für die Braven nachher keine besondere Belohnung übrig bliebe. Aber auf der Bühne verdrehen sie das; – alles Schwindel.
Ich bin auch tugendhaft, aber verlange ich dafür eine Belohnung? Wenn meine Geschäfte gut gehen – und das thun sie – wenn meine Frau und die Kinder gesund sind, sodaß ich keine Schererei habe mit Doktor und Apotheker, – wenn ich jahraus, jahrein ein Sümmchen zurücklegen kann für die alten Tage; – wenn Fritz frisch aufwächst, um später an meine Stelle zu treten, wenn ich nach Driebergen gehe, – dann bin ich zufrieden. Aber das ist alles die natürliche Folge der Umstände, und weil ich auf das Geschäft acht gebe; – für meine Tugend verlange ich nichts.
Und daß ich doch tugendhaft bin, sieht man klar aus meiner Liebe zur Wahrheit; – das ist, nach meiner Festigkeit im Glauben, meine Hauptneigung; und ich wünsche, daß ihr davon überzeugt wäret, Leser, denn es ist die Entschuldigung für das Schreiben dieses Buches.
Eine zweite Neigung, die bei mir ebenso hoch wie die Wahrheitsliebe angeschrieben steht, ist der Herzenszug für mein Fach – ich bin Makler in Kaffee, Lauriergracht Nr. 37. Nun also, Leser, meiner unantastbaren Liebe zur Wahrheit und meinem geschäftlichen Eifer habt ihr es zu danken, daß diese Blätter geschrieben sind. Ich will euch erzählen, wie das gekommen ist. Da ich nun für den Augenblick von euch Abschied nehmen muß – ich muß nach der Börse – so lade ich euch nachher auf ein zweites Kapitel. Auf Wiedersehen also.
Und, na, hier, steckt es ein – es ist eine kleine Mühe – es kann zu paß kommen – sieh da, da ist es – meine Geschäftskarte – die Compagnie bin ich, seit die Meyers heraus sind – der alte Last ist mein Schwiegervater.
Zweites Kapitel.
Inhaltsverzeichnis
Herr Batavus Droogstoppel thut einen großen Schachzug gegen die Konkurrenz. Er trifft einen alten Bekannten, der sich gern in Sachen mischte, die ihn nichts angingen z.B. das Abenteuer mit dem Griechen.
Es war flau auf der Börse, die Frühjahrsversteigerung muß es wieder gutmachen. Denkt nicht, daß bei uns kein Umsatz ist – bei Büsselinck & Waterman ist es noch flauer. Es ist eine sonderbare Welt; man erlebt schon was, wenn man so an zwanzig Jahre die Börse besucht[2q]. Denkt euch, daß sie danach getrachtet haben – Büsselinck & Waterman, meine ich – mir Ludwig Stern abzunehmen. Da ich nicht weiß, ob ihr an der Börse Bescheid wißt, will ich euch sagen, daß Stern ein erstes Haus in Kaffee ist, in Hamburg, welches stets durch Last & Co. bedient worden ist. Ganz zufällig kam ich dahinter – ich meine hinter die Pfuscherei von Büsselinck & Waterman. Sie würden ein Viertel Prozent von der Courtage fallen lassen – Schleicher sind sie, weiter nichts – und nun seht, was ich gethan habe, im diesen Schlag abzuwehren. Ein anderer an meiner Stelle hätte vielleicht an Ludwig Stern geschrieben, daß er auch etwas ablassen wolle, und daß er auf Berücksichtigung hoffe wegen der langjährigen Dienste von Last & Co. (ich habe ausgerechnet, daß die Firma, seit rund fünfzig Jahren, vier Tonnen an Stern verdient hat: die Beziehung datiert von der Kontinentalsperre[2] her, als wir die Kolonialwaren von Helgoland einschmuggelten) und solche Dinge mehr. Nein, schleichen thue ich nicht. Ich bin nach "Polen" gegangen, ließ mir Feder und Papier geben, und schrieb:
"Daß die große Ausbreitung, die unsere Geschäfte in der letzten Zeit genommen haben, besonders durch die vielen geehrten Aufträge aus Norddeutschland" (es ist die reine Wahrheit), "eine Vermehrung des Personals nötig machte;" (es ist die Wahrheit, – gestern noch war der Buchhalter nach elf auf dem Kontor, um seine Brille zu suchen); "daß vor allem sich das Bedürfnis geltend mache nach anständigen, wohlerzogenen jungen Leuten für die Korrespondenz im Deutschen. Daß zwar viele deutsche junge Männer in Amsterdam vorhanden wären, die auch die gewünschten Fähigkeiten besäßen, daß aber ein Haus, das auf sich hält" (es ist die reine Wahrheit), "bei dem zunehmenden Leichtsinn und der Leichtlebigkeit der Jugend, bei dem täglichen Anwachsen der Zahl der Glücksjäger, und mit Rücksicht auf die Notwendigkeit eines soliden Lebenswandels, um Hand in Hand zu gehen mit der Solidität in der Ausführung erteilter Aufträge" (es ist wahrhaftig alles die lautere Wahrheit), "daß solch ein Haus – ich meine Last & Co., Makler in Kaffee, Lauriergracht Nr. 37 – nicht umsichtig genug sein könne beim Engagieren von Personen ..."
Das ist alles die reine Wahrheit, Leser. Weißt du wohl, daß der junge Deutsche, der auf der Börse bei Pfeiler 17 stand, mit der Tochter von Büsselinck & Waterman davongelaufen ist? Unsere Marie wird im September auch bereits dreizehn.
"Daß ich die Ehre gehabt hätte, von Herrn Saffeler" – Saffeler reist für Stern – "zu vernehmen, daß der geschätzte Chef der Firma Stern einen Sohn habe, den Herrn Ernst Stern, der zur Vervollständigung seiner kaufmännischen Kenntnisse einige Zeit in einem holländischen Hause arbeiten möchte."
"Daß ich mit Rücksicht auf" – (hier wiederholte ich die Sittenlosigkeit und erzählte die Geschichte von Büsselinck & Watermans Tochter; es kann nicht schaden, wenn man das weiß;) "daß ich mit Rücksicht darauf nichts lieber sehen würde, als Herrn Ernst Stern mit der deutschen Korrespondenz unseres Hauses betraut zu sehen."
Aus Zartgefühl vermied ich alle Anspielung auf Gehalt oder Salair, ich fügte aber bei:
"Daß, falls Herr Ernst Stern mit dem Aufenthalt in unserem Hause – Lauriergracht Nr. 37 – vorlieb nehmen wollte, meine Frau sich bereit erklärte, wie eine Mutter für ihn zu sorgen, und daß seine Wäsche im Hause besorgt werden würde." (Das ist die reine Wahrheit, denn Marie stopft und strickt ganz nett. Und zum Schlusse:) "Daß bei uns dem Herrn gedient wird."
Das kann er in seine Tasche stecken, denn die Sterns sind lutherisch.
Und den Brief schickte ich ab. Ihr begreift, daß der alte Stern nicht gut zu Büsselinck & Waterman übergehen kann, wenn der junge bei uns auf dem Kontor ist. Ich bin sehr neugierig auf die Antwort.
Um nun wieder auf mein Buch zurückzukommen. Vor einiger Zeit komme ich des Abends durch die Kalverstraat, und ich blieb vor dem Laden eines Krämers stehen, der sich gerade beschäftigte mit dem Sortieren einer Partie "Java, ordinär, schön, gelb, Sorte Cheribon, etwas gebrochen und Kehricht dabei," was mich sehr interessierte, denn ich merke auf alles. Da fiel mir auf einmal ein Herr ins Auge, der in der Nähe vor einem Buchladen stand und mir bekannt vorkam. Er schien mich auch zu erkennen, denn unsere Blicke begegneten sich fortwährend. Ich muß bekennen, daß ich zu sehr vertieft war in die Betrachtung des Kehrichts, um sofort zu merken, was ich später sah, daß er nämlich ziemlich ärmlich in den Kleidern stak, sonst hätte ich die Sache laufen gelassen; aber mit einem Male schoß mir der Gedanke durch den Kopf, es könnte ein Reisender eines deutschen Hauses sein, das einen soliden Makler sucht. Er hatte wohl auch etwas von einem Deutschen an sich, und von einem Reisenden auch; er war sehr blond, hatte blaue Augen, und in Haltung und Kleidung etwas, was den Fremden verriet. Anstatt eines gehörigen Winterüberziehers hing ihm eine Art von Shawl über die Schulter, als ob er so von der Reise käme. Ich meinte einen Kunden zu sehen und gab ihm eine Geschäftskarte, Last & Co., Makler in Kaffee, Lauriergracht Nr. 37. Er hielt sie an die Gasflamme und sagte:
"Ich danke Ihnen, aber ich habe mich geirrt; ich dachte das Vergnügen zu haben, einen alten Schulkameraden vor mir zu sehen, indessen ... Last, das ist der Name nicht ..."
"Pardon," sagte ich, denn ich bin stets höflich, "ich bin Mijnheer Droogstoppel, Batavus Droogstoppel ... Last & Co. ist die Firma, Makler in Kaffee, Lauriergr ..."
"Gut, Droogstoppel, kennst du mich nicht mehr? Sieh mich einmal gut an."
Je mehr ich ihn ansah, je mehr erinnerte ich mich, ihn öfter gesehen zu haben; aber merkwürdig, sein Gesicht hatte auf mich die Wirkung, als ob ich fremde Parfümerien röche. Lach nicht darüber, Leser, du sollst später sehen, wie das kam. Ich bin sicher, daß er keinen Tropfen Räucherwerk bei sich trug, und doch roch ich etwas Angenehmes, etwas Starkes, etwas, das mich erinnerte an ... da hatte ich's!
"Sind Sie es," rief ich, "der mich von dem Griechen befreit hat?"
"Natürlich," sagte er, "und wie geht es Ihnen?"
Ich erzählte ihm, daß wir insgesamt dreizehn auf dem Kontor wären, und daß viel zu thun wäre. Und dann fragte ich ihn, wie es ihm ginge, was mich später reute, denn er schien nicht in guten Verhältnissen zu sein, und ich liebe arme Menschen nicht, weil da gewöhnlich eigene Schuld mit unterläuft, denn der Herr würde nicht jemand verlassen, der ihm treu gedient hätte. Hätte ich einfach gesagt, "wir sind insgesamt dreizehn" und "guten Abend weiterhin," dann wäre ich ihn los gewesen, aber durch das Fragen und Antworten wurde es je länger je schwerer (Fritz sagt: je länger, desto schwerer, aber das thu ich nicht), je schwerer also, von ihm los zu kommen. Anderseits muß ich auch wieder bekennen, daß ihr dann dieses Buch nicht hättet zu lesen bekommen, denn es ist eine Folge von dieser Begegnung! ... Man muß immer das Gute hervorheben, und wer das nicht thut, das sind unzufriedene Menschen, die ich nicht leiden kann.
Ja, ja, er war es, der mich aus den Händen des Griechen gerettet hatte! Denkt nun nicht, daß ich jemals durch Seeräuber bin gefangen genommen worden, oder daß ich in der Levante Krieg geführt habe. Ich habe euch bereits gesagt, daß ich nach der Hochzeit mit meiner Frau nach dem Haag gefahren bin; da haben wir das Moritz-Haus gesehen und in der Veenestraat Flanell gekauft. Das ist der einzige Ausflug, den meine Geschäfte mir überhaupt gestattet haben, weil bei uns so viel zu thun ist. Nein, in Amsterdam selbst hatte er um meinetwillen einem Griechen die Nase blutig geschlagen, denn er gab sich immer mit Dingen ab, die ihn nichts angingen.
Es war im Jahre drei- oder vierundvierzig, glaube ich, und im September, es war Kirmeß[3] in Amsterdam. Da meine alten Leute vor hatten, aus mir einen Geistlichen zu machen, lernte ich Latein. Später habe ich mich öfter gefragt, warum man eigentlich Lateinisch verstehen muß, um auf Holländisch "Gott ist gut" zu sagen. Genug ich war auf der Lateinschule – jetzt sagen sie Gymnasium – und da war Kirmeß, – in Amsterdam, meine ich. Auf dem Westermarkt standen Buden, und wenn du ein Amsterdamer bist, Leser, und ungefähr von meinem Alter, so wirst du dich erinnern, daß eine darunter war, die sich auszeichnete durch die schwarzen Augen und die langen Flechten eines Mädchens, die als Griechin angezogen war; auch ihr Vater war ein Grieche, oder wenigstens sah er wie ein Grieche aus. Sie verkauften allerlei Räucherkram.
Ich war gerade alt genug, um das Mädchen hübsch zu finden, ohne indessen den Mut zu haben, sie anzusprechen. Das würde mir auch wenig genützt haben, denn Mädchen von achtzehn Jahren betrachten einen sechzehnjährigen Jungen noch als ein Kind, und darin haben sie ganz recht. Trotzdem kamen wir Quartaner jeden Abend auf den Westermarkt, um das Mädchen zu sehen.
Nun war er, der da jetzt vor mir stand mit seinem Shawl, eines Tages dabei, obschon er ein paar Jahre jünger war als wir anderen und darum noch ein bißchen zu kindisch, um nach der Griechin zu gucken. Aber er war der Erste in unserer Klasse – denn gescheit war er, das muß ich zugeben – und spielen, balgen und boxen mochte er gern; daher war er bei uns. Wie wir nun, wir waren im ganzen zehn Mann, hübsch weit von der Bude ab zusammenstanden und nach der Griechin schielten und beratschlagten, wie wir es anlegen sollten, um ihre Bekanntschaft zu machen, wurde also beschlossen, Geld zusammenzuthun, um irgend etwas zu kaufen. Aber nun war guter Rat teuer, wer die große Ehre haben sollte, das Mädchen anzureden. Jeder wollte, aber keiner getraute sich. Es wurde gelost, und das Los fiel auf mich. Nun bekenne ich, daß ich nicht gern Gefahren trotze; ich bin Familienvater, und halte jeden, der Gefahren sucht, für einen Narren, wie es auch in der Schrift steht. Es ist mir wirklich angenehm zu erklären, daß ich in meinen Ideen über Gefahr und dergleichen mir gleich geblieben bin, da ich jetzt noch darüber dieselbe Meinung hege, wie jenen Abend, als ich da vor der Bude des Griechen stand, mit den zwölf Stübern, die wir zusammengelegt hatten, in der Hand. Aber aus falscher Scham getraute ich mich nicht zu sagen, daß ich mich nicht getraute, und außerdem, ich mußte wohl vorwärts, denn meine Kameraden drängten mich, und da stand ich nun vor der Bude.
Das Mädchen sah ich nicht, ich sah überhaupt nichts, Alles war mir grün und gelb vor den Augen ... ich stammelte einen Aoristus Primus von ich weiß nicht welchem Zeitwort ...
"Plaît-il?" sagte sie. Ich faßte etwas Mut, und machte weiter:
"Meenin aeide thea," und "Ägypten wär' ein Geschenk des Nils" ...
Ich bin überzeugt, daß ich mit dem Bekanntschaftmachen schon noch vorwärts gekommen wäre, wenn nicht in diesem Augenblick einer meiner Kameraden aus kindischer Bosheit mir einen solchen Stoß in den Rücken gegeben hätte, daß ich recht unsanft gegen den Kasten flog, der in halber Manneshöhe die Vorderseite der Bude abschloß. Ich fühlte einen Griff in meinem Nacken ... einen zweiten Griff etwas tiefer ... ich schwebte einen Augenblick in der Luft ... und ehe ich noch recht begriff, wie die Sachen standen, befand ich mich in der Bude des Griechen, der in verständlichem Französisch sagte, "ich wäre ein Gamin, ein Straßenlümmel, und er würde die Polizei rufen." Nun war ich zwar in der Nähe des Mädchens, aber gefallen konnte mir das nicht. Ich heulte und bat um Gnade, denn ich hatte schreckliche Angst. Aber es nutzte nichts; der Grieche hielt mich am Arm und schüttelte mich; ich sah mich nach meinen Kameraden um ... wir hatten den Morgen gerade mit Scävola zu thun gehabt, der seine Hand ins Feuer steckte ... und in ihren lateinischen Sätzen hatten sie das so schön gefunden ... jawohl! Keiner war stehen geblieben, um für mich eine Hand ins Feuer zu stecken ...
So dachte ich. Aber da flog mit einem Male mein Shawlmann durch die Hinterthür in die Bude; er war nicht groß oder stark, und kaum so etwa dreizehn Jahre alt, aber er war ein flinker und tapferer Bursche. Noch sehe ich seine Augen blitzen – sonst blickten sie matt – er gab dem Griechen einen Faustschlag, und ich war gerettet. Später habe ich gehört, daß der Grieche ihn tüchtig verhauen hat; – aber weil ich den festen Grundsatz habe, mich nicht um Dinge zu kümmern, die mich nichts angehen, bin ich schleunigst davongelaufen und habe es also nicht gesehen.
So kam es, daß seine Züge mich so an Räucherwerk erinnerten, und so kann man in Amsterdam mit einem Griechen Streit bekommen.
Wenn bei späteren Jahrmärkten der Mann mit seiner Bude wieder auf dem Westermarkt stand, suchte ich mein Vergnügen immer wo anders.
Da ich ein Freund von philosophischen Betrachtungen bin, so muß ich dir, Leser, doch eben noch sagen, wie wunderbar die Dinge auf dieser Welt doch miteinander verknüpft sind. Wären die Augen des Mädchens weniger schwarz und ihre Zöpfe kürzer gewesen, oder wenn mich keiner gegen den Ladentisch gestoßen hätte, würdest du dieses Buch nicht lesen. Sei also dankbar, daß das so gekommen ist. Glaube mir, alles in der Welt ist gut, wie es ist, und die unzufriedenen Menschen, die fortwährend klagen, sind meine Freunde nicht. Da ist z.B. Büsselinck & Waterman ...; aber ich muß fortfahren, denn mein Buch soll noch vor der Frühjahrsversteigerung fertig sein.
Gerade heraus gesagt – denn ich halte auf Wahrheit – war mir das Wiedersehen mit diesem Menschen nicht angenehm. Ich merkte sofort, daß es keine solide Beziehung war. Er sah sehr blaß aus, und als ich ihn fragte, wie spät es wäre, wußte er es nicht. Das sind Dinge, auf die ein Mensch achtet, der so an zwanzig Jahre die Börse besucht hat, der so viel erlebt hat ... ich habe schon etwas an Häusern sehen fallen.
Ich dachte, er würde rechts gehen, und mußte daher nach links; aber sieh da, er ging auch links, und ich konnte es also nicht vermeiden, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Aber ich dachte stets daran, daß er nicht wußte, wie spät es war, und bemerkte obendrein, daß seine Jacke bis ans Kinn fest zugeknöpft war, was ein sehr schlechtes Zeichen ist, sodaß ich den Ton unserer Unterhaltung kühl bleiben ließ. Er erzählte mir, daß er in Indien gewesen war, daß er verheiratet war, daß er Kinder hatte. Ich hatte nichts dagegen, fand aber auch nichts Merkwürdiges dabei. Beim Kapelsteeg – ich gehe sonst nie durch den Steg, weil es sich für einen anständigen Mann nicht paßt, wie ich finde – aber diesmal wollte ich beim Kapelsteeg rechts abbiegen. Ich wartete, bis wir an dem Gäßchen beinahe vorbei waren, um ihm recht deutlich zu machen, daß sein Weg geradeaus führte, und dann sagte ich sehr höflich – denn höflich bin ich immer, man kann ja gar nicht wissen, wie man später jemand nötig haben kann – :
"Es war mir sehr angenehm, Sie wiederzusehen, Mijnheer ... und ... und, ich empfehle mich, ich muß hier hinein."
Da sah er mich ganz sonderbar an und seufzte, und faßte mit einem Male einen Knopf meiner Jacke ...
"Lieber Droogstoppel," sagte er, "ich muß Sie um etwas bitten."
Mir ging ein Schauder durch die Glieder. Er wußte nicht, wie spät es war, und wollte mich um etwas bitten! Natürlich antwortete ich, daß ich keine Zeit hätte und nach der Börse müßte, obwohl es Abend war: – aber wenn man so zwanzig Jahre die Börse besucht hat ... und jemand will einen um etwas bitten, ohne zu wissen, wie spät es ist ...
Ich machte meinen Knopf los, grüßte sehr höflich – denn höflich bin ich immer – und ging in den Kapelsteeg hinein, was ich sonst nie thue, weil es nicht anständig ist; und Anstand geht mir über alles. Ich hoffe, daß es keiner gesehen hat ...
Drittes Kapitel.
Inhaltsverzeichnis
Der verrückte Brief des Shawlmanns und der Theeabend bei Rosemeyers, die in Zucker machen.
Als ich tags darauf von der Börse nach Hause kam, sagte Fritz, es wäre jemand dagewesen, der mich sprechen wollte. Nach der Beschreibung war es der Shawlmann. Wie er mich nur gefunden hatte? Ach ja, die Geschäftskarte! Ich dachte schon daran, meine Kinder von der Schule zu nehmen; denn es ist unangenehm, wenn einem noch zwanzig, dreißig Jahre später ein Schulkamerad nachläuft, der einen Shawl trägt statt eines Überziehers, und der nicht weiß, wie spät es ist. Auch habe ich Fritz verboten, nach dem Westermarkt zu gehen, wenn Jahrmarkt ist.
Tags darauf kam ein Brief mit einem großen Paket. Ich will euch den Brief lesen lassen:
"Lieber Droogstoppel!"
Ich finde, er hätte wohl "Hochgeehrter Herr Droogstoppel" sagen können, denn ich bin Makler.
"Ich bin gestern bei Ihnen gewesen mit der Absicht, ein Anliegen vorzutragen. Ich glaube, daß Sie in guten Verhältnissen leben ..."
Das ist wahr, wir sind im ganzen dreizehn auf dem Kontor –
"und ich wünschte, mich Ihres Kredits zu bedienen, um eine Angelegenheit zustande zu bringen, die für mich von großer Wichtigkeit ist."
Hört sich das nicht an, als handelte es sich um einen Auftrag für die Frühjahrsversteigerung?
"Infolge von allerlei Umständen bin ich augenblicklich einigermaßen in Geldverlegenheit ..."
Einigermaßen! Er hatte kein Hemde auf dem Leibe. Das nennt er: einigermaßen!
"ich kann meiner lieben Frau nicht alles geben, was zur Annehmlichkeit des Lebens nötig ist, und auch die Erziehung meiner Kinder ist, aus pekuniären Gesichtspunkten, nicht so wie ich wünschte."
Annehmlichkeit des Lebens? Erziehung der Kinder? Meint er, daß er für seine Frau eine Loge in der Oper mieten will, und seine Kinder in eine Anstalt nach Genf schicken? Es war Herbst und ziemlich kalt, – er wohnte auf einem Bodengelaß ohne Feuer. Als ich diesen Brief empfing, wußte ich das nicht, aber später bin ich bei ihm gewesen, und noch jetzt bin ich ärgerlich über den tollen Ton seines Geschreibsels. Zum Kuckuck! wer arm ist, kann sagen, daß er arm ist; Arme muß es geben, das ist notwendig in der menschlichen Gesellschaft; wenn er nur kein Almosen verlangt und niemand zur Last fällt, habe ich durchaus nichts dagegen, daß er arm ist; aber die Ziererei dabei paßt mir nicht. Hört weiter:
"Da nun auf mir die Pflicht ruht, für die Bedürfnisse der Meinen zu sorgen, habe ich beschlossen, ein Talent auszunutzen, das, wie ich glaube, mir gegeben ist. Ich bin Dichter ..."
Puh! Du weißt, Leser, wie ich und alle vernünftigen Menschen darüber denken.
"und Schriftsteller. Seit meiner Kindheit drückte ich meine Gefühle in Versen aus, und auch später schrieb ich täglich nieder, was in meiner Seele vorging. Ich glaube, daß darunter einige Arbeiten sind, die Wert haben, und ich suche dafür einen Verleger. Aber das ist nun gerade die Schwierigkeit. Das Publikum kennt mich nicht, und die Verleger beurteilen die Werke mehr nach dem Namen und Ruf des Verfassers als nach dem Inhalt."
Gerade wie wir den Kaffee nach dem Renommee der Sorten und Marken.
"Wenn ich nun auch annehme, daß mein Werk nicht ohne Wert sein würde, so würde das doch erst nach dem Erscheinen zu Tage treten, und die Buchhändler verlangen die Druckkosten u.s.w. im voraus ..."
Finde ich sehr vernünftig.
"was mir augenblicklich nicht gelegen kommt. Da ich indes überzeugt bin, daß meine Arbeit die Kosten decken würde, und ruhig mein Wort darauf verpfänden kann, bin ich, ermutigt durch unsere Begegnung von vorgestern ..."
Das nennt der ermutigen!
"zu dem Beschluß gekommen, an Sie die Bitte zu richten, ob Sie sich bei einem Buchhändler für die Kosten einer ersten Ausgabe verbürgen würden, und wäre es auch bloß ein kleines Bändchen. Ich überlasse die Auswahl für diesen ersten Versuch ganz Ihnen. In dem beifolgenden Paket finden Sie viele Manuskripte; Sie werden daraus ersehen, daß ich viel gedacht, gearbeitet und erlebt habe ..."
Ich habe nie gehört, daß er ein Geschäft hatte.
"und wenn die Gabe der Darstellung mir nicht ganz und gar versagt ist, soll es gewiß nicht an dem Mangel an Eindrücken liegen, wenn ich nicht Erfolg hätte.
In Erwartung einer freundlichen Antwort bin ich
Ihr alter Schulfreund ..."
Sein Name stand darunter, doch ich will ihn verschweigen, weil ich nicht gern jemand ins Gerede bringe.
Lieber Leser, du begreifst, was für ein Gesicht ich gemacht habe, als man mich so plötzlich zum Makler in Versen erheben wollte. Ich glaubte fest, wenn Shawlmann, – ich will ihn nur weiter so nennen – mich bei Tage gesehen hätte, so wäre er mir mit so etwas nicht gekommen; denn Ehrbarkeit und Würde lassen sich nicht verbergen; aber es war Abend, und ich nehme es ihm deshalb nicht so übel.