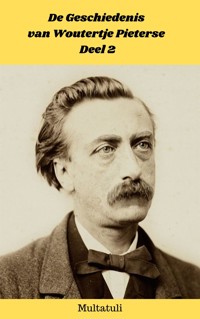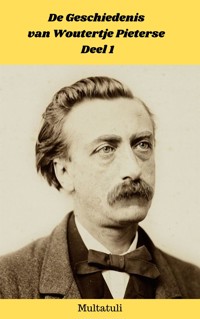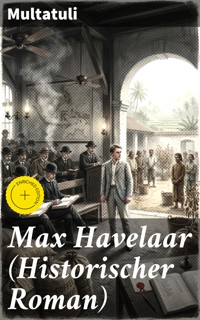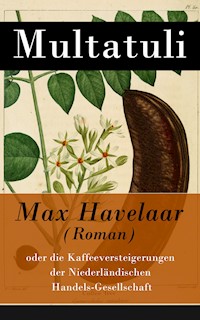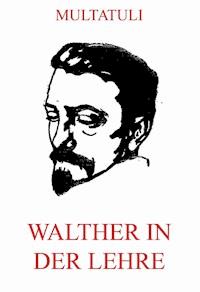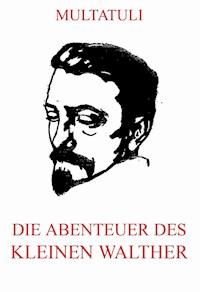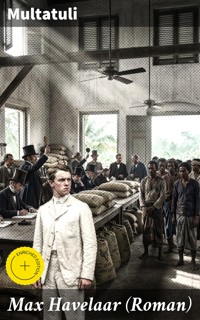
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Max Havelaar" entblößt Multatuli die Ausbeutung und Ungerechtigkeit, die niederländische Kolonialherrschaft in Java prägt. Durch die Figur des idealistischen niederländischen Beamten Emilie Havelaar, der in einem korrupten System zu kämpfen versucht, kombiniert der Roman fesselnde Erzähltechniken mit scharfer Sozialkritik. Multatulis einzigartiger literarischer Stil, der sowohl emotionale Intensität als auch präzise gesellschaftliche Analyse vereint, macht das Werk zu einem exemplarischen Stück der niederländischen Literatur und beleuchtet umfassend die ethischen Dilemmata im Kontext des Imperialismus. Multatuli, das Pseudonym von Eduard Douwes Dekker, war ein leidenschaftlicher Kritiker kolonialer Praktiken, dessen eigene Erfahrungen als Beamter in Java ihn motivierten, die brutalen Bedingungen der indonesischen Bevölkerung anzuprangern. Seine Biografie ist geprägt von einem Konflikt zwischen idealistischem Anspruch und der harten Realität der Kolonialpolitik, was seine Motivation zur Abfassung dieses Romans nachhaltig beeinflusste. Multatulis Werk ist nicht nur eine literarische Leistung, sondern auch ein Aufruf zum Dialog über Gerechtigkeit und Menschlichkeit. "Max Havelaar" ist ein unverzichtbares Leseerlebnis für alle, die sich für koloniale Geschichte, soziale Gerechtigkeit und die Kraft der Literatur als Mittel zur Veränderung interessieren. Der Roman bietet nicht nur einen historischen Einblick, sondern regt auch zur Reflexion über gegenwärtige soziale und moralische Herausforderungen an. Lassen Sie sich von Multatulis leidenschaftlichem Appell für die Rechte der Unterdrückten berühren. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Max Havelaar (Roman)
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Zwischen dem beruhigenden Aroma von Kaffee und dem bitteren Nachgeschmack von Unrecht entfaltet sich in Max Havelaar die Spannung zwischen ökonomischer Routine und moralischer Verantwortung, in der eine selbstzufriedene Handelswelt ihre Buchungen führt, während auf der anderen Seite der Welt Menschen unter einem System leiden, das von jener Ordnung profitiert, sodass der Roman mit schneidender Klarheit zeigt, wie Sprache, Akten und Geschäftssinn Missstände verschleiern können und wie zugleich eine unbequeme Stimme versucht, durch dieses Geflecht hindurch zu dringen, um Aufmerksamkeit, Empathie und letztlich Verantwortlichkeit einzufordern, gegen Widerstände, Selbsttäuschung und die Bequemlichkeit des Publikums.
Der Roman Max Havelaar erschien 1860 in den Niederlanden unter dem Pseudonym Multatuli, hinter dem der niederländische Autor Eduard Douwes Dekker steht, und gilt als fiktionales Werk scharfer Gesellschaftskritik mit stark satirischen Zügen. Er führt die Lesenden von den Handelskontoren Amsterdams in die damaligen Niederländisch-Indien, besonders nach Java, und verbindet die Welt der Kaffeebörsen mit der kolonialen Verwaltung vor Ort. Die Veröffentlichung traf auf ein Publikum, das sich an Nachrichten und Geschäftszahlen orientierte, und entfaltete gerade dadurch Wirkung, dass sie die vertraute Sprache des Handels mit den ethischen Fragen verknüpfte, die aus dieser Verflechtung erwuchsen.
Ausgangsseitig begegnen wir einer selbstgewissen Stimme aus Amsterdam, einem Kaufmann, der behauptet, nüchterne Tatsachen zur Kaffeewelt zu liefern, und der zugleich Manuskripte über einen Kolonialbeamten namens Max Havelaar in die Hände bekommt. Was als Geschäftsnähe beginnt, weitet sich durch Perspektivwechsel, eingeschobene Dokumente und stark markierte Erzählerhaltungen zu einer vielstimmigen Lektüre, in der Ironie und Ernst ineinander greifen. Der Ton schwankt bewusst zwischen pedantischer Trockenheit, polemischer Zuspitzung und leidenschaftlichem Appell; die Sätze treiben voran, stolpern mit Absicht, widersprechen sich und fügen sich doch zu einem Bild, das weniger erzählt als vorführt, wie man die Wirklichkeit zu sehen lernen kann.
Formell nutzt das Buch die Reibung zwischen Rahmen- und Binnenerzählung, zwischen Geschäftssprache und moralischer Rede, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Es montiert Erzählpassagen mit Briefen, Berichten und erläuternden Einschüben, die den Lesefluss bewusst unterbrechen und neu justieren. Dabei entsteht eine Dramaturgie der Erkenntnis: Was als scheinbar verlässliche Ordnung daherkommt, zeigt Risse; was marginal wirkt, wird zum Zentrum. Der Stil ist zugespitzt, pointiert, oft komisch und dann wieder erschütternd ernst, mit direkter Ansprache an Öffentlichkeit und Verantwortliche. Das Leseerlebnis ist damit weniger bequemes Eintauchen als ein waches, mitdenkendes Navigieren durch kontrastierende Stimmen.
Zentrale Themen sind die Verquickung von Handel und Herrschaft, die alltägliche Normalisierung von Gewalt und die Frage, wie viel Verantwortung aus Wissen erwächst. Die Figur des Beamten markiert den Versuch, idealistisches Pflichtverständnis gegen zynische Routine zu stellen; die Kaufmannsperspektive spiegelt die bequeme Selbstrechtfertigung, die in Zahlen Schutz sucht. Wiederkehrend ist die Problematik der Stimme: Wer darf für wen sprechen, und was wird durch die Art des Erzählens sichtbar oder verdeckt? In der Verbindung von Kaffeehandel, Verwaltungsabläufen und menschlichem Schicksal zeigt das Buch, wie strukturelle Ausbeutung mit sprachlichen und bürokratischen Formen zusammengeht.
Für heutige Leserinnen und Leser bleibt Max Havelaar relevant, weil er die Materialität globaler Warenketten mit einer Ethik des Hinschauens verschränkt. Kaffee ist alltäglich, doch die Frage nach Herkunft, Arbeitsverhältnissen und Machtasymmetrien ist es ebenfalls. Der Roman schult ein Bewusstsein dafür, wie Sprache Interessen bedient und wie leicht Empörung in Geschäftsrauschen untergeht. In Zeiten der Debatte um faire Lieferketten, Unternehmensverantwortung und postkoloniale Erinnerung bietet das Buch keine einfachen Lösungen, sondern Werkzeuge der Kritik: Es zeigt Mechanismen, entlarvt rhetorische Schutzwälle und fordert ein Publikum heraus, das zwischen Information, Werbung und Gewissensanspruch zu unterscheiden lernen muss.
Zugleich erinnert der Text daran, dass Literatur mehr sein kann als Spiegel: Sie greift ein, nicht indem sie Thesen lehrt, sondern indem sie Wahrnehmung verändert. Max Havelaar verbindet erzählerische Kunst mit einem unüberhörbaren moralischen Impuls, ohne die Ambivalenzen zu glätten, die jedes Handeln in komplexen Systemen begleiten. Wer sich auf diese Mischung aus Satire, Anklage und Selbstbefragung einlässt, bekommt keine einfachen Antworten, sondern eine dauerhafte Einladung zur Prüfung eigener Komfortzonen. So bleibt das Buch ein Prüfstein dafür, wie Geschichten Verantwortung erzeugen können – in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in künftigen Debatten.
Synopsis
Max Havelaar, 1860 unter dem Pseudonym Multatuli veröffentlicht, ist ein Roman über die niederländische Kolonialherrschaft auf Java. Das Buch verbindet Satire, Bericht und Anklage, um Ausbeutung, Amtsmissbrauch und moralische Verantwortung zu thematisieren. Die Handlung entfaltet sich in einer verschachtelten Erzählsituation: Ein europäischer Geschäftsmann rahmt Dokumente, die die Tätigkeit eines Kolonialbeamten beleuchten. Der Text führt schrittweise vom kaufmännischen Blick auf den Kaffeehandel zur Lebenswirklichkeit der javanischen Bevölkerung. Leitend sind die Fragen, wie Verwaltung, Profitinteressen und Gewissen kollidieren, und welche Verpflichtungen Beamte und Nation gegenüber den Untertanen tragen. Zugleich reflektiert das Werk die Macht der Darstellung.
Die Erzählung beginnt mit einem Amsterdamer Kaffeekaufmann, der sich als nüchtern, selbstgefällig und regelversessen präsentiert. Er erhält ein Konvolut mit Aufzeichnungen eines ehemaligen Kolonialbeamten und beschließt, es in seiner Weise zu ordnen. Seine Sprache und seine Einwürfe prägen zunächst den Ton: Fakten, Geschäftsetikett und Lehrsätze ersetzen Empathie. Dadurch entsteht eine satirische Distanz, die zugleich den blinden Fleck der Metropole sichtbar macht. Der Kaufmann versteht das Material als Beleg für kaufmännische Tugenden, während das Manuskript unterschwellig bereits Missstände ahnen lässt. Diese Spannung zwischen buchhalterischem Zugriff und moralischem Gehalt bildet den ersten Antrieb des Romans.
Um das Material verwertbar zu machen, engagiert der Kaufmann einen jungen Mitarbeiter, der die Papiere zu einer erzählbaren Form zusammenfügt. Mit seinem Eingreifen verschiebt sich der Ton vom pedantischen Kommentar zu einer lebendigeren Darstellung. Er setzt Akzente, die menschliche Schicksale und die Landschaft in den Blick rücken, und integriert Episoden, die über Zahlen und Verwaltungsakte hinausweisen. Dieses redaktionelle Wechselspiel macht die Konstruktion des Textes sichtbar: unterschiedliche Stimmen ringen darum, wie koloniale Wirklichkeit erzählt werden soll. Zugleich bereitet es den Übergang zum Kernbericht vor, in dem die Erfahrungen des Beamten Max Havelaar im Mittelpunkt stehen.
Max Havelaar tritt als Assistent-Resident in einer javanischen Regentschaft an und begegnet einem Geflecht aus hierarchischen Abhängigkeiten, Patronage und Angst. Er erkennt Hinweise auf Zwangsarbeit, Abgabenwillkür und Gewalt, die nicht nur lokalen Würdenträgern zugeschrieben werden können, sondern durch koloniale Erwartungen stabilisiert werden. Idealistisch und auf Recht bedacht, kündigt er an, Missstände zu untersuchen, Schutz zu gewähren und geltende Verordnungen zur Geltung zu bringen. Erste Initiativen zeigen Wirkung, aber sie machen ihn zugleich angreifbar. Havelaar gerät zwischen Loyalitäten: gegenüber den Bewohnern, der niederländischen Verwaltung und den einheimischen Autoritäten, deren Kooperation seine Arbeit voraussetzt.
Je deutlicher Havelaar die Belastungen der Bevölkerung dokumentiert, desto stärker wächst der Widerstand. Vorgesetzte drängen auf Vorsicht, Verfahrenswege und Rücksicht auf fiskalische Interessen, zumal der Kaffeeanbau für den Staatshaushalt wichtig ist. Havelaar insistiert auf rechtlicher Klärung und persönlicher Verantwortung, was in Berichten, Eingaben und Gesprächen sichtbar wird. Er versucht, Verbündete zu gewinnen und institutionelle Mechanismen anzurufen, doch jeder Schritt verstärkt die Furcht vor Skandal, Gesichtsverlust und wirtschaftlichen Einbußen. Damit verschiebt sich der Konflikt von einzelnen Übergriffen zu einem Systemproblem: Wie weit darf man Gerechtigkeit verfolgen, wenn das System selbst auf Ungleichheit beruht?
Eine eingefügte Erzählung über Saidjah und Adinda veranschaulicht die Erfahrung von Verlust, Zwang und Hoffnung aus Sicht der Betroffenen. Ohne Verwaltungsjargon zeigt sie, wie politische und ökonomische Strukturen in intime Lebensläufe eingreifen. Diese Episode kontrastiert den Zynismus des kaufmännischen Rahmens und dient dem Mitarbeiter als moralisches Gegenargument: Hinter Ertragszahlen stehen zerbrechliche Existenzen. Zugleich vertieft sie die poetische Dimension des Romans und erweitert den Blick über einzelne Amtsakten hinaus. Indem die Geschichte exemplarisch bleibt, unterstreicht sie die Dringlichkeit von Schutz, Recht und Anerkennung, ohne die Entwicklung der Haupthandlung vorwegzunehmen. Sie fungiert als Prüfstein für das Gewissen der Lesenden.
Auf dem Höhepunkt werden die Spannungen zwischen Pflicht, Karriere und Gewissen unübersehbar. Die Erzählebenen greifen ineinander und münden in einen direkten Appell, der die Verantwortung über Behördenwege hinaus adressiert. Der Roman endet nicht mit einer bequemen Lösung, sondern mit der Forderung nach moralischer Rechenschaft und politischer Konsequenz. Max Havelaar gilt als Schlüsseltitel der niederländischen Literatur und als kraftvolle Kritik an kolonialen Verhältnissen. Er prägte Debatten über Verwaltungsethik und Menschenrechte und wirkt durch seine Mischung aus Satire, Anklage und Empathie fort. Das Werk lädt dazu ein, Machtverhältnisse und Mitverantwortung nüchtern und menschlich zugleich zu prüfen.
Historischer Kontext
Max Havelaar erschien 1860 in Amsterdam und bezieht sich auf die niederländische Kolonialherrschaft in Niederländisch-Indien Mitte des 19. Jahrhunderts. Nach der Auflösung der VOC 1799 regierte der niederländische Staat das Archipel zentral von Batavia (heute Jakarta) aus. Prägende Institutionen waren der Generalgouverneur, der Raad van Indië, europäische Residentschaften und einheimische Regenten (Bupati). Rechtsgrundlagen wie das Regeringsreglement von 1854 ordneten Verwaltung und Zuständigkeiten. Ökonomisch entscheidend waren das staatlich organisierte Anbausystem auf Java und die Nederlandsche Handel-Maatschappij, die Kolonialwaren nach Europa vermarktete. Diese Konstellation bildet die unmittelbare historische Bühne, auf der Multatulis Roman seine Kritik ansetzt.
Das sogenannte Kultursystem (Cultuurstelsel), 1830 eingeführt, verpflichtete Dörfer auf Java, einen Teil ihrer Felder und Arbeitskraft für Exportkulturen wie Kaffee, Zucker und Indigo bereitzustellen. Die Erzeugnisse wurden an die Kolonialverwaltung abgeliefert, die sie über staatliche Kanäle vermarktete. Offiziell war der Anteil begrenzt, doch zeitgenössische Berichte dokumentierten Übergriffe, Mehrforderungen und Zwangsdienste. Die Kooperation zwischen niederländischen Beamten und der lokalen Elite der priyayi und Regenten war systemtragend. Für den niederländischen Staat lieferte das sogenannte batig slot – der kolonale Haushaltsüberschuss – jahrzehntelang erhebliche Einnahmen und entlastete das Mutterland finanziell. Diese Struktur ist der zentrale historische Bezug des Romans.
In den Niederlanden veränderte die Verfassung von 1848 unter Johan Rudolph Thorbecke das politische System grundlegend: Minister wurden dem Parlament verantwortlich, die Pressefreiheit weitete sich, und die öffentliche Debatte gewann an Gewicht. Diese Liberalisierung schuf den Resonanzraum, in dem koloniale Themen intensiv diskutiert wurden. Zeitgleich speiste das koloniale batig slot über Jahre den Staatshaushalt und erleichterte Investitionen sowie Schuldentilgungen, was die politische Bereitschaft zu raschem Kurswechsel verringerte. Zwischen liberalen Reformern und Verteidigern des Status quo entstand ein Streit über Zweck, Rechtfertigung und Kosten der Kolonialherrschaft. Multatulis Roman traf in dieses Umfeld zunehmender politischer Öffentlichkeit.
Eduard Douwes Dekker, der unter dem Pseudonym Multatuli schrieb, war langjähriger Kolonialbeamter. 1856 diente er als Assistenzresident in Lebak (Bantam) auf Java und geriet in Konflikt mit Vorgesetzten, nachdem er Missstände und die Ausbeutung der Bevölkerung anprangerte. Er verließ den Dienst und kehrte nach Europa zurück. 1860 veröffentlichte er in Amsterdam Max Havelaar, der in literarischer Form Erfahrungen, Dokumente und satirische Figuren bündelt. Der Roman verbindet Klage über Verwaltungspraktiken mit einer direkten moralischen Ansprache an die Verantwortungsträger. Diese biografische Nähe zu Verwaltungsvorgängen gibt dem Text den Charakter eines zeitgenössischen, quellennahen Kommentars.
Handel und Finanzinstitutionen verbanden Java eng mit den Niederlanden. Die Nederlandsche Handel-Maatschappij organisierte den Absatz von Kaffee, Zucker und anderen Kolonialwaren; Kaffeeauktionen in Amsterdam machten die Erträge sichtbar. In diesem Umfeld prosperierten Kaufleute, Makler und Raffinerien, die von staatlich gesicherter Lieferung profitierten. Der Roman spiegelt diese Verflechtung, indem er eine bürgerliche Handelsmentalität vorführt, die moralische Distanz zu den Produktionsbedingungen wahrt. Dadurch wird die europäische Nachfrage nach kolonialen Gütern als Teil der Struktur kenntlich, die Zwang und Abhängigkeiten aufrechterhielt. Die ökonomischen Knotenpunkte Europas erscheinen nicht als fern, sondern als integraler Bestandteil des Systems.
Nach dem Erscheinen löste Max Havelaar sofort Kontroversen aus. Zeitungen und Zeitschriften diskutierten die Vorwürfe, Parlamentsabgeordnete nahmen den Stoff in Debatten auf, und ehemalige Kolonialbeamte bestritten oder bestätigten einzelne Schilderungen. Die Kolonialverwaltung verteidigte das Kultursystem als notwendig und geordnet, Kritiker verwiesen auf dokumentierte Übergriffe und strukturelle Interessenkonflikte. Das Buch verbreitete sich in mehreren Auflagen und erreichte ein breites Lesepublikum. Obwohl es keinen amtlichen Untersuchungsbericht ersetzt, prägte es die Wahrnehmung der Kolonialherrschaft und verschob den Erwartungshorizont: Verwaltungshandeln sollte sich an rechtlicher Verantwortlichkeit und am Schutz der Bevölkerung messen lassen. Auch im Ausland wurde es wahrgenommen.
In den 1860er und 1870er Jahren setzte ein rechtlicher Umbau der Kolonialwirtschaft ein. Das Agrargesetz von 1870 und begleitende Regelungen öffneten weite Bereiche für privates Unternehmertum und leiteten den Abbau zentraler Elemente des Kultursystems ein; staatlich erzwungene Anbaupflichten wurden schrittweise reduziert. Zugleich rückten Fragen nach Bildungs- und Rechtsgarantien für die Bevölkerung in den Fokus. Um 1901 formulierte die niederländische Regierung die sogenannte Ethische Politik als Programm staatlicher Fürsorge, mit Schwerpunkten auf Bildung, Infrastruktur und ländlicher Entwicklung. Reformpublicisten wie C. Th. van Deventer beriefen sich auf eine „Ehrenschuld“. Max Havelaar war ein häufig genanntes Referenzwerk dieser Debatten.
Historisch gelesen kommentiert der Roman die Funktionsweise imperialer Herrschaft in einer administrativ durchorganisierten Kolonie: die Verzahnung von Amt, Rang und ökonomischem Interesse, die Anfälligkeit für Machtmissbrauch und die Distanz zwischen Metropole und Dorf. Er macht sichtbar, wie politische Reformen im Mutterland erst durch öffentliche Kritik und dokumentierte Erfahrung in koloniale Praxis übersetzt werden. Ohne die Handlung im Detail zu verraten, zielt der Text auf Verantwortlichkeit an der Spitze des Systems und auf rechtsstaatliche Kontrolle. Seine Wirkung erklärt sich daraus, dass er Zeitgenossen Quellen, Stimmen und Strukturen bündelte – und damit die Epoche aus sich selbst heraus befragte.
Max Havelaar (Roman)
Erstes Kapitel.
Inhaltsverzeichnis
Wir lernen Herrn Batavus Droogstoppel kennen, sowie seine Ansichten über Poesie im allgemeinen und Romanschreiben im besonderen.
Ich bin Makler in Kaffee, und wohne auf der Lauriergracht Nummer 37[1q]. Es ist eigentlich nicht mein Fall, Romane zu schreiben oder dergleichen, und es hat auch ziemlich lange gedauert, bis ich mich entschloß, ein paar Ries Papier extra zu bestellen und das Werk anzufangen, das ihr, liebe Leser, soeben zur Hand genommen habt, und das ihr lesen müßt, ob ihr Makler in Kaffee seid, oder ob ihr irgend etwas anderes seid. Nicht allein, daß ich niemals etwas geschrieben habe, was nach einem Roman aussah – nein, ich bin sogar nicht einmal ein Freund davon, solches Zeug zu lesen, denn ich bin ein Geschäftsmann. Seit Jahren frage ich mich, wozu so etwas gut sein kann, und ich stehe verwundert über die Unverschämtheit, mit der die Dichter und Romanerzähler euch allerlei weißmachen dürfen, was niemals geschehen ist, und was überhaupt niemals vorkommen kann. Wenn ich in meinem Fach – ich bin Makler in Kaffee und wohne auf der Lauriergracht Nummer 37 – einem Prinzipal – ein Prinzipal ist jemand, der Kaffee verkauft – eine Deklaration machte, in der nur ein kleiner Teil der Unwahrheiten vorkäme, die in Gedichten und Romanen die Hauptsache sind, er würde zur Stunde sicher Büsselinck & Waterman nehmen. Das sind auch Makler in Kaffee, doch ihre Adresse braucht ihr nicht zu wissen. Ich passe deshalb wohl auf, daß ich keine Romane schreibe oder andere falsche Angaben mache.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, daß Menschen, die sich mit so etwas einlassen, meistenteils schlecht wegkommen. Ich bin dreiundvierzig Jahre alt, seit zwanzig Jahren besuche ich die Börse, und ich kann daher wohl vortreten, wenn man jemand ruft, der Erfahrung hat. Ich habe schon etwas von Häusern fallen sehen! Und meistens, wenn ich der Sache nachging, kam es mir vor, daß der Grund in der verkehrten Richtung lag, die die meisten in ihrer Jugend empfingen.
Ich sage: Wahrheit und gesunder Menschenverstand, und dabei bleib ich. Für die heilige Schrift mache ich natürlich eine Ausnahme. Der Unsinn beginnt schon mit van Alphen[1], und gleich bei der ersten Zeile über die "lieben Kleinen". Was Teufel kann den alten Herrn veranlassen, sich für einen Anbeter meiner Schwester Trude auszugeben, die schlimme Augen hatte? Oder meines Bruders Gerrit, der immer die Finger in der Nase hatte? – und doch sagte er: "daß er die Verschen sang, durch Lieb' dazu gedrungen." Ich dachte mir oft als Kind: "Mann, ich möchte dich gern einmal treffen, und wenn du mir dann die Marmeln abschlägst, um die ich dich bitten will, oder meinen Namen in Zuckergebäck – ich heiße Batavus – dann halte ich dich für einen Lügner." Aber ich habe van Alphen niemals gesehen. Er war, glaube ich, schon tot, als er uns erzählte, daß mein Vater mein bester Freund wäre, – ich hielt Paulchen Winser mehr dafür, der in unserer Nähe wohnte, in der Batavierstraat; – und daß mein kleiner Hund so dankbar wäre, – wir hielten keine Hunde, weil sie so unreinlich sind.
Alles Schwindel. So geht nun die Erziehung weiter. Das neue Schwesterchen ist von der Gemüsefrau gekommen in einem großen Kohlkopf. Alle Holländer sind tapfer und edelmütig. Die Römer konnten froh sein, daß die Bataver sie leben ließen. Der Bey von Tunis bekam Bauchkneifen, als er das Flattern der niederländischen Flagge hörte. Der Herzog von Alba war ein Untier. Die Ebbe, ich glaube 1672, dauerte etwas länger als sonst, bloß um Niederland zu beschirmen. Lügen. Niederland ist Niederland geblieben, weil unsere Vorfahren sich um ihre Geschäfte kümmerten, und weil sie den rechten Glauben hatten; das ist die Sache.
Und dann kommen wieder andere Lügen. Ein Mädchen ist ein Engel. Nun, wer das zuerst entdeckte, hat niemals Schwestern gehabt. Liebe ist eine Seligkeit; man flüchtet mit dem einen oder anderen Gegenstand bis ans Ende der Welt. Die Welt hat keine Enden, und die Liebe ist auch Dummheit. Kein Mensch kann sagen, daß ich mit meiner Frau nicht gut lebe – sie ist eine Tochter von Last & Co., Makler in Kaffee – kein Mensch kann etwas über unsere Ehe sagen; ich bin Mitglied von Artis, und sie hat ein Umschlagetuch für zweiundneunzig Gulden, aber von so einer verdrehten Liebe, die durchaus am Ende der Welt wohnen will, ist zwischen uns nie die Rede gewesen. Nach unserer Hochzeit haben wir einen Ausflug nach dem Haag gemacht – sie hat da Flanell gekauft – ich trage noch Unterjacken davon – und weiter hat uns die Liebe nicht in der Welt herumgejagt. Also alles Unsinn und Schwindel.
Und sollte meine Ehe nun weniger glücklich sein als die der Menschen, die sich vor Liebe die Schwindsucht an den Hals holten oder die Haare aus dem Kopfe? Oder denkt ihr, daß mein Haus weniger gut geregelt ist, als es wäre, wenn ich vor siebzehn Jahren meinem Mädchen in Versen gesagt hätte, daß ich sie heiraten wollte? Unsinn. Ich hätte es ebenso gut gekonnt wie jeder andere, denn Versemachen ist ein Handwerk, das sicher leichter ist als Elfenbeindrechseln. Wie wären sonst die Pfefferkuchen mit Versen so billig? Und frage einer nach dem Preise eines Satzes Billardbälle!
Gegen Verse an sich habe ich nichts. Will einer die Worte in Reihe und Glied setzen, meinetwegen; aber er soll nichts sagen, was nicht die Wahrheit ist. " Die Luft geht rauh, vier Uhr ist's genau" – das laß ich gelten, wenn es wirklich rauh und vier Uhr genau ist. Aber wenn es nun dreiviertel drei ist, dann kann ich, der seine Worte nicht in Reih und Glied setzt, sagen: "Die Luft geht rauh, und es ist dreiviertel drei." Der Versemacher dagegen ist durch die Rauheit der ersten Zeile an eine volle Stunde gebunden; es muß genau vier, fünf, zwei, ein Uhr sein, oder die Luft darf nicht rauh sein. Da macht er sich nun ans Pfuschen: entweder muß das Wetter geändert werden oder die Zeit. Eins von beiden ist dann gelogen.
Und nicht bloß die Verse verführen die Jugend zur Unwahrheit. Gele einmal ins Theater und höre zu, was da für Lügen an den Mann gebracht werden. Der Held des Stücks wird aus dem Wasser geholt von einem, der gerade im Begriff steht, Bankerott zu machen. Darauf giebt er ihm sein halbes Vermögen; das kann nicht wahr sein. Wie unlängst auf der Prinzengracht mein Hut ins Wasser flog, hab ich dem Mann, der ihn mir wiederbrachte, ein Dübbeltje gegeben, und er war zufrieden. Ich weiß wohl, daß ich ihm etwas mehr hätte geben müssen, wenn er mich selber herausgeholt hätte, aber mein halbes Vermögen ganz gewiß nicht; – denn das ist klar, daß man auf die Weise bloß zweimal ins Wasser fallen dürfte, um bettelarm zu sein. Was aber das Schlimmste bei solchen Theaterstücken ist: das Publikum gewöhnt sich so an die Unwahrheiten, daß es sie schön findet und Beifall klatscht. Ich hätte wohl Lust, einmal so ein ganzes Parterre ins Wasser zu werfen, um zu sehen, ob der Beifall ernst gemeint war. Ich, der ich die Wahrheit liebe, warne hiermit jedermann, daß ich für das Auffischen meiner Person keinen so hohen Finderlohn bezahlen will. Wer nicht mit weniger zufrieden ist, lasse mich liegen. Höchstens Sonntags würde ich etwas mehr bewilligen, weil ich dann meine goldene Uhrkette trage und einen besseren Rock.
Ja, das Theater verdirbt viele, mehr noch als die Romane. Es ist so anschaulich. Mit ein bißchen Flittergold und einer Umrahmung von ausgeschlagenem Papier macht sich das alles so verführerisch. Für Kinder und Leute, die nicht im Geschäft sind, meine ich. Selbst wenn sie Armut darstellen will, ist die Vorstellung immer lügenhaft. Ein Mädchen, deren Vater bankerott machte, arbeitet, um die Familie zu ernähren; gut. Da sitzt sie nun, zu nähen, zu stricken oder zu sticken. Aber nun zähle einmal einer die Stiche, die sie während der ganzen Handlung macht. Sie schwatzt, sie seufzt, sie läuft ans Fenster, aber arbeiten thut sie nicht. Die Familie, die von der Arbeit leben kann, braucht wenig. So ein Mädchen ist natürlich die Heldin. Sie hat einige Verführer die Treppe hinuntergeworfen; sie ruft fortwährend: "O meine Mutter! o meine Mutter!" und stellt also die Tugend vor. Was ist das für eine Tugend, die zu einem Paar wollener Strümpfe ein Jahr braucht? Giebt das nicht falsche Ideen von Tugend und "Arbeit um das liebe Leben"? Alles Unsinn und Schwindel.
Dann kommt ihr erster Verehrer, der früher Schreiber war am Kopierbuch – jetzt aber steinreich – mit einem Male zurück, und der heiratet sie. Auch wieder Schwindel. Wer Geld hat, heiratet kein Mädchen aus einem bankerotten Hause. Und wenn ihr meint, daß das auf dem Theater hingehen könnte, als Ausnahme, so bleibt doch mein Tadel bestehen, daß man den Sinn für die Wahrheit beim Volke verdirbt, welches die Ausnahme für die Regel nimmt, und daß man die öffentliche Sittlichkeit untergräbt, wenn man das Volk gewöhnt, auf der Bühne etwas zu applaudieren, was im Leben durch jeden verständigen Makler oder Kaufmann für eine lächerliche Verrücktheit gehalten wird. Als ich mich verheiratete, waren wir auf dem Kontor von meinem Schwiegervater – Last & Co. – dreizehn, und es ging etwas vor.
Und noch mehr Lügen auf dem Theater! Wenn der Held mit seinem steifen Kömödienschritt abgeht, um das Vaterland zu retten, wie kommt es, daß dann die doppelte Hinterthür sich immer von selber öffnet?
Und dann – woher weiß eine Person, die in Versen redet, was die andere antworten hat, um ihr den Reim bequem zu machen? Wenn der Feldherr zu der Prinzessin sagt: "Prinzeß, es ist zu spät, verschlossen sind die Thüren!" wie kann er da vorher wissen, daß sie sagen will: "Wohlan denn, unverzagt! laßt uns die Schwerter rühren!" Wenn sie nun einmal, da die Thür zu ist, antwortet, sie werde dann warten, bis wieder aufgemacht wird, oder sie würde ein ander Mal wiederkommen, wo bleibt da Maß und Reim? Ist es also nicht purer Unsinn, wenn der Feldherr die Prinzessin fragend ansieht, um zu wissen, was sie nach Thoresschluß thun will? Noch eins: wenn sie nun gerade Lust hätte, zu Bette zu gehen, anstatt irgend etwas zu rühren? Alles Unsinn!
Und dann die belohnte Tugend? O, o! – ich bin seit siebzehn Jahren Makler n Kaffee – Lauriergracht Nummer 37, – und ich habe also etwas erlebt – das aber kränkt mich immer fürchterlich, wenn ich die gute liebe Wahrheit so verdrehen sehe. Belohnte Tugend – ist das nicht, um aus der Tugend einen Handelsartikel zu machen? Es ist nicht so in der Welt, – und es ist gut, daß es nicht so ist, denn wo bliebe das Verdienst, wenn die Tugend belohnt würde! Wozu also immer die infamen Lügen vorgeschoben?
Da ist zum Beispiel Lukas, der Packknecht, der schon bei dem Vater von Last & Co. gearbeitet hat, – die Firma war damals Last & Meyer, aber die Meyers sind heraus – das war doch wohl ein tugendhafter Mann. Keine Kaffeebohne ging da verloren, er ging gewissenhaft zur Kirche, und trinken that er auch nicht; als mein Schwiegervater zu Driebergen war, bewahrte er das Haus und die Kasse und alles. Einmal hatte er an der Bank siebzehn Gulden zu viel erhalten, und er brachte sie zurück. Er ist nun alt und gichtig und kann nicht mehr dienen. Nun hat er nichts; denn es ist viel Umsatz bei uns, und wir brauchen junge Leute. Nun also, ich halte diesen Lukas für sehr tugendhaft, und wird er nun belohnt? Kommt da ein Prinz, der ihm Diamanten schenkt, oder eine Fee, die ihm Butterbrote schmiert? Wahrhaftig nicht, er ist arm, er bleibt arm, und das muß auch so sein. Ich kann ihm nicht helfen – denn wir brauchen junge Leute, weil viel Umsatz bei uns ist – aber könnte ich auch, wo bleibt da sein Verdienst, wenn er nun auf seine alten Tage ein sorgenloses Leben führen könnte? Dann sollten wohl alle Packknechte tugendhaft werden, und jeder einzelne, – was doch der Zweck nicht sein kann, weil dann für die Braven nachher keine besondere Belohnung übrig bliebe. Aber auf der Bühne verdrehen sie das; – alles Schwindel.
Ich bin auch tugendhaft, aber verlange ich dafür eine Belohnung? Wenn meine Geschäfte gut gehen – und das thun sie – wenn meine Frau und die Kinder gesund sind, sodaß ich keine Schererei habe mit Doktor und Apotheker, – wenn ich jahraus, jahrein ein Sümmchen zurücklegen kann für die alten Tage; – wenn Fritz frisch aufwächst, um später an meine Stelle zu treten, wenn ich nach Driebergen gehe, – dann bin ich zufrieden. Aber das ist alles die natürliche Folge der Umstände, und weil ich auf das Geschäft acht gebe; – für meine Tugend verlange ich nichts.
Und daß ich doch tugendhaft bin, sieht man klar aus meiner Liebe zur Wahrheit; – das ist, nach meiner Festigkeit im Glauben, meine Hauptneigung; und ich wünsche, daß ihr davon überzeugt wäret, Leser, denn es ist die Entschuldigung für das Schreiben dieses Buches.
Eine zweite Neigung, die bei mir ebenso hoch wie die Wahrheitsliebe angeschrieben steht, ist der Herzenszug für mein Fach – ich bin Makler in Kaffee, Lauriergracht Nr. 37. Nun also, Leser, meiner unantastbaren Liebe zur Wahrheit und meinem geschäftlichen Eifer habt ihr es zu danken, daß diese Blätter geschrieben sind. Ich will euch erzählen, wie das gekommen ist. Da ich nun für den Augenblick von euch Abschied nehmen muß – ich muß nach der Börse – so lade ich euch nachher auf ein zweites Kapitel. Auf Wiedersehen also.
Und, na, hier, steckt es ein – es ist eine kleine Mühe – es kann zu paß kommen – sieh da, da ist es – meine Geschäftskarte – die Compagnie bin ich, seit die Meyers heraus sind – der alte Last ist mein Schwiegervater.
Zweites Kapitel.
Inhaltsverzeichnis
Herr Batavus Droogstoppel thut einen großen Schachzug gegen die Konkurrenz. Er trifft einen alten Bekannten, der sich gern in Sachen mischte, die ihn nichts angingen z.B. das Abenteuer mit dem Griechen.
Es war flau auf der Börse, die Frühjahrsversteigerung muß es wieder gutmachen. Denkt nicht, daß bei uns kein Umsatz ist – bei Büsselinck & Waterman ist es noch flauer. Es ist eine sonderbare Welt; man erlebt schon was, wenn man so an zwanzig Jahre die Börse besucht. Denkt euch, daß sie danach getrachtet haben – Büsselinck & Waterman, meine ich – mir Ludwig Stern abzunehmen. Da ich nicht weiß, ob ihr an der Börse Bescheid wißt, will ich euch sagen, daß Stern ein erstes Haus in Kaffee ist, in Hamburg, welches stets durch Last & Co. bedient worden ist. Ganz zufällig kam ich dahinter – ich meine hinter die Pfuscherei von Büsselinck & Waterman. Sie würden ein Viertel Prozent von der Courtage fallen lassen – Schleicher sind sie, weiter nichts – und nun seht, was ich gethan habe, im diesen Schlag abzuwehren. Ein anderer an meiner Stelle hätte vielleicht an Ludwig Stern geschrieben, daß er auch etwas ablassen wolle, und daß er auf Berücksichtigung hoffe wegen der langjährigen Dienste von Last & Co. (ich habe ausgerechnet, daß die Firma, seit rund fünfzig Jahren, vier Tonnen an Stern verdient hat: die Beziehung datiert von der Kontinentalsperre[2] her, als wir die Kolonialwaren von Helgoland einschmuggelten) und solche Dinge mehr. Nein, schleichen thue ich nicht. Ich bin nach "Polen" gegangen, ließ mir Feder und Papier geben, und schrieb:
"Daß die große Ausbreitung, die unsere Geschäfte in der letzten Zeit genommen haben, besonders durch die vielen geehrten Aufträge aus Norddeutschland" (es ist die reine Wahrheit), "eine Vermehrung des Personals nötig machte;" (es ist die Wahrheit, – gestern noch war der Buchhalter nach elf auf dem Kontor, um seine Brille zu suchen); "daß vor allem sich das Bedürfnis geltend mache nach anständigen, wohlerzogenen jungen Leuten für die Korrespondenz im Deutschen. Daß zwar viele deutsche junge Männer in Amsterdam vorhanden wären, die auch die gewünschten Fähigkeiten besäßen, daß aber ein Haus, das auf sich hält" (es ist die reine Wahrheit), "bei dem zunehmenden Leichtsinn und der Leichtlebigkeit der Jugend, bei dem täglichen Anwachsen der Zahl der Glücksjäger, und mit Rücksicht auf die Notwendigkeit eines soliden Lebenswandels, um Hand in Hand zu gehen mit der Solidität in der Ausführung erteilter Aufträge" (es ist wahrhaftig alles die lautere Wahrheit), "daß solch ein Haus – ich meine Last & Co., Makler in Kaffee, Lauriergracht Nr. 37 – nicht umsichtig genug sein könne beim Engagieren von Personen ..."
Das ist alles die reine Wahrheit, Leser[2q]. Weißt du wohl, daß der junge Deutsche, der auf der Börse bei Pfeiler 17 stand, mit der Tochter von Büsselinck & Waterman davongelaufen ist? Unsere Marie wird im September auch bereits dreizehn.
"Daß ich die Ehre gehabt hätte, von Herrn Saffeler" – Saffeler reist für Stern – "zu vernehmen, daß der geschätzte Chef der Firma Stern einen Sohn habe, den Herrn Ernst Stern, der zur Vervollständigung seiner kaufmännischen Kenntnisse einige Zeit in einem holländischen Hause arbeiten möchte."
"Daß ich mit Rücksicht auf" – (hier wiederholte ich die Sittenlosigkeit und erzählte die Geschichte von Büsselinck & Watermans Tochter; es kann nicht schaden, wenn man das weiß;) "daß ich mit Rücksicht darauf nichts lieber sehen würde, als Herrn Ernst Stern mit der deutschen Korrespondenz unseres Hauses betraut zu sehen."
Aus Zartgefühl vermied ich alle Anspielung auf Gehalt oder Salair, ich fügte aber bei:
"Daß, falls Herr Ernst Stern mit dem Aufenthalt in unserem Hause – Lauriergracht Nr. 37 – vorlieb nehmen wollte, meine Frau sich bereit erklärte, wie eine Mutter für ihn zu sorgen, und daß seine Wäsche im Hause besorgt werden würde." (Das ist die reine Wahrheit, denn Marie stopft und strickt ganz nett. Und zum Schlusse:) "Daß bei uns dem Herrn gedient wird."
Das kann er in seine Tasche stecken, denn die Sterns sind lutherisch.
Und den Brief schickte ich ab. Ihr begreift, daß der alte Stern nicht gut zu Büsselinck & Waterman übergehen kann, wenn der junge bei uns auf dem Kontor ist. Ich bin sehr neugierig auf die Antwort.
Um nun wieder auf mein Buch zurückzukommen. Vor einiger Zeit komme ich des Abends durch die Kalverstraat, und ich blieb vor dem Laden eines Krämers stehen, der sich gerade beschäftigte mit dem Sortieren einer Partie "Java, ordinär, schön, gelb, Sorte Cheribon, etwas gebrochen und Kehricht dabei," was mich sehr interessierte, denn ich merke auf alles. Da fiel mir auf einmal ein Herr ins Auge, der in der Nähe vor einem Buchladen stand und mir bekannt vorkam. Er schien mich auch zu erkennen, denn unsere Blicke begegneten sich fortwährend. Ich muß bekennen, daß ich zu sehr vertieft war in die Betrachtung des Kehrichts, um sofort zu merken, was ich später sah, daß er nämlich ziemlich ärmlich in den Kleidern stak, sonst hätte ich die Sache laufen gelassen; aber mit einem Male schoß mir der Gedanke durch den Kopf, es könnte ein Reisender eines deutschen Hauses sein, das einen soliden Makler sucht. Er hatte wohl auch etwas von einem Deutschen an sich, und von einem Reisenden auch; er war sehr blond, hatte blaue Augen, und in Haltung und Kleidung etwas, was den Fremden verriet. Anstatt eines gehörigen Winterüberziehers hing ihm eine Art von Shawl über die Schulter, als ob er so von der Reise käme. Ich meinte einen Kunden zu sehen und gab ihm eine Geschäftskarte, Last & Co., Makler in Kaffee, Lauriergracht Nr. 37. Er hielt sie an die Gasflamme und sagte:
"Ich danke Ihnen, aber ich habe mich geirrt; ich dachte das Vergnügen zu haben, einen alten Schulkameraden vor mir zu sehen, indessen ... Last, das ist der Name nicht ..."
"Pardon," sagte ich, denn ich bin stets höflich, "ich bin Mijnheer Droogstoppel, Batavus Droogstoppel ... Last & Co. ist die Firma, Makler in Kaffee, Lauriergr ..."
"Gut, Droogstoppel, kennst du mich nicht mehr? Sieh mich einmal gut an."
Je mehr ich ihn ansah, je mehr erinnerte ich mich, ihn öfter gesehen zu haben; aber merkwürdig, sein Gesicht hatte auf mich die Wirkung, als ob ich fremde Parfümerien röche. Lach nicht darüber, Leser, du sollst später sehen, wie das kam. Ich bin sicher, daß er keinen Tropfen Räucherwerk bei sich trug, und doch roch ich etwas Angenehmes, etwas Starkes, etwas, das mich erinnerte an ... da hatte ich's!
"Sind Sie es," rief ich, "der mich von dem Griechen befreit hat?"
"Natürlich," sagte er, "und wie geht es Ihnen?"
Ich erzählte ihm, daß wir insgesamt dreizehn auf dem Kontor wären, und daß viel zu thun wäre. Und dann fragte ich ihn, wie es ihm ginge, was mich später reute, denn er schien nicht in guten Verhältnissen zu sein, und ich liebe arme Menschen nicht, weil da gewöhnlich eigene Schuld mit unterläuft, denn der Herr würde nicht jemand verlassen, der ihm treu gedient hätte. Hätte ich einfach gesagt, "wir sind insgesamt dreizehn" und "guten Abend weiterhin," dann wäre ich ihn los gewesen, aber durch das Fragen und Antworten wurde es je länger je schwerer (Fritz sagt: je länger, desto schwerer, aber das thu ich nicht), je schwerer also, von ihm los zu kommen. Anderseits muß ich auch wieder bekennen, daß ihr dann dieses Buch nicht hättet zu lesen bekommen, denn es ist eine Folge von dieser Begegnung! ... Man muß immer das Gute hervorheben, und wer das nicht thut, das sind unzufriedene Menschen, die ich nicht leiden kann.
Ja, ja, er war es, der mich aus den Händen des Griechen gerettet hatte! Denkt nun nicht, daß ich jemals durch Seeräuber bin gefangen genommen worden, oder daß ich in der Levante Krieg geführt habe. Ich habe euch bereits gesagt, daß ich nach der Hochzeit mit meiner Frau nach dem Haag gefahren bin; da haben wir das Moritz-Haus gesehen und in der Veenestraat Flanell gekauft. Das ist der einzige Ausflug, den meine Geschäfte mir überhaupt gestattet haben, weil bei uns so viel zu thun ist. Nein, in Amsterdam selbst hatte er um meinetwillen einem Griechen die Nase blutig geschlagen, denn er gab sich immer mit Dingen ab, die ihn nichts angingen.
Es war im Jahre drei- oder vierundvierzig, glaube ich, und im September, es war Kirmeß in Amsterdam. Da meine alten Leute vor hatten, aus mir einen Geistlichen zu machen, lernte ich Latein. Später habe ich mich öfter gefragt, warum man eigentlich Lateinisch verstehen muß, um auf Holländisch "Gott ist gut" zu sagen. Genug ich war auf der Lateinschule – jetzt sagen sie Gymnasium – und da war Kirmeß, – in Amsterdam, meine ich. Auf dem Westermarkt standen Buden, und wenn du ein Amsterdamer bist, Leser, und ungefähr von meinem Alter, so wirst du dich erinnern, daß eine darunter war, die sich auszeichnete durch die schwarzen Augen und die langen Flechten eines Mädchens, die als Griechin angezogen war; auch ihr Vater war ein Grieche, oder wenigstens sah er wie ein Grieche aus. Sie verkauften allerlei Räucherkram.
Ich war gerade alt genug, um das Mädchen hübsch zu finden, ohne indessen den Mut zu haben, sie anzusprechen. Das würde mir auch wenig genützt haben, denn Mädchen von achtzehn Jahren betrachten einen sechzehnjährigen Jungen noch als ein Kind, und darin haben sie ganz recht. Trotzdem kamen wir Quartaner jeden Abend auf den Westermarkt, um das Mädchen zu sehen.
Nun war er, der da jetzt vor mir stand mit seinem Shawl, eines Tages dabei, obschon er ein paar Jahre jünger war als wir anderen und darum noch ein bißchen zu kindisch, um nach der Griechin zu gucken. Aber er war der Erste in unserer Klasse – denn gescheit war er, das muß ich zugeben – und spielen, balgen und boxen mochte er gern; daher war er bei uns. Wie wir nun, wir waren im ganzen zehn Mann, hübsch weit von der Bude ab zusammenstanden und nach der Griechin schielten und beratschlagten, wie wir es anlegen sollten, um ihre Bekanntschaft zu machen, wurde also beschlossen, Geld zusammenzuthun, um irgend etwas zu kaufen. Aber nun war guter Rat teuer, wer die große Ehre haben sollte, das Mädchen anzureden. Jeder wollte, aber keiner getraute sich. Es wurde gelost, und das Los fiel auf mich. Nun bekenne ich, daß ich nicht gern Gefahren trotze; ich bin Familienvater, und halte jeden, der Gefahren sucht, für einen Narren, wie es auch in der Schrift steht. Es ist mir wirklich angenehm zu erklären, daß ich in meinen Ideen über Gefahr und dergleichen mir gleich geblieben bin, da ich jetzt noch darüber dieselbe Meinung hege, wie jenen Abend, als ich da vor der Bude des Griechen stand, mit den zwölf Stübern, die wir zusammengelegt hatten, in der Hand. Aber aus falscher Scham getraute ich mich nicht zu sagen, daß ich mich nicht getraute, und außerdem, ich mußte wohl vorwärts, denn meine Kameraden drängten mich, und da stand ich nun vor der Bude.
Das Mädchen sah ich nicht, ich sah überhaupt nichts, Alles war mir grün und gelb vor den Augen ... ich stammelte einen Aoristus Primus[3] von ich weiß nicht welchem Zeitwort ...
"Plaît-il?" sagte sie. Ich faßte etwas Mut, und machte weiter:
"Meenin aeide thea," und "Ägypten wär' ein Geschenk des Nils" ...
Ich bin überzeugt, daß ich mit dem Bekanntschaftmachen schon noch vorwärts gekommen wäre, wenn nicht in diesem Augenblick einer meiner Kameraden aus kindischer Bosheit mir einen solchen Stoß in den Rücken gegeben hätte, daß ich recht unsanft gegen den Kasten flog, der in halber Manneshöhe die Vorderseite der Bude abschloß. Ich fühlte einen Griff in meinem Nacken ... einen zweiten Griff etwas tiefer ... ich schwebte einen Augenblick in der Luft ... und ehe ich noch recht begriff, wie die Sachen standen, befand ich mich in der Bude des Griechen, der in verständlichem Französisch sagte, "ich wäre ein Gamin, ein Straßenlümmel, und er würde die Polizei rufen." Nun war ich zwar in der Nähe des Mädchens, aber gefallen konnte mir das nicht. Ich heulte und bat um Gnade, denn ich hatte schreckliche Angst. Aber es nutzte nichts; der Grieche hielt mich am Arm und schüttelte mich; ich sah mich nach meinen Kameraden um ... wir hatten den Morgen gerade mit Scävola zu thun gehabt, der seine Hand ins Feuer steckte ... und in ihren lateinischen Sätzen hatten sie das so schön gefunden ... jawohl! Keiner war stehen geblieben, um für mich eine Hand ins Feuer zu stecken ...
So dachte ich. Aber da flog mit einem Male mein Shawlmann durch die Hinterthür in die Bude; er war nicht groß oder stark, und kaum so etwa dreizehn Jahre alt, aber er war ein flinker und tapferer Bursche. Noch sehe ich seine Augen blitzen – sonst blickten sie matt – er gab dem Griechen einen Faustschlag, und ich war gerettet. Später habe ich gehört, daß der Grieche ihn tüchtig verhauen hat; – aber weil ich den festen Grundsatz habe, mich nicht um Dinge zu kümmern, die mich nichts angehen, bin ich schleunigst davongelaufen und habe es also nicht gesehen.
So kam es, daß seine Züge mich so an Räucherwerk erinnerten, und so kann man in Amsterdam mit einem Griechen Streit bekommen.
Wenn bei späteren Jahrmärkten der Mann mit seiner Bude wieder auf dem Westermarkt stand, suchte ich mein Vergnügen immer wo anders.
Da ich ein Freund von philosophischen Betrachtungen bin, so muß ich dir, Leser, doch eben noch sagen, wie wunderbar die Dinge auf dieser Welt doch miteinander verknüpft sind. Wären die Augen des Mädchens weniger schwarz und ihre Zöpfe kürzer gewesen, oder wenn mich keiner gegen den Ladentisch gestoßen hätte, würdest du dieses Buch nicht lesen. Sei also dankbar, daß das so gekommen ist. Glaube mir, alles in der Welt ist gut, wie es ist, und die unzufriedenen Menschen, die fortwährend klagen, sind meine Freunde nicht. Da ist z.B. Büsselinck & Waterman ...; aber ich muß fortfahren, denn mein Buch soll noch vor der Frühjahrsversteigerung fertig sein.
Gerade heraus gesagt – denn ich halte auf Wahrheit – war mir das Wiedersehen mit diesem Menschen nicht angenehm. Ich merkte sofort, daß es keine solide Beziehung war. Er sah sehr blaß aus, und als ich ihn fragte, wie spät es wäre, wußte er es nicht. Das sind Dinge, auf die ein Mensch achtet, der so an zwanzig Jahre die Börse besucht hat, der so viel erlebt hat ... ich habe schon etwas an Häusern sehen fallen.
Ich dachte, er würde rechts gehen, und mußte daher nach links; aber sieh da, er ging auch links, und ich konnte es also nicht vermeiden, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Aber ich dachte stets daran, daß er nicht wußte, wie spät es war, und bemerkte obendrein, daß seine Jacke bis ans Kinn fest zugeknöpft war, was ein sehr schlechtes Zeichen ist, sodaß ich den Ton unserer Unterhaltung kühl bleiben ließ. Er erzählte mir, daß er in Indien gewesen war, daß er verheiratet war, daß er Kinder hatte. Ich hatte nichts dagegen, fand aber auch nichts Merkwürdiges dabei. Beim Kapelsteeg – ich gehe sonst nie durch den Steg, weil es sich für einen anständigen Mann nicht paßt, wie ich finde – aber diesmal wollte ich beim Kapelsteeg rechts abbiegen. Ich wartete, bis wir an dem Gäßchen beinahe vorbei waren, um ihm recht deutlich zu machen, daß sein Weg geradeaus führte, und dann sagte ich sehr höflich – denn höflich bin ich immer, man kann ja gar nicht wissen, wie man später jemand nötig haben kann – :
"Es war mir sehr angenehm, Sie wiederzusehen, Mijnheer ... und ... und, ich empfehle mich, ich muß hier hinein."
Da sah er mich ganz sonderbar an und seufzte, und faßte mit einem Male einen Knopf meiner Jacke ...
"Lieber Droogstoppel," sagte er, "ich muß Sie um etwas bitten."
Mir ging ein Schauder durch die Glieder. Er wußte nicht, wie spät es war, und wollte mich um etwas bitten! Natürlich antwortete ich, daß ich keine Zeit hätte und nach der Börse müßte, obwohl es Abend war: – aber wenn man so zwanzig Jahre die Börse besucht hat ... und jemand will einen um etwas bitten, ohne zu wissen, wie spät es ist ...
Ich machte meinen Knopf los, grüßte sehr höflich – denn höflich bin ich immer – und ging in den Kapelsteeg hinein, was ich sonst nie thue, weil es nicht anständig ist; und Anstand geht mir über alles. Ich hoffe, daß es keiner gesehen hat ...
Drittes Kapitel.
Inhaltsverzeichnis
Der verrückte Brief des Shawlmanns und der Theeabend bei Rosemeyers, die in Zucker machen.
Als ich tags darauf von der Börse nach Hause kam, sagte Fritz, es wäre jemand dagewesen, der mich sprechen wollte. Nach der Beschreibung war es der Shawlmann. Wie er mich nur gefunden hatte? Ach ja, die Geschäftskarte! Ich dachte schon daran, meine Kinder von der Schule zu nehmen; denn es ist unangenehm, wenn einem noch zwanzig, dreißig Jahre später ein Schulkamerad nachläuft, der einen Shawl trägt statt eines Überziehers, und der nicht weiß, wie spät es ist. Auch habe ich Fritz verboten, nach dem Westermarkt zu gehen, wenn Jahrmarkt ist.
Tags darauf kam ein Brief mit einem großen Paket. Ich will euch den Brief lesen lassen:
"Lieber Droogstoppel!"
Ich finde, er hätte wohl "Hochgeehrter Herr Droogstoppel" sagen können, denn ich bin Makler.
"Ich bin gestern bei Ihnen gewesen mit der Absicht, ein Anliegen vorzutragen. Ich glaube, daß Sie in guten Verhältnissen leben ..."
Das ist wahr, wir sind im ganzen dreizehn auf dem Kontor –
"und ich wünschte, mich Ihres Kredits zu bedienen, um eine Angelegenheit zustande zu bringen, die für mich von großer Wichtigkeit ist."
Hört sich das nicht an, als handelte es sich um einen Auftrag für die Frühjahrsversteigerung?
"Infolge von allerlei Umständen bin ich augenblicklich einigermaßen in Geldverlegenheit ..."
Einigermaßen! Er hatte kein Hemde auf dem Leibe. Das nennt er: einigermaßen!
"ich kann meiner lieben Frau nicht alles geben, was zur Annehmlichkeit des Lebens nötig ist, und auch die Erziehung meiner Kinder ist, aus pekuniären Gesichtspunkten, nicht so wie ich wünschte."
Annehmlichkeit des Lebens? Erziehung der Kinder? Meint er, daß er für seine Frau eine Loge in der Oper mieten will, und seine Kinder in eine Anstalt nach Genf schicken? Es war Herbst und ziemlich kalt, – er wohnte auf einem Bodengelaß ohne Feuer. Als ich diesen Brief empfing, wußte ich das nicht, aber später bin ich bei ihm gewesen, und noch jetzt bin ich ärgerlich über den tollen Ton seines Geschreibsels. Zum Kuckuck! wer arm ist, kann sagen, daß er arm ist; Arme muß es geben, das ist notwendig in der menschlichen Gesellschaft; wenn er nur kein Almosen verlangt und niemand zur Last fällt, habe ich durchaus nichts dagegen, daß er arm ist; aber die Ziererei dabei paßt mir nicht. Hört weiter:
"Da nun auf mir die Pflicht ruht, für die Bedürfnisse der Meinen zu sorgen, habe ich beschlossen, ein Talent auszunutzen, das, wie ich glaube, mir gegeben ist. Ich bin Dichter ..."
Puh! Du weißt, Leser, wie ich und alle vernünftigen Menschen darüber denken.
"und Schriftsteller. Seit meiner Kindheit drückte ich meine Gefühle in Versen aus, und auch später schrieb ich täglich nieder, was in meiner Seele vorging. Ich glaube, daß darunter einige Arbeiten sind, die Wert haben, und ich suche dafür einen Verleger. Aber das ist nun gerade die Schwierigkeit. Das Publikum kennt mich nicht, und die Verleger beurteilen die Werke mehr nach dem Namen und Ruf des Verfassers als nach dem Inhalt."
Gerade wie wir den Kaffee nach dem Renommee der Sorten und Marken.
"Wenn ich nun auch annehme, daß mein Werk nicht ohne Wert sein würde, so würde das doch erst nach dem Erscheinen zu Tage treten, und die Buchhändler verlangen die Druckkosten u.s.w. im voraus ..."
Finde ich sehr vernünftig.
"was mir augenblicklich nicht gelegen kommt. Da ich indes überzeugt bin, daß meine Arbeit die Kosten decken würde, und ruhig mein Wort darauf verpfänden kann, bin ich, ermutigt durch unsere Begegnung von vorgestern ..."
Das nennt der ermutigen!
"zu dem Beschluß gekommen, an Sie die Bitte zu richten, ob Sie sich bei einem Buchhändler für die Kosten einer ersten Ausgabe verbürgen würden, und wäre es auch bloß ein kleines Bändchen. Ich überlasse die Auswahl für diesen ersten Versuch ganz Ihnen. In dem beifolgenden Paket finden Sie viele Manuskripte; Sie werden daraus ersehen, daß ich viel gedacht, gearbeitet und erlebt habe ..."
Ich habe nie gehört, daß er ein Geschäft hatte.
"und wenn die Gabe der Darstellung mir nicht ganz und gar versagt ist, soll es gewiß nicht an dem Mangel an Eindrücken liegen, wenn ich nicht Erfolg hätte.
In Erwartung einer freundlichen Antwort bin ich
Ihr alter Schulfreund ..."
Sein Name stand darunter, doch ich will ihn verschweigen, weil ich nicht gern jemand ins Gerede bringe.
Lieber Leser, du begreifst, was für ein Gesicht ich gemacht habe, als man mich so plötzlich zum Makler in Versen erheben wollte. Ich glaubte fest, wenn Shawlmann, – ich will ihn nur weiter so nennen – mich bei Tage gesehen hätte, so wäre er mir mit so etwas nicht gekommen; denn Ehrbarkeit und Würde lassen sich nicht verbergen; aber es war Abend, und ich nehme es ihm deshalb nicht so übel.