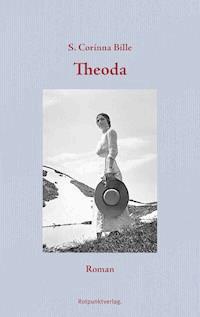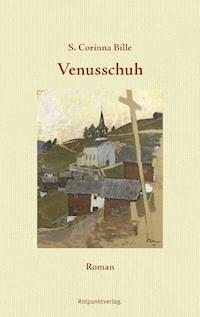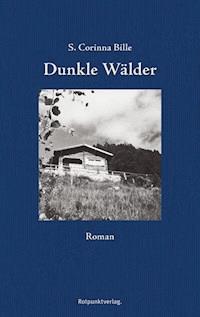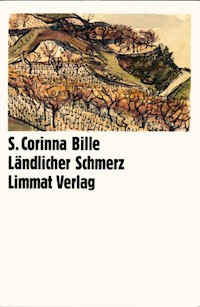Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotpunktverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Blau
- Sprache: Deutsch
Marthe macht Ferien an der Côte d'Azur. Dort begegnet die verheiratete Schweizerin dem jungen Fischer Marceau, und die Liebe bricht wie eine Naturgewalt über die beiden herein. Für kurze Zeit gibt sich das ungleiche Paar dem Liebesrausch hin. Doch als Marthe ein Jahr später zurückkehrt, ist auch Marceau verheiratet. Einzig sein Bruder, der Marthe wie ein Doppelgänger ihres Geliebten vorkommt, lässt sie weiterträumen, bis die Liebe im dritten Sommer endgültig erlischt. Dass Marthe unverkennbar Züge der Autorin trägt, zeigt ein Brief von S. Corinna Bille aus dem Sommer 1950: »Ich habe da einen echten Freund. Das ist ein junger Fischer aus der Gegend. Ein einfaches Wesen, absolut wunderbar.« Meerauge ist aber nicht nur eine melancholische Liebesgeschichte, sondern auch das Porträt eines Landes kurz nach dem Weltkrieg, der noch durch alle Köpfe spukt, und einer Zeit, in der Kolonialismus und Rassismus kaum hinterfragt werden. Zu Billes Lebzeiten unveröffentlicht, erschien Meerauge 1989 postum in einer stark gekürzten Version. Rund siebzig Jahre nach der Niederschrift macht die Übersetzerin Lis Künzli diesen literarischen Schatz erstmals in seiner ursprünglichen Form zugänglich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
S. Corinna Bille
Meerauge
Roman
Aus dem Französischen und herausgegebenvon Lis Künzli
Edition Blau im Rotpunktverlag
Marthe macht Ferien an der Côte d’Azur. Dort begegnet die verheiratete Schweizerin dem jungen Fischer Marceau, und die Liebe bricht wie eine Naturgewalt über die beiden herein. Für kurze Zeit gibt sich das ungleiche Paar dem Liebesrausch hin. Doch als Marthe ein Jahr später zurückkehrt, ist auch Marceau verheiratet. Einzig sein Bruder, der Marthe wie ein Doppelgänger ihres Geliebten vorkommt, lässt sie weiterträumen, bis die Liebe im dritten Sommer endgültig erlischt.
Meerauge ist aufgebaut wie ein Triptychon: Der mittlere, umfangreichste Teil schildert die sommerliche Liebesidylle, während der erste und der dritte Teil Erinnerung, Verlust und Einsamkeit thematisieren. Zu Billes Lebzeiten unveröffentlicht, erschien Meerauge 1989 postum in einer von ihrem Ehemann Maurice Chappaz stark gekürzten Version. Die Herausgeberin und Übersetzerin Lis Künzli skizziert in ihrem Nachwort, wie sehr Meerauge S. Corinna Bille am Herzen lag und wie viel sie von ihren eigenen Provence-Erlebnissen ungefiltert in den Roman einfließen ließ.
Verlag und Übersetzerin bedanken sich bei folgenden Institutionen:
Die Übersetzung wurde gefördert von Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung.
Der Rotpunktverlag wird vom Bundesamt für Kultur
mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021 bis 2024
unterstützt.
Die Originalausgabe ist 1989 unter dem Titel Œil-de-Mer in
den Editions 24 heures in Lausanne erschienen.
© Fondation de L’Abbaye, Le Châble
© 2024 Edition Blau im Rotpunktverlag, Zürich (für die deutschsprachige Ausgabe)
www.rotpunktverlag.ch
Umschlagbild: James Jenkins – Visual Arts / Alamy Stock Foto
Lektorat: Anina Barandun
Korrektorat: Sarah Schroepf
1. Auflage 2024
eISBN 978-3-03973-031-5
Inhalt
ERSTER TEIL
Der Doppelgänger
I
Als wäre er tot, dachte sie
II
Nein, darauf war sie nicht gekommen
III
Am Nachmittag kehrte sie ans Meer zurück
IV
Die Luft war kalt
ZWEITER TEIL
Die Liebe
I
Was war es dann?
II
Sie wusste immer noch nicht, wie er hieß
III
Er hatte gesagt: Guten Tag, Madame
IV
Es war der dritte Tag
V
Nächste Woche gehe ich vielleicht
VI
Er hatte sie noch einmal gebeten, ans Fest zu kommen
VII
Auch an diesem Morgen ging sie wieder ans Meer
VIII
Damit er sie besser verstehen konnte
IX
Er brachte ihr sämtliche Dokumente mit
X
Am Abend kehrten sie an den Fuß der Felsen zurück
XI
Schon am nächsten Tag hatte sich Marceau wieder gefasst
XII
An jenem Sonntag stimmte von Anfang an etwas nicht
XIII
Doch der Schatten dieses Tages lastete auch noch auf den nächsten
XIV
Sie kehrten durch die über dem Meer schwebenden Wälder zurück
XV
Inzwischen trafen sie sich jeden Abend
XVI
Am Samstagabend haben sie mich überall gesucht
XVII
Bis heute habe ich es nicht für möglich gehalten, dass du gehst
DRITTER TEIL
Der Schatten
I
Sie hatte Ja gesagt
II
Es waren zwei Jahre vergangen
III
Am folgenden Sonntag sah sie Marceaus armen kleinen Bruder noch einmal
IV
Die Palmen waren auf ihre Masten genagelt
V
Die Tage zogen dahin ohne Freude
VI
Marthe kehrte nicht mehr zu dem kleinen Haus beim Friedhof zurück
VII
Ganz allmählich starb die Liebe in ihr
NACHWORT
»In Wahrheit bin es immer ich.«
Ich brauche eine kleine Sprache,
wie Liebende sie verwenden.
VIRGINIA WOOLF
ERSTER TEIL
Der Doppelgänger
I
Als wäre er tot, dachte sie. Diese Abwesenheit auf den Wegen und Stränden, wo er immer gewesen war. Inzwischen wagte sie es wieder, in die Menschenmenge zu blicken. Die ersten Tage hatte sie sich nicht getraut, so sehr fürchtete sie, ihn vor sich auftauchen zu sehen. Und was dann? Aber von all diesen Leuten glich ihm niemand, trug niemand dieses strahlend weiße Unterhemd, diese blaue, über das Fußgelenk gekrempelte Leinenhose. Ein Fußgelenk, das so dünn war, dass Marthe es mit dem Daumen und dem längsten Finger beinahe umfassen konnte.
Am sonntäglichen Meer gingen vier Jugendliche in weiten, schmutzigen Kimonos aufeinander los. Mit ihren kribbeligen Füßen spritzten sie ihr Sandkörner in die Augen, und sie schimpfte leise. Man klärte sie auf, dass dieser eigenartige Kampf Judo hieß. Doch dann zog ein Pärchen etwas weiter weg Marthes Aufmerksamkeit auf sich: Der Mann hielt ein Laken vor ein junges Mädchen gespannt, um es vor den Blicken zu schützen. Einzig ihr hübscher Kopf war, wie auf einem Altar, zu sehen, und hinter dem Tuch wollte das Anziehen, das Zuknöpfen des Rocks, das Glattstreichen der Bluse kein Ende nehmen; schließlich hielt der Mann dem ausdruckslosen Gesicht einen Spiegel hin.
Ob Marceau mit seiner Frau auch so ist? Nein, sagte sie sich. Um den großen Strand zu meiden, kletterte sie am nächsten Tag zur Pointe-du-Vaisseau hinauf, an deren Klippen sich die Wellen teilten, und von dort zum nächsten Strand hinunter. Hier war es … Sie beugte sich über eine kleine Arena im Sand. Hier hatte er sie geliebt. Doch sie setzte sich weiter weg, wandte sich von der Stelle ab wie von einem Grab. Die junge Frau spürte in dieser Umgebung ein seltsames, verwirrendes Wohlgefühl. Der Nebel, der an dem Junimorgen die Küste einhüllte, schirmte sie von der übrigen Welt ab. Die nahen Schreie zweier junger Burschen störten sie so wenig wie die der Seemöwen; die nackten Körper der beiden stachen aus dem Dunst hervor, sie bewarfen einander lachend mit Tang. Der eine hatte schwarze, der andere rote Haare. In welcher Sprache redeten sie? Sie lauschte ihren schrillen Stimmen, ohne es herauszufinden. Wo der Schleier aufriss, funkelte das Wasser, und die feuchte Berührung der Sonne brannte auf ihrer Haut. Für Momente kam es ihr vor, als hätte sie leichtes Fieber.
Sie hatte den alten Fischer Demetria, der in der Pension Eisblöcke verkaufte, überredet, sie mitzunehmen, wenn er entlang der Küste seine Langleine auslegte. Vom Meer aus konnte Marthe endlich die bisher verborgen gebliebenen Hügel und Strände in ihrer ganzen Ausdehnung sehen. Von Pinien eingezäunt, zog das Annuntiatinnenkloster der unsichtbaren Nonnen vorbei, dann das Violett der Bougainvilleen, das Rothschild-Schloss und das Anwesen, auf dem Eisenbahnerkinder aufgenommen wurden. Sie lächelte den blau-weiß gestrichenen Hütten zu, welche die Combe-aux-Sources emporkletterten. Um ihr eine Freude zu machen, lenkte Demetria sein Boot zum schwarzen Wasser bei der Sainte-Madeleine-Höhle.
»Ist es tief?«, fragte sie.
»Na und ob das tief ist!«
Einmal meinte sie ihn vom Boot aus unter dem großen Felsen – sein Schlupfwinkel – zu sehen, aber der Mann war mit zwei Frauen und Kindern zusammen. Das ist er nicht, dachte sie.
Wie Menschen, die in ihrem Wahn den Tod eines geliebten Wesens anzweifeln und immer weiter auf ihn warten, konnte sie nicht glauben, dass es aus war. Marceau sollte sie nicht mehr lieben? Sie würde ihn nie mehr wiedersehen? Ein Teil von ihr verweigerte sich dem Offenkundigen.
Einmal hörte sie es früh am Morgen an ihre Zimmertür klopfen, und sie sah, wie sich der Griff langsam nach unten senkte, doch sie hatte mit dem Schlüssel abgeschlossen. »Wer ist da?« Keine Antwort. Eine heftige Erregung ergriff sie, dabei gab es keinen Grund dafür, Marceau war nie ins Hotel gekommen. Jemand musste sich im Zimmer geirrt haben. Es klopfte leise an andere Türen, Worte wurden gewechselt, und ein Schlüssel drehte sich in einem Schloss.
Beim Speisen saß sie allein in dem großen gefliesten Saal mit der Schilftapete, allein mit einer Flasche provenzalischen Rosé vor sich; sie rührte ihn nicht an, begnügte sich mit einem bescheidenen, mit Wasser gestreckten Rotwein. Die Flasche stand da, um die Kunden in Versuchung zu bringen, und auf ihrem Etikett stand der rätselhafte Satz:
Bois toujours avant la soif, elle ne viendra jamais.
»Trink immer vor dem Durst, dann kommt er nie.« Das ist kein Rat für mich, dachte sie, ich mag den Durst, weil der Genuss beim Trinken danach umso größer ist! Sie sah das Etikett von der Seite und las nur das Ende, »kommt er nie«.
»Madame Glanet«, verkündete ihr der Hotelier, ein Pariser, der sich erst vor kurzem in der Gegend niedergelassen hatte, »in wenigen Tagen wird es hier voll werden, aber im Moment halten die Wahlen die Leute noch zurück.«
»Die Wahlen …«
Bei diesen Worten musste Marthe an ihren Mann denken, der in der Schweiz geblieben war. Wie weit weg sie von ihm war!
Vielleicht wohnt Marceau inzwischen in der Stadt? An einem Nachmittag begab sie sich nach Toulon, um die Reede zu besichtigen.
»Hier ist es so still wie auf dem Genfersee«, sagte der Reiseleiter aufgeräumt, um die Touristen zu beruhigen. »Und unsere Kampfboote sind auf dem Bodensee aufgerieben worden.«
Der Anblick der großen Kriegsschiffe, nichts als ein Haufen Eisenschrott, stimmte Marthe traurig.
»Die Hälfte der Flotte liegt auf dem Meeresgrund und wird von den Tauchern Stück für Stück heraufgeholt. Hier haben wir die Überreste der Dunkerque und dort drüben die Lorraine, die für das Fest geschmückt wird. Morgen gibt es Tanz.«
Neben ihr hatten zwei stille Städter von einer protzigen, zweifelhaften Eleganz Platz genommen, und in ihrer Naivität verdächtigte Marthe sie, Zuhälter zu sein. Als sie den Fuß wieder an Land setzten, bemerkte sie, dass beide invalid waren. Sie gab dem Reiseleiter ein gutes Trinkgeld, der sich ihrer galant erbarmte:
»So allein?!«
Ja, sie war allein. Sie irrte noch eine Stunde durch die Straßen, betrat eine Kirche, wo sie eine Kerze anzündete, »damit kein Unglück geschieht«, und ging dann in ein kleines, düsteres Kino, wo ein alter Stummfilm lief: Lucrèce, mit Edwige Feuillère. Als sie wieder hinaustrat, waren überall schwarze Schiefertafeln angebracht, die die Wahlergebnisse verkündeten. Die Kommunisten hatten die meisten Stimmen bekommen. Sie kaufte sich Kuchen und ging zum Bahnhofsplatz hinauf, von wo sie der Autobus wieder nach La Farloude bringen sollte. Sie war erschöpft, verstaubt, und nahm sich vor, nicht mehr in die Stadt zurückzukehren.
Doch das Gefühl, dass etwas fehlte, wurde mit jedem Tag stärker. Ihre Lust, los und ans Meer zu rennen, prallte ab an einem krankhaften Bedürfnis zu schlafen. Und am Abend ging sie dann, stolz, den ganzen Nachmittag geschlafen zu haben, an den Strand, zur Stunde, da sich die Schwätzerinnen trafen:
»Endlich ein bisschen Abkühlung! Ein wahrer Paradiesgarten.«
Sie wollte weg.
Eines Morgens jedoch war etwas anders geworden. Sie ließ ihre langen Haare auf die Schultern fallen und schlüpfte in ein rotes Kleid mit grauen Blumen, das ihre von Meer und Luft bereits goldgebräunte Taille freiließ. Sie kam an der kleinen, auf Pfähle gebauten Bar vorbei, und der Mann, der das Geländer ausbesserte, hielt in seiner Arbeit inne. Die plötzliche Stille war ihr nicht entgangen. Und als sie gegen Mittag zurückkehrte, waren es drei oder vier, die dastanden und schauten, wie sie vorbeiging. Einer vor allem, etwas abseits von den anderen, schien auf sie zu warten und starrte sie so unverhohlen an, dass sie das Gesicht wegdrehte.
Doch auf der Straße wurde sie bald von zwei Männern überholt. Der eine schob ein mit einer kleinen Kiste beladenes Fahrrad. Sie meinte die Worte zu hören:
»Ah, diese Frau … Er hat gesagt, eine wie sie gebe es keine zweite auf Erden! Und jetzt …«
Der mit dem Rad sagte nichts.
Was an den folgenden, mit demselben Warten ausgefüllten Tagen geschah, hätte sie nicht sagen können. Es wurde ihr erst später bewusst.
Immer noch diese Abwesenheit auf den steinigen, von Winden und Ginster gesäumten Wegen, deren aufdringlicher Geruch nicht die Feinheit des viel selteneren Geißblatts hatte, das in Marthes Hand, kaum gepflückt, verwelkte. Was murmelte sie vor sich hin, wenn zwei schwarze Augen unter einer Zyklopenbraue sie eine Welle lang bespähten? Wie hätte sie ihn erkennen sollen, diesen hinter den dunklen Gläsern einer Hornbrille versteckten Blick? Und wie hätte sie ahnen können, dass sie auf ihn zugegangen war und auf keinen anderen, am Tag, als sie von weitem glaubte, in der Bewegung eines Badenden, der mit einem Speer ins Wasser stach, die Bewegung des Abwesenden zu erblicken? Sie hatte sich genähert, war die Felsen hochgestiegen, aber überzeugt, sich getäuscht zu haben, ging sie gleichgültig an dem Unbekannten vorbei und kehrte um.
Dieser mit der Fähigkeit der Allgegenwart ausgestattete Mann tauchte überall auf. Ohne es wirklich zu merken, hatte sie ihn immer wieder von neuem in ihrem Blickfeld. Dieser Unbekannte, dieser Fremde, ja, dieser Fremde, löste dumpfe Begierde und Hass in ihr aus. Wenn sie ihn hinter sich ahnte, spürte Marthe, wie ihre Hüfte geschmeidig wurde, ihre Taille zitterte. Doch wenn er vor ihr herging, sich auf sein Fahrrad schwang, zu viel von seinem braunen Schenkel entblößte und sich umdrehte, um sie noch einmal anzusehen, wandte sie die Augen mit Verachtung ab.
Abends spazierte sie manchmal über die einzige Straße des Dorfes. Auf der einen Seite reihten sich Häuser und Geschäfte aneinander, die hinter ihren oft geschlossenen Läden und dem Schmutzwasser am Trottoirrand kaum zu erkennen waren. Auf der anderen waren Gemüsegärten, ein großer Oleander und ein verlassener Park, in dem Laubfrösche quakten. Unter den jungen Leuten, denen sie begegnete, war stets einer, der sie mit einem frechen Bonsoir grüßte, das sie ungerührt entgegennahm. Einmal schnappte sie die Bemerkung auf:
»Willst du Marceaus Faust im Gesicht?«
Am nächsten Abend hörte sie, laut und wie für sie bestimmt:
»Er ist verheiratet, Marceau!«
Und eine junge Mädchenstimme, die fragte:
»Warum ist er verheiratet, Marceau?«
So wurde der Abwesende ihr durch nächtliche Stimmen wiedergegeben.
Doch für Momente schnürte ihr der Wunsch, tot zu sein oder weit weg zu flüchten, die Kehle zu. Im Hotel öffnete sie das kleine Fenster im Gang, um das Bellen eines Hundes vom Hügel oder den Schrei eines Vogels zu hören. Dieselben? Ja, dieselben! Sie ging ins Zimmer zurück und legte sich hin.
Vielleicht hat er heiraten müssen …, überlegte sie sich.
Marthe hatte einen Tag nach ihrer Ankunft in La Farloude von dieser Hochzeit erfahren.
»Ja«, hatte der Wirt zwei nicht weit von ihr sitzenden Gästen erzählt, »ich hatte vor kurzem eine Hochzeit hier. Ein junges Mädchen, das einen Burschen aus dem Nachbardorf geheiratet hat, einen Burschen mit dem Spitznamen Hitzkopf. Für das Dessert wollte der Konditor von mir einen Pauschalpreis von sechstausend. Also habe ich mich in die Küche gestellt und alles für ein paar Hunderter selbst gemacht, habe ihnen herrliche Kuchen, Cremes, Torten und Clafoutis aufgefahren.«
Sie hatte die Hände auf den Tisch gestützt und sah, wie das Blut aus ihren Fingern wich. Die Roséflasche zitterte leicht. Zum zwanzigsten Mal las sie: … kommt er nie.
»Unsere Bouillabaisse ist heute zur Hälfte pariserisch, zur Hälfte meridional. Es ist alles so teuer geworden! In der Hochsaison kommt mir die Bouillabaisse auf achthundert Francs pro Person zu stehen, das kann ich mir nicht leisten.«
Sie kehrte mit dem verwirrenden Gefühl, keine Hände mehr zu haben, auf ihr Zimmer zurück, doch sie sagte sich: So ist das Leben, es ist stärker als alles andere. Ich war nicht mehr da, und selbst wenn ich da gewesen wäre, Marceau hat ein junges Mädchen kennengelernt. Er wollte ein junges Mädchen haben. Sie gestand sich ein, wie gerne sie ein Kind von ihm gehabt hätte. Ihr Speichel hatte den Geschmack von Tränen, und ihre Arme mit den abgeschnittenen Händen glitten blind über ihren Körper. »Ich habe Marceau verloren.«
Eines Abends jedoch hatte sie eine dunkle Vorahnung, er käme zu ihr. Er hatte sich auf den Weg gemacht, sie war sich sicher, er kam.
Eine große Hoffnung überfiel sie wie ein neuer Glaube. Sie
konnte Gut und Böse nicht mehr auseinanderhalten. Sie spürte voller Angst Marceaus Anstrengung, die Anstrengung eines Mannes, der von sehr weit her kam und Wind, Wasser und Müdigkeit gegen sich hatte. Dunkle Mächte hinderten ihn voranzukommen, doch er kämpfte und trotzte ihnen. Dieser Kampf würde vielleicht Monate, Jahre dauern.
Sie atmete die Weite ein, schloss die Augen, die Seele dem Reisenden zugewandt.
Aber es war der Fremde, der auftauchte. An einem Morgen, als am Strand der Mistral blies, an den Röcken zerrte, die Haare auffliegen ließ, war er in dem Getose der Wellen, die an die Felsen schlugen, plötzlich wieder vor ihr, lautlos, aus dem Wind, der Gischt hervorgegangen. Und wie immer bespähte er sie geduldig, sanft, still. Dieses Mal wurde sie für ihn, was er für sie war: Sie belauerte ihn im Stillen. Marthe saß auf einem Felsen und tat, als betrachtete sie das Meer; er lag auf dem Sand und verlor sie nicht aus den Augen.
Er hatte sein blaugrünes Hemd ausgezogen, das sonst über seinen kakifarbenen Shorts um seine Hüften schlackerte. Er setzte die Brille ab und stützte sich auf die Ellbogen. Sie spielte eine Weile mit einem jungen Paar aus Paris Ball, ein Spiel, das sie nicht mochte, aber ihr war kalt. Sie sprang hoch und fing, gleichzeitig mit dem Ball, den Blick des Mannes auf.
Nach einer Weile ging er, nachdem er noch ein letztes Mal den Kopf nach ihr umgedreht hatte. Er verschwand zwischen den Klippen, um zum anderen Strand zu gelangen, zu dem mit der kleinen Bar, doch Marthe und er sollten sich am selben Tag noch einmal begegnen. Als sie aus dem Wald heraustrat, bog er mit dem Fahrrad auf die Straße ein. Er bremste, schien anzuhalten, zögerte, konnte sich aber nicht entschließen und raste den Hang des Hügels hinunter.
Als ihr die Tränen in die Augen stiegen, verstand die junge Frau mit einem Mal: Es ist Marceaus Bruder!
II
Nein, darauf war sie nicht gekommen. So nah ist man den Dingen, dass man sich weit weg wähnt. Dabei hatte ihre Intuition sie gewarnt, ihr Marceaus Erscheinen angekündigt. Marceaus Erscheinen? Ein wenig seins, ja, in Gestalt seines Bruders.
Doch diese plötzliche Präsenz nach so langer Abwesenheit – obwohl es nicht einmal die echte Präsenz war – wühlte sie auf. Marthe geriet in Panik.
Am nächsten Tag, einem Sonntag, suchte sie einen weißen Unterrock heraus, Nylonstrümpfe, puderte sich, legte die Ohrringe an, alles Dinge, die sie am Meer nicht mehr getan hatte. Statt in ihre üblichen Espadrilles schlüpfte sie in elegante weiße Hirschledersandalen, versteckte ihre Haare zur Hälfte unter einem Schal von Rodier, der in ihrem Nacken einen schweren, wassermelonenroten Knoten bildete, und so ausstaffiert, trat sie auf die Straße hinaus. Dort überkam sie Angst, ein Reflex zu fliehen. Bei der Kreuzung wäre sie beinahe ins Landesinnere abgebogen, kehrte aber um und schlug den Weg zum Meer ein.
Sie saß noch keine drei Minuten, nonchalant an einen Stein am Fuß der Felsen gelehnt, die Arme wie die Zacken eines Sterns von sich gestreckt, als sie den Mann in dem blassgrünen Hemd auf allen vieren von der Pointe-du-Vaisseau herunterklettern sah. Er kam in ihre Richtung, näherte sich aber nicht sofort. Er schien sich erst einen Moment besinnen zu wollen, bevor er sie ansprach. Was hatte sie so Furchterregendes an sich?
Seit fünf Tagen beobachtet er mich und bringt noch immer kein Wort heraus. Wartet er etwa darauf, dass ich den ersten Schritt tue? Ja, das musste seine geheime Hoffnung sein und der Grund für seinen offenkundigen Wunsch, erkannt zu werden.
Er ging ins Wasser, wo es tief war, und unterhielt sich mit einem dicken Jungen, der von einem Steg aus angelte. Aber auch jetzt verlor er sie nicht aus den Augen, während er sich gleichzeitig für den Fang des Jungen interessierte. Ein Kind hatte sich Marthe genähert und spielte mit einem kleinen Jeep, den es im Sand herumschob. Hin und wieder lächelte sie ihm zu; das Kind beachtete sie kaum, aber schien sich zu freuen, dass sie da war.
Plötzlich spürte sie im Rücken, wie ihr Herz gegen den Stein klopfte. Der Mann näherte sich. Sie war nun sicher, dass er sie ansprechen würde. Doch er ging wortlos vorbei, immer noch seine Maske, die schwarze Brille, im Gesicht. Sie hatte Zeit, seine dünne Nase, seinen Mund mit den schmalen Lippen, sein energisches Kinn zu sehen. Er drehte sich zu dem kleinen Jungen und lachte, als er ihn vor sich hin trällern hörte. Ja, es ist derselbe Mund, dachte sie.
Doch schon listete sie sämtliche Unterschiede auf. Wie viel misstrauischer, zaghafter, aber auch berechnender, städtischer er ist … Die städtische Erscheinung vor allem war es, die sie erst gehindert hatte, die Wahrheit zu sehen.
Das Knie leicht gebeugt, ging er mit festem Schritt, der vom Boden Besitz ergriff, mit dem Schritt eines Mannes, der über tückisches Gelände geht und nicht ausrutschen oder einsinken will. Kein Schritt der Angst, sondern der Entschlossenheit. Auch hier zeigte sich der Unterschied. Sie sah den stampfenden Gang von Marceau wieder vor sich, oder hörte ihn eher: das Klatschen seiner Espadrilles, seine wie bei einem Tanz angespannten Beine.
Dieser Bruder da trug Sandalen aus cremefarbenem Plastik; bestimmt mochte er alles, was neu und modern war. Er stieg über die Steine hinweg zum kleinen Nachbarstrand und verschwand. Aber schon kehrte er wieder zurück. Marthe, die sich nicht gerührt hatte, hob zum ersten Mal ihr Gesicht zu ihm, worauf er offenbar gewartet hatte. Er setzte seine schwarze Brille ab und sprach sie, das Gesicht leicht gesenkt, ein sibyllinisches Lächeln um die Lippen, endlich an:
»Entschuldigen Sie, Madame, ich würde Sie gern etwas fragen.« Und er schaute ihr in die Augen, bis tief in ihre verängstigte Seele und ihren verängstigten Körper hinein. »Das waren doch Sie, Sie haben doch für einen Schweizer Almanach posiert?«
Auf diese Frage war sie so wenig gefasst, dass sie einen falschen Vorwand vermutete und ein empörtes »Nein« stotterte. Noch bevor sie sich wehren konnte, murmelte er halblaut: »Ich gleiche ihm …« Aber schon verbesserte er sich höflich:
»Für ein Magazin, hätte ich sagen sollen. Sind Sie Modistin?«
»Ja.«
Wieder trafen sich ihre Augen. Die mandelförmigen des Mannes waren listig und durchdringend. Es tanzte ein lebhafter Glanz des Vergnügens und vielleicht auch der Lust darin. Die der jungen Frau blinzelten verunsichert. Instinktiv verbarg sie ihr Gesicht hinter einer Hand.
»Ah«, sagte er wie betroffen.
»Ah«, sagte sie wie ein Echo.
»Ich bin nicht von hier«, erklärte er und setzte sich neben sie, als wollte er sich rechtfertigen. Dann warf er einen anerkennenden Blick auf ihre weißen Ledersandalen.
»Doch, doch«, nickte sie.
»Nein, ich wohne dort drüben.«
Und er deutete mit dem Kinn auf die andere Seite des Meeres.
»Afrika«, sagte sie.
Er warf ihr heimlich einen Blick zu.
»Wo genau?«, fragte Marthe.
»Dakar, am Hafen von Dakar.«
»Und gefällt es Ihnen dort?«
»Na und ob es mir gefällt! Ich kann es kaum erwarten, wieder zurückzukehren, man lebt gut dort.«
Sie war etwas verunsichert. Sie erinnerte sich, dass Marceau ihr einmal gestanden hatte: »Es gibt nur einen Menschen auf der Welt, der mich jemals weinen gesehen hat: meine Mutter, als ich die Briefe meines Bruders aus Afrika las.«
Neben ihr saß ein Mann, der unverkennbar glücklich war über sein Los und stolz, es zeigen zu können. Sie empfand eine eigenartige Eifersucht.
»Aber dort drüben sehe ich nichts als Nachtgesichter.«
Marthe hörte ihn denken: Und Ihres ist ein Gesicht des Lichts …
»Schwarze?«
»Ja.«
Sie fühlte sich bedrückt, während er immer zufriedener wirkte. Er zupfte seine Shorts auf dem Schenkel zurecht und schaute sie mit einem honigsüßen Blick an. Wie unterschiedlich sie sind, musste sie wieder denken. Der Andere hatte mich niemals mit so viel Honig in den Augen bedacht.
»Oh, ich wollte nicht wiederkommen«, sagte sie. »Nein, wirklich, ich wollte nicht. Ich hatte bereits ein Zimmer in einer Pension in La Ciotat reserviert. Aber als ich die Küste hinter Marseille gesehen habe, fand ich alles hässlich, diese Straßen, Häuser und Casinos entlang der Strände. Ich bin fünfmal mit dem Bus umgestiegen und schließlich doch wieder hier gelandet. Ich mag La Farloude, es ist noch so unberührt.«
»Und ein Magnet hat Sie angezogen …«
»Oh nein«, protestierte sie ärgerlich.
»Na ja, vielleicht mögen Sie die Gegend einfach«, sagte er versöhnlich. Sie schaute aufs Meer hinaus.
»Wenn das Meer so ist wie jetzt«, sagte er, »trauen Sie sich dann nicht ins Wasser?«
»Ich gehe nicht wegen der Wellen nicht ins Wasser!«, gab sie zurück, empört, dass sie es sagen musste.
Er zeigte spöttisch auf den dicken Jungen, der immer noch angelte:
»Mit dieser Schnur wird er nur ganz kleine Fische erwischen. Aber den würde ich nicht an den Sohlen kitzeln: Das ist kein Mensch, das ist ein Stier!«
Marthe lächelte. Ihr Gefährte ballte und streckte die Hände.
»Wie sie werden, wenn man lange im Wasser ist …«, sagte er.
Sie blickte kurz hin. Es waren dieselben langen, geschmeidigen Finger des Anderen, aber ihre Elfenbeinfarbe bildete einen Kontrast zu den stark gebräunten Armen. Wollte er Marthes Aufmerksamkeit auf seine Hände lenken? Wusste er, dass sie seinem Bruder die Schicksalslinien gelesen hatte? Marceau hatte sich immer gewehrt: »Schauen kannst du«, hatte er gesagt, »aber sag nichts! Sag mir nichts!« Und er nannte es Humbug.
»Was fischen Sie denn?«
»Im Moment hole ich vor allem Napfschnecken. Eigentlich mag ich am liebsten das Tiefseefischen. Aber mein Bruder hat meine Harpune mitgenommen. Und für den einen Monat, dass ich in den Ferien bin, lohnt sich das nicht.«
»Doch, das würde sich schon lohnen.«
»Na, dann gehe ich sie mir nächste Woche holen.«
Sie fragte nicht, wo er sie holen wollte, doch sie dachte sich: Marceau hat das Dorf verlassen.
»Und wenn Sie einen Meerstern finden«, sagte sie, »dann geben Sie ihn mir!«
»Ja, und auch Perlmutt. Dort drüben kann man welches finden.«
Er zeigte auf die roten Felsen am Ufer einer Halbinsel weiter östlich:
»Sind Sie nie an dieser Küste gewesen?«
»Nein.«
Er schien überrascht.
Oh, dachte sie, der da kommt herum, und er bringt einem Perlmutt, das ist noch besser als Meersterne.
»In Afrika«, sagte er, »ist das Fischen interessanter. Es gibt dort jede Menge Fische.«
»Und Sie bereiten sie eigenhändig zu!«
»Wussten Sie das?«
»Vielleicht weiß ich auch Ihren Namen.«
»Und wie ist mein Name?«
Die Stimme des Mannes war gierig, doch ihre wurde heiser, als sie antwortete:
»Antoine.«
»Ha! Und als ich Sie vorhin fragte, ob Sie das sind auf dem Magazin, haben Sie Nein gesagt.«
»Ja, ich habe zuerst nicht verstanden, was Sie meinten.«
Sie hatte Lust hinzuzufügen: »Und außerdem haben Ihnen die anderen sowieso schon gesagt, wer ich bin!« So wie sie vorher sagen wollte: »Ich hätte ihm dieses Magazin besser nicht geschickt!« Sie schämte sich jetzt für ihre Freude, als sie sich Marceau auf dem Titelblatt einer Revue präsentierte. Dabei war sie nur aus Zufall darauf gelandet, weil sie für ein befreundetes Mannequin eines Modehauses eingesprungen war. »Wenn es wenigstens für einen deiner Hüte gewesen wäre«, hatte ihr Mann gemurrt. Wie stolz Marceau gewesen sein musste! Vielleicht hatte er sie in den Bistros herumgezeigt.
»Dort drüben, in Afrika, gibt es jede Menge Fische«, sagte der Mann noch einmal, »viel mehr als hier. Und man hat immer ein Messer im Gürtel, wegen der Haifische.«
»Ach«, sagte sie bewundernd.
»Aber es gibt Strände garantiert ohne Haie.«
»Wenn sich einer dorthin verirren will, können Sie es ihm nicht verbieten.«
»Nein, man weiß, dass es dort keine gibt. Ach, hier ist es ja nicht gerade warm. Gestern musste ich sogar mein Hemd wieder anziehen. Ich habe Sie am Strand gesehen, Sie haben Ball gespielt.«
»Ich habe Sie auch gesehen. Aber ich dachte nicht …«
»Und neulich, bei den Felsen, da haben Sie mich überholt.«
»Das waren Sie!«
Dann hatte sie sich also nicht getäuscht, als sie meinte, von weitem Marceaus Bewegungen zu erkennen.
»Am Morgen schlendere ich herum. Ich komme, ich gehe. Aber nachmittags bekommen Sie mich nicht zu Gesicht.« Er zwinkerte ihr zu.
»Dann sind Sie zwischen den Felsen?«
»Ja.«
»Heute Abend fahre ich mit dem alten Demetria hinaus. Ich mag es, wenn die Wellen hoch sind.«
»Ich weiß, er hat mir gesagt, er werde Ihnen eine Dusche verabreichen.«
Mit plötzlich ernst gewordenem Gesicht fragte sie:
»Und wie geht es Ihrer Mutter?«
»Nicht gut, sie geht am Stock.«
»Sie war bestimmt froh, Sie wiederzusehen.«
»Ha, meine Mutter, das ist schon was!«
Er drehte sich erstaunt zu Marthe um.
»Haben Sie meine Mutter denn kennengelernt?«
»Nein.«
Sie sprachen nicht mehr. Zwei junge Frauen brachten sich Hand in Hand lachend vor den Fluten in Sicherheit. Eine von ihnen trug einen blauen Schal, den sie mit geschickter Anmut um ihr Haar gebunden hatte.
»Stimmt es, dass Sie gegen Haifische gekämpft haben?«
Der Mann verneinte mit einem Schnalzen.
Sie musterte ihn von Zeit zu Zeit mit einem nicht sehr freundlichen, beinahe hasserfüllten Blick. Er meinte, sie habe seine Narben an den Beinen bemerkt, aber sie hatte sie nicht gesehen.
»Ich wäre beinahe verstümmelt worden. Aber da ich ein guter Schwimmer bin, konnte ich mich retten«, erklärte er und imitierte mit den Händen Schwimmbewegungen.
»Wie ist es passiert?«
»Ich bin durch ein Boot hindurch.«
Das war schwer zu verstehen, aber sie getraute sich nicht nachzufragen. Auch auf dem Arm hatte er eine Narbe.
»Und das da?«, fragte sie.
»Auch ein Unfall«, antwortete er mit einem Ausdruck triumphierender Verachtung. Sie suchte heimlich und etwas beunruhigt nach Spuren uneingestandenen Leids, doch sie prallte auf einen gesunden, glücklichen und mit sich selbst zufriedenen Mann. Während Antoine mit grausamer Beharrlichkeit und Lust nach dem inneren Leid von Marthe suchte.
»Waren Sie in Buchenwald?«, fragte sie.
»Ja, dreiundzwanzig Monate. Aber am Schluss war ich ›freier Arbeiter‹, da wurde ich etwas besser behandelt.«
»…«
»Ach, fett bin ich nicht gerade geworden.«
Er kicherte. Das war alles. Sie fragte nicht weiter.
»Wenn ich daran denke«, fuhr er fort, »wenn ich daran denke, dass sie wieder Krieg anzetteln wollen! Alles wieder von vorn! Wie damals, als ich dort war, und kein Ende abzusehen!«
»Sie wurden von den Russen befreit.«
»Ja.«
Sie musterte ihn mit einem kurzen, intensiven Blick. Er war bäuerlicher vom Körperbau her, gedrungener, stämmiger, aber sein Gesicht war maghrebinischer, und sein Lächeln hatte etwas Geheimnisvolles, Verschwiegenes, beinahe Verschlagenes. Es war etwas Falsches an ihm, das es bei seinem Bruder nicht gab, und er war Marthe fremder. Marceau war ihr nie fremd gewesen, sondern im Gegenteil vom ersten Wort, vom ersten Blick an vertraut. Bei Antoine musste sie sich anstrengen, um an ihn heranzukommen, ihn zu fassen. Dabei war er schön, vielleicht sogar schöner als Marceau.
»Sie haben doch noch einen jüngeren Bruder, der seinen Militärdienst in Afrika leistet. Wo ist er?«
»Im Obersenegal, vier Tagesreisen von mir entfernt.«
»Ah, da sehen Sie sich wohl nicht oft.«
»Meinen jüngeren Bruder haben Sie auch gekannt?«
»Nein.«
Sie standen auf, um nach Hause zu gehen. Der Mann lud die junge Frau ein, auf der verlassenen Terrasse der kleinen Bar etwas zu trinken. Sie bestellte einen Ananassaft, den er selbst holte. Als er zurückkam, spürte sie seinen Blick auf sich. Einen plötzlich ängstlichen Blick, als fürchtete er, sie könnte nicht mehr da sein. Genau der Blick seines Bruders, als er sie ein Jahr zuvor auf dieselbe Bank geführt hatte. Doch heute waren sie allein, während das letzte Mal Leute da gewesen waren. Ein Fischer mit tätowiertem Oberkörper hatte Muscheln zubereitet und dabei Marthes wiederholte Frage gehört, die nicht an ihn, sondern an Marceau gerichtet war, der sich taub stellte:
»Gibt es hier auch Teppichmuscheln?«
Der Fischer nickte.
Nicht, dass sie Lust auf Teppichmuscheln gehabt hätte, aber sie war neugierig, ob sie auch im Mittelmeer, nicht nur im Ozean vorkamen. Marceau hatte die beiden Flaschen mit dunklem Bier auf den Tisch gestellt. Und sie tranken.
Auch jetzt trank sie, ohne Durst und ohne Worte, mit einem Gefühl von Kälte im Herzen.
Gemeinsam gingen sie die breiten Stufen empor. Voller Freude hatte sie in den ersten Tagen diese sanft zum Meer abfallende Treppe wieder unter ihren Espadrilles gespürt, jeden Morgen in dem gelben Staub einen berauschenden Tanz angefangen auf diesem Trampolin, das sie nun nicht mehr dem entgegenfliegen ließ, den sie noch immer suchte.
Wie es sein Bruder so oft getan hatte, packte Antoine sein Fahrrad mit dieser Bewegung, mit der die Schäfer ein Zicklein aufheben.
Marthe sah sich das Eisengestell an, doch es war ein normales Rad, mit Gummigriffen und einer Kiste auf dem Gepäckträger, etwas ganz anderes als der rostige Alteisenhaufen, der letztes Jahr treu neben ihr hergerollt war.
Sie gingen über die kleine, von Hecken gesäumte Straße, die über Hügel in die Ebene im Landesinnern hinabführte, von wo aus das Meer nicht mehr zu sehen war. Der Mann beugte sich über ein Gebüsch und klatschte kurz und kräftig in die Hände.
»Ach nein, ich dachte, es sei eine Zikade! Ich wollte eine für Sie fangen.«
Da erinnerte sie sich, dass der Andere eines Abends, als sie sich im Wald auf dem Hügel getroffen hatten, zu ihr sagte: »Ich wollte dir eine Grille mitbringen.« Ja, sie hatte einfach in dieses Land zurückkehren müssen, wo die Männer den Frauen kleine singende Insekten schenken.
Er zeigte auf die Hecke, die höher war als sie selbst:
»Wenn der Weißdorn blüht, ist sie sehr schön.«
Antoine schaute Marthe begeistert an. Sie sah, dass die Weißdornblüte vorüber war, aber ganz sachte meldete sich das Glück zurück. Sie sprachen wieder über Afrika.
»Wie ist es außerhalb der Stadt? Gibt es da Urwald?«
Er schwieg einen Moment betroffen, dann antwortete er mit diesem strengen Ton, den sie nicht mochte, diesem lehrerhaften Ton, der sie etwas kränkte:
»Nein, Sie wissen doch, dass es ein trockenes Afrika und ein feuchtes Afrika gibt. Wir sind im trockenen Afrika. Da gibt es nur Wüste, Busch und ein paar riesige Bäume.«
»Affenbrotbäume?«
»Ja, Affenbrotbäume.«
»Oh!«
»Ich werde Ihnen auf einem Foto zeigen, wie klein ein Mensch daneben ist.«
»Ja, ich weiß, man bohrt Tunnels in sie hinein, und die Autos fahren hindurch.« Sie war stolz, dass sie nicht ganz so unwissend war.
Ein Schmetterling flatterte über der Straße.
»Dort drüben muss es schöne große Schmetterlinge geben.«
Er antwortete nicht sofort, vielleicht langweilte ihn das Gespräch.
»In der Stadt sieht man Vögel«, sagte er endlich, »schöne rote Vögel. Sie setzen sich auf die Trottoirs.«
Und er fügte hinzu: »Ich jage dort.«
»Was für Tiere?«
»Rehe, Pumas, Turteltauben.«
»Oh!«, rief Marthe. »Das ist nicht nett von Ihnen, Turteltauben zu töten!«
»Nicht nett? Und was ist mit meinem Bruder? Wissen Sie, was mein Bruder tötet? Rebhühner! Die sind kleiner als so!«
Er zeigte verärgert seine Faust. Dann erklärte er versöhnlich:
»Wilde Turteltauben, nicht die anderen. Sie sind eine Zielscheibe. Es ist für uns eine Frage der Zielscheiben.«
Sie schwiegen einen Moment. Sie waren auf dem höchsten Punkt der Hügel angekommen, und die Straße fiel in gerader Linie zu den Dörfern ab. Da gestand er ihr:
»Gestern, als ich bei La Tour herumfuhr, habe ich mich umgedreht, und ich habe gesehen, dass Sie mich angeschaut haben. Und wie Sie geschaut haben!«
Wenn er so weit weg war, dachte sie, wie konnte er dann sehen, dass ich ihm nachschaute? Er muss es gespürt haben …
»Wenn ich aus Afrika zurück bin, werde ich mir ein Motorrad kaufen.«
Sie wollte antworten: »Das war der Traum von Marceau«, besann sich jedoch eines Besseren.
»Es ist praktisch, um herumzukommen, man gelangt sehr schnell von einem Ort zum andern, man kann auf die Bälle gehen …«
»Ja«, sagte sie mit leicht erstickter Stimme.
»Dort drüben in Afrika geht man nicht gern zu Fuß. Um von hier zum Dorf zu kommen, würde man ein Taxi nehmen.«
»Ach, die Faulpelze!«
Antoine lächelte. Bei der Kreuzung verabschiedeten sie sich, und sie schlug den Weg nach La Farloude ein.
III
Am Nachmittag kehrte sie ans Meer zurück. Sie war noch ganz benommen, wie berauscht, und etwas beunruhigt. Was wollte der Mann von ihr? Doch wohl nicht dasselbe wie sein Bruder? Bei diesem Gedanken versteifte sie sich, nein, nein!, während sie die begehrlichen Mandelaugen vor sich sah. Angesichts dieser allzu forschen Männlichkeit sehnte sie sich nach dem einfachen Verlangen des Anderen. Ach, ob sie auf dieser Welt jemals wieder so viel Ursprünglichkeit wiederfinden würde?
Der Strand war leer, das Wetter kühlte weiter ab. Sie sah einen großen Schmetterling, eine Art Schwalbenschwanz, aus der Gischt aufsteigen, die Flügel schwer von der Feuchtigkeit, und dicht über dem Sand davonfliegen. Sie sah ihn am späten Nachmittag noch einmal, denselben, wie ihr schien, aber er wurde von einer Welle verschluckt.