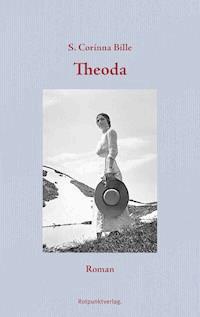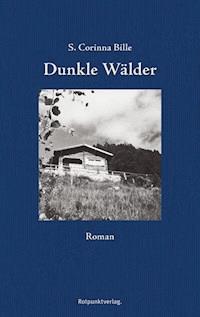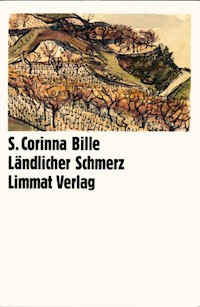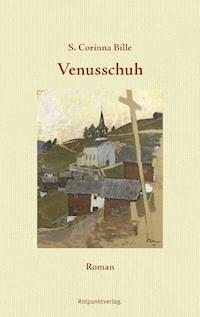
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotpunktverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Plötzlich sah er - und zwar klar und deutlich - diesen kleinen unsichtbaren Schuh, der sich in den Schnee gegraben und einen scharfen, unauslöschlichen Abdruck hineingestanzt hatte. An dem Loch, das der schmale Absatz außerhalb des gepfadeten Wegs hinterlassen hatte, erriet man den verzweifelten Willen des Körpers und seinen Drang Richtung Wald.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
S. Corinna BilleVenusschuh
Über dieses Buch
Auf einem seiner Streifzüge in der Herbstlandschaft stößt der junge Martin Lomense an der Rhone auf eine Frau, die »auf dem Wasser« geht. Es gelingt ihm, die Lebensmüde zurück ans Ufer zu holen, und er folgt ihr, kaum dass er ihr ein Wort entlocken kann, durch das Tal bis hinauf in das abgelegene Bergdorf Maldouraz. Dort feiert der Schreinermeister Grégoire Hochzeit mit einer Fremden, doch die geheimnisvolle Schönheit Bara ergreift am selben Abend noch die Flucht zu ihrem ehemaligen Liebhaber im nahen Ausland.
Martin bleibt den ganzen langen Winter in diesem einsamen, sich selbst ausgelieferten Bergdorf. Die Männer scheinen allesamt von einer dunklen Obsession für die mysteriöse Bara erfasst zu sein. Als diese zurückkehrt, gerät auch Martin selbst in den Bann ihres unergründlichen Wesens, dem er erst spät, zu spät, nahekommen kann.
In Venusschuh, ihrem zweiten, acht Jahre nach Theoda erschienenen Roman, nimmt Corinna Bille das Drama von Liebe, Tod und Verrat vor dem Hintergrund der gewaltigen Walliser Berglandschaft wieder auf. In sinnlicher, drängender Sprache vermag sie die untergründig brodelnden Affekte wie auch die gewaltsamen Ausbrüche der verschlossenen Menschen einzufangen.
Über die Autorin
S. Corinna Bille (1912–1979) gilt als eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen der Westschweiz. Nach Schuljahren in der Innerschweiz, »Lehrjahren« in Paris und Zürich führt sie ein naturverbundenes Nomadenleben in Walliser Weilern, gemeinsam mit anderen Schriftstellern. Darunter der Westschweizer Dichter Maurice Chappaz, den sie 1947 heiratet. Für ihr Schaffen wurde Corinna Bille mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 1974 mit dem Großen Schillerpreis und 1975 mit dem Prix Goncourt. Zu ihrem Werk zählen Romane, Novellen, Gedichte und Theaterstücke. Ihr Romandebüt Theoda (1944) verschaffte ihr seinerzeit den literarischen Durchbruch; 1952 folgte Venusschuh, ein hochgelobter zweiter Roman.
»Mit Venusschuh fand Corinna Bille ihreganz eigene und unverwechselbare Stimme.«
Peter Hamm, Die Zeit
S. Corinna Bille
Venusschuh
Roman
Aus dem Französischen übersetztvon Hilde und Rolf Fieguth
Rotpunktverlag
Für M. C.
I
Im Bett der Rhone
Mit heftigen Schulter- und Kniebewegungen stapfte er über den Deich. Fraglos hatte Martin Lomense mit seinem Gang etwas von einem Zentauren an sich, wenn auch einem unscheinbaren, eher Maultier als Pferd, und zentaurenhaft war auch sein doppelter Blick und sein Hang zu dunklen Erwartungen.
Bei seinem Anblick ließ ein Kind all das Schwemmholz fallen, das es gesammelt hatte, und eine Elster mit langem Schwanz schrak im Sanddornstrauch hoch. Insgeheim genoss Martin Lomense die lächerlich starke Wirkung seiner Person, die hier in der Einsamkeit und im weichen Widerstand des Sandes besonders zur Geltung kam.
Seit Tagesanbruch stieg er nun schon am Fluss entlang hinauf. Das kalte Wasser war so nah, dass er es geradezu durch seinen Körper fließen und zwischen seinen Fingern plätschern spürte, doch er schaute kaum hin. Es erfüllte ihn mit Unbehagen. Unmerklich floss es dahin, Schatten mischten sich hinein; es war kaum breiter als ein Bach, den man barfuß hätte durchqueren können. In den kleinen Buchten, wo das von den Deichmauern zurückgehaltene Wasser unbeweglich stand, hatte sich um die Kieselsteine ein Rand aus Eis gebildet. Martin betrachtete lieber die Inseln aus Gestrüpp unterhalb der Böschung, die der Trockenlegung der Sümpfe widerstanden hatten und jenen Gärten tief im Innern der Osterinseln glichen. Dahinein senkte der junge Mann seine schwarzen Augen, die so gewölbt waren, dass sich die blassen Augenlider darüber spannten wie bei einem Vogel. Er konnte dem Verlangen nicht widerstehen, in das Dickicht hinunterzusteigen und das Gras niederzutreten, dem der Reif eine trügerische Festigkeit verliehen hatte. Doch als er sich bückte, um über die Mauer zu springen, blieb auf dem mit Raureif bedeckten Deich der Abdruck seiner linken Hand zurück. Betroffen bemerkte er, dass ein Finger fehlte. Er hatte schon fast vergessen, wie er sich als Kind den Zeigefinger mit einer Axt abgeschlagen hatte. Die Stimmen seiner Eltern waren dabei über seinem Kopf aufeinandergeprallt wie die Stimmen erzürnter Götter. ›Um sich an ihnen zu rächen …‹ Schnell wischte er den Abdruck weg, rührte im Sand und im morgendlichen Schaum, der sich bei der leisesten Berührung auflöste. Er fluchte; dabei riss die kalte Luft auf seinen Lippen die kleinen Schründe vollends ein. So schwieg er. Dann stürmte er los, zerbrach Zweige und Eisschichten. Beschämt von so viel Lärm blieb er stehen und lauschte. Im feuchten Halbschatten der Gehölze, in die die Sonne noch nicht gedrungen war, entströmte den Bäumen am Wasser ein Pfeffergeruch wie am Meer, jener Flechten- und Algenduft, der ihn immer an eine Frau denken ließ.
Hier hätte er ihr begegnen wollen, an diesem fast unterirdischen Ort mit den verschwiegenen, von Schilf umstandenen Spalten. Nicht einfach ihr begegnen, entdecken wollte er sie, begraben im Schlamm – an diesem Morgen hatte er einen toten Widder gesehen, der halb von Wasserpflanzen bedeckt war –, eine lebende Frau, die er aus dem Boden holen würde, mit den Fingernägeln würde er sie ausgraben und den ganzen Körper freikratzen, dessen Formen sich ihm mehr und mehr darbieten würden. Und die Haut wäre nicht weiß, auch nicht rosa oder braun, sondern quecksilbergrau, wie der Glimmerstaub, der die Dinge färbt.
Er war allein; allzu schnell gelangte er zu den bebauten Feldern, die auf das Gesträuch folgten und es dann zu einer lächerlichen Hecke zusammenschrumpfen ließen. Die letzten Blätter, schwarz und gelb glänzend wie ein Salamander, hinterließen schmierige Spuren auf seinem Mantel. Eines fiel auf seine Wange, eine zartbraune Wange mit glatter Haut, auf der dicht, wie die den Sand säumenden Brombeerranken, die Stoppeln eines schlecht rasierten Bartes wuchsen. Manchmal befühlte er sich. Seine eigene Wärme, die sich der Kälte entgegenstellte, schuf eine Grenze dazwischen, die ihn seine ganze Körperoberfläche spüren ließ. Er genoss dieses intensive Gefühl. Die sanften Ein- und Ausbuchtungen seines Rumpfs wurden ihm bewusst, und auch die Wölbung seiner Hüften, die ihn mit ihrer unbegreiflichen Weiblichkeit quälte. Von ihnen und von seinen kräftigen Beinen her stammte dieser Gang eines Schützen. In einer Allee von Weidenbäumen suchte er sich eine Gerte aus und rollte sie gedankenverloren um sein Handgelenk.
Mit dieser Kinderwaffe ausgerüstet stieg er wieder auf den Deich, den bald die Sonne erreichen würde. Das andere Ufer hellte sich schon auf, grell rotbraun und deutlich. Martin Lomense schritt geblendet vorwärts zwischen einem Land des Lichts und einem Land der Nacht, begleitet von dem Engel des Feuers und dem der Finsternis.
Er schloss die Augen. Als er sie wieder öffnete, ließ die Sonne den Fluss in den Regenbogenfarben schillern. Da sah er eine Frau, die auf dem Wasser ging. Nur mühsam kam sie voran, die Steine und die Strömung behinderten sie. Der Fluss reichte ihr bis an die Waden und tränkte ihren Rocksaum; sie machte sich nicht die Mühe, ihn hochzuraffen. Obwohl sie einige Male fast ausgeglitten wäre, unternahm sie nicht den geringsten Versuch, das Ufer wieder zu erreichen, sie ging weiterhin die Rhone hinunter, als ob es keinen anderen Weg gäbe. Es war eine ältere Dame mit stolzem, entschiedenem Gang, in der Art der alten Aristokratinnen aus Martins Geburtsstadt.
»Heh!«, schrie er schließlich, bedauerte es aber sofort, denn sein Rufen hätte die Vision, die ihn da zum Narren zu halten schien, vertreiben können.
Die Unbekannte wandte sich nicht um. Sie befand sich einige Meter von ihm entfernt. Deutlich sah er ihr spitzes Gesicht und die rosigen Hände, die sich an das dunkle Gewand klammerten. Sie sah verärgert aus, fast böse. Ohne das Gleichgewicht zu verlieren, sank sie noch etwas tiefer ein. Das Wasser reichte ihr nun bis an die Knie. Der junge Mann sah sie schon fallen, aber sie richtete sich wieder auf und folgte unbeirrt würdig ihrem Weg.
›Wenn ich hier so tatenlos stehen bleibe, dann wird sie vielleicht für immer verschwinden.‹ Er rannte ans Ufer.
»Madame!«
Hörte sie ihn? ›Wenn sie taub ist, muss ich wohl in das Wasser steigen.‹ Diese Aussicht verdross ihn.
»Halt!«
Er brüllte. Eichelhäher mit großen blauen Flügeln flogen mit rauem Schrei auf. ›Sogar die Fische müssen mich hören!‹
Endlich schien die Frau aufmerksam zu werden, zögernd horchte sie auf.
»Hierher!«, befahl er.
Er stand dicht am Wasser und streckte die Arme aus; bei der Vorstellung, sie bald zu berühren, zitterte er. Folgsam ging sie auf ihn zu. Ihr Rock kam aus dem Wasser heraus, die Knöchel wurden sichtbar, aber die Beine, die im Fluss so stark gewesen waren, strauchelten, sobald sie das Ufer erreichten. Martin packte die Frau und trug sie bis zur Dammaufschüttung. Sie war nicht schwer.
Er setzte sie auf einen Erdklumpen und betrachtete sie. Da er damit gerechnet hatte, Worte einer Irren zu hören, war er erstaunt, als sie mit ruhiger Stimme sagte:
»Ich danke Ihnen.«
Sie sah ihn nicht an. Wie alt sie wohl war? Trotz einiger Fältchen und blutiger Lippen war ihr Gesicht immer noch schön, geprägt von einer etwas verstörten Würde. Ihre glatten Haare ohne jede widerspenstige Strähne, der sorgfältig zugehakte Stehkragen aus Samt, die mit schwarzem Garn bezogenen Knöpfe an ihrem Bauernmantel, von denen kein einziger fehlte, all das stand im Widerspruch zu dem jammervollen Zustand ihres Rocks, der mit seinem Schlammrand von Wasser triefte, und den groben Schuhen, die Rostspuren auf dem Sand hinterließen. An einer Kordel hielt sie etwas in der Hand, was er zunächst für eine Tasche oder einen Beutel gehalten hatte – es war aber ein ovaler, mit violettem Stoff gefütterter Strohhut.
Er kniete sich vor sie hin und begann, ihr die Schuhe auszuziehen. Als er sich umwandte, um das Wasser herauszuschütten, zog sie die Strümpfe aus. Er fand sich zwei mageren wachsgrauen Füßen gegenüber, dicht aneinandergepresst, mit langen steifen Zehen.
Solche Füße des gekreuzigten Christus hatte er auf seinen Wegen oft gesehen; auf einem kleinen Schneesockel aufliegend waren sie Wind und Wetter ausgesetzt. Heute empfand er bei ihrem Anblick das gleiche tiefe Mitleid, doch dieses Mal – und in welch merkwürdiger Situation! – war es ihm gegeben, sie zu wärmen. Aber wie sollte er das anstellen in dieser Einsamkeit, wo es nichts gab, womit er hätte Feuer machen können? Er hüllte sie in ein Stück seines Mantels und rieb sie. Es waren die Füße einer Toten.
»Ach was«, sagte sie, »das bin ich gewohnt.«
Sie zeigte keinerlei Müdigkeit und dachte nicht daran, ihren Rock auszuwringen. Ob sich ihre Teilnahmslosigkeit auf Martin übertragen würde?
Er blickte über die Ebene und hielt Ausschau nach einem Haus, zu dem er dieses der Rhone entstiegene Geschöpf bringen könnte. Aber er sah nichts.
»Einerlei«, sagte er mit plötzlich grobem Ton, »was haben Sie denn da im Wasser gesucht?«
Ein leichtes Zittern überlief sie, sie schwieg weiter.
»Wo wohnen Sie?«, fragte er noch.
Ohne zu antworten, stand sie auf. Sie war genauso groß wie der junge Mann. Nun gingen sie nebeneinander her, und Martin Lomense spürte die Nachbarschaft dieser Unbekannten wie eine Eiskruste, die jetzt ein Teil von ihm war.
Am rechten Ufer weideten auf den hellen Abhängen der Hügel Ziegen; junge Burschen sprangen hinter ihnen her und jagten sie. Ihre Schreie, vermischt mit dem rauen Gemecker, versetzten ihn in Erregung. Ach! Wenn ihm diese Ebene gehört hätte, gäbe es dann so viele bebaute Felder, so viele regelmäßig angepflanzte Bäume? Gestrüpp und die Rhone wären wieder die Herren, und die ausgestorbenen Tiere würden sich überall darin herumtreiben. Er stellte sich den Lauf eines Wildschweins im hellvioletten Nebel des Dickichts vor, aus dem sich der weiße Stamm der Birken erhob wie ein sanfter Pfeifton, wie ein Ruf. Blumen und Blätter gäbe es nicht mehr auf der Erde, und trotzdem wäre alles zart, feiner als eine Blume; und die dünnen glänzenden Äste würden die fernen Zweige durchscheinen lassen, so zart wie ein Federkleid.
»Madame…«, begann er, befangen, mit einer Frau zu sprechen, die vielleicht taub war, »Madame …«
Ein unwillkürliches Mitleid nötigte ihn zu dieser übertriebenen Höflichkeit. Aber ehe er fortfuhr, pflückte er im Vorübergehen von den kleinen, runden, dunkelvioletten Früchten eines Schlehenbusches, wie Murmeln rollte er sie zunächst in der hohlen Hand, noch traute er sich nicht, sie in den Mund zu stecken. Er warf einen schrägen Blick auf seine Begleiterin. Sie schien sich um ihn nicht mehr Gedanken zu machen als um ihre durchnässte Kleidung. Heimlich steckte er die Schlehen in den Mund; die Kälte traf seine Zähne, seinen Gaumen. Er kannte den bitteren Geschmack dieser Beeren, der nur durch den Frost gemildert wird, und ganz vorsichtig betastete und zerdrückte sie seine Zunge. Schnell schluckte er sie hinunter, kaum dass er sie kaute, um das pelzige Gefühl zu vermeiden. Erst als er seinen gierigen Appetit befriedigt hatte, sprach er mit lauter Stimme: »Wohnen Sie da?« Er zeigte irgendwo vor sich hin.
»Nein, da nicht.«
Sie hatte so entschieden geantwortet, dass Martin beschloss, seine Fragen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. So kamen sie schließlich zu einem dieser verfallenen Bauernhäuser, die einmal wahre Schlösser waren, nun aber Bruchbuden glichen. Ein Torbogen öffnete sich zu einem Hof, in dem verfaulte Kürbisse herumlagen.
»Hier könnte man Ihnen vielleicht helfen.«
Sobald sie das verstanden hatte, wandte sie sich ab und lief davon. Wider Willen musste er ihr folgen. ›Sie will vielleicht nicht, dass die Leute sie sehen …‹
Mit gerunzelter Stirn und blutunterlaufenen Augen stemmte die Alte sich gegen die grelle Helligkeit. Sicherlich wäre sie lieber im Schatten gewesen, am linken Ufer, über dem immer noch ein dichter Nebel lag, durch den kaum die ersten Strahlen drangen. Martin spürte nun kein Mitleid mehr. Er streifte von seinen Schuhen die Eisreste ab, die sich beim Laufen über die Steine daran festgesetzt hatten.
Den ganzen Deich entlang glänzten die feuchten gelben Gräser, aus den Gärten stieg ein saurer Geruch auf. Auf der anderen Flussseite fuhr ein Zug vorbei – dass sie von den Reisenden gesehen wurden, die weder etwas für noch gegen sie unternehmen konnten, ließ den jungen Mann lächeln. Aber seine aufgesprungenen Lippen, die davon schmerzlich überrascht wurden, erstarrten.
Ein Pfad führte zwischen rötlichen Spargelbüschen und Maisstoppeln auf ein niedriges Haus zu. Ohne sie um ihre Meinung zu fragen, stieß er die alte Frau über die Schwelle, aber sie wehrte sich und riss sich mit einer derartigen Gewalt los, dass er keuchend zurückblieb.
»Ich brauche nichts«, sagte sie, »mir ist warm, es geht mir gut.«
Ohne auf ihn zu warten, ging sie weiter.
»Wo gehen Sie hin?«, rief er und rannte ihr nach.
Sie erwiderte: »Gehen Sie Ihrer Wege, wohin auch immer, ich weiß schon, wo ich hingehe!«
»Ich gehe mit Ihnen …«
Sie machte keinerlei Anstalten, ihn zurückzuhalten, ermunterte ihn aber auch nicht. Jetzt war sie es, die ihn führte.
Eine eiserne Brücke überspannte die Rhone. Würde sie an dieser Kreuzung nach links gehen oder nach rechts oder weiter den Fluss entlang? Martins Herz pochte. ›Ich werde sie begleiten, wenn ich auch meine Verabredung versäume.‹ Ihr Dorf? War es eines von den beiden, die man am anderen Ufer sah, von kleinen Wiesen und Weinbergen umgeben, auf denen Hähne und gesprenkelte Hühner herumspazierten? ›Wo sie hingeht, gehe ich auch hin.‹ Aber ganz wohl war ihm nicht dabei.
›Und wenn es weit weg von hier ist? Egal, die anderen sollen auf mich warten.‹ Hatte er laut gesprochen? Dazu war er fähig, aber diese Unart machte ihm nichts aus. Er war sich immer noch nicht im Klaren darüber, ob die Alte ihre Sinne beisammenhatte oder nicht. Sie ging beständig in ihrem feierlichen Gang weiter, und vom Saum ihres allmählich trocknenden Kleides stieg ein grauer Dunst auf wie Weihrauchschwaden um eine Statue.
Als er sah, dass sie den Weg einschlug, der an den Fuß der kalten Berge führte, zögerte er doch. Dieser im Dunkel liegende Weg gefiel ihm überhaupt nicht; widerwillig folgte er ihr. Dann schämte er sich seiner schlechten Laune und dachte an die steinigen Wege, die in die Gärten der Seligkeit führen. In einem Dorf hallte die leere Gasse von ihren Schritten. Er dachte, dass alle Welt sie hören müsse, aber kein Mensch zeigte sich. Wer wohl wunderte sich über sie hinter den verschlossenen Fenstern dieser Hausmauern? Er glaubte, den Widerschein der Morgenröte auf einem der Fenster zu erkennen: Aber es war Einbildung, das Haus war nur rosa gestrichen, und im Fensterrahmen kämmte sich eine junge Frau, die das Fenster als Spiegel benutzte; ihre blassen Hände drehten farblose Haarsträhnen, die sich um sie ausbreiteten wie etwas dichtere Luft.
Der Gips, der als Staub von der Mauer auf den Gehweg gefallen war, klebte an den Schuhsohlen der beiden Wanderer. Sie trugen ihn ziemlich weit mit sich und hinterließen auf der Straße sichtbare Zeichen ihres Vorübergehens. Martin drehte sich von Zeit zu Zeit um, um sie zu sehen, und lächelte: ›Die Engel können keine schöneren Spuren auf Erden hinterlassen.‹
Seine Begleiterin, die vorausging, kam zur Kirche, lief um den Friedhof herum, auf dem sich erfrorene Chrysanthemen zum Boden neigten, und schlug dann einen Weg ein, der den Berg hinaufführte. Sie ging schnell. Der junge Mann folgte ihr in einiger Entfernung. So konnte er sie besser sehen, und mit scharfem Auge nahm er die geringsten Einzelheiten wahr: den etwas plumpen und trotzdem raffinierten Schnitt ihres Kleids, die Rockfalten, die sich auf Wasserhöhe aufgelöst hatten, die leicht ausgefransten Schnüre am Oberteil, die auf der Vagabundin etwas wie das schwarze abgefallene Laub eines Walds bildeten, das sein Pflanzensein verliert und schon in Humus übergeht. Ihr langer schmaler Hals, durchscheinend grau, erhob sich störrisch über der sanfteren und verletzlicheren Masse des Körpers; er wirkte wie eine halb heruntergebrannte Kerze, im Begriff, von ihrem kleinen Samtkragen zu fallen. Martin Lomense blieb stehen, um zu verschnaufen, dann hefteten sich seine Augen wieder auf seine schweigsame Führerin, auf ihre einfachen Schuhe, die mageren Beine, die durch die wollenen Strümpfe, die er ihr geliehen hatte, kaum umfänglicher waren. Ihre Hände, die sie vorn gegen den Rock drückte, konnte er nicht sehen. Er hätte sie gern wieder von vorn, im Ganzen betrachtet.
»Warten Sie!«, bat er.
Die Frau hörte nicht. Sie schien immer auf etwas zu lauschen, beugte den Kopf mit aufmerksamem Ohr nach vorn, mit diesem kleinen aschgrauen Ohr, das er so gut erkennen konnte. Oh ja, sie hatte ihn zurückgelassen, erinnerte sie sich überhaupt noch an ihn? War ihr bewusst, vor welcher Tollheit er sie bewahrt hatte? Und die Zeit, die er wegen ihr verlor, und die Freunde, die er vielleicht nicht mehr treffen würde.
Aber Martin Lomense würde die Sonne wiederfinden; er ahnte sie über sich, über diesem Land, das er noch nie gesehen hatte und in das er bald den Fuß setzen würde. Er sah schon die Lärchenwälder mit ihren gelben, unbeweglich erhobenen Flügeln, kurz und spitz, wie sie ein Erzengel im schnellen Flug zusätzlich zu den Flügeln auf dem Rücken vorne am Körper haben kann.
Aus welchen Tiefen würden sie auftauchen? Ein Wildbach toste unten in einer Schlucht, er war von den Wacholderbüschen verdeckt, die den Wegrand säumten, und von großen Blüten aus Reif auf brüchigen Stielen. Als er es schon nicht mehr erwartete, wandte sich die Unbekannte um. Zum ersten Mal fühlte er sich wahrgenommen. Endlich sah sie ihn an! Und damit dieser forschende Blick andauerte, der ihm kostbar und rar war, ließ er seine Augen zerstreut über die Landschaft schweifen. Nun spielte er den Gleichgültigen. Die Frau rührte sich nicht. Er hörte sie sagen: »Wie konnte ich nur die Religion vergessen?«
Jetzt hatte er das Recht, sie anzustarren. Sie gab es zu. Gleich würde er alles verstehen.
»Nie im Leben hätte ich geglaubt, dass ich einmal die Religion vergessen könnte!«
Sie war aufgebracht, zutiefst unzufrieden mit sich selbst. Er suchte nach einer Antwort, die sie beruhigen könnte, aber schon hatte sie ihm den Rücken zugekehrt und ging weiter.
Sie mussten lange laufen, ehe sie die Güte hatte, sich ihm wieder zuzuwenden. Der Weg war auf eine in den Felsen geschlagene Straße gestoßen, die an einem Abgrund entlangführte, dort verschwand die ganze Vegetation unter einer Fülle von flockigen Waldreben. Granitwände ragten in die Höhe, mitten in ihren Spalten trugen sie eine kleine Eiche oder eine Kiefer. Statt des Baums stellte sich Martin einen betenden Anachoreten vor, einen Säulenheiligen, der keine Verbindung mehr zu den Menschen hat, höchstens noch durch einen Korb an einer Schnur, den er auf den Weg herabließe und den gutmütige Menschen mit Nahrung und Geschenken füllten, falls diese Aufgabe nicht ein Bergrabe übernahm. Voll Spott dachte er an die Liebe zu Gott, zu allen Kreaturen und zur Welt, die zu einer verschärften Einsamkeit werden kann, denn sie verursacht durch eine merkwürdige Umkehrung, dass man genau das liebt, was man eigentlich fliehen wollte. Mit begierigem Auge durchmaß er noch andere Stellen des Walds, die durch ein Stück Felswand von der Erde getrennt waren und wo nur ein Vogelpaar leben konnte. Er stellte sich vor, wie er hier oben auf einer winzigen Insel in einer Holzhütte oder einer Höhle am Abgrund wohnte und nichts anderes kannte als den Schatten und den Geruch der Nadelbäume, deren vielerlei Seufzer er zu unterscheiden lernte.
Dann öffnete sich das Tal vor ihnen. Es war ein großes Alpental mit Dörfern, aber sie beachteten es kaum, sie hatten die Landschaft auf einen kleinen Kreis um sich herum zusammengefasst, kaum dass das Grün des Abhangs und das blasse Violett der Heckenrosensträucher in ihn hineindrang. Sie gingen dahin, vor allem waren sie sich der Sonne bewusst, die der junge Mann mit Wonne auf seinem Körper trug. Das Licht erwärmte das Gewand seiner Begleiterin und trieb dabei den Gestank nach Schlamm und altem Stoff aus ihm heraus, in dem Martin auch noch einen stickigen Geruch nach Schafen und verbranntem Kraut wahrnahm.
»Ja«, sagte er laut – als ob er mit sich selbst spräche, es geschah aber in der Hoffnung, sie neugierig zu machen –, »ja, wir glauben immer, wir haben uns in der Gewalt …« Und er machte eine dieser unbestimmten, bei schlechten Predigern beliebten Gesten. Diese Bewegung löste die Weidengerte von seinem Handgelenk. Sie fiel zu Boden. Als die Frau das sah, wich sie zurück und stieß einen Schrei aus.
»Na, na!«, murmelte er befriedigt. Es war ihm gelungen, ihre Gleichgültigkeit zu erschüttern. »Sind Sie erschrocken?«
»Ich hab geglaubt, es wäre eine Schlange«, sagte sie, »das sind schreckliche Tiere.«
»Die zeigen sich jetzt nicht mehr.«
»So, meinen Sie?« Sie grinste. »Die sieht man das ganze Jahr.«
Sollte sie noch redselig werden? Vorschnell nutzte der junge Mann die Gelegenheit, sie nach ihrem Namen zu fragen.
»Das geht Sie nichts an.«
Dieser entschlossene und dennoch respektvolle Ton brachte ihn zum Schweigen. Sie gingen weiter und kümmerten sich nicht mehr umeinander. Aber plötzlich fühlte er, ganz nah, eine Angst. Er schaute die Frau an. Ihr Schritt war zögerlich geworden. Trotz eines gewissen Automatismus, der ihr wohl eigen war, löste sich etwas in ihr auf und zerbrach. Er nahm sie am Arm. Sie wankte. Wieder kam sie ihm vor wie ein Nichts, geradezu wie ein Gespenst.
Fast erwartete er, sie verschwinden zu sehen, aber die Unbekannte fasste sich wieder, machte noch drei Schritte, dann fiel sie steif und leicht auf den Weg.
II
Der Aufstieg
›Sie ist tot‹, dachte Martin Lomense. Er sah nur ihren Rücken, die schwarzen Falten ihres Kleids und den Nacken. Die Arme, mit denen sie im Augenblick des Fallens nach rechts und links die Balance gesucht hatte, blieben so ausgebreitet liegen, nutzlos wie die zwei Flügel einer auf den Boden gefallenen Schwalbe. Er beugte sich über sie und drehte sie unsanft um. Ein Seufzer entwich den zusammengepressten Lippen. Das Gesicht zeigte trotz des Aufschlags keinerlei Wunde, Staub bedeckte es mit einer zarten weißen Puderschicht. Er hob sie hoch. Als er sie auf dem Abhang absetzen wollte, sah er in geringer Entfernung ein kleines Gasthaus, neben dem ein Pavillon stand.
Mit dem Knie stieß er die Tür auf und trat ein. In seiner Hast kippte er einen Stuhl um und hievte die Alte, die immer noch ohnmächtig war, auf ein Sofa. Von dem Geräusch aufgescheucht, ließ sich eine Frau blicken; sie war nicht frisiert, ihr dicker Körper steckte in einem roten Kittel; ein kleines Mädchen hing an ihrem Rockzipfel.
Sie verstand den Grund dieses ganzen Lärms nicht, denn vor ihr stand ein gut angezogener, höflicher junger Mann, der um ein Glas Schnaps bat, und in einer Ecke saß eine alte Frau.
Ein wenig überrascht holte sie einen Cognac; als sie wiederkam, war die Alte hellwach, hatte die Hände im Schoß gefaltet und antwortete mit sanftem Kopfschütteln auf die besorgten Fragen ihres Gegenübers. Es gehe ihr doch schon besser, man solle doch keine Umstände mit ihr machen. Das Rot kehrte in ihre Wangen zurück, und nun schien sie nicht mehr mit dem Reden aufhören zu wollen. Indem sie ihre Worte mit segnender Gebärde begleitete, sagte sie:
»Oh, die, die tut mir leid, und wie mir die leidtut!« Sie schien fast vergnügt zu sein. Martin hatte Angst vor dem Augenblick, wenn sie merken würde, dass ihr Hut nicht mehr da war. Sie musste ihn am Ufer vergessen haben.
»Sie tut mir leid. Sie weiß nicht, was auf sie zukommt!«, wiederholte sie.
Das kleine Mädchen hatte sich in dem anderen Zimmer versteckt und streckte manchmal den Kopf herein. Die Wirtin hinter der Theke hörte aufmerksam zu, und manchmal huschte ein Lächeln über ihre Lippen, aber sie sagte nichts. Ganz gewiss ging es nicht um sie. Sie betrachtete den jungen Mann mit respektvollem Staunen, was ihm nicht unangenehm war. Hatte sie Rock und Schuhe der Wanderin gesehen, die immer noch nass waren? Martin hätte ihr gern alles erzählt, aber er traute sich nicht, er wollte die empfindliche Natur der alten Frau nicht verletzen, die an diesem Morgen ja fremde Hilfe abgelehnt hatte.