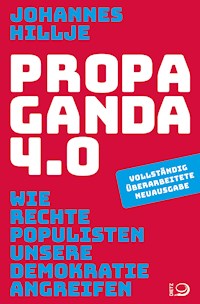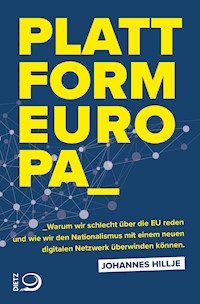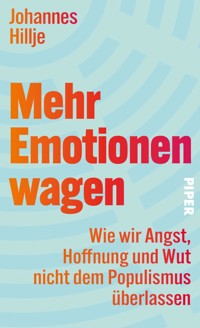
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Populisten und Extremisten dominieren die politischen Emotionen. Sie schüren nicht nur Wut, sondern gelten ihren Anhängern auch als Hoffnungsträger. Demokratische Kräfte wirken dagegen oft blutleer und technokratisch. Dabei lehrt die Geschichte, dass man die Emotionen nicht den Radikalen überlassen darf. Dieses Buch fordert ein Umdenken und zeigt, wie Emotionen zur Politik gehören und in den Dienst der Demokratie gestellt werden können. Anhand von eigenen Studien und konkreten Beispielen beweist Johannes Hillje, dass Hoffnung, Wut und Angst zu einer neuen demokratischen Emotionskultur gehören.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2025
© Grafiken: Johannes Hillje
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
1 Einleitung
Trump and Hope
Feel-Good-Rechtsextremismus
Warme Ränder, kühle Mitte
Politische Emotionen
Ein Buch mit einer (kleinen) Mission
2 Deutsche Emotionsaversion – falsche Lehre aus der Geschichte?
Pathos der Nüchternheit
Bonner Bescheidenheit
Schmidts nüchterne Leidenschaft
Kann man eine Verfassung fühlen?
Mauerfall zwischen Emotionskulturen
Merkels Momente
Wofür sich Bundespräsidenten rechtfertigen müssen
Charisma des Realismus
Scholz on fire
Was uns Weimar (auch) lehrt
3 Aufklärung und Affekt
»50 Prozent der Deutschen sollen Angst haben«
Fakten gegen Fakes?
Ein zweiter Blick auf Kant
Der blinde Fleck des Liberalismus
Emotionalität und Rationalität: Duett statt Dualismus
Wählen mit Gefühl
Ein Wir, das wärmt
Affektive Polarisierung und affektive Intelligenz
Emotional, niemals neutral
4 Demokratische und undemokratische Emotionalisierung
Emotionalität und Emotionalisierung
Algorithmus, Journalismus, Populismus
Gute Gefühle, schlechte Gefühle?
Das Dreieck politischer Emotionen
Hoffnung
Angst
Wut
Undemokratische Emotionalisierung
Entmenschlichung
Antagonisierung
Wahrheitsmonopolisierung
Verächtlichmachung demokratischer Institutionen
Die emotionale Repräsentationslücke
Für demokratische Emotionalisierung!
5 Die Versuchsanordnung
Wie kann man politische Emotionen messen?
Erfassung des Unbewussten
Demokratische vs. undemokratische Emotionalisierungen
Trigger-Themen Klima und Migration
6 Emotionen für Demokratinnen und Demokraten
Deutschland, ein Sorgenland
Fünf politische Emotionstypen
Angespannte Linke
Jüngere Optimistische
Besorgte Mitte
Gereizte Entkoppelte
Wütende Rechtspopulistische
Wollen die Deutschen politische Emotionalisierung?
Migration: Konservative schlagen rechtspopulistische Emotionalisierungen
Menschlichkeit emotionalisiert
Klima: Progressive schlägt rechtspopulistische Wut
Sehnsucht nach Hoffnung beim Klimaschutz
7 Von der Emotionsaversion zur Emotionsaffinität – fünf Thesen für eine neue politische Emotionskultur
1. Neue Wut – als Antrieb für Gerechtigkeit
2. Neue Hoffnung – liegt im Handeln
3. Neue Kultursensibilität – anstelle des Kulturkampfes
4. Neue emotionale Repräsentation – für Vertrauensaufbau
5. Neue Emotionskultur – braucht uns alle
Dank
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
1 Einleitung
Bitte lassen Sie sich für einen Moment auf einen irritierenden Gedanken ein: Der aggressive Populismus und der autoritäre Nationalismus sind eine Quelle der Liebe. Auch der Hoffnung, des Stolzes, des Glücks, der Selbstwirksamkeit, der Ästhetik und sogar: des Wissens. Sie halten bereit, wonach sich Menschen sehnen – nicht nur jene, die frustriert, verängstigt oder unzufrieden sind. Mehr noch: Rechtsextremismus ist Lifestyle, Popkultur und Gaming-Entertainment, verbreitet positive Vibes, ja, ist tanzbar – mit Aperol Spritz in der Hand. Und nennt sich, wirklich wahr, »Spritzkrieg«. Chin-chin!
Glauben Sie nicht? Dann sind Sie auf der Party der Populisten und Extremisten vermutlich nicht eingeladen. Dann wählen Sie wahrscheinlich solche Kräfte nicht. Dann blicken Sie von außen, womöglich mit Sorge oder Fassungslosigkeit, auf die Anziehungskraft von Parteien wie AfD oder FPÖ und Politikern wie Donald Trump oder Viktor Orbán. Dann haben Sie in den letzten Jahren vielleicht Analysen gelesen, die von »Wutwahlen« in Serie sprachen, AfD mit »Angst für Deutschland« ausbuchstabierten und gar ein »Zeitalter des Zorns« ausriefen. Und es ist ja auch ein Teil des Puzzles: Wählerinnen und Wähler von Rechtsaußen-Parteien sind überdurchschnittlich unzufrieden, verunsichert oder verängstigt. Aber: Diese Parteien sind spezialisiert auf die Skalierung, Transformierung und Regulierung von Emotionen. Das heißt, dass sie bestehende Störgefühle und Sorgen zu Ängsten verstärken, passive Ängste in aktive Wut umwandeln und, ganz wichtig, das Bedürfnis nach einem positiven Gefühlsausgleich mit attraktiven Hoffnungs- und Identifikationsangeboten erfüllen. Opfer- und Retterrolle sind in der populistischen Dramaturgie untrennbar miteinander verbunden. Wut mag Menschen kurzfristig aktivieren, aber erst die Wärme, die durch soziale Gemeinschaft und politische Verheißung entsteht, bindet sie an diese Akteure. Für »Outsider« sind Rechtspopulisten Hasardeure, Brandstifter, Menschenfeinde, für die »Insider« Aufklärer, Kümmerer und Erlöser, ja sogar Vater- und Mutterfiguren, die die Dinge in die Hand nehmen. Damit sind sie emotional leader. Studien bestätigen, dass die höhere Überzeugungskraft von populistischen Botschaften gegenüber einer unpopulistischen Ansprache in Emotionen wie Stolz und Hoffnung begründet liegt.[1]
Trump and Hope
Radikaler Populismus ist in westlichen (Noch-)Demokratien die winning strategy der 10er- und 20er-Jahre des 21. Jahrhunderts. Die verlierenden liberalen Kräfte haben in ihren Analysen des rechtspopulistischen Siegeszugs den Aspekt der positiven Emotionalisierung und Identifikationsfläche bislang großzügig ausgespart. Stattdessen wundert man sich, warum Menschen »gegen ihre Interessen« stimmen, oder sieht eine »falsch verstandene Vaterlandsliebe«. Für Donald Trump und seine Anhängerschaft ist MAGA (Make America Great Again) »eine Bewegung, gebaut auf Liebe«.[2] In seinen Reden wirft er mit Liebe nur so um sich – Liebe für seine Wählerinnen und Wähler, für »die vergessenen Frauen und Männer dieses Landes«, für Arbeiterinnen und Arbeiter in der Kohle- und Ölindustrie, für »jedes amerikanische Kind« und für den reichsten Mann der Welt (»I love you, Elon. You’re a super genius«). Als geschäftsführender Präsident am Ende seiner ersten Amtszeit schickte Trump am 6. Januar 2021 seinen MAGA-Mob zu einem Selbst-Staatsstreich in das Kapitol; nachdem es Tote und Verletzte gegeben hatte, rief er seine rioters mit sanften Worten zurück: »Geht nun nach Hause, wir lieben euch, ihr seid etwas sehr Besonderes.«[3] Und in seiner Geschichtserzählung erklärte Trump diesen Tag der Gewalt zum »Tag der Liebe«.[4] Wenn Trump die Wirklichkeit ins Gegenteil verkehrt, dreht er auch die Emotionen um 180 Grad. Konsequenterweise gewährte er am ersten Tag seiner zweiten Präsidentschaft (20. Januar 2025) rund 1500 verurteilten Kapitolstürmern eine »volle, vollständige und bedingungslose Begnadigung«, wenige Stunden, nachdem er in seiner Antrittsrede den »Tag der Befreiung« für Amerika ausgerufen hatte.
Die Liebe ist aufseiten der MAGA-Masse allerdings weitaus authentischer als bei Trump selbst, der ein Showman des Extremismus ist. Hört man seine Fans über ihn sprechen, dann vernimmt man eine bemerkenswerte Mischung aus religiösem Führerkult (»Gesandter Gottes«), nahbarer Kumpelhaftigkeit (»Ich könnte ihn in mein kleines Zuhause einladen und wäre nicht nervös«) und einem ausgeprägten, moralisch begründeten Repräsentationsgefühl, selbst bei Schwarzen Menschen (»Trump ist der Schwärzeste Präsident aller Zeiten«).[5] Er wird bewundert für seine Stärke – vom Amtsenthebungs- bis zum Anschlagsversuch hat er alles überlebt –, bestaunt für seinen Reichtum, bejubelt für sein, mitunter ja auch selbstironisches, Entertainment und gefeiert für sein Durchgreifen gegen die »verrotteten Eliten« aus Politik und Medien. Auf seine Social-Media-Posts, die voller Hass und Wut gegen andere sind, reagieren seine Fans am häufigsten mit dem Herz-Emoji. Bei der demokratischen Konkurrenz geht es viel liebloser zu, wie die Daten von Kommunikationswissenschaftlern zeigen.[6] Social Media ist heutzutage allerdings mehr als liken oder teilen, in einem Wahlkampf ist es massenhaft ausgelagerte content creation. Von der Sitznachbarin in der Schulklasse bis zum TikToker mit Millionen Followern sollen kleine und große influentials die Botschaften, Memes, Clips und Soundbites der Kandidierenden in eigenen Posts veredeln. So wurde beispielsweise am 5. November 2024, dem Tag, als Donald Trump zum zweiten Mal ins Präsidentenamt gewählt wurde, der »Trump Dance« zum TikTok-Trend: Junge Menschen posteten Videos, in denen sie sich betont ungelenk und roboterhaft zur Musik bewegten. Die abrupten Armbewegungen zu Y. M. C. A., mit denen Trump bereits 2020 nach überstandener Covid-Infektion seine Vitalität bei Wahlkampfauftritten beweisen wollte, anfangs aber steif und unrhythmisch rübergekommen war, hatte er 2024 als signature move des sympathischen Onkels kultiviert. An solchen Beispielen wird erkenntlich, dass Trump ein perfektes crossmediales Produkt ist. Egal ob Staatsbesuch, CNN-Interview oder MAGA-Rally, alles wird zerlegt, zerhackt und augen- und ohrengerecht für die spezifischen Bedürfnisse der Zielgruppen weiterverbreitet. Trump ist ein menschgewordenes Meme. Wenn man so will, ist er der Politiker mit der höchsten und modernsten Medienintelligenz – und Manipulationsfähigkeit.
Das emotionale Kapital, das Trump dadurch angehäuft hat, drückt sich in einer hohen affektiven Bindung und im Vertrauen seiner Anhängerschaft aus: 2024 war der verurteilte Straftäter, nicht seine Konkurrentin Kamala Harris, der Hope-Kandidat: Zwei Drittel der Trump-Unterstützenden gaben in einer Umfrage des Pew Research Center an, dass sie »extrem« oder »sehr« hoffnungsvoll über ihren Kandidaten fühlten. Bei Harris traf das gerade mal auf die Hälfte ihrer Anhängerschaft zu. In der Gesamtwählerschaft lag Trumps Hoffnungswert auch deutlich vor dem von Harris.[7] Dabei sprach die demokratische Kandidatin in ihren Reden immerzu von Hoffnung. Trump dagegen baute seine Hoffnungserzählung auf einer simplen, aber sehr effektiven (weil kulturell erlernten) Struktur auf, die aus drei Akten bestand: Die Demokraten hätten die Inflation in die Höhe getrieben, und illegale Migranten machten das Land unsicher. Er werde die Grenzen sichern und den wirtschaftlichen Motor anwerfen. Daraus werde ein »neues goldenes Zeitalter« für die Vereinigten Staaten entstehen. »She broke it, I’ll fix it« und MAGA sind die Verdichtungen dieser Erzählung zu einprägsamen Sprüchen. Und das positive Versprechen wurde Trump abgenommen: 86 Prozent seiner Wählerinnen und Wähler trauten ihm zu, die Dinge zum Positiven zu verändern. Über Harris dachten dies nur 58 Prozent ihrer Anhängerinnen und Anhänger, während 40 Prozent weder eine Veränderung zum Besseren noch zum Schlechteren erwarteten, also einfach business as usual. Bei Trump wurden zudem mehr Prinzipientreue und Klarheit hinsichtlich seiner politischen Pläne für Wirtschaft, Migration und Außenpolitik erkannt.[8] Erfahrene Strateginnen der Demokraten wie Randi Weingarten, die Vorsitzende der US-Lehrergewerkschaft AFT, sprachen davon, dass die Wahl eine »trust, not truth election« sei – es gehe um Vertrauen, nicht die Wahrheit. Wobei, und darum wird es später ausführlicher gehen, Trump so vehement die Wahrheit für seine Lügen reklamiert – täglich sendet er unzählige von seiner Plattform Truth Social –, dass dieser Alleinanspruch auf Richtigkeit eine eigene emotionalisierende Kraft entfaltet.
Auch in Europa bauen rechtsaußen verortete Kräfte ihre Wahlerfolge auf einer positiven emotionalen Bindung auf. Beispiel: Giorgia Meloni. Die amtierende italienische Ministerpräsidentin inszeniert Intimität, indem sie die Menschen über Social Media mit zu sich nach Hause aufs Sofa holt – Privatfotos, deren feine Kuratierung sie als Mutter, traditionellen Familienmensch, beste Freundin, gläubige Christin und durchschnittliche Italienerin darstellt.[9] Persönliche Merkmale, mit denen sich einerseits viele Landsleute identifizieren und die andererseits in ihrer nationalistischen Ideologie eine Metapher für Einheit und Autorität sind. Die großherzige, immer auch etwas mahnende Mutter, als die Meloni sich inszeniert, ist das weibliche Pendant zur strengen Vaterfigur Trump, der für die eigenen Kinder aber stets auch einen Joke auf der Zunge hat.[10] Beide erfüllen damit sehr traditionelle familiäre Rollenbilder.
In Österreich gehören zum Standardvokabular der FPÖ schon seit Jahrzehnten Begriffe wie »Nächstenliebe« und »Heimatliebe«, die man als Semantik der Selbstverharmlosung von klassischen rechtsextremen Parteien kennt. Heute arbeitet Herbert Kickl, der Spitzenmann der Partei, in seinen Reden noch disziplinierter als Trump mit einem dramaturgischen Bogen, der auf der Hoffnung endet. Beim Wahlkampfabschluss seiner Partei auf dem Wiener Stephansplatz am 27. September 2024 für die zwei Tage später stattfindende Nationalratswahl warnte Kickl minutenlang vor gefährlichen Migranten und dem bösen System, um dann die überraschende Wende einzuleiten: »Nichts von dem, was ich gesagt habe, ist Angstmache. Ganz im Gegenteil: Es gibt uns Zuversicht, Hoffnung und Optimismus.« Er sprach von einer »Freiheitsbewegung«, brachte das abstruse Framing der »Festung der Freiheit« (so hieß 2024 auch das FPÖ-Wahlprogramm), die er per Grenzschließung errichten wolle. »Jahre der Sicherheit, des Wohlstands, der Gerechtigkeit und der Heimatliebe und eine Zeit, in der vor allem die Jungen gute Chancen« hätten, stünden den »freiheitsliebenden« Menschen in dieser Festung bevor.
Feel-Good-Rechtsextremismus
Die AfD verhält sich seit ihrer Gründung wie die kleine Schwester der FPÖ, lernt medien- und kommunikationsstrategisch von ihr und hat sich nach ihrem Vorbild in kürzester Zeit zu einer »digitalen Propagandapartei« entwickelt.[11] Ein wichtiger Bestandteil ihrer digitalen Emotionsarbeit ist die Schaffung einer kollektiven Identität zwischen Partei und Anhängerschaft. In meiner Doktorarbeit Das »Wir« der AfD konnte ich zeigen, dass die Bundespartei in drei von vier Facebook-Beiträgen gezielt ein Gemeinschaftsgefühl konstruiert, wobei dieses »Wir« hauptsächlich mit Emotionen, weniger mit politischen oder normativen Ideen ausgestattet ist. Das positiv-emotionale Selbstbild ist von moralischer und intellektueller Überlegenheit geprägt (im Sinne von »wir durchblicken, wie es läuft, tun das moralisch Richtige für unser Land, und die anderen Wähler werden das auch noch verstehen«) und versteigt sich in einen heroischen Rettergestus. Die negativen Affekte formen und fördern Empörung und Unzufriedenheit. Erzählerisch wird damit eine Brücke zwischen krisenhaftem Status quo und hoffnungsvoller Zukunft gebaut. Eine Stimme für die AfD wird zu einem Investment in die Zukunft. Björn Höcke gab schon 2015 in einem seiner frühen strategischen Vorträge das Ziel aus, »die Menschen zu emotionalisieren«, er wolle »Angstbürger zu Mutbürgern« machen.[12]
2024 hoben Höcke und sein Landesverband im Thüringer Landtagswahlkampf die positive Emotionalisierung ihrer rechtsextremen Ideologie auf eine neue Stufe. Selbstverharmlosung, next level. Diese ist zwar schon seit Jahren ein strategischer Ansatz der AfD, der Kleinverleger Götz Kubitschek, der als einer der Vordenker der »Neuen Rechten« gilt, beschrieb sie 2017 als ein Vorhaben, das die »emotionale Barriere« zwischen »dem Normalbürger und seiner Hinwendung zur politischen und vorpolitischen Alternative« einreißen solle.[13] Sie wurde in Wahlkämpfen mit Slogans wie »Deutschland, aber normal« oder Plakaten mit blonden Frauen oder Babybäuchen jedoch nur partiell eingesetzt, daneben nahmen düstere Botschaften einen größeren Raum ein. Die konsequente Anwendung einer positiven Tonalität und hell-warmen Ästhetik in der Thüringen-Kampagne, mit der die menschenentwürdigende Ideologie der AfD überstrahlt werden sollte, war somit neu. Der Claim »Der Osten machts« aktivierte und sollte wohl eine gemeinsame Gewinneridentität schaffen. Höcke inszenierte sich unter anderem auf einer Simson, dem sogenannten DDR-Moped, das heute Teil ostdeutscher Jugendkultur ist (der begleitende Plakatspruch: »Ja! Zur Jugend!«). Besonders perfide war ein Plakatmotiv mit einem Urlaubsflieger in strahlend blauem Himmel, unter dem die Worte »Sommer, Sonne, Remigration« standen. Es fehlte nur noch der Zusatz: »Abschiebespaß für die ganze Familie« Die moderne und positive Bildsprache war jedoch nur ein Element des Wohlfühlwahlkampfs. Hinzu kam die Eventisierung. Die AfD Thüringen nannte ihre Veranstaltungen »Familien-« oder »Sommerfeste«. Der Wahlkampfauftakt in Arnstadt wurde als Samstagabend-Party mit Grillbüfett und Popmusik organisiert, und Höcke sprach im Stile eines Keynote-Speakers mit Headset-Mikro im Spotlight. Auch wenn bei einigen dieser »Familienfeste« Männer und Reichsflaggen überproportional vertreten waren: Die AfD erfand in diesem Wahlkampf einen Feel-Good-Rechtsextremismus, der ihre demokratiefeindliche Ideologie euphorisiert, ästhetisiert und eventisiert hat. Mit 32,8 Prozent landete sie bei einer Landtagswahl erstmalig auf Platz eins. Im Bundestagswahlkampf 2025 setzte die Partei die Volksfest-Strategie fort, paarte dabei Niedergang mit Hochgefühl. Es sind Partys in der imaginierten Apokalypse, bei denen gesungen und getanzt, Popcorn und Bier serviert wird. Zwischendurch schaltet sich Elon Musk zu und ruft dazu auf, Deutschlands »vergangene Schuld« zu überwinden. Alice Weidel erwidert die Begeisterung der Gäste mit Sätzen wie: »Ich liebe euch!« Am Wahlabend schoss der Balken der AfD auf über 20 Prozent in die Höhe, man feierte sich als »Volkspartei«.
Der Politikstil der FPÖ unter Jörg Haider wurde einst als »Feschismus« bezeichnet, eine Mischung aus »fesch« und »Faschismus«.[14] Ähnlich wie beim Feel-Good-Extremismus geht es darum, alle Sinne anzusprechen. Die damalige AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative (JA) setzte ab Sommer 2024 verstärkt auf ein Mittel, das man als Ohrwurmpolitik bezeichnen könnte. Dabei versuchen sich Rechtsextreme Popmusik anzueignen, indem sie auf bekannte Melodien einen umgedichteten, möglichst mitgröhlgeeigneten Text legen. Im Gegensatz zum früheren lärmenden Rechtsrock werden Songs gekapert, die man aus dem Club, dem Radio oder von Spotify kennt. L’amour toujours von Gigi D’Agostino ist so ein Fall. Jugendcliquen hatten dazu schon seit Längerem auf Dorffesten die Zeile »Deutschland den Deutschen, Ausländer raus« gebrüllt, als im Mai 2024 ein Video von der Terrasse der Pony Bar in Kampen auf Sylt die Runde machte: Junge Menschen, mitunter so gekleidet, als kämen sie direkt von einem der vier Inselgolfplätze, grölten die Hasshymne. Das Video wurde von so vielen journalistischen Medien mindestens ausschnittsweise gezeigt, dass sich in vielen Köpfen im Land die eingängige viertaktige Melodie von L’amour toujours mit der fremdenfeindliche Parole verband. Die JA nutzte den Moment und produzierte allerlei Merchandise- und Social-Media-Material, bei dem nur noch die die Melodie aktivierenden Worte »Döpdödödöp« vorkommen mussten. Noch offensichtlicher wurde die Ohrwurmstrategie, als die JA Brandenburg selbst ein Lied produzierte, das den Partyschlager Jetzt geht’s ab, wir feiern die ganze Nacht von der Band Die Atzen zu »Jetzt geht’s ab, wir schieben sie alle ab« umtextete. Dazu wurde mit einer Künstlichen Intelligenz ein Video produziert, in dem ein »arisch« wirkender Pilot arabisch aussehende Menschen ausfliegt und die blonden Stewardessen auf dem Rollfeld tanzen: »Wir haben den Aperol mitgebracht. Der Spritzkrieg findet kein Ende.« Nachdem bei der Wahlparty der AfD Brandenburg mitgefilmt worden war, wie JA-Mitglieder den Song zum Besten gaben, fungierten auch für dieses Lied die Massenmedien als Verstärker. Selbst der Deutschlandfunk spielte das Lied am Morgen nach der Wahl in seiner Berichterstattung kurz ein. »Wir schieben sie alle ab, schalalalaaa« – der nächste fröhlich-hassende Ohrwurm war im Umlauf. Die Macher des Videos, eine Agentur ehemaliger Führungspersonen der Identitären Bewegung (IB), wurden wenige Monate später mit der Beauftragung des Digitalwahlkampfs der AfD zur Bundestagswahl 2025 belohnt.[15] Martin Sellner, Kopf der IB, beschrieb das Ziel dieser popkulturellen Strategie auf einer Konferenz der rechtsradikalen US-Zeitschrift American Renaissance im November 2024 so: »Wir müssen den Remigrationsansatz bekannt, moralisch, positiv und hoffnungsvoll machen.«[16]
Warme Ränder, kühle Mitte
Bei der Entstehung rechtsautoritärer und radikalpopulistischer Bewegungen ist das Feindbild am Anfang stärker als das Selbstbild. Die Exklusionskonstellationen von »unten gegen oben« (Volk gegen Elite), »innen gegen außen« (Einheimische gegen Fremde) und mehr und mehr auch »gestern gegen morgen« (fossile gegen klimaneutrale Welt) sowie die Abwertung der jeweils gegenüberstehenden Gruppen und Akteure sind als Mechanismus der populistischen Weltsortierung mittlerweile vielerorts beschrieben worden. Für die langfristige Bindung der Anhängerschaft ist die positive Gruppenzugehörigkeit jedoch ausschlaggebender. Im bundesrepublikanischen Parteiensystem wendet nicht nur die AfD diese emotionspolitische Strategie an, sondern mit einigen Unterschieden auch das Bündnis Sahra Wagenknecht, das einen »Querpopulismus« mit Elementen von linkem und rechtem Populismus vertritt. Auch in der Linkspartei sind Spuren von linkem Populismus enthalten. Die Reaktion der gemäßigten demokratischen Kräfte auf die Emotionsdominanz der populistischen Ränder kann man anhand dreier idealtypischer Muster skizzieren.
Die erste Gegenstrategie ist die stoische Sachlichkeit. Dabei wird dem Emotionalismus betonter Rationalismus entgegengesetzt. Es ist die weitverbreitetste »Antwort« auf Populismus, die aus meiner Sicht allerdings auf zwei Fehlannahmen beruht: Erstes wird der Populismus verkürzt über die kurzfristigen und intensiven Affekte wie Wut und Empörung beschrieben, die Identifikationsflächen, die positiven Emotionalisierungen und die lebensweltliche Anschlussfähigkeit bleiben unbeachtet. Zweitens, und das ist meine Erfahrung aus über zehn Jahren Beratungstätigkeit, sind viele Politikerinnen und Politiker der Meinung, dass die »richtige« Politik keiner Emotionalisierung bedürfe, weil sie allein kraft ihrer Sinnhaftigkeit die Menschen überzeuge. Doch es reicht nicht, die Fakten auf der eigenen Seite zu haben, wenn andere die emotionale Realität bestimmen. Fakten müssen mit Gefühlen und Geschichten verbunden werden. Die Annahme, sachliche und seriöse Antworten allein würden die Menschen überzeugen, ist womöglich der folgenreichste Irrtum der Aufklärung. Er wird in diesem Buch noch eine größere Rolle spielen. Als ein Archetyp dieses Sachlichkeitsdogmas präsentierte sich Olaf Scholz während seiner Kanzlerschaft. In einer Regierungserklärung nach der Europawahl 2024, bei der die AfD ihr bis dato stärkstes Ergebnis eingefahren hatte, warnte er im Bundestag vor einem »Wettbewerb mit den Populisten und Extremisten«. Seine Empfehlung: »Es geht eben immer um Antworten in der Sache; ja, es geht um Antworten in der Sache.«[17]
Die zweite Gegenstrategie ist das selektive Kopieren. Der Ansatz: Politikerinnen und Politiker aus der demokratischen Mitte reproduzieren Emotionalisierungsformen der radikalen Konkurrenz und erhoffen sich dadurch, ihr auf magische Weise »das Wasser abzugraben«. Beispiele gibt von fast allen Parteien: Als CDU-Chef Friedrich Merz in seiner damaligen Rolle als Oppositionsführer ohne Faktengrundlage, aber mit umso mehr Emotionalisierungspotenzial ukrainischen Flüchtlingen »Sozialtourismus« unterstellte und an einem anderen Tag behauptete, dass Asylbewerber den Deutschen die Zahnarzttermine wegnehmen würden, waren das offensichtliche Kopien rechtspopulistischer Ressentiments. Auch die kompromisslose und sofortistische »Strongman«-Pose, mit der Merz im Januar 2025 nach den schrecklichen Morden eines Afghanen in Aschaffenburg, einen symbolischen (weil nicht gesetzkräftigen) 5-Punkte-Plan dem Bundestag vorlegte, hatte etwas von populistischer Affektpolitik. Verbessert hat der angenommene Antrag an der Sicherheit nichts, mutmaßlich aber am Wahlergebnis der AfD, deren Stimmen drei Wochen vor der Bundestagswahl erstmalig im höchsten deutschen Parlament entscheidend für die Mehrheitsbildung eines Antrags waren. Doch auch Grüne übernehmen populistische Stilmittel wie jenes der Feindbildkonstruktion, wenn sie ihrerseits Friedrich Merz mit Donald Trump gleichsetzen, zwischen deren politischen Überzeugungen Welten liegen. Und manche Attacke von Olaf Scholz auf Merz und dessen Position zu Waffenlieferungen an die Ukraine (»Russisch Roulette mit Deutschlands Sicherheit«) wirkte in diesem Wahlkampf wie der Versuch, Angst vor einem Atomkrieg zu schüren – eine Emotion mit langer Tradition in der Bundesrepublik.[18] Erneut zeigt der Wahlkampf, dass die demokratischen Kräfte, wenn überhaupt, eher mit negativen Gefühlen emotionalisieren und dabei häufig die Integrität ihrer Kontrahenten angreifen. Das hat es natürlich irgendwie schon immer gegeben, der entscheidende Unterschied zu den derben Äußerungen etwa eines Franz Josef Strauß oder Joschka Fischers ist jedoch, dass sie in Abwesenheit von ernst zu nehmenden Akteuren stattfanden, die mit dieser Stilistik die Institutionen der Demokratie angriffen. Ein weiteres Beispiel für das rhetorische race to the bottom: 2020 sprach die SPD-Vorsitzende Saskia Esken nach einer Corona-Demonstration in Berlin pauschalisierend von »Tausenden Covidioten« und beschimpfte damit jenseits von Extremisten auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, mit denen man nicht einer Meinung sein muss, aber deren Demonstrationsrecht unbedingt verteidigt gehört.[19] Die Folge solcher Populismusplagiate ist, dass sie normalisiert werden, da die Kräfte der Mitte stets der Maßstab für das Normal der politischen Auseinandersetzung sind.
Der dritte Ansatz ist die betonte Positivität. Gemeint ist damit der Glaube, dass man den schwarzmalenden Emotionalisierungen einfach nur eine ordentliche Portion positiver Gefühle entgegensetzen müsse, um den Siegeszug destruktiver Kräfte zu stoppen. Mit diesem Ansatz läuft man aber Gefahr, insbesondere in Krisenzeiten an den Emotionen der Menschen vorbeizureden. Wer Hoffnung geben will, muss bei den Sorgen ansetzen. In Deutschland waren im Sommer 2024 viele Kommentatoren und Politikerinnen vom Kampagnenstart Kamala Harris’ (»hope, joy, and action«) begeistert. Ihr running mate, Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz, rief ihr damals zu: »Danke für das Zurückbringen der Freude!« Letztlich zeigt die verlorene Wahl der US-Demokraten sehr eindrücklich den bedeutenden Unterschied zwischen der Mobilisierung der eigenen Basis und der Überzeugung von Unentschlossenen. Erstere können sich von positiver Energie motivieren lassen, um am Ende tatsächlich zur Wahl zu gehen oder sich im Wahlkampf zu engagieren. Die Unentschlossenen beeindruckt das aber nicht hinreichend. Für sie müssen die guten Gefühle mit einem glaubwürdigen positiven Versprechen für die relevanten Themen hinterlegt sein. Das hat Harris nicht geliefert, insbesondere ihre wirtschaftspolitischen Pläne blieben unkonkret und unüberzeugend. Eine Wählerin nannte ihre Formulierung von der »Opportunity Economy« einen »Think-Tank-Begriff, der normale Leute nicht anspreche, denn was heißt das denn bitte?«.[20] Wohl wahr. Positive Phrasen ohne politische Substanz hört mal freilich allerorten. Bei den Grünen kam nach der Verlustangst machenden Heizungsdebatte kurzzeitig die Idee auf, man müsse nun vermitteln, dass Klimaschutz »Spaß« mache. Wer soll das bitte glauben? Ähnlich verhält es sich mit halbgaren politischen Entscheidungen, die dann »Gutes-Irgendwas«-Gesetz genannt werden.
Von den drei beschriebenen Ansätzen erlebt man in der politischen Praxis von allen ein bisschen, dominant ist aber die stoische Sachlichkeit, die nicht selten als ein Pathos der Pathoslosigkeit selbst emotionalisiert wird. Die bittere Erkenntnis lautet, dass die demokratische Mitte noch immer ziemlich hilflos gegenüber dem Populismus ist. Und zwar in einer ganzen Reihen von westlichen Demokratien. Ein einstiger Hoffnungsträger wie der französische Staatspräsident Emmanuel Macron, der einst mit den Themen Europa und freiheitliche Grundwerte emotionalisierte, hält sich nur noch mit instabilen Abwehrkoalitionen über Wasser und büßte stark an Zustimmung ein. Um es klar zu sagen: Es geht dabei nicht in erster Linie um Kommunikation. Es geht darum, Lösungen auf der Höhe der Probleme zu entwickeln und die Menschen zum Teil dieser Lösungen zu machen. Um Vertrauen in demokratische Lösungen herzustellen, ob konservative oder progressive, bedarf es allerdings der emotionalen Involvierung der Menschen.
Politische Emotionen
Zoomen wir an dieser Stelle aus der Gegenwart heraus und werden etwas grundsätzlicher: Politik ist die öffentliche Angelegenheit, so lautet eine der simpelsten Definitionen. Deshalb müsse sie, davon sind viele überzeugt, auch eine rationale Angelegenheit sein, die Emotionen so weit wie möglich außen vor lasse. Emotionen gehörten ins Private. Ich argumentiere andersherum: Weil Politik eine öffentliche Angelegenheit ist, ist sie auch eine emotionale Angelegenheit. Denn was die Öffentlichkeit betrifft, betrifft uns alle bis ins Private, und was unser aller Leben betrifft, hat Auswirkungen auf die Dinge, die uns lieb und wichtig sind oder nerven und stören. Der griechische Begriff politikos bringt es mit seiner Bedeutung »den Bürger betreffend« vielleicht am besten auf den Punkt.[21] Was die Bürgerinnen und Bürger betrifft, ist für sie auch emotional, weil Emotionen weitaus mehr sind als kurzzeitige Erregungen.
Mit der Frage »Was ist eine Emotion?« hat der US-amerikanische Psychologe und Philosoph James Williams bereits im Jahr 1884 einen Aufsatz überschrieben.[22] Bis heute ist die Antwort auf diese Frage umstritten und womöglich gar nicht abschließend zu klären. In der Psychologie und den Neurowissenschaften konkurrieren mehreren Theorien, nicht gleichwertig und nicht mit gleich starker Unterstützung, aber keine so unangefochten wie etwa die Relativitätstheorie aus dem Bereich der Physik. Nimmt man die entsprechende Fachliteratur zur Hand, findet man beispielsweise klassische Theorien, die von separaten Basis-Emotionen ausgehen (z. B. Freude, Furcht, Ekel), die sich durch Gesichtsausdrücke oder andere körperliche Reaktionen eindeutig am Menschen identifizieren ließen. Wut erkenne man demnach an zusammengezogenen Augenbrauen und aufeinandergepressten Lippen, Überraschung an hochgezogenen Augenbrauen und einem offenen Mund. Andere Theorien konzentrieren sich stärker auf das Zusammenspiel des Nervensystems in Körper und Gehirn, also die Verbindung von Denken und Fühlen, und postulieren etwa, dass unsere kognitive Bewertung einer Situation die Emotionen beeinflusst, die wir dann wiederum spüren können. Das heißt, wir fühlen denkend (und denken auch fühlend), oftmals vollkommen unbewusst.
Ein mittlerweile sehr prominenter Ansatz, der sich von den klassischen Ansätzen abgrenzt, versteht Emotionen als soziale Konstrukte. Maßgeblich entwickelt hat ihn die Psychologin Lisa Feldman Barrett. Eine Emotion definiert sie als »Kreation des Gehirns«, die den »körperlichen Empfindungen in Bezug auf das Geschehen um uns herum Bedeutung zuweist«.[23] Wenn wir Emotionen mental erschaffen, dann fließen dabei die Wahrnehmung äußerer Einflüsse, unsere inneren körperlichen Vorgänge, unsere persönlichen Erfahrungen sowie Konzepte unseres Kulturkreises mit ein. Barrett widerspricht der Annahme, dass man eine Emotion eindeutig von anderen mit einer wissenschaftlichen Messung von Gesichtsausdrücken, Hautreaktionen oder Gehirnaktivität unterscheiden könnte. Auch wenn ihr Emotionsbegriff etwas weniger griffig ist, erscheint er doch plausibel: Emotionen sind demnach breite, sich überlappende Kategorien, für die wir Menschen uns auf Begriffe geeinigt haben, etwa »Wut« oder »Freude«. Wenn zwei Menschen in einer spezifischen Situation sagen, dass sie »Freude« über etwas empfinden, kann das physiologisch und kognitiv ganz unterschiedlich ausfallen. Derartige Grundlagen sind wichtig, weil sie instruktiv für die Untersuchung von Emotionen in politischen Kontexten sind. Mit Barretts konstruktivistischem Ansatz lassen sich Emotionen von Menschen beispielsweise durch Befragungen untersuchen, nicht allein durch Hirnscans oder die Messung der Herzschlagrate. Diese Untersuchungsmethode ist auch für das vorliegende Buch zum Einsatz gekommen.
Dass Emotionen in der Demokratie eine bedeutsame Rolle spielen, ist nicht erst seit dem Aufstieg des Populismus evident, sondern war schon in den ersten hitzigen Debatten der Bonner Republik über die Remilitarisierung Deutschlands oder rund drei Jahrzehnte später über den NATO-Doppelbeschluss unübersehbar. »Die Politikwissenschaft aber fremdelt nach wie vor in Analyse, Zugang, Theoretisierung und Interpretation von Emotionen«, stellt der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte fest.[24] Vereinzelte Ansätze gibt es gewiss, einige davon werden in diesem Buch besprochen, aber eine Forschungstradition zu politischen Emotionen gibt es anders als im angelsächsischen Raum nicht. Deshalb habe ich mich für dieses Buch von der entsprechenden Forschung in den USA und Großbritannien inspirieren lassen. Mit der Theorie der Affektiven Intelligenz schlägt George E. Marcus mit seinen Kollegen eine Brücke aus der Politikwissenschaft zu der neurowissenschaftlichen Emotionstheorie von Barrett.[25] Mithilfe dieses Ansatzes wurde herausgefunden, dass Emotionen die Art und Weise beeinflussen, wie Menschen politische Informationen verarbeiten, Einstellungen formen und Entscheidungen treffen, beispielsweise hinsichtlich ihres Wahlverhaltens oder sonstigen politischen Engagements. Die entsprechenden empirischen Untersuchungen haben ergeben, dass Angst, Wut und Hoffnung die entscheidenden Kategorien sind, um die Rolle von Emotionen in der politischen Urteilsfindung zu ergründen. Mit diesen drei Kategorien werde auch ich mich verstärkt auseinandersetzen.
Ein Buch mit einer (kleinen) Mission
Erfreulicherweise hat in jüngster Zeit die Anzahl populärer Sachbücher zugenommen, die mit jeweils spezifischem Blick die Funktionen von Emotionen für demokratische Gemeinwesen beleuchten. Die Philosophin Martha Nussbaum hält es für die oberste Aufgabe demokratischer Kräfte, Liebe und Mitgefühl bei den Bürgerinnen und Bürgern zu fördern, um einer gerechten Gesellschaft näher zu kommen. Die Soziologin Eva Illouz widmete sich zuletzt dem gebrochenen Aufstiegsversprechen heutiger kapitalistischer Gesellschaften, das ihrer Meinung nach die Grundlage von populistischer Wut sei. Die Historikerin Ute Frevert ergründete deutsche »Verfassungsgefühle«, und die Neurowissenschaftlerin Maren Urner forderte als Voraussetzung für eine bessere Politik einen »reiferen« Umgang mit Emotionen. Wie fügt sich dieses Buch in diese Debatte ein?