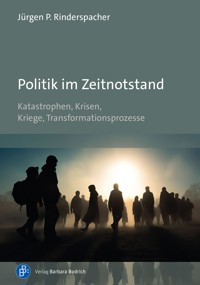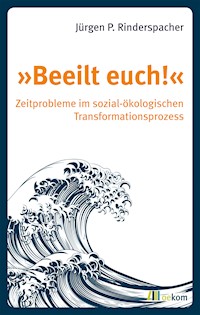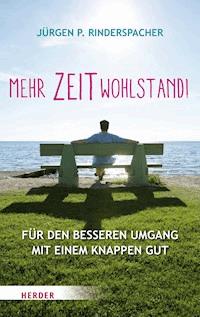
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Zeit spielt eine zentrale Rolle in allen Lebensbereichen – sei es bei der Arbeit, in Beziehungen oder im Alltag. In 35 prägnanten Stichworten schreibt Jürgen P. Rinderspacher über Sinn und Unsinn im Umgang mit der Zeit und das Gefühl, nie genug von ihr zu haben. Sein Plädoyer: Entscheidend ist, wie wir unsere Zeit nutzen. Geliefert werden unerwartete Einblicke, historische Hintergründe und praktisches Wissen über den "Zeit-Faktor" und seine Bedeutung für unser Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Dieses Buch und das ihm zugrunde liegende Forschungsprojekt wurden gefördert von der Hans-Böckler-Stiftung
Titel der Originalausgabe: Mehr Zeitwohlstand
Für den besseren Umgang mit einem knappen Gut
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2017
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Kathrin Keienburg-Rees
Umschlagmotiv: (c) Cameron Strathdee – iStock
E-Book-Konvertierung: Arnold & Domnick, Leipzig
ISBN (E-Book): 978-3-451-81070-1
ISBN (Buch): 978-3-451-06833-1
Inhalt
Vorwort
Arbeitszeit
Darf’s ein bisschen weniger sein?
Bildung
Gute Investition für bessere Zeiten
Ehrenamt
Sich Zeit für andere nehmen
Einkommen
Mehr oder weniger gut auskommen
Essen und Trinken
… hält die Menschen zusammen
Familie
Zeit gestalten im privaten Bermuda-Dreieck
Feierabend
(K)Eine Selbstverständlichkeit
Feste und Feiern
Was ganz Besonderes
Ich
Wer sonst?
Internet
Unterwegs im Netz der Zeit
Kinderzeiten
Von den Kleinen lernen
Konsum
Mehr haben oder mehr sein?
Leistung und Erfolg
The winner is…?
Mobilität
Der schnellste Weg ist nicht immer der beste
Muße
Kann man Nichts tun und dabei Zeit gewinnen?
Rente
In Ruhe älter werden
Rhythmus
Die Basis des Lebens
Sinn
Wofür die Zeit gut sein kann
Sorgen und Pflegen
Sich kümmern zur rechten Zeit
Spiel(en)
Wo die Zeit wieder geblieben ist
Stress
Was noch erledigt werden müsste…
Umwelt
Zeit gespart – Natur zerstört
Wochenende
„Schönes Wochenende“ oder „Wochen ohne Ende“?
Zeitdiebe
Immer schön aufpassen!
Zeitsouveränität
Mehr Freiheit durch mehr Flexibilität?
Zweierbeziehung
Zeit für jemanden, den man liebt
Literatur
Vorwort
Wieder ein Zeitbuch? Ja, aber ein etwas anderes. Die Zeit ist, wie man weiß, eine Sache, die jeden von uns irgendwie jeden Tag betrifft. Zwischen den vielen wissenschaftlichen Abhandlungen zu diesem Thema und den Zeitmanagement-Ratgebern, die in den letzten Jahren erschienen sind, schließt dieses Buch eine Lücke. Wer eine Step-by-Step-Anleitung mit To-Do-Listen sucht, was wann erledigt werden muss, um aus der Zeit das Maximum herauszuholen, wird höchstwahrscheinlich enttäuscht werden. Vielmehr soll die Leserin/der Leser dazu angeregt werden, sich ihr/sein eigenes Bild vom Sinn und Unsinn ihrer/seiner Zeitverwendung und dem Umgang mit der Zeit in der Gesellschaft zu machen.
Fest steht: Die Welt ist voller Zeitkonflikte. Einige machen uns den Alltag schwer, ohne dass wir etwas ändern könnten, andere haben wir uns selbst eingebrockt. Wie können wir also zu mehr Zeitwohlstand kommen? Denn mit der Modernisierung und Industrialisierung der westlichen Länder im Verlauf der letzten 200 Jahre hat sich unser Wohlstand an Gütern bekanntlich enorm vermehrt. Dagegen scheint das, was wir an zeitlichen Ressourcen zur Verfügung haben, immer weiter ins Hintertreffen zu geraten.
Den Menschen zu der Zeit zu verhelfen, die sie zu einem guten Leben brauchen – nicht nur was ihren Umfang, sondern auch was ihre Qualität betrifft –, ist im 21. Jahrhundert also ein hoher Anspruch. Denn eigentlich sind die Chancen, in Zeitwohlstand zu leben, nach einer langen Phase der Verkürzung der Wochenarbeitszeiten und zusätzlichen Urlaubstagen ja langfristig enorm gewachsen. Inzwischen erleben wir jedoch oft das Gegenteil: Arbeitstage werden wieder länger, auch weil wir auf dem Smartphone ständig erreichbar sein sollen, Feiertage werden abgeschafft und Urlaubsansprüche gekürzt. Immer bereit zu sein – dadurch wächst der zeitliche Stress in Beruf, Familie, Freizeit und Partnerschaft vielen über den Kopf. „Flexibilisierung“ hieß einmal das Zauberwort, von dem man sich eine Lösung moderner Zeitkonflikte versprach. Heute wissen wir nicht nur um die Chancen, sondern auch um die vielen Kehrseiten dieser Idee.
Bessere Zeiten setzen aber nicht einfach nur voraus, genügend freie Zeit zu haben. Denn Zeitfragen sind Sinnfragen: Zum Beispiel welche Qualität die Zeit hat, die wir mit Erwerbsarbeit verbringen, oder womit wir unsere Zeit füllen, wenn wir online gehen. Wer die Hoffnung auf bessere Zeiten nicht aufgeben will, muss eben manchmal gegen den Strom schwimmen. Öfter mal Pause machen und seinen eigenen Rhythmus finden, Zeit zur rechten Zeit haben oder sich Zeit für Kinder, Partnerschaft, Essen und Trinken, Kunst und Kultur, Spiel und Sport nehmen – auch dann, wenn andere etwas dagegen oder vermeintlich Besseres vorhaben.
Dass, wie auch der Titel erwähnt, von dem in den letzten Jahren viel diskutierten Konzept „Zeitwohlstand“ ausgegangen wird, ist auch politisches Programm. Zeitwohlstand steht für die Vision einer Gesellschaft mit besseren Zeiten, die es dem Individuum möglichst oft erlauben soll, seine einmalige Lebenszeit mit den Dingen und zugleich mit den Menschen verbringen zu können, die ihm wichtig sind. Das ist aber nur möglich, wenn die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen so gestrickt sind, dass sie die Menschen unterstützen, die ein alternatives Wohlstandsmodell leben wollen, in dem die Verfügung über Zeit wichtiger ist als die über Güter. Für die politische Praxis bedeutet das einerseits, mit neuen Zeitmustern zu experimentieren, andererseits aber auch bewährte Zeitinstitutionen wie das freie Wochenende gegen Zugriffe aus der Wirtschaft zu verteidigen. Der Autor will – was sicher nicht überrascht – nicht seine Auffassung verhehlen, dass es zur Verbesserung „der zeitlichen Lage der Nation“ viel zu tun gibt, und dass wir sofort damit beginnen können. Wo und wie das geschehen kann, dazu finden sich immer wieder Anregungen in den Texten.
Die Zeitstrukturen, in denen wir leben, sind nicht vom Himmel gefallen. Deshalb macht es Sinn, hin und wieder in der Geschichte zurückzugehen und zu fragen, woher es eigentlich kommt, dass wir uns täglich zwischen relativ starren Arbeitszeiten, Schulzeiten oder Öffnungszeiten bewegen. Seit wann gibt es eigentlich die Idee eines freien Wochenendes oder des geregelten Jahresurlaubs? Welchen Kulturen und Epochen entstammt unser Verständnis von Familie und dem Verhältnis der Geschlechter? Oder unsere Vorstellung von einem guten Leben, unser Maßstab von Leistung und Erfolg? Und was hat das eigentlich alles mit Zeit zu tun?
Dieser Band stellt, anders als gängige Sachbücher, das Thema Zeit nicht als durchlaufende, lineare Argumentationskette dar, sondern nähert sich ihm aus vielen Facetten an. Das sind die Lebensbereiche und Situationen, in denen die Zeit den Menschen als Widersacher oder Freund begegnet: Etwa wenn sie im Alltag Entscheidungen treffen, ihre Zukunft planen oder über den Sinn des Lebens nachdenken. Dabei stellt sich oft heraus, dass Stichworte, die auf den ersten Blick nichts mit Zeit zu tun haben, voller unvermuteter Zeitbezüge sind. Je nach eigener Interessenlage kann man an der Stelle einsteigen, die einen spontan am meisten anspricht. Natürlich ist es genauso möglich, der alphabetischen Reihenfolge nachzugehen, oder man kann sich einfach nach Gusto von den Verweis-Pfeilen im Text durch die Gesamtthematik „hindurchziehen“ lassen.
In diesem Buch zu lesen – darauf soll hier noch einmal ausdrücklich hingewiesen sein – beansprucht ein mehr oder weniger großes Stück der eigenen Lebenszeit. Aber vielleicht ist die Vergewisserung über Sinn und Unsinn unserer alltäglichen Zeitverwendung eine gute Investition. Also nehmen Sie sich Zeit!
Arbeitszeit
Darf’s ein bisschen weniger sein?
Für die Mehrheit der arbeitenden Menschen verläuft der Alltag wie zwischen zwei Buchdeckeln: vom Morgen zum Abend. Die Gegenüberstellung zweier Bereiche – hier das Erwerbsleben, das tendenziell vermieden oder doch zeitlich reduziert werden soll, dort das „eigentliche“ Leben, Freizeit und Muße – erscheint als Grundmodell unserer Alltagsgestaltung ganz natürlich. In den vorindustriellen, agrarischen Gesellschaften hingegen war der Tagesablauf für die meisten Menschen noch bunt durchmischt mit schwerer Arbeit, nützlichen Verrichtungen, Unterhaltung und Geselligkeit sowie kurzen, wiederkehrenden Ruhephasen. Erst während der frühen Industrialisierung begann man, säuberlich zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit zu unterscheiden. So drohten die Fabrikherren in ihren Fabrikordnungen für „Kartenspielen und faules Gerede“ während der Erwerbsarbeit drakonische Strafen an. In Verbindung mit der zunehmenden, auch räumlichen Trennung von Arbeiten und Wohnen (→Mobilität) sowie dem Verlust zeitlicher Freiheiten am Arbeitsplatz wurde die Grenze zwischen Arbeit und Leben beziehungsweise Freizeit immer schärfer.
Die industrielle Lohnarbeit machte es zwingend erforderlich, die Zeit, die ein Arbeitnehmer an seinem Arbeitsplatz verbringt, genau zu messen. Zum einen errechnete sich daraus der Lohn. Zum anderen hatte die (Stech-)Uhr eine disziplinierende Funktion. Die Arbeitgeber waren anfangs allerdings überhaupt nicht an messbaren Arbeitszeiten interessiert. Sie wurden ihnen erst von kämpfenden Arbeitern und den Gewerkschaften aufgezwungen, denn zuvor herrschte pure Willkür: Wie lange der Arbeitstag zu dauern hatte, entschied, je nach Arbeitsanfall, der Arbeitgeber. In den Fabriken des 19. Jahrhunderts genügte das Tragen von Armbanduhren, um entlassen zu werden. Die Demokratisierung der Zeit, das heißt ihre Allgemeinverbindlichkeit und die Möglichkeit für jeden, sie exakt festzustellen, bildete somit eine unverzichtbare Voraussetzung dafür, dass „Arbeitszeit“ als gesellschaftliche Institution überhaupt entstehen konnte (→Zeitsouveränität; Schneider M., 1984).
Nachdem einmal durchgesetzt war, Arbeitszeiten vertraglich festzulegen, forderten die Vertreter der Arbeiterbewegung sodann, sie zu verkürzen. Doch trafen sie dabei nicht nur auf den Widerstand der Arbeitgeber, sondern auch auf den vieler Arbeiter, denn kürzere Arbeitszeit bedeutete zunächst weniger Lohn (→Einkommen). Erst durch die Einführung eines so genannten „Lohnausgleichs“, das heißt der Beibehaltung des gleichen Lohns bei nun reduzierter Arbeitszeit, ließen sich auch die Arbeiterinnen und Arbeiter mit niedrigen Stundenlöhnen für dieses Ziel mobilisieren (Deutschmann 1985).
Unter „Arbeitszeit“ versteht man heute im Allgemeinen die Zeit, die eine abhängig beschäftigte Person an ihrem Arbeitsplatz verbringt. Das kann in der Fabrik, im Büro, aber auch unterwegs im Auto sein. Dabei wird Arbeit, wie man weiß, nicht nur als Arbeit zum Erwerb geleistet, sondern auch im Haushalt (wie beim Kochen und Reinemachen), privaten Handwerkerarbeiten, natürlich bei der Erziehung und Betreuung von Kindern (→Kinderzeiten) oder bei der Pflege kranker Menschen (→Sorgen und Pflegen). Ebenfalls wird Arbeit im Rahmen eines ehrenamtlichen Engagements geleistet (→Ehrenamt). Hier, außerhalb des Erwerbslebens, wird die Zeit normalerweise nicht exakt gemessen. Beginn und Ende der Arbeit ergeben sich aus Art und Umfang der Aufgabe, aus sachlichen Zwängen oder den Bedürfnissen und Interessen der Menschen, mit denen man zusammenlebt. In all diesen Fällen würde man auch im engeren Sinne nicht von „Arbeitszeit“ sprechen, sondern davon, wie lange eine Tätigkeit „gedauert“ hat – sofern dies überhaupt thematisiert wird. Die geringere oder zumindest andersartige Bedeutung von Zeit in der häuslichen Arbeit resultiert schließlich auch daraus, dass kein Entgelt, Lohn oder Gehalt gezahlt wird (→Einkommen).
Die Regelungen der Arbeitszeit, die wir heute in der Erwerbsarbeit vorfinden, sind das Ergebnis zum Teil sehr opferreicher Arbeitskämpfe der Gewerkschaften in allen Industrieländern seit weit über 100 Jahren. Damit wurde der Grundstein für die Herausbildung unserer modernen Alltagskultur gelegt und für die Entstehung und immer weitere Zunahme von Zeitwohlstand im Rahmen industrieller, kapitalistisch strukturierter Gesellschaften: Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert entstand durch die Verkürzung der Tages-, Wochen-, Jahres- und Lebensarbeitszeit ein Freizeitsektor (Prahl 2015) mit neuartigen Freizeitinstitutionen, so vor allem der geregelte →Feierabend, der Anspruch auf Urlaub, das freie →Wochenende sowie, in Bezug auf die Lebensarbeits(frei-)zeit, die sozial abgesicherte →Rente. Was zunächst als soziale Utopie geträumt und formuliert wurde, entwickelte sich allmählich zu eigenständigen Gebilden, deren Umfang von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gesellschaft und der Kampfkraft ihrer Gewerkschaften abhängig war. Im Rahmen dieser Zeitinstitutionen wurde für eine breite Mehrheit der Menschen ein ganz neuer Umgang mit ihrer Zeit und damit erstmals so etwas wie gelebter Zeitwohlstand (Rinderspacher 2002) möglich.
Die Begründungen für die arbeitszeitpolitischen Forderungen der Gewerkschaften haben sich im Verlauf der Geschichte gewandelt, entsprechend den sich verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, Arbeitsbedingungen, Lebensumständen und Wertvorstellungen (Rinderspacher 2000a). Anfänglich ging es zunächst darum, der physischen und psychischen Verelendung entgegenzuwirken, die ihre Ursachen in Arbeitstagen von zwölf oder mehr Stunden sowie einer Sieben-Tage-Woche hatte. Dazu gehörte auch die Bekämpfung der Nachtarbeit, insbesondere von Frauen. Vor allem in den USA wurden seit den 1920er Jahren Arbeitszeitverkürzungen gefordert und zum Teil umgesetzt, mit dem Ziel, die Massenarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Hier wurde 1938 zum ersten Mal eine 38-Stunden-Woche durchgesetzt (Klein/Worthmann 1999). Die Idee dahinter: Das vorhandene Arbeitsvolumen, also die in einer Volkswirtschaft von den Unternehmern benötigte Arbeitsleistung, sollte gleichmäßig auf alle an Erwerbsarbeit Interessierten und dafür Qualifizierten verteilt werden. Dieser Ansatz spielte auch in den Arbeitszeitverkürzungskampagnen im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts in Deutschland eine wichtige Rolle und wird auch heute weiterhin propagiert (Bremer Initiative für Arbeitszeitverkürzung; Zimpelmann/Endl 2008).
Je mehr sich die wirtschaftliche Situation in West- und auch Osteuropa nach dem Zweiten Weltkrieg verbesserte (→Konsum), umso mehr rückte das Ziel in den Vordergrund, mit dem Instrument der Arbeitszeitverkürzung nicht nur zur Abwehr von Gesundheitsschäden, sondern auch positiv zur Erhöhung des Wohlstands der Menschen beizutragen. Die gewaltig gestiegene Arbeitsproduktivität in Kombination mit anderen günstigen Wachstumsfaktoren bildete die ökonomische Grundlage für einen großen wirtschaftlichen „Verteilungsspielraum“. Dieser eröffnete neue Möglichkeiten, nicht nur – was nach einer Zeit materieller Entbehrungen zunächst als das Wichtigste erschien – den Güterwohlstand zu erhöhen, sondern auch den Zeitwohlstand. So verfolgten die Gewerkschaften schon seit der Aufbauphase der Bundesrepublik Deutschland die Strategie, den Verteilungsspielraum außer für höhere →Einkommen auch dazu zu nutzen, die Arbeitszeiten in mehreren Schritten spürbar zu verkürzen. Eine vergleichbare Zielsetzung fand sich auch in Ostdeutschland.
Damit schien die in dem Roman „Utopia“ von Thomas Morus bereits im 16. Jahrhundert beschriebene Vision eines Sechs-Stunden-Tages in greifbare Nähe zu rücken (Morus 1986). So wurde beispielsweise im Parteiprogramm der SPD von 1989 eine Regelarbeitszeit von 30 Stunden an fünf Tagen für alle arbeitenden Menschen gefordert (SPD 1989, S. 21, 27). In den vorangegangenen Jahrzehnten war es zudem gelungen, bestehende Zeitinstitutionen auszubauen und neue zu schaffen, vor allem die sehr populäre Fünf-Tage-Woche (→Wochenende; Herrmann-Stojanov 1999a). Dies, und der Ausbau anderer Zeitinstitutionen wie dem Urlaub oder der →Rente, führte zu einem nie gekannten Aufwuchs an Zeitwohlstand für breite Kreise der Bevölkerung. In den 1980er Jahren trat ein weiteres Ziel der Arbeitszeitpolitik hinzu: die Gleichstellung von Männern und Frauen. Nicht nur in der Frauenbewegung bestand die Erwartung, dass bei einer drastisch reduzierten Arbeitszeit von sechs Stunden für alle täglich so viel freie Zeit zur Verfügung stünde, dass auch Männer – von sich aus – mehr Haus- und Erziehungsarbeiten übernehmen würden (Kurz-Scherf/Breil 1987). Doch hat die Erfahrung gezeigt, dass solche Erwartungen ohne einen vorhergehenden Mentalitätswandel der Männer illusorisch sind.
Seit Ende der 1970er Jahre entstand im Zuge eines beginnenden Wertewandels in der Gesellschaft (→Ich) immer öfter der Wunsch, die Arbeitszeit im großen Umfang selbst bestimmen zu können, entsprechend den wechselnden Bedürfnissen und Lebensumständen der Menschen. So sollte es möglich werden, die Arbeitszeit an typische Phasen und Wechselfälle des Lebens (junges Erwachsenenalter, Kindererziehung, späte Erwerbsphase, Pflegeaufgaben (→Sorgen und Pflegen)) sowie an individuell veränderte Lebensziele (→Sinn →Zweierbeziehung →Familie) besser anzupassen. Diese neuen Ideen wurden unter den Schlagwörtern flexible Arbeitszeiten und →Zeitsouveränität populär. Zugleich wurde auch in den Unternehmen über flexiblere Formen der Betriebsorganisation diskutiert; wobei sich jedoch schon bald herausstellte, dass die wirtschaftlich begründeten Flexibilitätsinteressen der Unternehmen hier, und das Bedürfnis der Beschäftigten nach selbstbestimmten Arbeitszeiten dort, nur teilweise übereinstimmten. Aber eben von der Selbstbestimmung hängt ab, ob die Menschen tatsächlich mehr zeitliche Freiheiten haben und damit auch tatsächlich zu mehr Zeitwohlstand gelangen (Rinderspacher 2009). Schließlich ist die Bewahrung einer lebenswerten Umwelt als arbeitszeitpolitisches Ziel denkbar: So könnten die Individuen die Zeit, die sie durch Arbeitszeitverkürzungen gewonnen haben, ja nicht nur für mehr Freizeitaktivitäten verwenden, sondern auch dazu, sich umweltschonender zu verhalten, etwa bei der Überwindung räumlicher Distanzen (→Mobilität).
Grundsätzlich lassen sich vier Dimensionen von Arbeit und Arbeitszeit unterscheiden: Dauer, Lage, Verteilung und Kontrolle. Die erste Dimension bezieht sich auf die Frage, wie lange ein Mensch an seinem Arbeitsplatz ist; die zweite darauf, zu welchem Zeitpunkt er sich dort am Tag, in der Woche oder im Laufe des Jahres aufhält, etwa ob früh oder spät. In der dritten Dimension kann die Arbeitszeit entweder von früh bis spät gleichmäßig durchgehen, aber auch unterbrochen oder unregelmäßig über den Tag und die Woche verteilt sein (zum Beispiel bei einer Beschäftigung im Rahmen einer reduzierten Drei-Tage-Woche von 18 Stunden, verteilt auf Montag, Donnerstag und Samstag). Ob in der vierten Dimension eine Person Kontrolle über ihre Zeit ausüben kann, entscheidet sich daran, inwieweit sie ihre Arbeitszeit, also deren Dauer, Lage und Verteilung mehr oder weniger selbst gestalten kann.
Die über hundertjährige Phase kontinuierlich abnehmender Arbeitszeiten scheint heute in Anbetracht wirtschaftlicher Schwierigkeiten in einigen Branchen, der Steigerung der Lebenshaltungs- und Vorsorgekosten (→Einkommen →Bildung →Rente), weit verbreiteter Niedriglöhne, befristeten Verträgen und eines in vielen Branchen und Regionen nur schwachen Organisationsgrades der Gewerkschaften für’s Erste an ihr Ende gekommen zu sein. So waren Arbeitnehmervertretungen und Gewerkschaften im vergangenen Jahrzehnt erst einmal damit beschäftigt, Arbeitszeitverlängerungen zu verhindern, sowohl der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeiten als auch der Lebensarbeitszeit, die bekanntlich auf 67 Jahre heraufgesetzt wurde und wahrscheinlich auch dort noch lange nicht ihr Ende gefunden hat (→Rente).
Demgegenüber würden nach wie vor viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Arbeitszeiten gern verkürzen: 31 Prozent der Männer beziehungsweise 43 Prozent der Frauen, die ganztags arbeiten, wünschen sich Arbeitszeitreduzierungen um 1,6 Stunden oder mehr. Männer über 50 wünschen sich sogar eine Arbeitszeitreduzierung von drei Stunden gegenüber der vereinbarten Arbeitszeit. Aber die Arbeitszeitwünsche gehen auch häufig in die Richtung einer Verlängerung, wenn nämlich Teilzeit gearbeitet wird: Hier möchten fast 40 Prozent der Frauen und sogar 46 Prozent der Männer mindestens 1,6 Stunden mehr arbeiten, Frauen zwischen 15 und 29 Jahren sogar etwas über acht Stunden, im Durchschnitt aber mehr als drei Stunden (IAB 2014; Holst/Seifert 2012).
In einer freien Wirtschaftsverfassung steht es natürlich jedem Arbeitnehmer prinzipiell frei, mit seinem Arbeitgeber die Stundenzahl, die er sich vorstellt, im Einzelgespräch selbst auszuhandeln – allerdings setzt das voraus, dass dieser sich auch darauf einlässt. Dem Nachdruck verleihen könnten gesetzliche oder tarifvertragliche Regelungen, die eine Art Recht des Arbeitnehmers auf Wahlarbeitszeiten beinhalten (→Zeitsouveränität). Ein verbrieftes Recht, seine Arbeitszeit frei zu wählen, ist allerdings nur in Richtung ihrer Verkürzung denkbar, nicht aber ihrer Verlängerung. Das wäre nach der Wirtschaftsverfassung der Bundesrepublik Deutschland, die außer auf Vertragsfreiheit auch auf der Freiheit der unternehmerischen Entscheidung aufbaut, nicht möglich.
Die Arbeitszeit individuell zu verkürzen muss man sich allerdings auch leisten können; bei höheren Qualifikationsstufen mit dementsprechenden Gehältern ist diese Hürde freilich niedriger als bei den unteren (→Bildung). Hinzu kommt, dass aufgrund verschiedener gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklungen, beispielsweise höherer Kosten für die (private) Altersvorsorge (→Rente), seit vielen Jahren Lohnfragen wieder wichtiger geworden sind als Arbeitszeitverkürzungen (Zeit-Geld-Präferenz, →Einkommen). Andererseits kann in bestimmten Lebenslagen dennoch Zeit wichtiger als Geld sein. Das gilt besonders für solche Arbeitnehmer, die Erziehungsaufgaben haben oder sich um einen pflegebedürftigen Angehörigen kümmern (→Familie →Sorgen und Pflegen; Mückenberger 2007). Entsprechend scheint der Trend der Arbeitszeitpolitik für die nächsten Jahre eher in Richtung Aufgaben beziehungsweise belastungsbezogener Arbeitszeitverkürzung zu gehen. Dazu liegen Modelle auf dem Tisch, die während solcher Lebensphasen Arbeitszeitverkürzungen auf ungefähr 30 Stunden in Kombination mit einem, wenn auch nicht vollständigen, Ausgleich des Einkommensverlustes mittels Lohnersatzleistungen durch öffentliche Kassen bieten. Sie heißen etwa „Familienarbeitszeit“ (Müller u. a. 2013; →Familie →Zeitsouveränität) oder „Plegevollzeit“ (→Sorgen und Pflegen; Reuyß u. a. 2012).
Weil die individuellen Bedürfnisse der Menschen immer wichtiger werden (→Ich →Zeitsouveränität →Zweierbeziehung), haben, im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte gegenüber Arbeitszeitverkürzungen, flexible Modelle zunehmend an Bedeutung gewonnen, gerade auch wenn es darum geht, Zeitwohlstand zu verwirklichen (Rinderspacher 2009; 2012). Möglicherweise bietet die bevorstehende radikale Digitalisierung der Produktionsprozesse, die gegenwärtig unter dem Schlagwort „Industrie 4.0.“ diskutiert wird (Hirsch-Kreinsen u. a. 2015), hierfür neue Chancen. Zu erwarten sind aber auch viele neue Begehrlichkeiten der Arbeitgeber, um die Arbeitszeiten – was deren Dauer, Lage und Verteilung angeht – sogar noch mehr als bisher, den wirtschaftlichen und technischen Vorgaben anzupassen. Dazu gehören Vorstöße, die gesetzlich erlaubte tägliche Arbeitszeit von durchschnittlich acht Stunden wieder zu verlängern, indem die Höchstgrenze nun auf die Woche statt auf den Tag bezogen wird und bei flexibler Verteilung dort 48 Stunden nicht überschreiten darf. Faktisch haben sich die Arbeitstage ohnehin schon verlängert: So leisten 20 Prozent der Beschäftigten regelmäßig zehn und mehr Überstunden pro Woche, und 15 Prozent der Beschäftigten erledigen auch außerhalb der Arbeitszeiten noch Aufgaben für den Betrieb. Nahezu ein Drittel, 27 Prozent, müssen auch außerhalb der Arbeitszeiten für den Betrieb erreichbar sein (DGB-Index Gute Arbeit 2012, S.6ff. →Feierabend).
Obwohl Arbeitszeitpolitik in verschiedener Hinsicht sehr viel schwieriger geworden ist als in früheren Jahrzehnten, muss die Geschichte der Arbeitszeitverkürzung deshalb keineswegs abgeschlossen sein (Rinderspacher 2005), jedenfalls nicht zwangsläufig. Ein Blick zurück zeigt, dass Arbeitszeiten mit den unterschiedlichsten Begründungen immer wieder verlängert, dann aber auch wieder reduziert wurden, im langfristigen Trend jedoch kürzer geworden sind. Es wird sowohl auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung als auch auf die Kräfteverhältnisse und vor allem auf das Engagement der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ankommen, wie sich die Arbeitszeiten in Zukunft entwickeln werden. Zumindest in der Arbeitsgesellschaft bleiben die Arbeitszeiten jedenfalls die Basis für gelebten Zeitwohlstand und Muße.
Ehrenamt
Sich Zeit für andere nehmen
Ohne die Bereitschaft von Millionen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, freiwillig und unentgeltlich ihre freie Zeit für andere Menschen und in Dinge zu investieren die ihnen wichtig sind, wäre unsere Gesellschaft um Vieles ärmer. Öffentliche Ämter und Aufgaben zu übernehmen verbindet sich in Deutschland traditionell mit dem Begriff „Ehrenamt“. Versuche, ihn durch moderner klingende Namen wie „freiwilliges Engagement“ oder „Freiwilligenarbeit“ zu ersetzen, deuten zwar auf ein gewandeltes Verständnis bei Politikern und Verbandsvertretern hin, haben sich im allgemeinen Sprachgebrauch aber nicht wirklich durchsetzen können (BMFSFJ 2010b, S.14). Der Begriff „Ehrenamt“ hat in Deutschland Tradition und trifft die Sache, für die er steht, hinsichtlich zweier maßgeblicher Komponenten genau: Es handelt sich um eine Tätigkeit, die tatsächlich um der Ehre willen getan wird und zur Ehre gereicht. Sie bringt dem, der sie leistet, soziale Anerkennung, aber keine „müde Mark“ ein. Daneben steht das „Amt“. Das meint im Ursprung eine organisierte, mehr oder minder dauerhafte, verbindliche und verpflichtende Tätigkeit, die bestimmten Aufgaben, Rechten und Pflichten folgt.
Ursprünglich einmal war „Ehre“ an den sozialen Stand gebunden. Doch mit dem Aufstieg des Bürgertums im 18. Jahrhundert änderte sich dies. Nun war Ehre verstärkt eine Frage von Leistung und Verdienst (→Leistung und Erfolg). Und hier bot unter anderem die Arbeit für das Gemeinwohl ein breites Betätigungsfeld. Dabei gab es von Anfang an eine stark geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Männer engagierten sich in der Politik oder im Sportverein, Frauen in den entstehenden karitativen Organisationen. Diese Aufteilung prägt das Ehrenamt bis heute, wenngleich sie nicht mehr so stark ist wie einst.
Das angelsächsische volunteering betont mehr die „Freiwilligkeit“ und das „Tun“. Die „Universal Declaration of Volunteering“ hebt hervor, dass zum einen die persönliche Motivation und zum anderen die Möglichkeit, sein Tätigkeitsfeld zu wählen, die Basis für ein zeitgemäßes freiwilliges Engagement sei. Das erscheint heute selbstverständlich. Zudem wechselt man gelegentlich die Art und den Träger seines öffentlichen Engagements – die lebenslange Bindung an einen Verein, in dem man langfristig ein Ehrenamt übernehmen würde, entspricht nicht mehr unbedingt dem, was die Menschen gerne wollen. Darüber hinaus ist bei den „neuen Freiwilligen“ ein weit stärkeres Interesse an Eigenverantwortung und Selbstbestimmung zu beobachten, wie die im Jahr 2000 eingerichtete Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ hervorhebt. In ihrem ehrenamtlichen Tätigkeitsfeld stellten die Freiwilligen weitreichende Anforderungen an Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Und dies nicht zuletzt mit Blick auf die zeitlichen Rahmenbedingungen (→Zeitsouveränität →Ich).
Darauf haben sich auch die Freiwilligen-Agenturen eingestellt, die überall in Deutschland ihre Vermittlungsdienste anbieten. Sowohl in größeren Organisationen als auch in der privaten Pflege von Kranken und Hilfsbedürftigen, der Betreuung von Kindern oder in der Flüchtlingsarbeit ist die Nachfrage nach ehrenamtlichen Kräften groß. Dem entsprechend sind auch die Freiwilligen-Agenturen darauf bedacht, passende Qualifikationen zu vermitteln. Der „Freiwilligensurvey 2009“ (BMFSFJ 2010b) zeigt, dass in diesem Jahr immerhin 71 Prozent der Bevölkerung in Vereinen, Organisationen, Gruppen oder öffentlichen Einrichtungen (also im dritten Sektor bzw. in der Infrastruktur der Zivilgesellschaft) „teilnehmend aktiv“ waren, das war gegenüber 1999 ein Zuwachs von fünf Prozent. Ansprechbar für ein Engagement sind vor allem solche Personen, die ohnehin in öffentliche Systeme integriert sind, wie in der Bildungs- und Ausbildungsphase; bei den Familien stellt sich der Zugang häufig durch die Kinder her. Aber auch immer mehr ältere Menschen sind seit 1999 öffentlich aktiv geworden (ebd., S.4). Die sogenannte Engagementquote, also der Anteil der Menschen an der Gesamtbevölkerung, die nicht nur beteiligt sind, sondern tatsächlich aktive Arbeit leisten und diese auch längerfristig ausüben, liegt bei 36 Prozent. Das freiwillige Engagement ist besonders hoch bei Männern, Erwerbstätigen, jungen Leuten in der (verlängerten) Ausbildungsphase, bei höher Gebildeten und bei Menschen mit einem gehobenen Berufsprofil (ebd., S.4). Etwa 10 Prozent der Bevölkerung sind im Bereich Sport und Bewegung unterwegs, ganz überwiegend in Vereinen, welcher der größte Engagementsbereich ist. Nachgeordnet folgen die Bereiche Kindergarten und Schule sowie Kirche und Religion, gefolgt mit einem gewissen Abstand vom Bereich soziales Engagement. In so anspruchsvollen Diensten wie der Freiwilligen Feuerwehr beziehungsweise den Rettungsdiensten engagieren sich etwas weniger als drei Prozent (ebd., S.6).
Die Verteilung über die Bereiche hinweg hat sowohl etwas mit den Interessen der Freiwilligen zu tun als auch mit den Angeboten, die die Gesellschaft bietet. (ebd., S.6). Einen großen Einfluss auf das Engagement haben zunehmend auch die →Arbeitszeiten. Davon hängt bekanntlich ab, ob und wie man seine Zeit planen kann. Im Freiwilligensurvey 2009 (ebd.) geben 57 Prozent der erwerbstätigen Engagierten an, ihre freie Zeit unter der Woche verlässlich planen zu können; für 20 Prozent ist das nur teilweise möglich und für 23 Prozent gar nicht. Diejenigen, die für ihre Freizeit über eine wirkliche Planungssicherheit verfügen, sind mit 45 Prozent weit überdurchschnittlich engagiert. „Das Zeitregime zeigt damit einen Riss in der gesellschaftlichen Kultur an, der es Teilen der erwerbstätigen Bevölkerung schwerer macht, sich mehr in der Zivilgesellschaft zu engagieren.“ (ebd., S.10)