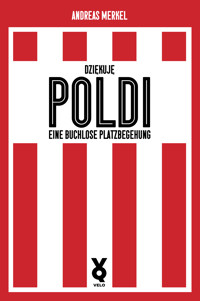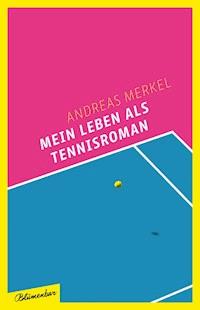
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
It’s a match! Arthur Wilkow, fourtysomething, Literatur- und Sportjunkie, setzt alles auf eine Karte. Sein Ziel: einen autobiographischen Tennisroman zu schreiben. Aber was, wenn das Leben für einen Roman nicht taugt? Hin- und hergerissen zwischen Wunsch und Wirklichkeit reist Wilkow durchs Jahr, nach Hawaii, zum Lago Maggiore, nach Köln und Kühlungsborn, Polen und Portland. Mein Leben als Tennisroman erzählt von Gegner- und Partnerschaft, den täglichen Kämpfen und letzten großen Duellen. Zwischen Mann und Frau, Autor und Figur, Erinnerung und Gegenwart. »In der hiesigen Literatenszene, in der es von Kojoten, Tagedieben und anderen Heiligen nur so wimmelt, ist Andreas Merkel der – wie es im Sport heißt –, „den du gesehen haben musst“. Ronald Reng
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Ähnliche
Über Andreas Merkel
Andreas Merkel, geboren 1970 in Rendsburg, lebt in Berlin. Studium der Germanistik, Philosophie, Politik- und Filmwissenschaft in Kiel und Berlin. Magisterarbeit über Christoph Heins »Der fremde Freund« (»Die Problematik des Ich angesichts der Erfindung und Abschaffung des Anderen«). Autor von Kurzgeschichten und der Romane »Große Ferien« und »Das perfekte Ende«. Journalistische Arbeiten für taz, Berliner Zeitung, ZEIT und Süddeutsche. Schreibt im »Literatenfunk« (piqd.de) und für den Freitag die Kolumne »Bad Reading«. Sein Tagebuchroman »Fan-Fibel 1. FC Köln« (11Freunde: »das Anti-Fußballbuch des Jahres«) wurde 2017 von der Deutschen Fußball-Akademie zum »Fußballbuch des Jahres« nominiert. Merkel ist Inhaber einer abgelaufenen Tennistrainer-C-Lizenz und steht im Tor der Autorennationalmannschaft.
Informationen zum Buch
It’s a match!
Arthur Wilkow, fourtysomething, Literatur- und Sportjunkie, setzt alles auf eine Karte. Sein Ziel: einen autobiographischen Tennisroman zu schreiben. Aber was, wenn das Leben für einen Roman nicht taugt? Hin- und hergerissen zwischen Wunsch und Wirklichkeit reist Wilkow durchs Jahr, nach Hawaii, zum Lago Maggiore, nach Köln und Kühlungsborn, Polen und Portland.
Mein Leben als Tennisroman erzählt von Gegner- und Partnerschaft, den täglichen Kämpfen und letzten großen Duellen. Zwischen Mann und Frau, Autor und Figur, Erinnerung und Gegenwart.
»In der hiesigen Literatenszene, in der es von Kojoten, Tagedieben und anderen Heiligen nur so wimmelt, ist Andreas Merkel der – wie es im Sport heißt –, ›den du gesehen haben musst‹.« Ronald Reng
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Andreas Merkel
Mein Leben als Tennisroman
Roman
Inhaltsübersicht
Über Andreas Merkel
Informationen zum Buch
Newsletter
Teil 1: Das Schwache Denken
Amerika
2. Januar: I’m writing a novel
3. Januar: Das Parfum von Yvonne
4. Januar: Der amerikanische Tennisroman
5. Januar: Lenz
6. Januar: Wer waren sie voreinander?
7. Januar: Das schwache Denken
9. Januar: Home of the NFL
10. Januar: Nicht-Ichigkeit
11. Januar: Ongoingness
12. Januar: Snowbound
13. Januar: Not the actual events
14. Januar: 36 Stunden Portland
16. Januar: Putting Today to Bed
Görlitz
27. Januar: Görlitz
28. Januar: Schlaflos an der Grundlinie
Die Grundlinie
Köln
2. Februar: Alone in Cologne
3. Februar: Drink doch kene met
Polen
28. Februar: Hampton Inn
1. März: Die halbe Hitlerjugend in der Hala tenisowa
2. März: Love 17 / 17 all
3. März: Nicht Paris
Teil 2: Die schlechte Presse
Ostsee
21. April: K-born
22. April: Overruled
23. April: Gegenspieler
Nordburg
16. Mai: Rückkehr nach N
17. Mai: Oldenbüttel
18. Mai: Breiholz
19. Mai: Neumünster
20. Mai: Brasilien
21. Mai: Eine richtige Freundin
Interlude
24. Juni: Die schlechte Presse
Italien
15. Juli: Junior-Suite
16. Juli: Lucky Shoulder
17. Juli: 34. Baveno 1937
18. Juli: Am Lido
19. Juli: Ciao fratello
20. Juli: Demisexuell
21. Juli: Gottfried von Wilkow
22. Juli: Ti amo
23. Juli: Your Ex-Character is dead
Teil 3: Der falsche Freund
Amerika
8. September: Welches Jahr haben wir?
9. September: Metro Boomin
11. September: Employees Only
12. September: Zwischen Salt Lake City …
13. September: Nocturnal Portland
14. September: CRITICAL PROCESS DIED
15. September: Güero
16. September: Good Writing
18. September: Renegade
19. September: Dr. Wilkinson’s
20. September: Crescent City
21. September: Girl is a gun
22. September: Schreiben ist das neue Rauchen
23. September: Stammtisch
Nordburg
8. Dezember: Unter dem Tannenbaumsystem
9. Dezember: Der falsche Freund
Amerika
24. Dezember: Der Return des Lenz
Dank
Impressum
Für P.
Teil 1: Das Schwache Denken
Who’s that laughing in my library?
Frank Ocean
AMERIKA
2. Januar: I’m writing a novel
Der Überfahrer war auch schon mal auf Hawaii und erzählt uns davon. Montagmorgen, five AM in Portland, Oregon. Die Fahrt zum Flughafen dauert eine halbe Stunde. Der Wagen ist ein ganz normaler Ford, aber hinten gibt es eine kleine Vase mit Blumen, Kleenex und Wasserflaschen. E. sitzt neben mir und hält meine Hand, während sie aus dem Fenster die vorbeigleitenden Lichter der Stadt betrachtet, in der ihre Tochter wohnt.
Seine Ahnen kämen auch aus Deutschland, sagt der Überfahrer: In alten Einreiseregistern auf Ellis Island stehe, dass die Urgroßeltern reich gewesen wären, weil sie mit drei Gepäckstücken in der Neuen Welt ankamen, ein Handwerk hatten, lesen und schreiben konnten. Damit hätte man damals als reich gegolten. Der Überfahrer hat das recherchiert, er interessiert sich für Geschichte. Seine Lieblingsstadt (in Europa) ist Rom. Dessen antike Überreste haben es ihm angetan, die Amphitheater und Katakomben. Und unter dem Kolosseum gebe es diese geheimen Gänge. Mehr noch als für History, sagt der Überfahrer mit einem unangenehmen Blick in den Rückspiegel, interessiere er sich für Mistery-History.
Dann fragt er, was wir machen.
Vor der schweigenden E. antworte ich wie für uns beide Writing, und es dauert dann noch mal eine Weile, bis wir das Missverständnis aufgeklärt haben, weil der Überfahrer aus irgendeinem Grund zuerst Hunting verstanden hat (und ganz abgesehen davon, dass E. natürlich auch nicht schreibt).
»Then what are you writing about?«
Ich muss an die Homeland Security denken, die vor einer Woche genauso nachgefragt hat und der ich erzählte, ich wäre Journalist und würde über Sport, Literatur und Pop schreiben – mostly Bundesliga, um mir weitere Nachfragen zu ersparen.
Jetzt sage ich einfach die Wahrheit.
»I’m writing a novel.«
»Oh«, sagt der Überfahrer, nicht im Mindesten überrascht. »What is it about?«
»It’s about death, sex and tennis.«
Der Überfahrer guckt mich wieder im Rückspiegel an. »Now, that’s quite some combination.«
Das kleine Gespräch könnte hier schon beendet sein. Wir könnten einfach den restlichen Weg zum Flughafen schweigen.
Dann überlegt es sich der Überfahrer aber noch mal anders: »I mean, death and sex sound like any other novel I’ve read so far. But tennis? That’s different.«
»Thank you.«
»May I ask you something?«
Ich nicke.
»Why death?«
»Because it’s such an important thing in life. I mean, people are always dying. And because people want to read about it.«
Wir halten an einer roten Ampel, der Überfahrer blickt geradeaus auf die Straße und wirkt nicht so, als würde er zuhören.
»But who is dying in your novel?«
»The author.« Ich überlege kurz, ob das stimmt, dann füge ich hinzu: »It’s always the author, who is dying.«
Der Überfahrer guckt aus dem Seitenfenster und hupt kurz, grüßt den Fahrer nebenan, der ihn entgeistert anschaut.
»Right. Like in the song: so you can remember him.«
Die Ampel springt auf Grün, der Überfahrer fährt weiter:
»And why sex?«
»Because the novel plays in Berlin, you know. The Party Capital. It’s all going down there right now. Plus: most of the tennis-players I know are sex-addicts. I mean…«
E. drückt meine Hand. Ich schaue sie an. Aber ihre Augen sind geschlossen, und es ist nur ein Zucken im Schlaf gewesen.
Der Überfahrer nickt nachdenklich.
»Yeah, I understand.«
Die Abfahrt zum Airport taucht auf, er setzt den Blinker.
»And so this is why you write about tennis.«
Ich habe den Überfahrer vorhin genau beobachtet, als er uns half, das Gepäck in den Kofferraum zu wuchten: Ein großer Typ in markenlosen Sneakers, Jeans, Sweatshirt. Hohe Stirn, leichtes Übergewicht. In Berlin wäre er ein ganz normaler Taxifahrer, der bloß irgendwann erwähnt, dass er Adolf Hitler wählt. In Amerika dagegen wirkt so jemand gleich wie der Zodiac Killer. Jemand, mit dem man sich auf einer Reise unterhält und den man fünf Minuten später wieder vergessen hat.
»Tennis… is just something I practised a lot. I could hit winners with my backhand…«
Beim Gedanken an meine Rückhand muss ich plötzlich lachen, und der Überfahrer lacht netterweise ein bisschen mit.
»But of course, I’m not this good. Not like a pro. But I can see why it’s a nice game. And I can see what’s the problem with it…«
Der Überfahrer will wissen, was das denn für ein Problem sei.
»It’s a singles’ sport you can’t play alone.«
»Death, sex and tennis, you said?«
»That’s right.«
»Sounds like a very private project.«
»Yeah, that’s why I will write it in English. So I won’t feel too lonely. And I want to write for a bigger readership. You know, go global…«
»Well, that’s pretty smart. Good luck then.«
Wir sind am Flughafen angekommen. E. ist aufgewacht, und ich frage sie auf Deutsch, ob wir dem Überfahrer Trinkgeld geben sollen. E. antwortet, dass schon alles online bezahlt wurde und es nicht Über, sondern Uber heißt. Für den Uberfahrer klingt diese kleine Unterhaltung vielleicht wie Geheimsprache, aber als er das hört, grinst er (»That’s alright, he can call me Über!«) und wünscht uns eine gute Reise.
Am Terminal ist die destination immer noch domestic, das Ziel immer noch Inland. Um uns rum lauter Amerikaner in Outdoor-Klamotten und kurzen Hosen – im Januar, der Anblick hilft gegen den leichten Schwindel, jetzt sechs Stunden raus auf den Pazifik zu fliegen. An Bord lese ich die Sonntags-New York Times von gestern, zwei Artikel aus dem Ressort MOST READ 2016. Im ersten geht es darum, wie Obama die Abende seiner Präsidentschaft verbracht hat: nach einem frühen Dinner mit der Familie zog er sich zurück, um circa fünf Stunden allein in einem Raum im Weißen Haus zu sein (Lesen, Mailen, Basketball im Fernsehen gucken) und exakt sieben leicht gesalzene Mandeln zu essen – pretty anal, scherzte der Stab.
Der andere Artikel handelt von jesidischen Sex-Sklavinnen im sogenannten Islamischen Staat: bemerkenswert wenige seien bei den Vergewaltigungen schwanger geworden. Mittelalterliche Vorschriften verböten Sex mit Schwangeren, weswegen die Kämpfer sich strikt an Empfängnisverhütung hielten, was in dem Text als das Allerverwunderlichste betont wurde.
Ich überwinde den Impuls, E. zu erzählen, was ich gerade gelesen habe. Wir befinden uns irgendwo über dem Ozean, und den Rest des Fluges mache ich mir auch keine Notizen mehr zu dem geplanten Tennisroman, den ich in diesem Jahr schreiben will, weil ich zum Glück schon weiß, wie es losgeht. Ich werde ihn einfach als Arthur Wilkow schreiben. Niemand sonst heißt so, ich habe meinen Namen extra noch mal im Internet nachgeguckt. Aus Gründen der erzählerischen Härte und maximalen Distanzierung könnte ich mich im Tennisroman außerdem einfach nur Wilkow nennen – Klarname Nachname: wie aus einem schonungslosen Hintergrundbericht im Sport- oder Politikteil. Mein Herz schlägt wild, und ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich mir nicht selbst in die Falle gehe, indem ich mir zu smart vorkomme.
3. Januar: Das Parfum von Yvonne
Der Tennisroman befindet sich nun als Tagebuch seit gestern auf Hawaii. Heute, am Dienstagmittag, sitze ich im Schatten der Bäume des Statepark zwischen Waikiki Beach und Diamond Head an einem Picknick-Tisch aus Beton. Während ich E. im Auge behalte, die etwa hundert Meter entfernt am Strand liegt, schreibe ich vorsichtig mit blutigen Fingern und Knien. Wenn man im Ozean schwimmen will, muss man sich noch im Flachen über ein scharfkantiges Riff direkt unter der Oberfläche tasten, auf das einen die Wellen dann immer wieder sanft runterdrücken … beim Rauskommen rinnt das Blut dünn aus kleinen Papercuts und vermischt sich auf der Haut mit dem schnell trocknenden Salzwasser des Pazifik.
Ich habe zwei Notizbücher: ein rotes (fürs Tagebuch) und ein blaues (für den Roman). Klassischer Fall von doppelter Buchführung. Das rote ist ein dickes Moleskin, das blaue ein elegantes, dünnblättriges Smythson, auf dem in goldenen Lettern To be perfectly frank steht (ein Geschenk von meinem Freund Eilinger, weil ich ab und zu auf seinen Dackel aufpasse). Ich fange mit dem blauen Notizbuch für den Roman an, und dieser Tennisroman beginnt immer wieder mit dem Betreten einer Anlage, die sich gerade Zehntausende Meilen Luftlinie entfernt im Land der Erinnerung befindet. Im engeren Sinne könnte die Anlage ein Tennisclub sein, im weiteren Sinne aber vielleicht auch eine Art Traumlandschaft. Der Traum wäre dann eine Geschichte, die den Autor so lange verfolgt, bis sie irgendwann nicht mehr von einer Geisteskrankheit zu unterscheiden ist. Diese Geschichte ist der Tennisroman.
Er könnte zum Beispiel damit beginnen, wie Wilkow einmal allein in einem leeren Stadion im äußersten Westen der Stadt saß und sich ein Zweitrunden-Match der German Junior Open anguckte. Das war im Juli 2008: Obama kam zum ersten Mal nach Berlin, und Wilkow fuhr an einem Donnerstagnachmittag mit dem Rad zum Lawn Tennis & Hockey Club Rot-Schwarz Berlin. Das wäre dann die wahre Anlage, und alles würde nicht besonders ermutigend mitten in Dahlem seinen Anfang nehmen. Um den Roman zu betreten, müsste man am Ende einer von Villen gesäumten Straße durch ein Tor gehen, hinter dem dann tatsächlich ein komischer Offizieller in einem Clubjackett rumstand, als wäre man gerade in Wimbledon angekommen. Das Clubjackett erinnerte allerdings eher an Higgins aus Magnum. Dafür begrüßte Higgins den Besucher immerhin freundlicher als damals die Schnösel von den Dritten Herren, gegen die Wilkow mal in der Berliner Bezirksliga angetreten war. Die hatten gar nicht erst mit ihren Gegnern geredet, sondern lieber gleich aufs Clubpersonal verwiesen, »falls ihr Fragen habt«.
Higgins konnte also davon ausgehen, dass Wilkow schon mal da gewesen war und sich auf der parkähnlichen Anlage auskannte. Obwohl der Eintritt frei war, bestanden die German Junior Open im Wesentlichen aus Teilnehmern und Trainern. Wilkow sah nicht einen normalen, neutralen Zuschauer. Er ging direkt zum Center Court, der in einem großen Betonstadion untergebracht war, das man in den besseren Tagen des Sports nach Deutschlands berühmtester Spielerin benannt hatte. Heute war das Stadion leer, bis auf eine Frau, die ganz unten hinter den Bänken der beiden Spieler saß, die sich gerade einschlugen.
Mit dem komischen Gefühl, sich unter 5000 grünen Plastiksitzen für einen Platz zu entscheiden, setzte sich Wilkow in den Ober-Rang, um sich auf das Spiel von oben konzentrieren zu können, wie man ein dickes Buch beim Lesen von sich weghielt. Die Namen der beiden Spieler standen mit Kreide auf einer Anzeigetafel geschrieben, die am ebenfalls verwaisten Schiedsrichterstuhl angebracht war. Sie sagten Wilkow nichts, und er vergaß sie auch sofort wieder. Der eine war ein Slowake (oder Tscheche), der andere ein Deutscher. Die Frau war die Trainerin, Freundin oder vielleicht sogar Mutter des Tschechen, vorstellbar war irgendwie alles. Der Deutsche hatte niemanden außer Wilkow im Ober-Rang auf seiner Seite.
Der Tscheche spielte müheloses Federer-Tennis, mit der einhändigen Rückhand konnte er direkte Winner schlagen. Der Deutsche, schwerer und muskulöser, hatte mit seiner beidhändigen Rückhand dagegen keine Chance. Den ersten Satz verlor er 1:6 gegen den Slowaken, fluchte sich einmal durch das obszöne Alphabet mit F (wofür es sofort eine court violation gegeben hätte, wenn denn jemand auf dem Hochsitz gesessen hätte – so mussten die Junioren strittige Bälle unter sich ausmachen, indem sie mit lässig hängendem Schläger Abdrücke im Sand umkreisten). Bei den Seitenwechseln vergrub der Deutsche das Gesicht im Sponsoren-Handtuch von kinderschokolade.
Im zweiten Satz dann die überraschende Wende. Der Deutsche hatte sein Spiel umgestellt, orientierte es jetzt besser am Gegner und dessen schwächerer Vorhand und konnte im Tiebreak gewinnen, 7:6. Das Match ging in den dritten Satz. Langsam legte sich eine abendliche Einsamkeit über den Center Court, was an dem seltsamen Klang gelegen haben mag, den es macht, wenn nur zwei Menschen in einer leeren Arena klatschen (als würden in einem Lesesaal Buchseiten umgeblättert). Andere Geräusche schienen von weit her zu kommen: Auf den Nebenplätzen schrie jemand OUT, ein anderer antwortete mit FUCK. Im Hundekehlesee hinter dem Club badeten Kinder. Ab und zu fuhr eine S-Bahn an der Stadionrückseite vorbei.
Der Deutsche verlor den dritten Satz 4:6, und als die Gegner sich am Netz die Hand gaben, war Tennis plötzlich wieder ein schöner Sport gewesen. Und Wilkow hatte auf der Tribüne eine Art Erweckungserlebnis gehabt: Es war das erste Mal, dass er über sein Leben als Tennisroman nachdachte.
Dabei fielen ihm sofort folgende Dinge ein:
Die Verschwendung seiner Jugend auf den nördlichsten Courts der untergehenden Bundesrepublik. Endlose Nachmittage in epische Privatduelle mit den immer gleichen Freunden verstrickt. Forderungsspiele, Clubmeisterschaften, Bezirksturniere an den Wochenenden. Warten, dass der schleswig-holsteinische Regen abzieht und man den Platz selbst mit Schwämmen trockenlegen konnte.
Der Job als Tennistrainer während des Studiums. Zuerst hatte Wilkow Jugendliche im Heimatverein trainiert, die kaum jünger waren als er selbst. Dann erwachsene Feierabendspieler in den umliegenden Dörfern. Dazwischen einen Sommer lang betagte Millionärinnen auf Sylt.
Die neuen Freunde fernab seines Studiums bei den
Treptower Teufeln
, einem Ostberliner Tennisclub. Das Vereinsheim befand sich in einem alten Schachclub, wo ein Dosenbierautomat rumstand (nach dem Montags-Training wurde bis spät in die Nacht gesoffen). Die Kabinen mit altem Linoleum und Stoffvorhängen. Alles roch noch nach
DDR
, nach wilden Vereinsfeiern und Sex im Osten.
Die Metapher, die Tennis fürs Schreiben oder Schreiben fürs Tennis sein könnte. Beides dreht sich um das einsame Spiel eines romanesken Ichs gegen sich selbst oder andere Gegner (Rafael Nadal, Christian Kracht, Aaron Krickstein, Roberto Bolaño). Beides findet statt in einer künstlich hochgezüchteten, irgendwie privilegierten, dafür aber auch psychisch ruinösen Welt der
Books
and
Courts
.
Seitenwechsel: Aus dieser Welt auftauchend, beschließe ich, dass es Zeit ist für eine kleine Schreibpause mit Eiskaffee, American Spirits und New York Times. Autorsein ist ja auch eine Lifestyle-Entscheidung: wenn nicht mal mehr Kaffee, Zigaretten und Zeitung drin sind, ist der Text sowieso schon verloren. Um das zu verhindern, bin ich heute Morgen mit E. extra in einen der heavy airconditionedABCs gelatscht. ABC ist eine Supermarktkette, die sich an jeder Straßenecke von Waikiki Beach breitgemacht und so zwischen den ganzen postsozialistisch anmutenden Hotelbunkern vermutlich allen Kolonialwarenläden das Licht ausgeblasen hat. ABC ist dennoch oder gerade deswegen der einzige Ort auf Hawaii, wo man New York Times, American Spirits, Starbucks-Doseneiskaffee auf einmal bekommt.
So unauffällig wie möglich stecke ich mir also jetzt im Rahmen meiner Schreibpause eine an. Der Statepark ist natürlich Non-Smoking-Area. Überall Verbotsschilder, die drakonische Strafen von bis zu 500 Dollar verkünden, wenn man erwischt werden sollte. Aber ich vertraue einfach mal meinen partners in crime, den versprengten Co-Smokern auf den Bänken um mich herum, überwiegend Homeless und Skater, die schon wissen werden, was sie tun. Nur eine kleine Urlaubsaufregung: es tut gut, sich über etwas hinwegzusetzen. Und das war ja auch immer meine Standardfrage gewesen, als ich noch für Andy Warhol’s Interview Magazine Leute wie Knausgård, Judith Hermann oder Richard Ford befragte: Hilft ein kriminelles Grundgefühl beim Schreiben?
Mit dieser Grundhaltung kann man sich aber genauso gut über andere Verbote hinwegsetzen, die man für sich selbst und das eigene Schreiben aufgestellt hat. Um dann noch mal ganz anders in den Tennisroman einzusteigen: Peinlicher, anmaßender, romanmäßiger. Denn: Gibt es etwas Peinlicheres und Anmaßenderes, als noch einen Roman schreiben zu wollen? – Ja, einen Familienroman zu schreiben.
Der Tennisroman als Familienroman würde mit der merkwürdigen Reminiszenz beginnen, wie Wilkow mal mit seiner Mutter im Kino gewesen war. Seiner armen Mutter, die in der Familie Tennis als Erste und ganz für sich allein entdeckt hatte. Als nettes, gesundes Hobby: sich einmal die Woche zum Damen-Doppel treffen so wie andere zum Handarbeiten oder Kaffee – bevor die Männer (sein Vater, Bruder und er) den Sport auf das Grausamste für sich okkupierten, die Sache mit ihrem heiligen Ehrgeiz so richtig angingen und so weiter. Der Film, in den er seine Mutter mitgenommen hatte, war ein französischer Autorenfilm, über den Wilkow vermutlich eine Filmkritik in der SZ gelesen hatte: Das Parfum von Yvonne oder Yvonnes Parfum. In Nordburg lief so etwas einmal pro Woche als Der besondere Film. Es handelte sich um einen dieser philosophisch veredelten französischen Softpornos, worauf die Filmkritik in der SZ damals sicherlich nur unzureichend hingewiesen hatte, denn sonst wäre er da garantiert nicht allein mit seiner Mutter reingegangen.
Wilkow erinnerte sich nicht mehr genau – er dachte eigentlich, er wäre damals jünger gewesen, vielleicht siebzehn.
Aber als ich den Film jetzt nur wegen seines Produktionsjahres noch mal googelte, fand ich heraus, dass Das Parfum von Yvonne von 1994 war, Wilkow also vierundzwanzig gewesen sein musste, was die Sache an sich – mit seiner Mutter ins Kino gehen – nicht weniger merkwürdig machte, das mit ihr verbundene Gefühl (vor Scham im Sitz versinken) aber etwas relativierte. Trotzdem war es ihm unangenehm gewesen (vielleicht überlegte er sogar, das mit den Filmkritiken sein zu lassen, die er damals manisch in den Feuilletons verfolgte, ausschnitt, fotokopierte, archivierte …).
Der Film handelte von einem jungen Mann, der in der mondänen Fünfziger-Jahre-Atmosphäre eines französischen Badeorts in die Fänge einer jungen Frau (Yvonne) und ihres älteren Begleiters geriet. Jede Menge knisternde Erotik zwischen den beiden jungen Liebenden (die Kamera immer nah unter dem Rock von Yvonne im Wind des Meeres). Jede Menge unmoralische, kluge Ratschläge des älteren Begleiters (der, wenn Wilkow sich richtig erinnerte, homosexuell war), denn die ganze Beziehung entwickelte sich natürlich unglücklich. Ständig ging es um das Wesen der »Portugiesischen Melancholie«, die klugerweise – das hatte Wilkow damals schon beeindruckt – nie erklärt wurde (schon gar nicht als Saudade oder so). Man ließ den Begriff einfach immer nur prätentiös nebenbei fallen – als etwas, das man kannte. Oder eben nicht.
E. guckt von einem Strandtuch auf, der anderen Seite der Welt hoch und winkt mir zu, als würde sie eine Szene aus Yvonne nachstellen. Sie hat eine Sonnenbrille auf, und ich kann ihren Blick nicht richtig lesen. Trotzdem fühle ich mich ertappt bei meiner Reminiszenz. Ich sollte jetzt auf einem Handtuch neben ihr liegen. Sonne tanken, Hawaii als Ferienstimmung oder Urlaubskrankheit in mich aufnehmen – statt hier irgendwelchen Roman-Erinnerungen hinterherzujagen.
Der Eindruck verblasst, bis auf ein entscheidendes Zitat. Denn was mir von dem französischen Film, den Wilkow vor Urzeiten gemeinsam mit seiner Mutter in einem Kino in Nordburg geschaut hatte, vor allem in Erinnerung geblieben ist, war nur eine kleine, denkbar kurze Szene. Tennis spielte in dem Film sonst keine Rolle. Einmal aber schauten der junge Liebhaber und der ältere Begleiter einem Spiel zu (der rote Aschenplatz leuchtete im nostalgischen Herbstlicht, die Spieler in elegantem Weiß). Und der weise alte Schwule sagte auf der Tribüne des Lebens zum jungen Mann ungefähr folgenden Satz: Die Welt könne kein ganz so schlimmer Ort sein, solange sich Menschen in langen weißen Hosen über ein Netz hinweg Bälle zuspielten.
4. Januar: Der amerikanische Tennisroman
Silbern glänzt die Tennis-HEROES-Ausgabe in der untersten Reihe des Zeitschriftenregals bei Barnes & Noble, das ansonsten von Militaria und Waffenheften dominiert wird. Ein paar NRA-Rentner in kurzen Hosen und Sandalen lungern rum und blättern interessiert in Zweiter-Weltkrieg-Magazinen. Hier ist an diesem Mittwoch nicht viel los, es riecht nach altem Teppich und Stadtteilbibliothek. Schon nach zwei Tagen brauche ich dringend eine Strandpause. Also haben E. und ich die Pink Line zum Ala Moana-Center genommen, nachdem uns an der Hotelrezeption angedeutet wurde, dass es dort eventuell eine Buchhandlung geben könnte (und wenn, dann mit Sicherheit die einzige auf der ganzen Insel). Aber tatsächlich fand sich dann in der riesen Shopping Mall ein Barnes & Noble, im stinkenden Untergeschoss gleich neben den Tiefgaragen.
Ich bin auf der Suche nach dem amerikanischen Tennisroman. Vor einer Woche bei Powell’s in Portland war der allerdings ebenso wenig vorrätig wie jetzt im Ala Moana bei Barnes & Noble. In beiden Fällen hätte das Buch erst bestellt werden müssen, was in den USA mehrere Wochen dauert, so dass man bei seinem Eintreffen im Laden schon wieder selbst außer Landes wäre.
Ein herber Rückschlag. Mein ganzer Schreibplan für diese Reise ist auf das Lesen des amerikanischen Tennisromans in Amerika ausgerichtet gewesen. Ich hab mir sogar extra keine anderen Bücher mitgenommen, um hier allein auf die String Theory von David Foster Wallace zurückgeworfen zu sein, die in Wahrheit natürlich kein Tennisroman ist. Bloß eine Kompilation von bereits anderswo veröffentlichten Texten oder Reportagen zum Thema. Die Idee war dennoch, mit dem eigenen Tennisroman zu beginnen, indem man sich die amerikanische String Theorynatürlich in Amerika besorgt, sonst funktioniert der Zauber ja nicht.
Bis heute bewahre ich den Bon von Infinite Jest in der Taschenbuchausgabe auf, die ich im September 2008 bei City Lights in San Francisco gekauft habe. Das war an dem Freitag, als die Lehman Brothers kollabierte. »Hier fehlen nur Rotweintrinker und Pfeifenraucher«, sagte eine Freundin über die Atmosphäre in der berühmten Buchhandlung, wo vormittags schon Jazz lief. Abends auf dem Weg zum Essen meinte ihr Mann, ob wir schon gehört hätten, dass der Autor, dessen Buch ich am Morgen gekauft und von dem ich ihnen ein bisschen erzählt hatte (über die Handlung: Incandenza, Tennis, Fernsehen, Drogen), ob wir also schon in den Nachrichten gehört hätten, dass sich dieser Autor heute erhängt hat. Ich weiß noch gut, wie hochalarmiert ich danach war – und wie wenig in der Lage, das als Zufall zu begreifen. Vielmehr fühlte es sich so an, als wäre ich damals in San Francisco auf eine ganz heiße (oder dunkle) Spur gestoßen.
So ähnlich geht es mir auch jetzt mit der Nicht-Existenz des amerikanischen Tennisromans in Amerikas Buchhandlungen. Wenn sie nicht mal die neueste Veröffentlichung eines ihrer wichtigsten Gegenwartsautoren auf Lager haben, kann mich das nur in der Abseitigkeit meines Themas bestätigen. Was in mir eine Mischung aus Panik und Erleichterung auslöst.
Statt der String Theory kaufe ich mir dann lieber schnell die silberne Tennis-HEROES-Nummer und das Can’t Sleep Coloring Journal, ein Malbuch für Erwachsene mit Schlafproblemen. Schnell, denn ich muss mich plötzlich beeilen. Jedes Mal, wenn ich zu lange in Buchhandlungen oder Bibliotheken bleibe, überkommt mich irgendwann ein akuter Kack-Impuls: mein Magen reagiert mathematisch auf Überangebot pro Regalmeter geteilt durch Lebens- mal Lese-Zeit. Gleich Klo. Keine Ahnung, ob es hier eins gibt.
Also zahle ich schnell mit Karte, und dann raus. Das Verlassen der Buchhandlung wirkt sofort, und der Magen entspannt sich. Aber als wir mit der Pink Line zurückfahren wollen, gibt es erneut Stress. Weil wir nicht den exakten Fahrpreis in Form von vier einzelnen Eindollarscheinen zur Hand haben (die Herausgabe von Wechselgeld würde die Mitarbeiter der Buslinie offenbar überfordern). Also gehe ich noch mal zurück ins Ala Moana, kaufe im erstbesten Café einen Americano mit Muffin und komme mit passendem Bargeld zurück. Beim nächsten Bus das nächste Problem: keine Getränke und kein Essen mit an Bord! E. streitet sich mit den Pink-Line-Managerinnen, deren blassgrüne Hawaii-Hemden an Ostblock-Uniformen erinnern. Es hilft nichts, wir müssen uns noch mal ganz hinten in die nächste Schlange für den nun übernächsten Bus stellen. Das heißt, ich nutze jetzt die Wartezeit, um in der knallenden Sonne der Designated Smoking Area zwanzig Meter neben der schattigen Haltestelle eine zu rauchen, den heißen Kaffee runterzunippen und mir den Muffin reinzuprügeln – das heißt, beides fluchend in die Mülltonne zu pfeffern, als auch schon die nächste Pink Line eintrudelt. Schwitzend hetze ich aus der tropischen Hitze zu E. in den Bus.
In dem Doppeldecker finden wir oben zwei Plätze. Während wir durch Downtown Honolulu zurück zum Hotel zuckeln, fühlt sich der Tennisroman inmitten dieser amerikanischen Tagebuch-Ereignisse ziemlich weit weg an. Allein, das ist ja genau der Plan gewesen: Als Autor schwankt jeder dauernd zwischen äußerster Hybris und innerster Selbstverdammung, die einander auf komplexe Art fast gegenseitig bedingen, hochschaukeln und dann auch wieder runterbringen. Ambition, Anspruch, Abfuck. Den großen Tennisroman seiner Generation schreiben zu wollen: Dagegen hilft vielleicht nur die literarisch niedrigste Form, das Tagebuch. Und hierfür gelten vor allem zwei Lehrsätze:
1. »Tagebuch kann jeder« (Der Kritiker).
2. »Tagebuch könnte ich nie« (Der Dramatiker – mit der Begründung, da könne er sich ja gleich selbst in die Tasche lügen).
Diese beiden Ansichten sollen mir nun ein Jahr lang gegen meine Roman-Ambition helfen. The problem is never the novel, the problem is always the author, wie Karl Ove Knausgård mal im Interview zu mir meinte. Auch mit Tagebuch ist also immer noch alles drin. Die Grenzen des Romans bleiben auch auf Hawaii die Grenzen der Welt.
Nachmittags in der Hotellobby schreibe ich mir das noch mal als Lehrsatz ins blaue Büchlein: Don’t fuck with the infinite. Passend dazu läuft im Hintergrund auf sämtlichen Fernsehern CNN. Zum niemals endenden Nachrichtenband unten auf dem Bildschirm fällt es mir leicht, mich auch mal auf was anderes zu konzentrieren.
5. Januar: Lenz
Seit ich auf Hawaii bin, hab ich diese deutsche Synchronstimme im Ohr, die sich erst mal aus der Kühlbox ein Bier nimmt und dann als Magnum in der gleichnamigen amerikanischen Detektivserie immer aus dem Off mit sanfter Ironie ein paar beruhigende Ratschläge parat hat: zum Beispiel, dass Dinge nie so schlimm sind, wie sie scheinen – selbst wenn man gemeinsam mit Zeus und Apollo das Anwesen eines Bestsellerautors bewachen muss und in kurzen Hosen mit seinen kryptoschwulen Kumpels Rick, TC und Higgins im Paradies festhängt.
Bevor ich am Tennisroman schreibe, gehe ich am frühen Nachmittag ins hoteleigene Gym, um mich trainierend dem Helden der Geschichte näher zu fühlen. Lenz.
Lenz, eigentlich Lorenz Neigenfind, war der Siebzehnjährige, den Wilkow vor Jahren (oder am absoluten Anfang des Tennisromans) bei den German Junior Open auf der Anlage von Rot-Schwarz Berlin in der zweiten Runde in drei Sätzen gegen einen viel besseren Tschechen tapfer verlieren sah.
Wie bereits berichtet, war Wilkow der einzige Zuschauer dieser Center-Court-Partie. Nach dem Match ging er zu den beiden Jugendlichen runter, die gerade ihre Schläger und Handtücher in identische rote Wilson-Taschen packten (sie hatten denselben Sponsor), und gratulierte ihnen auf Englisch zu ihrer Leistung. Beide sahen den Unbekannten fragend an, bevor der Tscheche sich knapp auf Englisch bedankte, Thanks, während Lenz einfach weiter seine Sachen packte. Nur an den Letzteren gewandt erklärte Wilkow dann auf Deutsch, dass er von Mark McCormack komme. Nur falls Lenz sich gefragt haben sollte, warum sich Wilkow während des Matches Notizen gemacht habe (Lenz hatte sich das nicht gefragt). Und dann erzählte Wilkow ihm auf möglichst unschwule Weise (erstes Kennenlernen zwischen nichtgleichaltrigen Männern, immer die Hölle), was er in ihm gesehen hatte. Er machte das den Umständen entsprechend gut. Es gelang ihm, Wörter wie Potenzial, Persönlichkeit oder Problem zu vermeiden. Er sprach nicht wie ein Mentor oder Manager. Auch nicht wie ein Berater oder Fan. Und schon gar nicht wie ein Trainer oder (noch schlimmer) väterlicher Freund.
Wilkow unterhielt sich ganz normal mit Lenz über Einzelsportarten, um ihn dann ziemlich unvermittelt zu fragen, ob er – in Trainingspausen oder wann auch immer – lesen würde. Lenz bejahte. Arthur hakte nach: Bücher? Romane? Nicken beziehungsweise Kopfschütteln. Und dann setzte Arthur alles auf eine Karte: ob Lenz sich vorstellen könne, einen Tennisroman zu lesen? Lenz schaute ihn nur kurz entgeistert an und reagierte dann so schnell, als würde er einen Aufschlag retournieren: »Sie wollen über mich schreiben, oder? Das können Sie schön vergessen.« Es war der Beginn ihrer Freundschaft. Einer absolut nicht väterlichen Freundschaft, einer Freundschaft im Zeichen von Tennis und Literatur oder besser gesagt: der Bewältigung eines Lebens mit Tennis und Literatur.
Inzwischen ist allerdings aus dem flauen Barnes&Noble-Bauchgefühl mit fremden Büchern von gestern durch konstantes Denken ans eigene Buch heute richtiger Durchfall geworden. Mit schweren Krämpfen sitze ich auf dem Klo des Hotel-Gym und versuche, nicht zu laut zu sein. Ein paar Kids hängen direkt vor der Klotür ab, wo die Ergometer stehen, und verbringen den Donnerstagnachmittag offenbar lieber airconditioned & indoor hinter den getönten Scheiben des Kraftraums als draußen am Hotelpool. Sie sind wie ich.
Nach der Entleerung die Erleichterung. Die Krankheit hat nur so lang gedauert wie eine Kindheitserinnerung auf dem Klo. Sicherheitshalber bleibe ich aber noch eine Weile sitzen (scheißegal, was die Kids denken). Aber es kommt nichts mehr. Es könnte auch am Wetter, an tropischer Melancholie oder dem Voltaren gelegen haben, das ich mir am Morgen gegen die Knieschmerzen eingeworfen habe. Gestern Abend bin ich noch laufen gewesen. Auf der Strandpromenade, vorbei am Statepark mit seinen Tenniscourts im Flutlicht und bis Diamond Head, einer Steilküste außerhalb der Stadt, wo die Surfer aufs Meer rauspaddeln und auf ihren Brettern in der Abendsonne schaukeln.
Ein letztes Reinhorchen ins Innere, aber die Krämpfe scheinen weg zu sein. Ich atme tief aus, spüle noch mal nach und wasche mir die Hände. Dann öffne ich entschieden die Klotür, geh an den American Kids vorbei – ein älterer Junge mit seinen beiden Geschwistern – und mache weiter Übungen.
Der Junge sieht aus wie ein Junior-Quarterback, eher fünfzehn als siebzehn. Konzentriert arbeitet er mit leichten Hanteln und beobachtet mich zwischendurch aus dem Augenwinkel bei meinen Übungen. Einmal nicken wir uns stumm zu, als ich zum Wasserspender gehe. Der kleine Bruder des Junior-Quarterbacks ist vielleicht fünf und guckt ihm bewundernd zu, bevor er eifrig eine neue Hantel bringt. Durch das Schweigen im Raum bekommen unsere Übungen fast etwas Andächtiges – wenn nicht ihre Schwester gelangweilt neben ihnen abhängen würde. Sie ist vielleicht zehn, sitzt mit baumelnden Beinen auf einem Ergometer, Smartphone in der Hand, Kopfhörer im Ohr, und drückt mit ihrer ganzen Körperhaltung aus, wie wenig sie das idiotische Geschehen um sie herum interessiert. Das Trainings-Gemälde wird komplettiert durch das Poster, das über den drei Geschwistern an der Wand des Gym hängt. Es zeigt die Startphase eines hawaiianischen Bootsrennens. Unter einem stürmischen Himmel wuchten muskulöse Einheimische ihre polynesischen Ruderboote in die Brandung. Die Ruderer erinnern eher an Rugby-Spieler und wirken gleichzeitig ungeschützter und kriegerischer, als American Football je sein könnte.
E. ist schon vom Strand zurück und sitzt auf dem Balkon, als ich aufs Hotelzimmer komme – und gleich noch mal runter zum ABC renne, um uns Bier und Wein für den Sundowner zu besorgen. Während die Sonne wie auf einer Postkarte im Pazifik versinkt, stoßen wir an, rauchen eine und reden darüber, wie die Reise weitergeht, morgen. Womöglich oder sehr wahrscheinlich werden wir dieses Hotelzimmer, diesen Balkon nie wiedersehen. Aber links unter uns liegt das Meer, rechts die Hügel hinter Honolulu, dazwischen die Hochhäuser der City, mittendrin das grüne Satteldach einer Kirche. Im Abenddunst sitzen vereinzelt andere Raucher auf anderen Balkonen, glühende Punkte in der Dämmerung grüßen zu uns rüber. E. erzählt von dem Roman, den sie gerade liest, Licht und Zorn von Lauren Groff, angeblich Obamas Lieblingsbuch. E. ist eine ebenso lebhafte wie genaue Leserin und kann Handlung so detailliert nacherzählen, dass es den Zuhörer fast genauso viel Nerven kostet, als müsste er den Roman selber lesen. Was ich nicht vorhabe.
6. Januar: Wer waren sie voreinander?
Im Bus treffe ich den zweiten interessanten Menschen seit unserer Ankunft. Wir sind unterwegs zum Flughafen und haben diesmal nicht die Pink Line genommen, sondern den normalen Linienbus, so als würden E. und ich nach fünf Tagen schon immer hier leben, das heißt, nachdem sie uns im Hotel erklärt haben, wie das geht. Am Airport ist der Car Rental, wo wir den Mietwagen abholen müssen, mit dem wir in den kommenden Tagen die Insel erkunden wollen. Das Gepäck haben wir im Hotel gelassen, weil man es im Linienbus nicht mitnehmen darf, das müssen wir also gleich noch abholen. Aber »gleich« ist auf Hawaii relativ. Der Linienbus hält an jedem zweiten der riesigen Wohnblöcke, die in der parkähnlichen Umgebung von Waikiki alle wie Hotels aussehen, als plötzlich der zweite interessante Mensch von Hawaii zusteigt: die Frau hat ein asiatisch hübsches Gesicht (blass, desinteressiert) und trägt ein französisches Business-Kostüm (weiße Bluse, schwarzer Rock, Strumpfhose, Ballerinas) und setzt sich in die Reihe neben uns. Weil sie ganz klar keine Touristin ist, sondern sich hier offenkundig in ihrem Alltag auf dem Weg zur Arbeit befindet, gleichzeitig mit ihrem Petite-European-Look absolut nicht hierherpasst, kann ich nicht anders, als sie aus den Augenwinkeln zu mustern und mich für einen heftigen Moment genauso verloren in der tropischen Sunshine-Flip-Flop-Welt Waikikis zu fühlen wie sie. Ein Rückfall in die Schreibkrankheit: Staring at women, Beobachtungsgabe trainieren.
Versuch einer kleinen Kurzgeschichte, wie sie hier lebt. Maggie Chung (sie dürfte auch nicht zu französisch heißen!), 29, lebt allein in einem kleinen Apartment mit Seitenblick auf den Pazifik, arbeitet bei der Bank Chase als persönliche Assistentin der blonden Kalifornierin Linda de Vries, 37, mit der sie seit zwei Jahren eine Affäre hat, die die beiden sofort publik machen würden, wenn sie nicht mehr denselben Arbeitgeber hätten. Maggie bewirbt sich gerade bei anderen Banken, will aber auch nicht die Insel verlassen …
Aus irgendeinem Grund kann ich mir vorstellen, dass sie eine Leserin sein könnte, Emily Brontë oder Gone Girl. Und tatsächlich öffnet sie jetzt ihre Handtasche, holt ein iPhone heraus und beginnt etwas zu spielen, bei dem Piktogramme von Vögelchen oder Monstern übers Display dirigiert werden müssen … Okay. Wann fing das eigentlich an, dass Leute nicht mehr normal im Öffentlichen Nahverkehr rumsitzen können und einfach nichts tun?
Anstrengender als die jetzt sofort nervende Beobachtung der Asiatin neben mir ist nur der Wunsch, ihr dennoch etwas über meinen Tennisroman erzählen zu wollen. Als schlechte Simulation von Nahverkehrs-Smalltalk (»… oh, and what is it you are so obsessed with?«), unterbrochen von Zwischenfragen, mit denen Maggie Chung durchschauen würde, dass ich ebenso wenig wie sie Tourist bin, sondern stranger in a strange land: ein Reisereporter, unterwegs in den eigenen Roman.
Anders als dem Überfahrer in Portland würde ich der potenziellen Nicht-Leserin allerdings einen romantischen Jugendroman erzählen. Die einfache Geschichte der unwahrscheinlichen Freundschaft zwischen einem jungen Tennistalent und einem mittelalten Politikberater, der mal Autor war und denkt, er könne mithilfe des Jungen noch mal was schreiben. (Für Maggie Chung würde ich auf eine frühe Romanphase zurückgreifen, in der Arthur Wilkow tatsächlich Politikberater war und entgegen seinen eigenen Überzeugungen eine CDU-Ministerin betreute, was dann aber in der Realität meines Schreibens überraschenderweise nirgendwohin geführt hat.)
Der Junge hatte eine harte Benedict-Wells-Kindheit: beide Eltern kamen bei einem Autounfall ums Leben, als er zwei Jahre alt war. Danach wuchs er bei seiner Tante auf, einer (laut Neffe) »nymphomanischen« Berliner Galeristin, die selber keine Kinder hat, den Neffen sehr liebt und ihn auf sogenannte Tennis-Akademien nach Marbella und Florida schickt, wo der Junge an Heimweh erkrankt, bis er bemerkenswerterweise an sich selbst feststellt, dass er nicht als Schnösel (oder als verwöhntes Waisenkind, als »Sensibler«) enden will und sich neben seinen Vorhand- und Rückhandschlägen auch eine innere Härte antrainiert, die er nach außen mit Zurückhaltung und Freundlichkeit überspielt, wobei er sich zu einem der Welt (aber nicht unbedingt der Literatur) zugewandten Wesen entwickelt.
Jedenfalls ist der Politikberater von dem Jungen beeindruckt, als die beiden sich auf der Anlage von Rot-Schwarz Berlin kennenlernen (kurzer Blick, ob Maggie Chung die gewagte Stendhalisierung begreifen würde, kein Tennisclub der Welt würde sich die Wappenfarbe Schwarz verpassen). In der Folge treffen sich der Berater und der junge Tennisspieler regelmäßig, um gemeinsam ein paar Bälle zu schlagen oder Mittag zu essen. Oder auch nur zwischendurch auf einen Kaffee und ’ne Cola, um dabei die Lage zu besprechen – es geht fast immer nur um Tennis, Bücher und Liebe, aber jeweils auf eine fatale Art …
»Fatally?«, würde Maggie Chung (was für ein bekloppter Name!) vielleicht kurz dazwischenfragen und sich vor allem für die Orte interessieren, Cafés, Restaurants und Bars in Berlin, in denen sich der Berater und der Junge trafen. Berlin, das interessierte sie wirklich (»I would love to go there!«). Mir würden spontan nur ein paar Mitte-Spots wie das Alte Europa, die Z-Bar, das Distrikt oder Prassnik einfallen, um mich dann aber nicht weiter in diesen Details zu verlieren, sondern Maggie Chung lieber auf das Wesentliche hinzuweisen. Wie der Ältere und der Jüngere sich gegenseitig aus der Krise helfen.
Denn es gibt eine Schreibkrise und eine Tenniskrise. Beide haben die Lust verloren. Was sie einst so gut konnten und ihnen so viel Freude machte, ist zum Problem geworden: Tennis und Literatur, die kompliziertesten Spiele (wenn du einmal anfängst, über eine verinnerlichte Bewegung nachzudenken, triffst du nie wieder eine Rückhand, hinterfragst den Klang jedes Wortes).
Aber wenn der Junge mit dem ehemaligen Autor ausschließlich Bälle über ein Netz schlägt – Wilkow weiß immer noch nicht, ob der Spruch im Parfum von Yvonne nicht doch eher Verarschung war –, sind sie in diesem Augenblick sämtliche Ambitionen und Sorgen los. Es geht nur noch darum, den Ball im Spiel zu halten (statt ihn sich um die Ohren zu hauen). Rhythmus und Ruhe, lange Grundlinienschläge, Bundesliga und Bezirksliga, langsam gewinnt der Junge seine Freude am einfachen Spiel zurück: hier hat der Jugendroman schon fast etwas von einem Tennismärchen.
Wenn der Autor (der sich nur noch äußerlich als Politikberater fühlt, eine leere, lebensmüde Hülle …) den Jungen für Romane begeistern will, muss der Ältere, der seinen Geschmack nach Jahrzehnten des Lesens so verfeinert, aber auch ermüdet hat, dass er kaum noch Romane erträgt, wieder zu den frühsten Werken zurückgehen, die ihn einst begeisterten: den Fänger im Roggen, Jack London, Das große Heft, Das obszöne Werk. So beginnt er selbst wieder, die Literatur mit den Augen des Jungen zu sehen und sich an einfachen Erzählungen zu erfreuen … Beide begreifen, dass sie einen Einzelsport betreiben, den man nicht allein spielen kann.
»Alright, and where is the conflict? Where does your story begin?«, könnte Maggie Chung ungeduldig fragen, vielleicht weil ihre Haltestelle näher rückt, vielleicht aber auch, weil sie recht hat.
Okay, würde ich antworten: der Konflikt beginnt damit, dass beide Hintergedanken haben. Der Junge geht mit zwei Mädchen aus seinem Tennisclub gleichzeitig, aber wirklich scharf ist er auf eine Bloggerin aus der Nachbarschaft, von der er nur weiß, dass sie eine büchersüchtige Leserin ist (weil er oft Pakete für sie entgegennehmen muss), und bei der er mit der realen Freundschaft zu einem echten Autor landen möchte. Und Wilkow will logischerweise über Lenz schreiben.
Hier würde Maggie Chung vermutlich aus dem Jugendroman aussteigen: »Why these names all of a sudden! Who is Wilkow, and who is Lenz? Isn’t this a complete different story: to write about a younger boy? I think it’s creepy…«
Und ich müsste Maggie Chung dann damit beruhigen, dass Wilkow sich ganz offiziell bei der Erziehungsberechtigten von Lenz vorgestellt hat. Bei einem Mittagessen im Borchardt überzeugte Wilkow die Tante von Lenz nicht nur von seinen Schreibabsichten, sondern konnte auch sofort ihre Bedenken zerstreuen, warum ihr Neffe jetzt dauernd mit einem fast dreißig Jahre älteren Typen abhing, indem er Patrizia Neigenfind versicherte, dass Lenz ein völlig normaler Junge sei. Im Helmut-Lang-Anzug mit offenem Hemd und Lust an der Verkleidung als reicher Kyniker und slicker Gesellschaftslöwe. Er hatte sich in Magazinen wie Monopol oder Art ausführlich über die Galeristin vorab informiert, die wiederum auch entfernt wusste, wer er war (weil er mit E. zusammen war und die beiden sich aus der unvermeidbar engen Berliner Szene aus Fashionweeks und Gallery-Weekends kannten). Also erklärte Wilkow ihr, wie gut es ihm tat, mit Lenz ab und zu ein paar Bälle zu schlagen, ein wenig über Bücher zu reden und eventuell ein längeres Porträt fürs Tennis Magazin über ihn zu schreiben. Patrizia Neigenfind schaute etwas länger aus dem Fenster des Borchardt auf das graue Treiben in der Französischen Straße, draußen ein ganz normaler Geschäftstag, und fand eine Reportage fürs Tennis Magazin zu vulgär. Aber als Wilkow meinte, er könnte sich eigentlich auch einen Tennisroman über ihren Neffen vorstellen, war sie sofort begeistert. Danach zog Lenz Wilkow noch eine ganze Weile eben damit auf, wie »begeistert« die Tante ihm von dem Treffen mit »deinem Autor« vorgeschwärmt hatte. Lenz nannte ihn deswegen einen verdammten Politiker oder einfach nur »Bascombe« (den Sportreporter), beschuldigte ihn sogar irgendwann – als sie sich mal eine Zeit lang häufiger zum Mittagessen trafen –, eine Affäre mit seiner Tante gehabt zu haben …
Und, hätte ich Maggie Chung damit vor den kleinen Monstern und Vögelchen ihrer iPhone-Welt gerettet? Wake up and get real, man.
Als ich E. auf unsere Sitznachbarin aufmerksam mache, antwortet sie nur: »Das ist eine Verkäuferin bei Prada, die arbeitet im Ala Moana.« Und tatsächlich ist dort für Maggie Chung Endstation. Sie steigt aus, als der Bus vor der riesigen Mall hält, um uns danach weiter vorbei an braunen Bürokomplexen, heruntergekommenen Kinos und Obdachlosen-Camps irgendwann im Industriegebiet unter den Autobahnbrücken zu den Car Rentals am Airport zu bringen.
Den Rest der Fahrt gucken wir gebannt aus dem Fenster oder unterhalten uns über die Terrorattacke auf den Flughafen von Fort Lauderdale, die heute Morgen als Breaking-News-Endlosschleife über die Fernseher in der Hotellobby lief, fünf Tote so far, ein Einzeltäter oder mehrere. Beim Auschecken waren wir froh, dass wir keine 200$ Strafe für Rauchen auf dem Balkon zahlen mussten (das hatte E. erst heute Morgen in der Hotel-Directory gelesen). Im Gegenteil, E. handelte sogar noch einen Nachlass raus wegen der Eismaschine hinter unserer Zimmerwand, die nachts über die Air-Condition hinweg Lärm machte, als würde jemand Wackersteine durch unsere Träume wälzen.
7. Januar: Das schwache Denken
Die Befürchtung, dass die Insel zu klein sein könnte, um sie eine Woche lang mit dem Auto zu erkunden, kam uns erst, nachdem wir gestern den Mietwagen abgeholt hatten. Außerhalb von Honolulu gibt es wegen einer strengen Bebauungspolitik kaum Hotels, Motels oder Bed&Breakfasts auf O’ahu. So finden wir am späten Freitagabend nur mit Mühe und Not noch ein Zimmer im Marriott Courtyard Inn in La’ie, einer kleinen Mormonen-Gemeinde am North Shore.
Heute frühstücken wir dort in einem original hawaiianischen Geheimtipp aus E.s Reiseführer, einem runtergekommenen Café voller übergewichtiger Einheimischer, die weißen Touristen nicht eben freundlich gegenübertreten und ihnen so immerhin klarmachen, dass die US