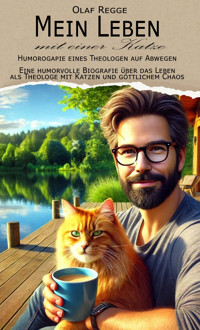
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: olaf-regge.de
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Katzen, Glaube und das ganz normale Chaos Ein Theologe erzählt aus seinem Leben!Wer glaubt, Theologen führen ein geordnetes, besinnliches Leben, der irrt gewaltig besonders, wenn Katzen im Spiel sind! In Mein Leben mit einer Katze Humorogapie eines Theologen auf Abwegen erzählt Olaf Regge mit einer ordentlichen Portion Humor von den überraschenden Umwegen, die das Leben (und die Katzen) für ihn bereithielt.Von der Kindheit auf dem Bauernhof über eine unerwartete Karriere als Elektriker bis hin zum Leben als freier Theologe und Hochzeitsredner dieses Buch ist eine humorvolle Biografie voller skurriler Erlebnisse, tierischer Weisheiten und göttlichem Chaos. Dabei spielen Katzen immer wieder eine entscheidende Rolle: Sei es als stiller Beobachter, als liebevoller Störenfried oder als selbsternannter Lebensberater mit Schnurrhaaren.Was dich erwartet: Katzenwahnsinn pur: Wer mit Katzen lebt, weiß, dass sie nicht nur den Alltag auf den Kopf stellen, sondern auch gnadenlose Lehrmeister in Sachen Geduld und Selbstaufgabe sein können. Von Theologie zu Stromschlägen: Was passiert, wenn ein Theologe beschließt, Elektriker zu werden? Richtig, er landet schneller im Chaos, als er Schöpfungsgeschichte sagen kann. Humor mit Tiefgang: Skurrile Geschichten, ironische Reflexionen und tiefgründige Erkenntnisse über das Leben stets mit einem Augenzwinkern erzählt. Hochzeiten, Beerdigungen und Stromausfälle: Ein freier Theologe muss auf alles vorbereitet sein inklusive der Möglichkeit, dass eine Katze die perfekte Predigt mit einem gezielten Pfotenhieb ins Chaos stürzt. Eine Geschichte für die ganze Familie: Egal, ob Katzenliebhaber, Theologie-Interessierte oder einfach nur Fans von humorvollen Lebensgeschichten dieses Buch lädt zum Lachen, Schmunzeln und Nachdenken ein.Für wen ist dieses Buch? Für alle, die Katzen lieben (und trotzdem weiterhin mit ihnen zusammenleben) Für Theologen, die sich fragen, wo Gott steckt, wenn die Katze mal wieder das Mittagessen stiehlt Für Menschen, die wissen, dass Pläne nur so lange halten, bis das Leben (oder eine Katze) dazwischenkommt Für alle, die eine witzige, lebensnahe und inspirierende Biografie lesen möchtenFazit:Mein Leben mit einer Katze Humorogapie eines Theologen auf Abwegen ist ein herzerwärmendes, augenzwinkerndes Buch über die unerwarteten Wendungen des Lebens erzählt von einem Mann, der sich nie zu schade war, über sich selbst und die kleinen Katastrophen des Alltags zu lachen.Ob du Katzenbesitzer bist, einen Draht zu Theologie hast oder einfach gerne unterhaltsame Geschichten liest dieses Buch wird dich begeistern, inspirieren und vielleicht sogar dazu bringen, deine eigene Katze mit neuen Augen zu sehen.Denn eines ist sicher: Katzen und göttliches Chaos gehören untrennbar zusammen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mein Lebenmit einer Katze
Humorogapie eines Theologen auf Abwegen
Eine humorvolle Biografie über das Lebenals Theologe mit Katzen und göttlichem Chaos
Olaf Regge
Copyright © 2025 Olaf Regge
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN: 9783689957780
Verlag: Olaf-Regge.de
Widmung
Für alle, die jemals dachten, sie hätten ihr Leben unter Kontrolle – nur um dann festzustellen, dass die Katze das Sagen hat.
Für die Theologen, die glauben, den göttlichen Plan zu verstehen – bis sie erleben, wie eine Katze eine perfekte Predigt mit einem gezielten Pfotenhieb durcheinander bringt und sie es erst auf der Kanzel merken.
Für die Handwerker, die dachten, sie könnten jedes Chaos in Ordnung bringen – bis eine Katze beschließt, dass Kabel das ultimative Kauspielzeug sind.
Und für alle, die wissen:Der wahre Sinn des Lebens besteht darin, sich einer schnurrenden, eigenwilligen Miniatur-Diva zu unterwerfen und es mit Humor zu nehmen.
Möge dieses Buch euch erheitern, inspirieren – und euch daran erinnern, dass Katzen und göttliches Chaos oft dasselbe sind.
Danksagung
Mein besonderer Dank gilt Christina Klittich, die nicht nur den Mut hatte, sich meinem kreativen Wahnsinn in Form eines Lektorats zu stellen, sondern dabei auch noch so freundlich war, meine zahllosen Tippfehler, Satzbauabenteuer und theologischen Abschweifungen zu zähmen – quasi die Katzenflüsterin unter den Lektoren! Ohne sie wäre dieses Buch vermutlich eine Mischung aus Predigt, Kabelsalat und Katzenkrallen-Markierungen geworden. Christina, du hast nicht nur meine Sätze geglättet, sondern auch meine Nerven geschont – dafür verdienst du einen Ehrenplatz in der Hall of Fame der literarischen Helden!
Danke an all die Menschen, die mir mit ihren Geschichten, Ermutigungen und gelegentlichen „Soll das wirklich SO da stehen?!“-Fragen geholfen haben, dieses Buch zu vollenden.
Und natürlich ein ganz besonderer Dank an die Katzen dieser Welt – für ihre Inspiration, ihre gnadenlose Ehrlichkeit und ihre Fähigkeit, sich immer genau dann auf die Tastatur zu setzen, wenn man gerade den perfekten Satz gefunden hat. Ohne euch gäbe es dieses Buch nicht. Und vermutlich auch deutlich weniger zerstörte Möbel.
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Bauernhof des Lebens - Mein Leben mit einer Katze
Vom Stromschlag zum Eheglück – Ein Theologe auf Abwegen
Ein Zuhause für ein neues Leben – Das Haus am See
Der Freie Theologe – Mein Leben mit Kätzchen
Der Katzenzirkus nimmt Fahrt auf – von Rabenmutter zum Katzenvater
Mein neuer Alltag – Die Besucherkatze
Katze oder Kater – Fragen und Antworten
Theologischer Reparaturdienst – Dinge der Verbindung
Schlafmangel – Gemeindearbeit im Gotteshaus
Futtervorratshandel – Schmaus der Könige
Die Wahl des Restaurants – Jeder hat seine Aufgabe
Endlich Ruhe – Pelziger Besucher
Badeparty – Diva im falschen Gewand
Ein tierisches Geschenk – Yoga für Anfänger
Die Sache mit dem Katzenklo – Fenster zu
Nachbarschaftshilfe – Katze ohne Eier
Das Klo-Drama –Hochzeitsgesprächsprengung
Pfotenrochade - Schachturnier mit Problemen
Kratzweltmeister - Der ungebetene Karton
Ein würdiger Abschied – Neue Katzenhaarverzierung
Das Monstrum – Eingangsbereich blockiert
Der Fernsehsessel – neuer Ruheplatz
Ein Abend am See – Mutti ist die Beste
Die nächtliche Jagd – Katze spielt Lego
Urlaub im Spätherbst –Kofferpacken zum Abschied
Epilog
Prolog
Das Leben ist eine äußerst seltsame Angelegenheit. Man könnte es mit einer Katze vergleichen, die in der Küche eine leere Sardinendose im Mülleimer riecht: Sie ist neugierig, chaotisch und es passieren immer die unerwartetsten Dinge. Ja, wenn man nicht aufpasst, dann sitzt sie plötzlich schnurrend auf dem Küchentisch und hat das Abendessen für sich beansprucht. Aber genau das macht es ja auch so wunderbar spannend.
Stellt euch das Leben als eine Art nicht ganz vertrauenswürdiges Navi vor. Es verspricht euch eine klare Route: geradeaus, links abbiegen, immer der Straße folgen. Und dann, kurz vor dem Ziel, entscheidet es sich plötzlich für eine Umleitung über eine Schotterpiste voller Schlaglöcher, wo es vielleicht sogar regnet und der Handyempfang ausfällt. „Warum?“ fragt ihr euch dann. Nun, das Leben hat seine eigenen Pläne. Und seien wir ehrlich: Die besten Geschichten passieren nicht, wenn alles wie geplant läuft, sondern wenn die Katze beschließt, mitten auf die Tastatur des Laptops zu springen, während man gerade versucht, einen wichtigen Text zu schreiben.
Das Leben ist voller solcher Katzenmomente. Du planst alles minutiös, und dann kommt ein schnurrender Pelzball und macht dir einen Strich durch die Rechnung. Und was bleibt uns da anderes übrig, als die Schultern zu zucken und darüber zu lachen? Es gibt eine alte Weisheit, die besagt, dass man die Dinge entweder ernst nehmen oder darüber lachen kann. Und glaubt mir, mit einem Kater auf der Tastatur bleibt einem nur das Lachen. Man kann den Störenfried schließlich schlecht wegdiskutieren.
Manchmal denken wir, wir hätten alles unter Kontrolle – Job, Beziehung, Freizeit. Doch dann wirft das Leben uns eine Banane auf die Straße, auf der wir elegant ausrutschen, während eine Taube über unserem Kopf uns auslacht. Was wir dabei oft vergessen, ist, dass genau diese Momente die Würze des Lebens sind. Die Unordnung, das Durcheinander, das spontane Auf-den-Kopf-Stellen all dessen, was wir so schön geordnet hatten. Das Leben ist nicht die gerade Linie eines Stromkreises, sondern eher ein wilder Kabelsalat hinter dem Fernseher, den man einmal im Jahr verzweifelt entwirren muss.
Und wisst ihr, was das Schönste daran ist? Wir müssen es nicht perfekt machen. Wir müssen nicht immer die richtige Route finden, den perfekten Plan haben oder den wildesten Kabelsalat sofort sortieren. Das Leben ist chaotisch, wir sind es auch, und das ist völlig in Ordnung. Es ist okay, wenn die Katze den Weg versperrt, wenn der Plan durcheinanderkommt und wenn wir uns einfach treiben lassen. Denn genau das sind die Momente, an die wir uns später erinnern – nicht das geplante Abendessen, sondern das, wo wir zum schön gedeckten Tisch kommen, die Katze auf dem Tisch sitzt und genüsslich am Braten knabbert.
Also lasst uns das Leben genießen, in all seiner wirren und katzenhaften Unberechenbarkeit. Lasst uns lachen, wenn es chaotisch wird, und uns freuen, wenn alles ein bisschen anders kommt als geplant. Denn genau das ist das wahre Abenteuer: Man weiß nie, was als Nächstes passiert – aber eins ist sicher: Es wird unterhaltsam.
Bauernhof des Lebens - Mein Leben mit einer Katze
Ach, die Kindheit! Das war die Zeit, in der man glaubte, die Welt wäre ein großer Abenteuerspielplatz und die einzigen Sorgen bestanden darin, ob man noch ein weiteres Stück Kuchen von Oma bekommen würde. Bei mir drehte sich in diesen Jahren vieles um den kleinen Bauernhof meiner Großeltern, auf dem ich viele Wochenenden und Ferien verbrachte. Es war ein Ort, der nach frisch gemähtem Gras, nach Heu und den seltsamen, aber irgendwie beruhigenden Gerüchen der Ställe duftete. Ein Ort, an dem Hühner gackernd über den Hof liefen, Kühe genüsslich auf der Weide kauten und Schweine zufrieden im Matsch wühlten. Und dann waren da noch die Katzen.
Ja, die Katzen. Diese eleganten, fast majestätischen Geschöpfe, die sich mit einem leisen "Miau" überall Zugang verschafften – außer ins Haus meiner Großeltern. Denn so süß und verspielt sie auch waren, Katzen im Haus? Undenkbar! Für meine Großmutter war das eine eiserne Regel, die sie nur mit einem strengen Blick und einem kurzen „Da gehör’n die nicht hin!“ verteidigte. Aber ich liebte sie trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb. Sie hatten etwas Geheimnisvolles an sich. Sie schlichen mit erhobenem Schwanz über den Hof, als wäre er ihr persönliches Königreich, und hielten sich doch immer in sicherer Distanz, wenn Oma den Besen schwang.
Ich habe oft am Rand des Hühnergeheges gesessen und die Katzen beobachtet, wie sie sich lautlos durchs Gras bewegten, die Augen immer aufmerksam auf die flatternden Hühner gerichtet. Ich stellte mir vor, dass sie edle Jäger aus alten Zeiten wären, die auf ihrer Lauer lagen. Und irgendwie war das gar nicht so weit hergeholt, wie ich später herausfand. Denn die Geschichte der Katzen beginnt vor vielen tausend Jahren, in einer ganz anderen Welt...
Wenn wir über Katzen sprechen und uns dabei an ihre königliche, majestätische Ausstrahlung erinnern, dann müssen wir unweigerlich nach Ägypten reisen – ins Land der Pyramiden, der Pharaonen und einer ziemlich speziellen Besessenheit für alles, was miauen kann. Ägypten, das war sozusagen das Las Vegas der Antike für Katzen. Hier wurde die Katze nicht nur als schnurrendes Haustier angesehen, sondern regelrecht als Gottheit mit VIP-Status verehrt. Und glaubt mir, wenn Katzen heute schnippisch das Wohnzimmer durchqueren und dabei alle ignorieren, als seien sie die Königin von Saba, dann liegt das daran, dass sie diese Attitüde schon seit tausenden von Jahren kultivieren.
Schätzungsweise um 2000 v. Chr. – also zu einer Zeit, als es noch keine gemütlichen Sofakissen und Katzen-Yoga auf YouTube gab – tauchten die ersten domestizierten Katzen in Ägypten auf. Damals, als die Menschen noch fleißig Pyramiden bauten und komplizierte Hieroglyphen in Stein meißelten, schlichen sich diese eleganten, felligen Kreaturen in die Herzen der Ägypter. Es begann ganz pragmatisch: Die Vorratshäuser der Ägypter, bis oben hin gefüllt mit Getreide, Brot und vermutlich dem alten ägyptischen Äquivalent von Haferflocken, waren das Schlaraffenland für Ratten und Mäuse. Die kleinen Nager veranstalteten da drinnen wahre Fressgelage. Was sie aber nicht ahnten: Ihre Party war bald vorbei.
Denn mit dem Auftauchen der Katzen bekamen die Mäuse und Ratten einen ungebetenen Gast auf der Tanzfläche: ein pelziger Raubtier-DJ, der die Musik stoppte und die Tanzfläche räumte – und zwar gründlich. Die Katzen, diese perfekten Jäger mit ihren messerscharfen Krallen und lautlosen Pfoten, machten kurzen Prozess mit den Nagern und schafften es so, dass die Menschen ihre Lebensmittel wieder genießen konnten, ohne dass kleine Krümelmonster sich darüber hermachten.
Doch die Ägypter, diese schlauen Köpfe, sahen nicht nur die Nützlichkeit der Katzen, sondern erkannten schnell, dass sie es hier mit ganz besonderen Geschöpfen zu tun hatten. Diese Augen! Diese Eleganz! Diese „Ich mache genau das, was ich will und du kannst nichts dagegen tun“-Attitüde! Es dauerte nicht lange, und die Katzen eroberten die ägyptischen Haushalte im Sturm. Nicht als kleine pelzige Angestellte, sondern als – und jetzt wird’s spannend – lebende Götter.
Die Ägypter waren so begeistert von den Katzen, dass sie ihnen eine eigene Göttin widmeten: Bastet. Bastet, die katzenköpfige Göttin mit dem Körper einer Frau (oder war es andersherum?), wurde zur Beschützerin von Heim und Herd, zur Göttin von Anmut, Schönheit und Fruchtbarkeit. Man muss sich das so vorstellen: In einem Haushalt des alten Ägyptens war es völlig normal, dass man eine kleine Statue von Bastet neben dem Eingangsbereich aufstellte. „Zum Schutz vor bösen Geistern“, sagten die Ägypter, aber vermutlich auch, damit alle Besucher direkt wussten: Hier ist das Reich der Katze, bitte mit Respekt betreten. Und wehe, jemand traute sich, das nicht zu respektieren!
Die Katzen wandelten damals regelrecht als lebende Götter durch die ägyptischen Städte und erlangten einen Status, von dem selbst heutige Promis nur träumen können. Jeder Katzenbesitzer kennt diesen Blick – dieser eine Blick, der deutlich sagt: „Du bist mein Diener, und ich lasse es dich gnädig wissen, dass ich überhaupt in deiner Gegenwart weile.“ Tja, so verhielten sich die Katzen schon damals. Ob sie über die Sandstraßen schlenderten oder auf den Dächern von Luxor dösten – überall wurden sie verehrt, bewundert und auf Händen getragen.
Die Ägypter trieben ihre Katzen-Verehrung so weit, dass das Verletzen oder gar Töten einer Katze ein todernstes Verbrechen war. Tja, versuche man einer Katze auf den Schwanz zu treten oder ihr einen Tritt zu verpassen, stand dir damals eine Anklage bevor, als hättest du den heiligen Pharao persönlich beleidigt. Die Strafen für so eine Tat? Manchmal ging das tatsächlich bis zur Todesstrafe. Man stelle sich das mal vor: „Weshalb wurde der Mann hingerichtet?“ – „Ach, er hat sich versehentlich auf die Pfote einer Katze gesetzt.“ Klingt absurd, oder? Aber so groß war die Macht der Katzen damals. Sie waren unantastbar, und jeder Ägypter wusste: Wenn eine Katze beschließt, auf deinem Kopfkissen zu schlafen, dann schläfst du gefälligst im Heu.
Ein weiteres kurioses Detail der Katzenverehrung im alten Ägypten: Wenn eine Katze verstarb, war das ein Familienereignis, das man in etwa mit dem Tod eines sehr, sehr geliebten Familienmitglieds gleichsetzte. Die Besitzer rasierten sich zum Zeichen der Trauer die Augenbrauen ab und hielten monatelange Trauerzeremonien ab. Versuchen Sie das mal heute, wenn Ihre Katze verstirbt, und sehen Sie zu, wie Ihre Kollegen Sie verständnislos anstarren. „Warum trägst du denn eine schwarze Robe?“ – „Meine Katze ist gestorben.“ Und zack, werden Sie zur urbanen Legende.
Durch diese göttliche Anbetung wurden die Katzen in den ägyptischen Tempeln regelrecht verhätschelt. Die Priester, die Bastet die den Katzengeistern dienten, versorgten die Tiere mit Opfern – nein, sie wurden nicht von den Priester-Novizen bedient. Die Prieser reichten die feinsten Leckerbissen: Fisch, Fleisch, Milch – das Beste vom Besten. Die Katzen, die auf den Treppen des Tempels ruhten, wussten um ihren Status und gaben sich mit einer Gelassenheit, die jeden Hund in den Wahnsinn getrieben hätte. Wo andere Tiere hektisch bettelnd durch die Straßen rannten, saßen die Katzen da und warteten darauf, dass die Menschen ihnen huldigten. „Miau“ bedeutete in etwa: „Noch ein Häppchen, bitte. Und diesmal bitte in kleineren Stückchen.“
Die jahrtausendelange Verehrung der Katzen in Ägypten führte dazu, dass ihr königlicher Ruf über die Landesgrenzen hinausreichte. Händler, Reisende und Seeleute trugen die Geschichte dieser gottgleichen Kreaturen in andere Länder – und, natürlich, auch die Katzen selbst. Die Katzen reisten mit den Schiffen der Phönizier, stiegen in die Boote römischer Soldaten und nisteten sich schließlich in den Stuben der europäischen Adelshäuser ein. Während die Pharaonen Pyramiden bauen ließen und in grandiosen Grabkammern in die Ewigkeit einzogen, ließen es sich die Katzen gemütlich machen – sie reisten einfach weiter und eroberten die Herzen und Haushalte der Menschen überall auf der Welt.
Ihre königliche Haltung, dieses subtile „Komm mir nicht zu nahe, aber bitte bleib in meiner Nähe“-Spielchen, hat sich über Jahrtausende hinweg in ihrem Verhalten gehalten. Noch heute, wenn Ihre Katze sich mit erhobenem Schwanz durch Ihr Wohnzimmer bewegt und dabei einen Blick aufsetzt, als müsse sie sich durch eine Menschenmenge von minderwertigen Dienern schlängeln, dann erinnert das stark an ihre Zeit im alten Ägypten. Ein unsichtbarer Thron, ein Hauch von Unnahbarkeit – und eine Erwartungshaltung, dass der Futternapf nie leer und das Kissen stets plüschig genug ist.
Manchmal frage ich mich, was wohl passiert wäre, wenn die Ägypter nie auf die Idee gekommen wären, die Katzen als Götter zu verehren. Würden unsere Stubentiger uns dann heute auch mit so viel Verachtung strafen, wenn wir ihren Napf nicht schnell genug füllen und nicht mit dem Futter, auf das sie gerade Appetit hat? Wahrscheinlich nein. Denn Katzen – und das muss man ihnen lassen – haben es seitdem drauf, ihren Status als halbgöttliche Wesen aufrechtzuerhalten. Ob sie damals in den Tempeln von Bastet faulenzten oder heute auf meinem Laptop sitzen, während ich versuche, zu arbeiten – sie wissen, wie man einen Haushalt regiert. Nur mit ein bisschen mehr Schnurren, Krallen und diesen Augen, die sagen: „Na schön, du darfst mich jetzt anbeten… ich meine, streicheln.“
Wenn ich heute an die Katzen meiner Großeltern denke, muss ich lächeln. Vielleicht habe ich es damals nicht bemerkt, aber auch diese kleinen Mäusejäger auf dem Bauernhof trugen ein Stück dieser alten Geschichte und die Seelen von Pharaonen in sich. Ihre Blicke scheinen zu sagen: „Ich habe Götter kommen und gehen sehen. Und du? Du bist nur der Mensch, der mich füttert.“ Sie verhielten sich, als hätten sie in den alten Tempeln von Theben regiert, als seien sie Zeugen des Aufstiegs und Falls ganzer Dynastien. Und genau deshalb liebte ich sie – weil sie ein Stück Geschichte in jedes sanfte „Miau“ packen und uns spüren lassen, dass sie es uns nie vergessen werden lassen: Sie waren einmal Götter. Und vielleicht – in ihren Köpfen – sind sie es immer noch. Denn sie ließen sich nicht aus dem Haus verbannen, weil meine Oma es so wollte. Die Katzen wussten, dass sie nicht unter den Gesetzen der Menschen lebten, sie machten trotzdem das, wozu sie Lust hatten. Wer weiß, vielleicht saßen sie damals genauso auf der Mauer und sahen auf mich herunter, wie einst ihre Vorfahren auf die Pharaonen schauten: mit einem Blick, der sagte: „Ihr Menschen habt uns verehrt. Jetzt reicht es uns, einfach nicht gestört zu werden.“
Diese Katzen mit ihren mysteriösen Augen und ihrer unnahbaren Art – sie passten einfach perfekt auf diesen alten Hof meiner Großeltern. Sie waren die stillen Beobachter meiner Kindheit, die Herrscher über einen kleinen Flecken Land, der gleichzeitig mein Abenteuerspielplatz war. Und obwohl sie nie ins Haus durften, war ich mir sicher: Wenn sie gekonnt hätten, hätten sie es regiert.
So, und dann kam die Zeit, in der ich meinen Kindheitstraum, auf dem Bauernhof meiner Großeltern jeden Hühnerstall mit einem „Sesam, öffne dich!“ zum Leuchten zu bringen, gegen die Realität eintauschen musste: Das Studium. Ich entschied mich für Theologie. Theologie, das klingt in etwa so, als hätte man sich freiwillig für einen knöchelhohen Lauf durchs dickste Dickicht des Philosophie-Dschungels entschieden – nur mit mehr lateinischen Begriffen und weniger Wegen, die direkt zu einer Antwort führen. Also nichts mit Streicheleinheiten für Katzen, eher Staub der alten Kirchenväter und jede Menge Bücher, die aussahen, als könnten sie unter ihrem eigenen Gewicht in ein Paralleluniversum stürzen.
Ich zog also aus der ländlichen Idylle weg und hinein in eine völlig neue Welt: eine verschlafene Studentenwohnung, die ich bei einer leicht verschrobenen, aber herzensguten alten Dame mietete. Sie war die Art Vermieterin, die darauf bestand, dass ich meine Schuhe schon im Erdgeschoss ausziehe, weil die „Energie des Treppenhauses nicht durch moderne Gummisohlen beeinflusst werden“ sollte. Ähm, ja, okay. Aber was mich wirklich überraschte, war das stille Mitbewohnerchen, das mir am ersten Abend begegnete: Eine stattliche, feingliedrige Katze mit goldenen Augen, die mich musterte, als hätte ich gerade ihre heiligen Hallen entweiht.
Da war es wieder. Eine Katze und ab da war mir klar, dass diese anmutigen Diven mich mein Leben lang begleiten werden.
„Das ist Marlene“, erklärte mir meine Vermieterin mit einem geradezu mystischen Lächeln. „Sie ist schon ewig hier.“ Ich nickte vorsichtig und dachte mir: Na ja, wie lange kann eine Katze schon leben? Ein Jahrzehnt? Vielleicht zwei? Doch als ich etwas genauer hinsah, schien Marlene mich direkt durch die Zeiten hindurch anzustarren, als ob sie wirklich schon zur Zeit des Alten Testaments hier gesessen hätte. Da war also wieder eine Katze – und ich, der alte Bauernhof-Experte, bereit, mit ihr Frieden zu schließen.
Frieden. Ha! Wer hätte das gedacht.
Marlene hielt mich auf Trab, während ich versuchte, dem Glaubensverständnis eines Augustinus auf den Grund zu gehen oder mich in die Diskussionen um die Scholastik - die Mittelalterliche Theologie - hineinzufuchsen.
Meistens kam sie im besten Moment. Das hieß: Genau dann, wenn ich gerade den Faden verloren hatte und versuchte, mich wieder durch die lateinischen Begriffe der Trinitätslehre, der Lehre der Dreifaltigkeit und somit der Wesenseinheit Gottes in den drei Personen Vater, Sohn und heiliger Geist, zu kämpfen. Sie starrte mich dann mit einem überlegenen Blick an, den nur Katzen und sehr zynische Philosophieprofessoren perfekt beherrschen. Irgendwann streckte sie sich gähnend, als wollte sie mir sagen: „Klar, ich verstehe das alles – was hast du für ein Problem?“
Ich nannte sie dann liebevoll „Professor Marlene“. Aber die Professorin hielt sich nicht mit theoretischen Prüfungen auf. Sie war eine Katze der Praxis. Zum Beispiel, als sie eines Nachts beschloss, dass mein Kopfkissen ideal für ihre nächtliche Meditation war. Gerade als ich das „Vater unser“ im Halbschlaf murmelte (ja, das passiert, wenn man den ganzen Tag Kirchenliteratur liest), sprang Marlene aus dem Nichts auf mein Gesicht und machte es sich gemütlich. Ihr Schnurren vibrierte durch meinen Schädel, als würde sie die Heilige Dreifaltigkeit in Katzenmantra übersetzen.
Und das war noch nicht alles. Morgens, pünktlich zu den „Laudes“ – wie man im Studium gerne die Morgenstunden nannte – gab Marlene den Weckruf. Keine Glocke, kein friedliches „Großer Gott wir loben dich.“ aus der Kirche nebenan. Nein, sie setzte sich mitten auf meinen Brustkorb, starrte mich an und schlug einmal sanft mit der Pfote auf meine Nase. Der Subtext? „Aufstehen, fauler Theologe, die Welt wartet auf deine brillanten Gedanken. Oder wenigstens auf ein Frühstück.“ Und falls ich mal so unklug war, ihre Aufforderung zu ignorieren, tippte sie wiederholt auf meine Nase – bis ich aufgab und aufstand. Glaubt mir, selbst ein Schlafmuffel wie Augustinus hätte sich unter ihrem sanften, aber beharrlichen Druck aus dem Bett geschält.
Im Haus meiner Vermieterin gab es dann auch so etwas wie ein tägliches Ritual. Ich machte mich fertig für die Uni, meine Notizen unter dem Arm, aber Marlene – sie hatte einen sechsten Sinn für Theologen in Eile. Immer, wenn ich versuchte, zur Tür zu gehen, setzte sie sich genau davor, schob ihren flauschigen Körper in den Türrahmen und blickte mich an, als wollte sie sagen: „Du kannst diesen Raum nicht verlassen, bevor ich mein Frühstück hatte und du mich ausreichend gestreichelt hast.“
Natürlich habe ich sie gestreichelt. Wer wäre ich, gegen eine Katze zu rebellieren? Jemand, der mit göttlichen Strafen rechnen muss, wenn ich diese kleine Göttin in meinem Flur nicht zufriedenstelle? Kaum. Die Streicheleinheit – inklusive sanftem Massieren ihrer Ohren – war offenbar meine morgendliche Buße. Sie schnurrte, rollte sich zusammen und ließ mich dann mit einem letzten Blick los, der nur bedeutete: „Heute bist du ausnahmsweise freigesprochen, geh und predige.“
Obwohl ich die Theologie in all ihren Facetten liebte, half mir Marlene, das Gleichgewicht zu halten. Ein ausgeglichenes Leben zwischen den himmlischen Gedanken der Dogmatik und dem irdischen Chaos einer katzenverseuchten Studentenbude. Während ich in der Uni über Schöpfung, Sünde und Erlösung diskutierte, zeigte sie mir daheim in ganz praktischer Weise, dass das wahre Universum durch die Gesetze einer schnurrenden Fellkugel beherrscht wurde, die gelegentlich eine ganz eigene Form der „Katzenliturgie“ zelebrierte: Ein umgekipptes Bücherregal, ein zerrissenes Notizbuch oder der stolze Fund eines toten Vogels, den sie als Geschenk auf meiner Bibel platzierte.
Eines Tages erzählte ich meiner Professorin im Seminar – die sich, wie sich herausstellte, selbst als „Katzenmensch“ bezeichnete – von Marlene. Sie nickte weise und sagte nur: „Ah, Sie lernen also das wahre Wesen der Schöpfung kennen.“ Und dann fügte sie hinzu: „Katzen, mein lieber Olaf, erinnern uns an die wunderbare Eigenwilligkeit des Lebens. Sie machen, was sie wollen, und das ist ihr göttliches Recht.“
Was soll ich sagen? Vielleicht war es Marlene, die mich auf diese Art und Weise mehr über Theologie lehrte, als es manche meiner Professoren je konnten.
Und so kam es, dass ich mein Studium der Theologie mit einem stolzen Diplom und jeder Menge Bücher unter dem Arm abschloss – und dann da stand: fertig ausgebildet, bereit, die Welt mit Predigten zu erhellen, nur um festzustellen, dass ich noch etwas Entscheidendes vermisste… nämlich das Gefühl, wirklich lebendig zu sein. Nicht falsch verstehen: Theologie hat mir sehr viel gegeben. Aber irgendwie fühlte ich mich wie ein Priester, der predigen möchte, aber dabei den Draht zum „echten Leben“ verloren hat. Tja, und in meiner Version des „echten Lebens“ war das keine Metapher, sondern wortwörtlich: Ich wollte an den Strom ran. Also entschied ich mich dazu, eine weitere Ausbildung zu machen. Als Elektriker.
Ja, ihr habt richtig gehört. Elektriker. Der freie Theologe tauschte die Bibel gegen die Zange, das dogmatische Nachdenken über die Dreifaltigkeit gegen die Frage „Wo zur Hölle ist der verdammte Sicherungskasten?“. Ich kann gar nicht beschreiben, wie die Gesichter meiner ehemaligen Studienkollegen aussahen, als ich ihnen erklärte, dass ich statt sonntäglicher Predigten nun lieber Kabel in Häuser verlegte. Ich könnte schwören, einer von ihnen hatte tatsächlich das Bedürfnis, bei mir die Beichte abzulegen. „Warum Elektriker, Olaf?“ fragten sie mit schiefen Blicken und einem Hauch von Besorgnis. „Weil ich jetzt Menschen wirklich Erleuchtung bringen möchte!“, war meine augenzwinkernde Antwort.
Der Wechsel war… nun ja, sagen wir, ein bisschen holprig. Es war schon seltsam, statt einer theologischen Diskussion darüber, wie die Gnade Gottes in unser Leben wirkt, nun bei einer Diskussion über die Vorteile eines 230-Volt-Wechselstromsystems zu sitzen. Aber hey, jeder hat so seine Berufung, oder? Außerdem war es mal was anderes, statt durch die staubigen Gänge einer Bibliothek zu schlendern, mit einem Schraubenzieher – ja ich weiß es, das Ding heißt Schraubendreher, in der Hand durch verwinkelte Dachböden zu kriechen und nach dem nächsten kaputten Anschluss zu suchen.
Die größte Herausforderung dabei? Nein, es waren nicht die Stromschläge. Wobei, ein paar Stromschläge gab es durchaus – wenn ich ehrlich bin, ich habe mehr als einmal die „Prüfe immer, ob der Strom abgestellt ist“-Regel auf die harte Tour gelernt. Nein, die größte Herausforderung war, die Sprache der Handwerker zu lernen. Die Theologie hat mich auf sehr viele Begriffe vorbereitet, aber die Wortwahl auf einer Baustelle? Puh! Es dauerte eine Weile, bis ich den Unterschied zwischen einem Phasenprüfer und einem Phasenschieber nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch verstanden hatte.
„Na, Prediger, hast du schon wieder den falschen Draht erwischt?“, fragte mein Meister regelmäßig mit einem breiten Grinsen, wenn ich mich zum zehnten Mal dabei ertappte, die falsche Sicherung zu kappen. „Warte, ich check noch mal den… ähm… sakralen, also ich meine… den neutralen Draht“, murmelte ich dann und erntete das nächste schallende Gelächter. Ich hatte es mir zur Angewohnheit gemacht, die Kirchensprache auf die Elektrik zu übertragen, nur um die Leute ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. „Vorsicht! Da kommt Gleichstrom, das ist teuflisch gefährlich!“, rief ich einmal in einer Baustelle, woraufhin meine Kollegen mich ansahen, als hätte ich eine Teufelsaustreibung angekündigt. Aber hey, Humor ist überall wichtig, selbst wenn man ihn durch die Schutzbrille und das Kabelgewirr kaum erkennen kann.
Doch trotz des Baustellen-Chaos, der zappelnden Drähte und der verdächtig häufigen Fragen, ob ich wirklich „ganz bei Sinnen“ bin, blieb ich meinem Glauben doch treu. Ich wollte die Verbindung zur Kirche nicht komplett aufgeben. Also bot ich an, am Wochenende ehrenamtlich zu predigen. Ich habe das immer gerne als „meinen wöchentlichen Spirit-Ausgleich“ bezeichnet – von Montag bis Freitag an den Sicherungskästen unterwegs, am Wochenende auf der Kanzel.
Ich erinnere mich noch gut an die erste Predigt, die ich nach meinem Start als Elektriker hielt. Die Kirchenbänke waren gut gefüllt (ich vermute, viele kamen einfach aus Neugier, um zu sehen, ob ich nach dem Wechsel zum „Lichtbringer“ nicht völlig den Faden verloren hatte). „Liebe Gemeinde“, begann ich mit einem breiten Lächeln, „heute möchte ich mit euch über die wahre Erleuchtung sprechen. Nein, nein, keine Sorge, ich werde euch nicht erklären, wie man einen Lichtschalter anklemmt. Aber wenn ihr nachher noch Fragen zu euren Lampen habt… ich stehe nach dem Gottesdienst für technische Anfragen zur Verfügung.“
Das Lachen in der Kirche hallte durch das ganze Kirchenschiff. Ich schätze, ich habe mein Publikum damals genauso überrascht wie die Bauarbeiter, die mich kurz zuvor noch fluchen gehört hatten, weil ich wieder einen Draht vertauscht hatte. Meine Predigt drehte sich damals um das Thema „Berufung“, und ich erklärte, dass Berufung nicht bedeutet, einen vorgezeichneten Weg bis zum bitteren Ende zu gehen. Manchmal bringt uns der Weg eben zu Sicherungskästen statt zu Kirchenportalen. Aber wer sagt, dass man nicht auch dort Gutes tun kann?
Ehrlich gesagt, brachte mir das predigende Handwerk einige neue Herausforderungen. Denn die Gemeindemitglieder gewöhnten sich schnell an meine etwas… sagen wir „unkonventionelle“ Art. So stand ich dann eines Sonntags vor den Augen eines halb belustigten, halb verdutzten Publikums, als ein älterer Herr in der ersten Reihe rief: „Was bedeutet eigentlich dieses ‚Gleichstrom‘, über den du immer sprichst?“ Und schon entwickelte sich eine lebhafte Diskussion darüber, wie Strom als Metapher für den Glauben dienen kann. „Gleichstrom“, erklärte ich grinsend, „ist wie starrer Glaube ohne Schwankungen. Aber Wechselstrom… der ist flexibel, anpassbar, immer in Bewegung.“ Was für eine herrliche Ironie, dachte ich, dass ich am Ende die Physik zu meiner theologischen Botschaft gemacht hatte.





























