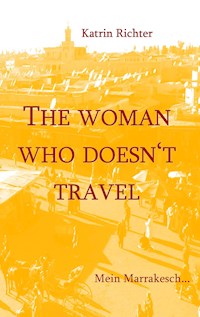Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Meine Reisetagebücher
- Sprache: Deutsch
Zum dritten Mal auf Kreta. Warum lässt diese beiden jene Insel nicht mehr los? Eine Reise ist nicht, wie sie ist. Eine Reise ist, wie du bist. Durch diesen Gedanken kommt die Autorin einer Antwort auf die Frage einen kleinen Schritt näher. Und dann ist da noch das berühmte Buch ihres Kollegen Nikos Kazantsakis, der "Alexis Sorbas"; in dem jener seinen griechischen Freund unsterblich gemacht hat. Literatengeister verbinden sich. Parallelen scheinen für eine liebende Frau unübersehbar ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorbemerkung der Autorin
Lieber Leser, geschätzte Leserin,
die mir in dieser Geschichte begegnenden Personen entspringen meiner Phantasie. Was ich sie sagen und tun lasse, ist künstlerisch abgewandelt und nicht konkret lebenden oder bereits verstorbenen Menschen zuzuordnen.
Irgend jemanden bloßzustellen, ist und war niemals der Grund, warum ich Bücher schreibe.
Katrin Richter, im Winter 2016/2017 in Berlin
Die Autorin
Katrin Richter hat – auch unter ihren Namen Katrin Panier, Katrin Panier-Richter und Clara Felder – bisher insgesamt zwanzig lieferbare Bücher veröffentlicht. Als leidenschaftliche Tagebuchschreiberin und Spaziergängerin lebt sie mit ihrer Familie in Berlin.
Eine Reise ist nicht, wie sie ist.
Eine Reise ist, wie du bist.
Kat Al´di Nepari
Wieder für Nikos.
Dieses Mal komme ich nicht wieder zurück. Nein.
Ein Teil von mir bleibt für immer dort, auf dieser göttlichen Insel. Ich liege weiterhin am Strand, ohne Hülle außen, ohne Filter innen – auch, wenn ich schon längst wieder in meiner Berliner Handwerkstatt am Schreibtisch sitze. Ich weiß, ich bleibe auf Kreta. Und niemand kann mir das jemals wieder nehmen. Es versucht ja zum Glück auch keiner. Zu meinem großen Glück. Ja.
Von Anfang an schaute sie freundlich auf mich, und das tut sie immer noch, sie lächelt mir zu. Mir – und ihm. Für eine solche Liebe gibt es keine Entfernungen, keine räumliche Trennung. Sie ist hier auf alle Zeiten. Ich bin hier. Er ist hier, bei mir. Und so bleibt es. So soll es sein. Alles wegen Kreta. Und Kreta – auf diese Weise – wegen uns.
Jede Nacht lese ich nun den Alexis Sorbas – wie ich ihn am Galiskiari Beach gelesen habe, oh so langsam, weil auf Englisch. Im Zeitungskiosk von Paläochora hatten sie diese Paperback-Ausgabe „Zorba the Greek“, die nach mir rief. Die ich zuerst zurückließ in der Auslage, die ich meinte, nicht haben zu wollen, nicht zu brauchen, von wegen! Die mir jedoch einfach nicht aus dem Kopf ging beim Fortgehen, während des Zurücklassens, einer Wanderung durch die Anidri-Schlucht. So viel ich kletterte, stolperte, stakste; der Zorba blieb. „Ich muss dieses Buch kaufen“, sagte ich zum Gefährten zwischen Stock und Stein. Und wie so oft – weil er den Ernst meiner Lage erkennt -, hielt ich das Bändchen vierundzwanzig Stunden später schon in den Händen. Was für ein schön aufgemachtes Werk! Die Farben golden und himmelblau; sie hatten ja ihr Bestes gegeben, um mir entgegen zu leuchten, auf dass ich sie ja nicht übersah. Stilisierte Figuren in schwarz, eine von ihnen – man kann nicht ausmachen, ob Mann oder Frau – reitet einen Esel oder ein Maultier, was hierzulande noch passender wäre. Die tanzenden, abgerundeten Schrifttypen in Gold und weiß wirken auf mich, als hätte der Künstler Friedensreich Hundertwasser sie entworfen. In seiner Welt gab es keine gerade Linie; und genau so lebendig, voller Leben, pulsiert mir jene Geschichte entgegen, einfach dadurch, in welchem Gewand sie daher kam. Und das Buch lag leicht in der Hand. Hätte ich es schon in dieser Form in Berlin gehabt, ich hätte es nicht wieder ausgepackt aus meinem Flugzeug-Kabinenkoffer. Die Sorbas-Ausgabe in meiner Muttersprache besitzt harte Deckel aus fester Pappe, durch sie überschritt das Bordgepäck sein höchst zulässiges Gewicht. Und ich dachte, ich würde im Urlaub sowieso nicht sehr viel lesen, eher erleben, schauen, selber schreiben. Tja. So kann man sich täuschen. Und dann lag ich also – eine Eva, wie Gott und mein eigener Lebensstil sie geschaffen hatten – am Strand und arbeitete mich durch die englische Übersetzung.
Ich dachte an meine früheren Sprachlehrer dabei; und an was sie mich gemahnt hatten: Versuche, dir den Sinnzusammenhang zu erschließen. Ohnehin kann kein Mensch – und kennte er sich noch so gut aus in einer fremden Sprache – ein jedes einzelnes Wort auf Anhieb verstehen. Also. Mutig las und kombinierte ich drauflos, ging zwischendurch schwimmen, drehte mich auf eine andere Körperseite, der herrlichen Sonne zu; oder ließ mir vom Gefährten einen Leckerbissen reichen, um nicht ausschließlich von Luft, Liebe und Inspiration leben zu müssen. Alexis hat den so viel jüngeren Freund und Kopfmenschen ja auch tagtäglich mit Nahrung versorgt während ihrer gemeinsamen Zeit auf Kreta.
Ich habe auch wieder an deinem Grab gesessen, Nikos, hoch über den Dächern von Heraklion. An deinem einfachen, aber sehr hohen Holzkreuz habe ich mich erneut mit dir verbunden – wie schon vor einem Jahr, wie schon vor zwei Jahren. Die Leute murmeln deine bekanntesten Worte, wenn sie auf deine Ruhestatt zu gehen, aus der du eine so wundervolle Sicht auf das Meer hast. „Ich erwarte nichts. Ich fürchte nichts. Ich bin frei“, zitieren sie dich in vielen Sprachen, meistens auf Englisch. Sie sehen ehrfürchtig dabei aus, so, als wollten sie sich und ihren Begleitern diese drei Gedanken auf jeden Fall einprägen. Du, lieber Nikos, hast damit ja auch ein Ziel formuliert, an das man sich erinnern sollte, an dem auch ich mich vor mir selber messen will. An manchen Tagen meine ich schon, ich hätte es fast erfüllt. Oder – um ehrlicher zu sein – es sei mir zu meiner großen Freude erfüllt worden. Ich kann es ja nicht selbst machen, das weiß ich schon, das wusstest auch du, Nikos, ganz ohne jeden Zweifel. Ich komme sicherlich voran mit meinem Üben, mit meinem Zulassen; aber dann erscheint ein Tag, an dem fürchte ich mich dann doch wieder vor irgendetwas, oder ich ertappe mich bei einer Hoffnung in die Zukunft. Er ist ein Ideal, dein Gedanke, ähnlich wie das Gebet des heiligen Franz von Assisi. Eine Wunschvorstellung, aber ein guter Wegweiser. Das ja.
Das auf jeden Fall.
Inzwischen kenne ich auch andere Worte von dir, Nikos. In einem Café in Myrthia – dort, wo auch dein Museum zu finden ist -, da stand auf Deutsch an die Wand geschrieben: „Du hast den Pinsel, du hast die Farben. Also male dir dein Paradies und tritt ein.“ Dankeschön, Kollege. Exakt dafür war ich ja angetreten, hatte es zu Beginn dieser Reise – um es wirklich nicht zu vergessen – ganz vorn in mein Tagebuch notiert. Ich übe bewusst zu genießen. Das habe ich mir Stunden vor dem Abflug ins Stammbuch geschrieben. An dieser Stelle in meinen Lebensfähigkeiten muss ich wohl einen gewissen Mangel festgestellt haben. Disziplin kann ich gut. Eine Sache durchhalten, mein lieber Mann! Die Langstrecke liegt mir. Das Beständige. Aber der Genuss – scheinbar ohne Zweck und Verstand…
Das Leben ist freundlich und gibt einem, was zur Vollkommenheit fehlt. Man muss es nur zu erkennen und anzunehmen verstehen. „Nur“ ist gut. Ich weiß. Aber unmöglich ist es nicht. Es gibt Beweise dafür. Mich? Und ihn? Urteilt selbst. Ich erzähle nur. Von mir und meinem Sorbas, der mich das Leben genießen lehrt. Schon immer, schon von Anfang an, wie ich jetzt in der Rückschau erkenne. Das sah ich damals natürlich noch nicht. Und fühlte mich doch davon angezogen. Wie das geschehen konnte, mir Ahnungslosen – oder gar Ahnungsvollen -, das weiß nur Gott allein. Und an den habe ich auch nicht geglaubt, damals, zuerst. Er aber vielleicht an mich. Wer weiß.
Vier Wochen Kreta lagen also vor mir. Und nun liegen sie nach menschlicher Zeitrechnung hinter mir; aber ein Teil von mir sieht das anders: der kam nicht wieder zurück, ich sagte es schon. Der ist noch immer dort, bei Nikos, in den Schluchten, auf den mystischen Bergen; in den Restaurants, wo die jungen Geschäftsleute die Ärmel hoch krempeln und ihre Heimat neu kreieren.
Ein Teil von mir ist nicht mit in die Air Berlin-Maschine gestiegen, vier Wochen später; und dieser Teil von Katrin mag mich jetzt leiten durch das, was ich zu erzählen habe.
„Wir haben die Pflicht, uns nicht zu beeilen, nicht ungeduldig zu werden und dem ewigen Rhythmus der Natur mit Vertrauen zu folgen.“ Die Pflicht!
In der Nacht habe ich wieder den Sorbas gelesen und auf Seite hundertneunundzwanzig meiner deutschsprachigen Ausgabe dieses Zitat gefunden, das mich elektrisiert. Auf der Stelle habe ich es mittels meines Kalligraphie Sets so schön wie mir eben möglich abgeschrieben und das Blatt gut sichtbar in meiner Schreibhandwerkstatt aufgehängt. Die Pflicht. Uns nicht zu beeilen. Und nicht in die natürlichen Rhythmen einzugreifen. Wie wohl das tut. Allein der Gedanke!
Der Autor erzählt an dieser Stelle von einem Erlebnis, das ihn als Kind entsetzte und das er nie vergessen konnte: Wie er durch Pusten einem Schmetterling auf die Welt hatte helfen wollen, so dass sich dessen Kokon rascher öffnete – was aber zur Folge hatte, dass die Flügel des Tierchens nicht kräftig genug wurden, wie sie es geworden wären durch das eigene Herauskämpfen, sich selbst auf die Erde arbeiten, in ein nächstes Entwicklungsstadium hinein. Der Schmetterling konnte nicht fliegen – so sehr der Junge auch erneut versuchte, mit seinem Atem das Entfalten doch noch zu erzwingen. Es gelang nicht, und eine kleine Leiche lag auf dem Handteller des verzweifelten Kindes Nikos.
Wie tief mich das anrührt.
Wir dürfen die weisen Abläufe von Mutter Natur nicht beschleunigen wollen; wie oft habe ich das gehört, selber zitiert. Gras wächst weiß Gott nicht schneller, wenn man daran zieht. Genau. So einfach.
Und wie lange habe ich dazu gebraucht, das einzusehen, danach zu leben gar, in einer Gesellschaft, die nun auch noch ganz das Gegenteil zu proklamieren scheint, wer weiß, wie lange noch.
Auch ich besitze ein solches Kindheitserlebnis, das mich hätte lehren können, vielleicht sollen, dass man nicht eingreifen darf, ohne gleichzeitig zu zerstören. Ein Schneckenrennen, das wir zwei veranstalteten, eine Freundin und ich, einen Kindheitssommernachmittag lang. Wir hatten sie zuvor gesammelt, weiße, braune, elfenbeinfarbene Weinbergschnecken, und wir hatten ihnen mit dickem schwarzen Filzstift aus dem Westen Startnummern auf die Häuser geschrieben. Dann trieben wir sie mit Stöckchen an. Immer wieder. Schleimspuren des Stresses zogen sie hinter sich her, unsere unfreiwilligen Läufer, Wettkämpfer. Mir wird heute noch übel vor Ekel, vor Scham. Denn auch wir zwei kleinen Mädchen ließen nicht locker, bis wir Todesfälle zu beklagen hatten unter unseren tierischen Sportlern, was wir sicherlich so nicht beabsichtigt hatten. Sie sollten nur schnell sein; wir wollten ihnen auf die Sprünge helfen, unsere Macht spüren sicherlich auch. Kleine zarte Menschenkinder; groß für die Kriechtiere. Schnecken hetzt man nicht. Man zwingt sie nicht zur Eile.
Meine Mutter hat mir einmal eine Tonschnecke geschenkt für meinen Schreibtisch. Da steht sie immer noch. Ich habe mich nicht immer an ihr Vorbild gehalten.
Schneckentempo. Es respektieren.
Und nun steige ich wieder in ein Flugzeug! Irgendwann habe ich damit aufgehört, meine Flüge zu zählen. Ich weiß also nicht, der wievielte das sein mag, heute, an diesem Tag Mitte Mai von Berlin nach Heraklion. Auch die Angst verliert ihren Sinn, wenn sie nicht mehr gebraucht wird. Eine Weile hielt ich noch daran fest, wie aus alter Gewohnheit. Dann wurde alles daran schal und blass und überflüssig. „Ist das überhaupt noch meine Flugangst, an der ich hier so überaus bereitwillig leide?“, hatte ich mich plötzlich in einem ganz bestimmten Augenblick in einem Flugzeug auf dem Weg nach Marrakesch gefragt. „Wer bin ich eigentlich ohne diese Panik?“, kam es schon zwei Jahre später aus mir selbst in einer anderen fliegenden Blechröhre. Dadurch brauchte ich nicht mehr zu zählen. Weil ich mir nicht länger beweisen musste, dass ich es kann. Dass ich den Dämon in mir erneut verwandelt, überwunden hatte; dass es mir tatsächlich möglich war, Insch´Allah, wie sie in Marokko sagen oder Gott sei Dank eben.
Und die guten Mächte spielen mir ganz offensichtlich sowieso in die Hände, denn kaum habe ich Platz genommen auf meinem Sitz am Gang, da liegt schon ein Baby auf meinem Schoß und schaut mich aus großen braunen Augen aufmerksam an.
Tavi heißt der Knabe, höre ich; und er ist beinahe so alt wie meine Enkelin; seit einem halben Jahr hier bei uns auf der Erde. Der Kleine soll auf seine Flugtauglichkeit geprüft werden, erzählen mir seine jungen, schönen Eltern, ein Paar wie aus Tausendundeiner Nacht. Scheherezade in engen Jeans bereitet ein Breigläschen vor, während ihr geschmeidiger Prinz viele Gepäckstücke in die dafür vorgesehenen Fächer über uns wuchtet. „Und du darfst natürlich den kleinen Jungen halten“, schaut mich mein Gefährte neidisch von der Seite an. Oder gespielt neidisch, denn er ist es ja nicht wirklich, er gönnt mir die Freude durchaus. Außerdem weiß er ganz genau, dass die Leute einer mütterlich wirkenden Frau eher vertrauen – ihr Kind anvertrauen – als ihm, einem reichlich fremden nicht recht einzuschätzenden Kerl. Ja, er weiß auch um mein Sehnen nach jener Kleinen, der meine frische Oma-Rolle eigentlich gilt. Und so lässt er es dabei, lächelt dem sich ihm bietenden Bild zu. So zärtlich wie kurz darf ich ein Baby halten; und dann ist sie auch schon wieder vorbei, diese Szene.
Tavi leert sein Breiglas zügig, schlummert ein, während unser Flugzeug abhebt. Um erst wieder zu erwachen, als der Landeanflug auf Kreta beginnt. Die Eltern sind zuversichtlich: Nun können sie mit ihrem kleinen Prinzen auch eine Langstrecke wagen. So ein pflegeleichter Säugling! Aber Obacht: Manchmal wird aus dem unkompliziertesten Kleinkind ein eigensinniger Großer. Dann nicht erschrecken. Einige Babies sammeln bloß Kraft. Für später.
Die längste Mole der Welt. Das ist – unter anderen Überraschungen – wofür ich dieses Heraklion so liebe. Sie haben Kilometerangaben auf den hellgrauen Beton gemalt. Zweitausend Meter, zweitausendeinhundert. Bei zweieinhalb etwa endet jenes Band mitten hinein ins offene Meer. Also fünf Kilometer hin und zurück, und darum gibt es sogar Toiletten in der Mauer, die die Brandung im Zaum hält. Jogger, Radfahrer, die hier trainieren, wissen die Notkämmerchen zu schätzen. Ich – nebenbei gesagt – auch!
Hey, man kann an dieser Stelle übers Wasser gehen! Wo sonst hätte man eine solche Möglichkeit, wenn man nicht Jesus ist; noch dazu frei und kostenlos. Flaniere ich auf dieser Mole, dann weiß ich: Jetzt bin ich wirklich da. Ich weile tatsächlich wieder auf meiner Insel – und „Urlaub“ sage ich nur deswegen dazu, weil ich mich dem allgemein üblichen Sprachgebrauch anpassen muss, um verstanden zu werden. Das weiß ich aus Erfahrung, dass es genau so ist. Allzu oft habe ich viel zu komplexe, verschnörkelte Erläuterungen abgegeben, die einem Gegenüber klar machen sollten, dass für mich kein Unterschied zwischen Beruf und Freizeit existiert; dass in meinem Leben mittlerweile alles Eins ist. Es ist überflüssig, sich zu erklären. Die anderen verstehen es oder verstehen es nicht, aber letzten Endes spielt es keine Rolle.
Also sage ich „Urlaub“ zu etwas, das für mich eine spürbare Erweiterung meines Seins ist, eine Vertiefung meiner Liebesaffäre und inniglichsten Freundschaft – und ansonsten Arbeit mit Erholung vermischt, wie zu Hause auch, wie immer. Auch in Heraklion, auch auf diesem göttlichen Eiland, werde ich jeden Morgen als Allererstes mein Tagebuch aufschlagen und mein Pensum schreiben; ohne das geht ein neues Heute nicht los. Wohl mir, die ich meinen Sorbas habe, der das nicht nur toleriert, sondern sogar fördert – mit Kaffee, Süßigkeiten, aufmunternden Worten. Welch anderer Mann täte das wie er – und noch dazu in seinem einmaligen, kostbaren, alljährlichen Arbeitnehmer-Urlaub!!!
Wir sind ein Team.
Manchmal gefällt es den Göttern, zwei wie uns zusammenzubringen und beieinander zu lassen. Ich höre sie lachen, die Götter (oder ist es nur mein laut schlagendes Herz?). Wahrscheinlich tun sie ihre Wunder auf Erden nur zur eigenen Freude.
Es scheint mir gerade so, als sei ich nun an einem Punkt angelangt, an dem sich für mich vieles, was früher negativ war, in ein Positives umkehrt. „Du bist nie ganz allein!“ Das habe ich früher als Abwertung gehört, als den Stempel der Verrücktheit, der mir aufgedrückt zu werden drohte. Du bist niemals ganz allein, das verstehe ich heute ganz anders. Ja, aber ja doch, lache ich dazu, wenn das jemand sagt, liebevoll sagt; oder wenn ich mich selber so bezeichne. Alles andere wäre ja auch schlimm! Natürlich bin ich niemals ganz allein; da sind ja Ahnungen um mich herum und Ströme, die mich zu beschützen, auch zu inspirieren scheinen, denen ich bewusst lausche.
Anderes Beispiel: „Du stellst dich an wie der erste Mensch!“ Wie der erste Mensch; genau so ungeschickt, so stolpernd, so angstvoll um sich blickend, weil noch gar nichts wissend, alles fürchtend. Es war kein Lob, das ahnte ich.
Jetzt – durch den Alexis Sorbas – wird auch diese Eigenschaft zur Tugend. Wie der allererste Mensch – genau so staunend betrachtet diese Seele alles, wie zum allerersten Mal. Neu, frisch; als wurde diese Küste eben erst nur für ihn aufgestellt; als blühten diese Bäume nur für ihn, als wäre diese Mahlzeit heute duftend von einem Koch erfunden; als hätten diese Frauen ihre Hüften nie zuvor gewiegt.
Ich merke, dass ich diesen Roman auch so in mich aufnehme, als hätte ich zuvor noch nie ein Buch gelesen. Ausgerechnet ich! Ein Bücherwurm von Kindesbeinen an, a bookworm, wie der Dichter Nikos von einem Freund bezeichnet wird. Zu Hause schlafe ich jede Nacht in einem wahren „Bücherland“; in einem Hochbett, darin von den Gedanken weiser Schreiber aller Zeiten wie umzingelt. Gut möglich, dass sie sich in meine Träume einschleichen.
Aber dennoch: Dieses Buch lese ich wie zum allerersten Mal, wie der erste Mensch; als hätte ich gerade eben erst Lesen gelernt und versuchte mich an meinen ersten Seiten. Als hätte ich gerade eben erst Denken gelernt – oder das überflüssige Denken wieder verlernt. So ist es richtiger. Ja. Als wäre ich der erste Mensch, der seinen ganzen Ballast wieder über Bord geschmissen hat; der wieder einer Geschichte zuzuhören vermag, als müsste er sie nicht kraft seiner geballten Lebenserfahrung bewerten und einordnen.
So ist das.
Der erste Mensch. Oder – na gut – wenigstens der zweite; denn der erste muss es ja verfasst haben, dieses Buch, damit ich es überhaupt aufblättern kann.
Alles wie zum ersten Mal sehen. Hören, riechen, schmecken, schauen. Genießen. Wie der erste Mensch. Dann wird alles zum Wunder, jeder nächste neue Tag – egal, wo man auch ist. Alexis, mir scheint, ich lerne von dir. Auch, wenn ich nicht jede deiner Ansichten teile. Aber was heißt Ansichten. Du beobachtest ja nur. Ziehst deine Schlüsse aus dem Stand deiner Erkenntnis. Du fragst. Befragst deine Zeit. Bist jederzeit bereit, deine Sicht verändern zu lassen, falls die Antwort auf deine gestellte Frage dich überzeugt.
Ich würde dir gern antworten, aus meiner Erfahrung. Ich würde nur zu gern ein Gespräch mit dir führen. Von Frau zu Mann. Oder meinetwegen auch umgekehrt. Von Mann zu Frau. Aber wie soll ich dich erreichen mit meinen Gedanken, wenn wir zu derart verschiedenen Zeiten leben, Sorbas? Wenn sich die Erdkugel schon so oft drehte, seit du gingst, seit ich kam…
Ein Weib wie ich. Hast du so eine gekannt? Ich bin erst in der Mitte mit dem Roman über dich, ich weiß es ja noch nicht. Von Nikos weiß ich es auch noch nicht, der über dich erzählt, ein Mann über einen anderen Mann – und beide in ihrer Sicht auf das andere Geschlecht, damals. Du schreibst ihm, die Frauen wollen nicht frei sein – und damit erfüllen sie in deiner Welt die Kriterien menschlicher Wesen nicht.
Ein Mensch – wenn er die Bezeichnung verdient hat, sagst du – will unbedingt frei sein. Aber dieses Weib, sobald es sich in dich verliebt hat, will mit dir zusammen sein und nicht mehr frei – also allein nur mit sich selbst unterwegs. Darüber staunst du, Sorbas; und ich wünschte, ich könnte dich in den Arm nehmen und dir unser Beispiel zeigen. Du bekommst diese beiden nicht zusammen, die Freiheit und die Liebe, aber ich schon. Ich schon! Es hat ein Weilchen gedauert, das gebe ich zu. Aber es ist mir durchaus möglich geworden. Ich lebe es ja, jeden Tag. Ob in Berlin oder Heraklion, zu Hause oder auf Kreta – in das du mich zurückführst, auf dessen Boden ich mit dir und ihm umherwandele, als wären wir die allerersten Menschen; als hätte es vor uns noch niemanden gegeben mit Augen und Ohren und Mund zum weit Offenstehen für all diese Eindrücke, die ein prallglücklicher Gott zum Anstaunen geschaffen haben muss – wirklich: